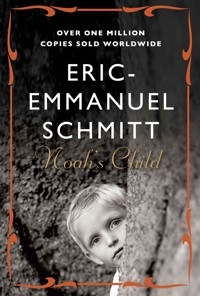7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2013
»Mozart, das bedeutet Lebendigkeit, schnelle Beine, ein pochendes Herz, summende Ohren, Sonnenwärme auf unseren Schultern, das Wunder zu leben.« Eric-Emmanuel Schmitts Liebe zu Mozart ist die Neigung zu einem Seelenverwandten, dem es scheinbar traumwandlerisch gelingt, Schwieriges leicht werden zu lassen. So kann Mozart Hilfe sein im dunkelsten Augenblick und so rettet er Schmitt das Leben. Und sein Weihnachten. Und seine Erinnerungen. Wie? In dreißig, sehr persönlichen Briefen antwortet Schmitt auf die musikalischen Botschaften des verehrten Komponisten: von der Zauberflöte bis zum Klavierkonzert Nr. 21 in C-Dur.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 97
Ähnliche
Eric-Emmanuel Schmitt
Mein Leben mit Mozart
Aus dem Französischen von Inés Koebel
FISCHER E-Books
Inhalt
Er meldete sich als erster.
Eines Tages, ich war fünfzehn, schickte er mir eine Musik. Sie hat mein Leben verändert. Oder vielmehr: Sie hat mich am Leben erhalten. Ohne sie wäre ich längst tot. Seither schreibe ich ihm oft, manchmal nur ein paar flüchtige Zeilen an der Tischkante, während ich an einem Buch arbeite, dann wieder lange Briefe, nachts, wenn der Himmel sternenlos und schwer über der orangefarbenen Stadt hängt. Wenn ihm danach ist, antwortet er mir, das kann während eines Konzerts sein, in der Halle eines Flughafens oder an einer Straßenecke, und immer wieder bin ich überrascht, überwältigt.
Hier nun das Wesentliche unseres Austausches: seine Stücke, meine Briefe. Mozart kommt in Tönen zu Wort, ich in Texten. Mehr noch als ein Meister der Musik ist er für mich ein Meister in Sachen Weisheit geworden, er lehrt mich Kostbares: Staunen, Milde, Heiterkeit und Freude …
Wie nennt man so etwas? Freundschaft? In meinem Fall handelt es sich um Liebe, gepaart mit Dankbarkeit.
Was ihn anbetrifft …
Mit fünfzehn war ich das Leben leid. Wahrscheinlich muß man so jung sein, um sich so alt zu fühlen …
Ohne die Hand, die mich zurückhielt, hätte ich irgendwann Selbstmord begangen. Ein Tod, der mich unwiderstehlich anzog, mir Linderung versprach, eine geheime Zuflucht, die mir erlaubte, unbemerkt Schluß zu machen mit meinem Schmerz.
Woran leidet man mit fünfzehn?
Genau daran: daß man fünfzehn ist. Man ist kein Kind mehr und noch kein Mann. Man schwimmt mitten im Fluß, hat das eine Ufer verlassen und das andere noch nicht erreicht, schluckt Wasser, geht unter, kommt wieder hoch, kämpft gegen die starke Strömung, mit einem Körper, der jung ist und unerprobt, man ist allein, ringt nach Luft.
Plötzlich, mit fünfzehn, schlägt sie brutal zu, die Wirklichkeit; tritt ein und richtet sich ein. Und aus ist es mit den Illusionen. Als kleinerer Junge konnte ich noch alles sein: Flieger, Polizist, Zauberkünstler, Feuerwehrmann, Tierarzt, Automechaniker und Prinz von England; auch meiner äußeren Erscheinung waren keine Grenzen gesetzt, mal war ich groß, mal schlank, mal untersetzt, muskulös oder elegant; ich schrieb mir die vielfältigsten Begabungen zu, verstand mich auf die Mathematik, die Musik, den Tanz, die Malerei, die Bastelei; ich besaß ein Talent für Sprachen, war der geborene Sportler und verstand mich auf die Kunst des Verführens, kurzum ich konnte mich, weil es die Wirklichkeit in meinem Leben noch nicht gab, in alle Himmelsrichtungen entfalten. Wie schön war doch die Welt, solange sie nicht wirklich war … Mit fünfzehn aber schrumpfte mein Aktionsfeld, meine Aussichten schwanden, kippten wie Zinnsoldaten, meine Träume nicht anders. Fuhren reihenweise in die Grube.
Und schon zeichnete sich ein Körper ab: meiner. Betroffen verfolgte ich seine Entwicklung im Spiegel. Behaarung … Das Letzte! Überall wuchsen mir Haare, mir, der ich bisher die Haut eines Babys hatte, glatt und samten … Wer zum Teufel hatte sich das einfallen lassen? Ein Gesäß … Ist es nicht zu dick? Ein Geschlecht … Sieht es gut aus? Ist alles in Ordnung damit? Kräftige, lange Hände. Für meine Mutter »Pianistenhände«, für meinen Vater »Würgerhände« … Nur zu, einigt euch! Quadratlatschen … Hinter verschlossener Badezimmertür, bei laufendem Wasser, damit jeder dachte, ich wusch mich, verbrachte ich Stunden damit, mir die Katastrophe anzusehen, die mir der Spiegel vor Augen hielt: Das ist er, dein Körper, mein Junge, gewöhn dich dran, auch wenn’s dir komisch vorkommt, vergiß nicht, du hast nur den einen, um damit zu tun, was ein Mann tun muß: rennen, verführen, küssen, lieben … Aber war er dazu überhaupt in der Lage? Je eingehender ich ihn erforschte, um so lauter meldeten sich berechtigte Zweifel: War ich entsprechend ausgestattet?
Zugleich trieben mich bisher ungekannte Empfindungen um … der Gedanke an den Tod ließ mich nicht los. Ich spreche nicht von der panischen Angst, wie sie mich manchmal abends zwischen den Laken überkommen hatte, während die anderen längst schliefen. Und ich dann im Halbdunkel dasaß, an die kalten Gitterstäbe des Bettes geklammert, weil mir plötzlich der Verdacht kam, daß es irgendwann vorbei war mit dem Leben; nein, ich meine nicht dieses nackte Entsetzen, das verfliegt, kaum scheint irgendwo ein Licht auf, sondern ein beständig lastendes, tiefsitzendes Unbehagen, einen chronischen Schmerz.
Während meinen Körper von Kopf bis Fuß eine neue, bisher ungekannte Kraft durchströmte und ich zu einem jungen Mann heranreifte, beschlich mich zugleich eine dunkle Vorahnung: Genau diesen Körper würde man eines Tages begraben. Mein Leichnam zeichnete sich bereits ab. Ich ging meinem Ende entgegen. Wir alle gingen dem Tod entgegen, und meine Schritte gruben unweigerlich mein Grab. Dem nicht genug, befand sich dieses Grab nicht nur am Ende meines Weges, sondern mein Weg führte schnurstracks darauf zu.
Ich war überzeugt, den Sinn des Lebens begriffen zu haben. Und das war der Tod.
Wenn sich aber der Tod als der Sinn des Lebens erwies, hatte das Leben keinen Sinn mehr. Und wenn wir uns auf eine Augenblicksbewegung von Molekülen reduzierten, eine eher flüchtige Anordnung von Atomen, wozu dann überhaupt leben? Warum ihm also einen Wert beimessen, diesem wertlosen Leben? Warum es bewahren, dieses leblose Leben?
Die Welt hatte ihren Reiz verloren, ihre Farben, ihren Zauber, war nur noch ein trügerischer Schein. Ich war auf den Nihilismus gekommen, weihte mich selbst ein in diese Religion des Nichts. Das Alltägliche hatte sich seiner Wirklichkeit entäußert: Ich sah nur noch Schatten. Ein Körper aus Fleisch und Blut? Eine Illusion … Ein Mund, der mir zulächelte? Künftiger Staub … Meine lärmenden, aufsässigen Kameraden? Leichen: zu Skeletten abgemagert. Nichts mehr hielt meinem krankhaften Röntgenblick auf die Welt stand. Das rundeste Mädchengesicht verriet bereits den Totenkopf. Selbst Haare, diese trockenen, obszönen Schlangen, stießen mich ab, seit ich wußte, daß sie ihre eigene Dauer haben, länger als unsere, sie wachsen selbst im Sarg weiter.
Das Leben, dieses kurze, nutzlose Affentheater, ich wollte nichts mehr damit zu tun haben.
Mit der ganzen Kraft meiner fünfzehn Jahre stürzte ich mich in die Verzweiflung. Fieber, Schüttelfrost, Herzrasen, Erstickungsängste, Unwohlsein, Ohnmachtsanfälle. Mein Körper bot mir sämtliche zur Verfügung stehenden Fluchtmöglichkeiten.
Irgendwann schlugen sich die vielen Stunden, die ich auf der Krankenstation verbrachte, in meinen Leistungen nieder, und die Schulleitung schlug Alarm.
Meine Eltern gingen mit mir von Arzt zu Arzt. Ich wurde jedesmal auf der Stelle gesund, nur um nicht Rede und Antwort stehen zu müssen. Sie suchten das Gespräch mit mir, ich gab mich wortkarg.
Niemand verstand, was in mir vorging. Fragte man mich, verstummte ich vollends. Schließlich hatte ich die Bürde eines Eingeweihten zu tragen: Wenn ich die Geheimnisse unseres Daseins ergründet hatte, wenn ich – offenbar als einziger – sah, wie dieses Universum vom Wundbrand des Todes befallen war, wie trügerisch und unbeständig, warum sollte ich dieses Geheimnis dann lüften? Solange es die anderen in ihrer Unbedarftheit nicht merkten, wozu ihnen die Augen öffnen? Damit sie litten wie ich? Nein, so grausam war ich nicht … Selbstlos behielt ich meine erschreckenden Erkenntnisse für mich, mir lag nicht daran, daß sich die Wahrheit wie eine Krankheit ausbreitete … Mir war lieber, jeder glaubte, das Leben sei schön, auch wenn ich wußte, daß genau das Gegenteil der Fall war … Ausgestattet mit einem klaren Verstand, begriff ich mich als Märtyrer des Nihilismus: Es kam nicht in Frage, daß ich den anderen die völlige Bedeutungslosigkeit des Seins enthüllte. Wenn man in der Verzweiflung lebt, diesem Elendsviertel des Geistes, beneidet man die Bewohner der Reichenviertel nicht: man straft sie mit Vergessen oder siedelt sie auf einem anderen Planeten an.
Doch so leicht stirbt man nicht am Fieber, selbst wenn die Temperatur in wenigen Minuten auf vierzig Grad ansteigt; und genausowenig schwitzt man sich zu Tode, so groß die Angst auch sein mag …
Da mein Körper sich weigerte, mir zu helfen, mußte ich ihm helfen – zu verschwinden.
Ich dachte ernsthaft an Selbstmord.
Während der vielen Stunden, die ich in der Badewanne zubrachte, hatte ich meine Methode gefunden. Ich wollte es halten wie Seneca. Der feierliche Ablauf stand fest. In der Badewanne liegend, beschützt von einer dicken Schaumschicht, würde ich mir mit einem scharfen Messer die Pulsadern öffnen, mein Blut würde sanft entweichen und mein Leben in den blauen Wassern ertränken. Ein schmerzloser Tod, um eine Welt der Schmerzen zu verlassen. Unerfahren in Sachen Liebe, stellte ich mir dieses Sterben wie ein lustvolles Vergehen vor, wie die Umarmung Draculas, diesen Vampirkuß, unter dem den Frauen die Sinne schwinden, ein sanftes Hinübergleiten …
Aber der Gedanke, nackt aufgefunden zu werden, war mir peinlich. Dieser Körper, dieser Körper eines noch unfertigen Mannes, dieser unberührte Körper, den noch keiner je gesehen, umfangen oder geküßt hatte, nein, den sollte man weder auffinden noch irgend etwas mit ihm anstellen. Und so verzögerte die Scham die Ausführung meines Planes.
Demungeachtet fühlte ich mich derart miserabel, daß die hinderliche Prüderie gewiß bald wich und der Augenblick der Erlösung nicht mehr lange auf sich warten ließ …
In dieser Verfassung wohnte ich eines Nachmittags Proben an der Oper von Lyon bei. Unser Musiklehrer hatte erreicht, daß seine besten Schüler in den Genuß dieses Privilegs kamen.
Als ich den Saal betrat, fielen mir zunächst nur die zerschlissenen Sitze auf, der Staub auf dem stockigen Samt, die Feuchtigkeit, unter der sich die Tapeten lösten und die Gemälde wellten. Dieses alte Theater, das ein Jahrhundert ohne Renovierungen hinter sich hatte, entsprach voll und ganz meiner Weltsicht, denn auch hier sah ich überall nur Verfall.
Die Proben begannen. Vom Orchestergraben aus begleitete ein Klavier die Sänger, Regisseur und Assistentenschar sprangen harsch mit ihnen um. Es wurde gemeckert, wieder von vorne angefangen und wieder kritisiert. Es war eine Qual. Ich langweilte mich maßlos. Jedenfalls vermochte nichts mein Interesse zu wecken.
Da erschien eine Frau auf der Bühne. Zu dick. Zu viel Schminke. Zu unbeholfen. Verzweifelt wie ein gestrandeter Walfisch, versuchte sie sich auf der Szene zurechtzufinden.
»Geh vom Fenster zum Frisiertisch und von dort wieder zum Bett.«
Je mehr man sie lautstark herumdirigierte, um so zögerlicher wurde sie, begann erneut von vorn, suchte nach Orientierungspunkten, die sie nicht fand, wurde noch unsicherer, bemühte sich vergeblich um Anmut und Unbefangenheit.