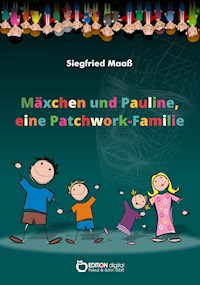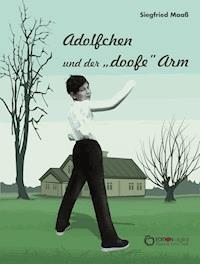
8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Man schreibt das Jahr 1935. In einer mitteldeutschen Kleinstadt kündigt sich die Geburt eines Kindes an, von dem erwartet wird, dass es ein Junge ist. Die Hebamme hat ein schwieriges Amt, denn sie soll die Geburt des Kindes verzögern, bis Mitternacht vorüber und der 20. April angebrochen ist. Dann kann der neue Staatsbürger den Namen des 'Führers’ erhalten, zu dessen Ehrentag die Straßen mit Hakenkreuzfahnen beflaggt sind. Jahre später stattet der Großvater den Jungen mit einem Haarschnitt aus, der dem des 'großen’ Adolf sehr ähnlich ist. Doch zum Leidwesen seiner Eltern ist der Junge nur ein 'Adolfchen’, der in seiner Entwicklung hinter anderen zurück bleibt. Eine Behinderung gestattet ihm nicht, den rechten Arm zum geforderten Gruß zu erheben, so dass ihm überall im täglichen Leben Schwierigkeiten entstehen und er sowohl Spott wie auch Verachtung ausgesetzt ist. Wie es ihm gelingt, sich im weiteren Leben zu behaupten und sich von der Last, die ihm sein Name aufbürdet, zu befreien, wird in teilweise satirisch zugespitzten Situationen eindrucksvoll gestaltet. INHALT: Der Auftrag - Vorspiel Der Junge Der Schüler Der junge Mann Der Auftrag - Nachspiel
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 401
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Impressum
Siegfried Maaß
Adolfchen und der "doofe" Arm
ISBN 978-3-86394-690-6 (E-Book)
Die Druckausgabe erschien 2005 beim Projekte-Verlag Halle
Gestaltung des Titelbildes: Ernst Franta
© 2012 EDITION digital®Pekrul & Sohn GbR Alte Dorfstraße 2 b 19065 Godern Tel.: 03860-505 788 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.ddrautoren.de
Der Auftrag - Vorspiel
Steffen Harburg vernahm das Quietschen der Tür hinter sich, die sich stets auf diese Weise bemerkbar machte, sobald sie jemand von außen öffnete, während er sich in seinem kleinen Redaktionszimmer befand. Als wollte sie mich warnen, hatte er schon oft gedacht und sich zugleich vorgenommen, darauf zu achten, ob sie auf gleiche Weise auf sich aufmerksam machte, wenn er selbst sein Zimmer betrat. Aber noch immer hatte er es in der Hektik des Redaktionsgeschehens nicht geschafft, im richtigen Augenblick daran zu denken.
"Was macht die Sache Emmenrode?" Der Chefredakteur war leichten Schritts und damit unhörbar zu Steffen Harburgs Arbeitsplatz getreten, wo dieser vor seinem Bildschirm saß. Dieses Schwergewicht ist wirklich der geborene Leisetritt, dachte er nicht zum ersten Mal. Entgegen den Ratschlägen seiner Kollegen würde er die Türangeln niemals schmieren. Der Schleicher verpasst mir sonst eines Tages einen solchen Schreck, dass ich von meinem Stuhl kippe, dachte er etwas amüsiert.
Der junge Redakteur blickte zu seinem Chef auf. "Bin bald so weit." Er wies auf den Bildschirm. "Noch zwei, drei Sätze. Damit es sich rundet."
"Die Fotos sind okay. Lass dir aber noch gute Texte dafür einfallen. Können ruhig etwas Pep haben. Du weißt schon ... Das ist schließlich keine alltägliche Sache. Gib mir das Ganze dann auf meinen Rechner herüber. Das ist der Aufmacher für morgen, wie ausgemacht."
Noch einmal stöhnte die Tür gequält auf, bevor sie sich wieder in ihre Ruhestellung begab. Steffen Harburg war wieder allein. "Etwas Pep!" Er ahmte den Chef nach. Wann würde der es sich abgewöhnen, seine Redakteure anzutreiben? Wann mit dem zufrieden sein, wie sie etwas beschrieben und darstellten, nachdem sie sorgfältig recherchiert hatten?
Steffen Harburg war kein Freund sogenannter Schnellschüsse, die, sobald man genau prüfte, ihr Ziel verfehlt hatten, wenn auch manches Mal nur um Haaresbreite. Aber auch dies konnte zumindest sehr peinlich sein, wenn nicht sogar unangenehme Folgen für den "Schützen" nach sich ziehen. Zum Glück war er selbst davon noch nie betroffen, sodass er sich der Gunst des weisen Marabu, wie sie ihren Chef insgeheim nannten, erfreuen konnte. Trotzdem gefiel es ihm nicht, wenn dieser ihm bereits über die Schulter sah, während er noch an seinem Bericht arbeitete.
"Was macht die Sache Emmenrode?", wiederholte er leise in der Art des Marabu, ohne jedoch dessen stets heisere Stimmlage zu treffen. Das ist wirklich alles andere als alltäglich, dachte er, darin muss ich ihm zustimmen. Aber eine Sache? War der Tod eines Menschen eine "Sache"?
Steffen Harburg stemmte sein Kinn in die Hände und zwirbelte gewohnheitsmäßig sein dünnes Bärtchen, das einer Pinselquaste ähnlich sah. Mein Zickenbärtchen nannte er es und hatte sich längst damit abgefunden, dass es sich niemals zu einem dichten Vollbart auswachsen würde, wie er ihn sich als Jugendlicher einst gewünscht hatte. Als Ausgleich dazu gedieh sein Haupthaar jedoch sehr üppig, sodass er bereits seit Jahren einen "Pferdeschwanz" trug. Morgens, noch bevor er sein Spiegelbild betrachtete, zwängte er seine "Lottersträhnen" durch ein Gummiband und achtete darauf, dass sie schwungvoll seine Ohren bedeckten, bevor ihre Enden wie ein Schweif auf seinen Rücken herabfielen.
Noch einmal las er aufmerksam seinen Bericht, als begutachte er den Text eines anderen. Ihm schien es, als sähe er plötzlich das Dorf Emmenrode in der weiten Ebene vor sich liegen. Ein geradlinig verlaufender, wie auf dem Reißbrett entstandener Kanal schien es in Hälften zu teilen. Er besann sich, bereits in einem anderen Zusammenhang über die Entwicklung des Dorfes gelesen zu haben, in dem die Kluft zwischen Arm und Reich besondere, noch bis in die Gegenwart gültige Gewohnheiten und Abhängigkeiten geschaffen hatte. Einst als erfahrene "Landgewinner" ins Dorf geholte Holländer hatten nicht nur Kanäle durch das Moor gezogen und nutzbares, gutes Ackerland gewonnen, sondern alsbald auch mit ihrer Mentalität die Lebensart im Dorf bestimmt, woran sich ebenfalls kaum etwas geändert hatte.
Auch die Dorfeinfahrt erkannte er genau vor sich, die sich an einem kleinen Teich vorüber windet, auf dem im Sommer grün die Entengrütze schwimmt, der jetzt aber von einer dünnen Eisdecke überspannt ist. Korbweiden säumen die Ränder des Kanals, der den Besucher wie ein Pfad zur Kirche aus uraltem Feldstein führt, deren Turm nicht höher als der städtische Turm der Feuerwehr ist, an dem die Schläuche zum Trocknen aufgehängt werden. Über Kopfsteinpflaster gelangt man zu dem Haus am Dorfrand, in dem der kleine Mann gewohnt hat. Alles ist ordentlich und in gutem Zustand. Ziegelrot grüßt das Dach bereits von Weitem. Der Schornstein darauf wirkt wie ein stolzer Reiter. Mit schwarzen Ziegeln hat man die Jahreszahl 19... darauf geschrieben. Die grünen Fensterläden heben sich freundlich von dem Gelb der Fassade ab. Neben dem Haus ein mannshoher Staketenzaun, der den Gemüsegarten begrenzt. Seine Spitzen tragen kleine Eishäubchen, die an Schlagsahne denken lassen.
Aber das ist alles nicht für meinen Bericht geeignet, hatte Steffen Harburg gedacht und sich schnell von der Idee getrennt, sich in epischer Breite auszudrücken, wie er es gern getan hätte. Er wollte dem Marabu keinen Anlass bieten, seinen Bericht nach eigenem Gutdünken zu ändern und zu kürzen. Obwohl es ihn gereizt hätte, diese Idylle darzustellen, um dann umso krasser auf den Gegensatz hindeuten zu können und zu zeigen, was sich dahinter verbirgt. Denn ausgerechnet dieses Haus und seine Bewohner hatten ihn länger als sonst beschäftigt. Das Objekt meiner Neugier nannte er üblicherweise einen Sachverhalt, der ihm wichtig genug erschien, um besonders gründlich und aufwendig zu recherchieren.
Neugier gehörte zu seinem Beruf. Doch so sehr er darin geübt war, sich bei seinen Recherchen nicht von persönlichen Ansichten und Empfindungen leiten zu lassen und sich ganz sachlich dem "Fall" zu widmen und vorurteilsfrei zu informieren, wie man es ihn während des Studiums gelehrt hatte, so wenig gelang es ihm diesmal, sich selbst herauszuhalten und seine Meinung und Sicht zu leugnen.
Umso aufmerksamer musste er seinen Bericht nachlesen, der nichts von dem enthalten oder auch nur im Ansatz erkennen lassen durfte. Desto schwieriger erschien ihm diesmal seine "Selbstkontrolle".
Steffen Harburg erinnerte sich: Der Marabu hatte ihn gestern per Handy beauftragt, nach Emmenrode zu fahren. Dort sei auf mysteriöse Weise ein älterer Mann ums Leben gekommen. "Bring mir einen Aufmacher! Vielleicht kannst du von der Kripo oder Staatsanwaltschaft etwas erfahren. Der Mann soll seit einiger Zeit Ärger mit Jugendlichen gehabt haben. Man munkelt, dass Rechte dabei im Spiel wären ... Bring mir was Genaues!"
Kurz wie immer, hatte Steffen Harburg gedacht und das Mittagessen, wie so oft, auf den Abend verschoben. Nach der kurzen Pause, die gerade noch für einen Kaffee reichte, hatte er zur Einweihung einer Sporthalle fahren wollen. Doch wenn der weise Marabu es so dringlich machte und sich anders entschieden hatte, musste etwas daran sein. Umsonst zog er seinen besten Rechercheur nicht von einem Auftrag ab und dirigierte ihn um. Dabei hatten sie erst in der Woche zuvor aus Emmenrode berichtet. Er selbst war hinausgefahren und hatte sich am Tatort umgesehen und -gehört. Ein PKW war über Nacht demoliert worden, direkt vor dem Haus des Eigentümers, sogar unmittelbar unter dessen Schlafzimmerfenster, das sich im oberen Stockwerk befand. Als der Besitzer aus dem Schlaf aufschreckte und wahrnahm, dass etwas scheppernd auf das Pflaster polterte und schließlich vom Fenster aus nachsah, war es bereits zu spät. Von den Randalierern war nichts mehr zu hören und zu sehen. Erst am anderen Morgen hatte der gutgläubige kleine Mann den Schaden an seinem Fahrzeug bemerkt und sofort die Polizei benachrichtigt. Nun also schon wieder ein Vorfall in diesem Fünfhundertseelendorf an der äußersten Grenze des Landkreises.
Der Gedanke, dass beide Vorfälle möglicherweise in unmittelbarem Zusammenhang standen, war ihm erst gekommen, nachdem ihn seine erneuten Erkundigungen zu dem gleichen Haus wie in der Vorwoche geführt hatten.
Der Fahrzeughalter, dessen Golf nahezu unbrauchbar gemacht worden war, hieß Adolf Oberschmidt und war ein ehemaliger Buchhalter, der seit einigen Jahren von seiner Rente lebte und sich mit der Zucht von Tauben beschäftigte.
Ratlos hatte er auf das Wrack vor seinem Haus gewiesen, als Steffen Harburg bei ihm eintraf. Die beiden Kriminalisten, die kurz zuvor angekommen waren, hatten bereits mit den üblichen Maßnahmen und Untersuchungen begonnen, befragten vermeintliche Zeugen und protokollierten deren provisorische Täterbeschreibungen.
Aufgeregt hatte ihm der kleine Mann seinen Ärger mit Jugendlichen des Dorfes geschildert, die bereits einige seiner wertvollen Zuchttauben vergiftet und die Hauswand mit Hakenkreuzen beschmiert hatten. Selbst auf der hinter dem Haus zum Trocknen aufgespannten Bettwäsche hatten Sprayer Nazisymbole hinterlassen. Die Täter hatten auch keine Mühe gescheut, quer über den gesamten Hof ein Spruchband zu spannen, auf dem in fetten schwarzen Buchstaben zu lesen war: "Ausländer raus!"
Damit sei seine Frau gemeint, hatte der kleine Mann erklärt und ergänzt: "Sie stammt nämlich aus Polen, lebt aber schon über vierzig Jahre hier ..."
Über Mutmaßungen bezüglich der Täter war der Mann jedoch nicht hinausgekommen. Darauf verließen sich jedoch weder die beiden Kriminalisten noch er als Berichterstatter. Mit Mutmaßungen konnte er seinem Chefredakteur nicht kommen.
Nun hatte die Frau den kleinen Mann am Morgen tot in seinem Bett aufgefunden und Steffen Harburg musste sich fragen, weshalb ihn der Marabu nochmals nach Emmenrode schickte.
Seit wann recherchieren wir, wenn jemand in seinem Bett stirbt, hatte er sich gefragt und wurde sich nicht klar darüber, was sich sein Chef davon versprach. "Bring mir einen Aufmacher ...!" Was hatte das zu bedeuten? Woher hatte der Marabu überhaupt diese Information? Verfügte er über anonyme Informanten?
Die Frau des Verstorbenen hatte ihm wortlos geöffnet und ihn stumm in ihre Küche geführt, in der es ihm aufgeräumt und unbelebt wie in einer Ausstellung erschien. Als hätte die Frau die letzten Stunden damit verbracht, nach dem plötzlichen Tod ihres Mannes sämtliche Spuren des bisherigen gemeinsamen Lebens zu beseitigen. Auch gewann er den Eindruck, dass sie zwar irgendwen erwartet, aber natürlich nicht mit ihm, dem Mann von der Zeitung, gerechnet hatte. Völlig teilnahmslos ließ sie sich auf einem Hocker nieder, der vor das Fenster gerückt worden war und starrte ins Leere. Sie schien nicht fähig, auch nur eine seiner vorsichtig formulierten Fragen beantworten zu können. Die Wanduhr tickte laut und erinnerte Steffen Harburg, dass er, wollte er den Auftrag des Marabus pünktlich erfüllen, das beharrliche Schweigen der Witwe brechen musste. Wieso, fragte er sich nochmals, glaubt der Alte, dass es sich hier um einen Todesfall handelt, der die Öffentlichkeit etwas angeht und von dem das "Tageblatt" berichten müsste? Hat nicht jeder, der einen nahen und lieben Menschen verliert, das Recht auf ungestörte Trauer?
"Frau Oberschmidt", hatte er endlich leise begonnen, um die Frau nicht zu erschrecken, "können Sie vermuten, dass andere zum Tod Ihres Mannes beigetragen haben? Gibt es da etwas, was untersucht und verfolgt werden müsste? Was ist in der letzten Nacht geschehen?"
Verhärmt sieht sie aus, dachte er, während er sie möglichst unauffällig betrachtete. Strähniges graues Haar, grau auch ihr Gesicht. Wie von Asche bedeckt, stellte er fest. Ihre Hände, die reglos auf ihrem Rockschoß lagen, waren rissig, fast wie von einer Borke überzogen. Sahen so Hausfrauenhände aus? Auch seine Mutter war eine Hausfrau. Aber ihre Hände besaßen keine Ähnlichkeit mit denen der Frau vor ihm. War sie vielleicht täglich mit Gartenarbeit beschäftigt? Er müsste es herausbekommen. Jedes Detail erschien ihm mit einem Mal wichtig. Wie alt mochte sie sein? Mitte sechzig? Also etwas älter als seine Mutter ... Er war jedoch vorsichtig. Mit derartigen Schätzungen hatte er keine guten Erfahrungen gemacht und flüchtig erinnerte er sich, dass er sich peinlichst blamiert hatte, als er einmal das Alter einer Kollegin schätzen sollte und unvorsichtigerweise nicht auf seine innere Stimme hörte, die ihm zu vornehmer Untertreibung riet. Hochrot im Gesicht hatte sie sich nach seiner Äußerung für seine "charmante Antwort" bedankt, sich von ihm abgewandt und ihn während der Dauer ihres Fortbildungslehrgangs nicht mehr beachtet. Dabei hatte er ausgerechnet in diesem Fall auf eine nähere Bekanntschaft Wert gelegt. Aus und vorbei ...
Steffen Harburg zwang sich, sich auf seinen Auftrag zu konzentrieren. Nochmals sprach er die Frau an, die völlig in sich zusammengesunken auf ihrem Hocker saß und sich nicht rührte. Er verfluchte den Marabu, der ausgerechnet ihn mit diesem diffizilen Auftrag betraut hatte. Sie hatten auch eine Frau in der Redaktion. Margot hätte es bestimmt leichter gehabt, sich Gehör bei der Witwe zu verschaffen, dachte er. Von Frau zu Frau spricht es sich besser, wenn es sich um so etwas handelt.
Um so etwas? Um den Tod eines Mannes. Aber was ging ihn und den Marabu der Tod des kleinen Mannes an, der offensichtlich seinen rechten Arm nicht gebrauchen konnte? Steffen Harburg erinnerte sich plötzlich, dass er bei Oberschmidt eine Ledermanschette bemerkt hatte, als dessen Jackenärmel bei einer ungeschickten Bewegung verrutschte. Sie schien seinen gesamten Unterarm zu umschließen. Die Folgen eines Unfalles, hatte er sich gefragt, oder ein Defekt seit der Geburt? So wie mein Ohr, dachte er und war fast geneigt, sich zu vergewissern, ob sein kleines verkrüppeltes Ohr auch ordentlich vom Haar verdeckt wurde. Darauf achtete er, seit er als Kind, dieses Ohres wegen, Opfer von Hänselei und Spott geworden war.
"Sie haben wieder gegrölt", hörte er die Frau plötzlich sagen und blickte sie aufmerksam an. Er hatte bewusst vermieden, sein Notizbuch aus der Tasche zu ziehen, wo es stets griffbereit war. Er glaubte aber, sich jedes ihrer Worte genau einprägen zu können. Darin war er geübt und er konnte sich auf sein Gedächtnis verlassen.
"Was haben sie gegrölt, Frau Oberschmidt?"
"Wir machen dich kaputt!"
"Damit war Ihr Mann gemeint?"
"Ich!", sagte sie und sah ihn nun zum ersten Mal an. Ihr Blick war kalt und stechend und Steffen Harburg konnte nicht verhehlen, dass ihn dieser Blick erschreckte. Was mag sie durchgemacht haben, dachte er. Wieso drohten die Verbrecher ihr auf diese Weise? Doch nicht ihres kalten Blickes wegen.
"Und was geschah dann?"
"Er hat sich was übergezogen und ist raus." Sie hob die Hand und wies müde zur Tür. Aber Steffen Harburg begriff, dass sie einen Weg beschrieb, der vom Schlafzimmer aus hinausführte. Aus der Kenntnis gleicher oder zumindest ähnlicher Reihenhäuser wusste er, dass sich die Schlafräume in der oberen Etage befanden. Das hieß, der Hausherr hatte einen längeren Weg vor sich, als er sich entschloss, sich den Grölern entgegenzustellen. Doch warum bedrohten diese die Frau? Weil sie nicht aus dieser Gegend stammte, sondern aus Polen kam, was ihr Tonfall und Wortklang noch heute verrieten? Hatte der Marabu recht mit seiner Vermutung, dass hier Rechtsgerichtete im Spiel waren, die an dieser Fremden, wie sie wohl meinten, ihr Mütchen kühlen wollten? Aber sie lebte bereits seit Jahrzehnten im Dorf. Galt sie während dieser ganzen langen Zeit als eine ungeliebte Fremde?
"Ihr Mann ist also hinausgegangen ..."
"Dann flogen die Steine ..."
Stimmt, dachte Steffen Harburg. Er hatte die zerbrochene Scheibe der Tür bemerkt. Die Splitter waren offensichtlich schon beseitigt worden.
Die Frau deutete an ihre Stirn. "Hier wurde er getroffen ..." Sie ballte eine Faust. "So groß ... Ein Pflasterstein. Von der Baustelle da vorn ..." Wieder stieß sie ihre Hand richtungweisend von sich. Auch diesmal bestätigte er sich ihre Aussage. Er hatte vorsichtig die Baustelle passieren müssen, die nur eine Spurbreite freigab. Die alten Pflastersteine der Straße hatten gleich daneben auf einem Haufen gelegen. "Ich bin dann hinterher, wollte ihn zurückholen. Gegen die war er doch machtlos. Steine flogen ... Die Polizei musste her und ich wollte schnell wieder ins Haus zurück und anrufen. Aber dann traf ihn der nächste Stein. Das Blut strömte über sein Gesicht und ich lief zu ihm, schrie die dabei an und drohte ... Darüber konnten sie bloß lachen. Aber als Adolf dann nicht aufstand, haben sie sich verdrückt ... Feige, wie sie sind ..."
"Und die Nachbarn?", fragte Steffen Harburg. Er konnte sich nicht vorstellen, dass niemand von dem Gegröle, wie es die Frau genannt hatte, wach und damit aufmerksam geworden war.
"Ach, die ..." Sie winkte ab. "Stehen bloß hinter der Gardine und glotzen. Die lassen sich nicht draußen sehen."
Steffen Harburg nickte. Ähnliche Aussagen kannte er von anderen Vorkommnissen. Niemand will etwas gesehen haben. Jeder glaubt, sich mit seiner angeblichen Unkenntnis schützen zu müssen, um nicht das gleiche Schicksal wie jene anderen zu erleiden, die es bereits getroffen hat. Feigheit siegt, dachte er sarkastisch und schämte sich zugleich, die Frau noch weiter herauslocken zu müssen, von den Ereignissen der letzten Nacht zu sprechen. Aber er musste seinen Auftrag erfüllen, dafür war er Journalist, um die Öffentlichkeit zu informieren. Wenn ihm in diesem Fall auch die eigenen Skrupel wie Pflastersteine den Weg zu versperren schienen ...
"Dann habe ich ihn rein gebracht und seine Wunden ausgewaschen. Ich sollte keinen Arzt holen, auch die Polizei wollte er nicht haben. Das macht es bloß noch schlimmer, meinte er ..." Die Frau hielt die Hände vor ihr Gesicht und plötzlich schien sich ihre Anspannung zu lösen, sodass sie laut zu weinen begann. Steffen Harburg ließ sie in Ruhe. Er sah seinen Aufmacher bereits genau vor sich und brauchte noch die Zustimmung der Frau für einige Aufnahmen. Die Kamera lag griffbereit neben ihm, aber es widerstrebte ihm, jetzt einfach draufzudrücken. Die seelische Not der Frau ging niemanden etwas an, fand er, und wusste, dass er dem weisen Marabu diesen Gedanken um jeden Preis vorenthalten musste. Er beschloss darum, sich mit einigen Fotos vom Haus und dessen unmittelbarer Umgebung zufriedenzugeben. Auch der Marabu musste es.
Nachdem die Frau sich etwas beruhigt zu haben schien und ihre Hände wieder das Gesicht freigaben, wagte Steffen Harburg die Frage, die ihm augenblicklich am wichtigsten schien: Weshalb die Jugendlichen ihr gedroht hatten, sie "kaputt" zu machen.
"Die hören doch, was die Alten sagen. Weil ich nicht dazugehöre. Eine von da hinten bin ..." Sie wies offenbar wahllos in eine unbestimmte Richtung. "Sagen, ich habe mich reingedrängt damals ..." Sie lachte gehässig auf. "Ist schon ein Menschenleben drüber vergangen. Hat auch lange keiner davon gesprochen. Aber jetzt ..." Sie hob die Schultern. "Sie glauben, jetzt können sie alles neu aufwärmen, das von damals ..."
"Jetzt, sagen Sie. Meinen Sie damit, nach der sogenannten Wende?"
Sie nickte. "Vorher ließen sie mich in Ruhe. Ich war geschützt, verstehen Sie. Da haben sie sich nicht so getraut. Nicht so offen. Nur Adolf musste es spüren. In der Molkerei, wo er Buchhalter war. Da gab es schon mal Bemerkungen ... Polenweib und so. Du mit deinem Polenweib ... Hast wohl keine Deutsche abgekriegt? Oder waren die nicht gut genug für dich?" Sie wischte mit dem Taschentuch, das sie als Knäuel aus ihrer Hand hervorzuzaubern schien, über ihren Mund. "Und die draußen in der Nacht, die Jungen, die machen nun weiter, wo ihre Großeltern und Eltern früher aufgehört haben. Ich bin das schlimme Polenweib, das nicht hierher gehört ... Und ich mich dazwischen gedrängt habe. So sagen sie. Weil Adolf schon eine andere hatte. Rosi ... Doch auch ohne mich wäre es mit ihr nichts geworden. Weiß ich doch von ihm ... Aber die da draußen ..." Sie hob wieder ratlos die Schultern. "Sie machen Terror. Daran ist Adolf gestorben."
Bei den letzten Worten hatte sie ihn angesehen, als wollte sie auf diese Weise zu erkennen geben, wie wichtig sie ihr waren. Steffen Harburg erwiderte ihren Blick. Daran ist er gestorben ... Nicht an den Folgen der Steinwürfe. Wie wollte sie diese Behauptung aufrechterhalten? Welchen Beweis würde es dafür geben?
"Welche Todesursache hat denn der Arzt festgestellt? Was steht auf dem Totenschein?"
Die Frau lenkte seine Aufmerksamkeit mit ihrem Blick auf die Küchenzeile hinter ihm. Er wandte sich um und bemerkte dort die amtliche Urkunde. Er erhob sich. "Darf ich ...?"
Die Frau nickte.
,Akutes Herzversagen", las er und war überrascht. Also kamen die Kopfwunden tatsächlich nicht als Ursache infrage? Hatte sich der Mann so sehr erregt, dass es ihn das Leben kostete? "War Ihr Mann herzkrank?"
Sie nickte. "Ich habe immer gesagt, mich meinen sie, aber dich machen sie damit kaputt. Doch er hat mir nicht geglaubt. Weil er zu gutmütig war." Sie hob die Hand und schwenkte sie unentschieden in verschiedene Richtungen. "Die dort haben ihn auf dem Gewissen."
Steffen Harburg schwieg. Er konnte die Frau gut verstehen, ihren Kummer, ihre Wut, auch dass sie Verdächtigungen aussprach. Doch er durfte sich nicht dazu äußern. Nachdem sie ihm dann überraschend einige Aufnahmen von ihrer Wohnung gestattet hatte, wollte er sich bereits verabschieden, als plötzlich eine junge Frau eintrat, sich hastig der Frau näherte und sich dieser in die Arme warf. Als beide darauf laut zu weinen begannen und sich ihre Schultern vor Erschütterung hoben und senkten, stahl er sich grußlos davon. Wahrscheinlich die Tochter, dachte er und warf einen flüchtigen Blick zurück, sodass er über der Schulter der älteren den dunklen Haaransatz der anderen erkennen konnte.
Vor dem Haus, gleich neben seinem kleinen Ford, war ein schwarzer Renault geparkt.
Langsam fuhr er dann durch das Dorf, das wie verlassen wirkte. Nichts ließ auf das nächtliche Geschehen schließen, kein noch so kleiner Hinweis war zu entdecken. Auch während seines ersten Besuchs erschien das Dorf zunächst wie ausgestorben, doch schließlich hatten sich einige ältere Leute bei dem Autowrack eingefunden. Offenkundig hatte sie die Neugier übermannt und Steffen Harburg verstand sehr gut, dass man in dem kleinen Dorf jedes außergewöhnliche Ereignis zum Anlass nahm, die eigenen vier Wände zu verlassen und sich am Ort des Geschehens umzusehen. Aufgeregt hatten sie geschwatzt und sich ihre offensichtlich unterschiedlichen Ansichten und Meinungen vorgetragen. Doch nachdem er sich ihnen zugesellt und sich als Zeitungsmann ausgewiesen hatte, waren sie verstummt. Als wären sie nicht fähig, zu sprechen und noch ehe er wusste, welche Taktik er anwenden sollte, um sie zu einer Meinungsäußerung bewegen zu können, stand er bereits allein da. Dieses Mal jedoch geriet er gar nicht erst in die Verlegenheit, sich Fragen auszudenken. In dem Dorf schien sich, außer den beiden Frauen, die er soeben verlassen hatte und ihm selbst, niemand zu befinden. Auch an der Baustelle ruhte wie an einem Feiertag die Arbeit. Ohne Aufenthalt fuhr er in die Redaktion und begab sich an die Arbeit.
Nun war sein Bericht über den so genannten mysteriösen Tod des Adolf Oberschmidt aus Emmenrode geschrieben und der Marabu brauchte ihn nur noch abzusegnen. Obwohl er sich wahrscheinlich mehr davon versprochen hatte, dachte Steffen Harburg. Denn statt eines reißerischen Aufmachers hatte er dem Chefredakteur einen sehr verhaltenen Beitrag über die Nöte einer nun alleinstehenden Frau geliefert - einer Frau, die nach dem plötzlichen Tod ihres Mannes offenbar berechtigte Fragen nach den Ursachen und Hintergründen des Geschehens stellt und die die aus Feigheit unterlassene Hilfeleistung einiger Nachbarn und anderer Dorfbewohner beklagt. Er hatte seine Titelzeile mit einem Fragezeichen versehen, um den Eindruck unbewiesener Behauptungen und Unterstellungen zu vermeiden. Er durfte nicht riskieren, die Witwe irgendeiner neuerlichen Gefahr auszusetzen. Am liebsten wäre es ihm gewesen, wenn der Marabu auf den Druck des Beitrags verzichtet oder ihn zumindest um ein oder zwei Tage ausgesetzt hätte. Dann jedoch wäre die Aktualität nicht gewährleistet gewesen. Somit fand er sich schließlich damit ab, dass sein Beitrag bereits in der nächsten Ausgabe des "Tageblattes" zu lesen sein würde.
An seinem freien Tag erwachte Steffen Harburg mit dem Gefühl einer unbestimmten Erwartung. Er gähnte und sah sich um, als gelte dieses Gefühl einer möglichen Veränderung seiner Umgebung, doch alles glich dem gewohnten Bild: Wie immer war es unaufgeräumt, den Tisch sowie die beiden Stühle bedeckten Zeitungen und Zeitschriften und auf dem Fußboden türmten sich Bücher. Sie schienen ihn eindringlich zu mahnen, sie endlich zu lesen. Aber er wusste, sobald ein neues hinzukäme, würde er sich sofort wieder darin festlesen, sodass die aufgetürmten vorläufig in Vergessenheit gerieten. Längst hatte er sich vorgenommen, zunächst die Stapel "abzuarbeiten", bevor er ein weiteres Buch kaufte. Doch ebenso oft hatte er gegen seinen Vorsatz verstoßen, sodass auch jetzt das zuletzt gekaufte neben ihm auf dem Tisch lag, nur flüchtig kurz vor dem Einschlafen mit einem Zeitungsschnipsel als Lesezeichen versehen.
Es wird Zeit, mal wieder gründlich aufzuräumen und Staub zu wischen, dachte er und war nicht erfreut bei dem Gedanken, dafür seinen freien Tag opfern zu müssen. Dennoch beschloss er, seine kleine Wohnung so herzurichten, als wolle er Besuch empfangen. Das würde dann wenigstens einige Zeit vorhalten und ihm so lange lästige Hausarbeit ersparen.
Doch an Besuch war gar nicht zu denken. Ich Einsiedlerkrebs, dachte er, kann gar keinen Besuch gebrauchen. Wer würde sich hier schon wohlfühlen? Er versuchte, sich zu erinnern, wer sein letzter Gast gewesen war. Falls ihn sein Gedächtnis nicht im Stich ließ, musste seitdem tatsächlich schon ein halbes Jahr vergangen sein. Es ist Susi gewesen, entschied er sich. Sie hatte es jedoch nicht lange ausgehalten und war vorzeitig aufgebrochen, wie er es damals empfunden hatte. Jedenfalls bevor es zu dem von ihm beabsichtigten "Schmusestündchen" gekommen war. Wie in plötzlicher Panik war sie geflüchtet. Erst danach nahm er sein Umfeld bewusst wahr, welches er ihr geboten und sie letzten Endes damit abgeschreckt hatte. Er war offenbar zu ungeschickt, um jemanden bewirten zu können und hätte sich zugleich in der Rolle eines freundlichen Gastgebers, der außerdem ein angenehmer Unterhalter sein sollte, nicht wohlgefühlt.
Der Februarmorgen warf schattenhaftes Licht ins Zimmer, sodass sich die Umrisse der Bücherstapel sowie seiner spärlichen Singleeinrichtung selbst wie Schatten abzeichneten. Steffen Harburg warf einen kurzen Blick auf seine Armbanduhr neben sich und meinte, es sei Zeit für ein gutes und ausgedehntes Frühstück, als ihn schrilles Telefonklingeln aus seinen Gedanken schreckte. Schon wollte er zu seinem Handy greifen, als er sich besann, dass es diesmal völlig ungewohnt der Festnetzanschluss war.
Hastig sprang er aus dem Bett und meldete sich mit einer rauen Stimme, die plötzlich wie die des weisen Marabu klang. Es war Frau Oberschmidt aus Emmenrode, die sich für den "schönen Artikel" im "Tageblatt" bedankte. Er habe ihr sehr gefallen, darüber hätte sich ihr Adolf bestimmt sehr gefreut, meinte sie ernsthaft.
Deswegen muss sie mich doch nicht an meinem freien Tag so früh anrufen, dachte Steffen Harburg und unterdrückte ein Gähnen.
"Ich habe etwas gefunden", fügte die Frau dann schnell hinzu, gerade so, als hätte sie seine Gedanken erraten, Steffen Harburg erkannte ihre Erregung. "Das hat er selbst geschrieben. In letzter Zeit ist er abends oft in die Dachkammer hinaufgegangen. Stundenlang war er dann dort oben. Ich wusste nicht, was er da trieb. Dachte, es hätte vielleicht mit seinen Tauben zu tun, davon konnte er ja nie genug kriegen, bloß dass er nun auch noch abends hinaufging ..."
"Also, etwas geschrieben ..." Steffen Harburg suchte nach den richtigen Worten. "Etwas, das mit dem Vorgefallenen zu tun hat?" Er spürte plötzlich, dass ihn sein Gefühl einer unbestimmten Erwartung nicht getrogen hatte.
"Über sein Leben hat er geschrieben, Kindheit und Jugend ... Es kommt mir vor, als hätte ich ihn gar nicht richtig gekannt. Nach so vielen Jahren ... Also, ich dachte, das wäre vielleicht was für Sie ... Ich kann das nicht beurteilen, davon verstehe ich nichts ... Aber Sie sind doch von der Zeitung ... Und weil Sie einen so schönen Artikel geschrieben haben ..."
"Sie meinen, ich sollte mir das einmal ansehen? Was Ihr Mann heimlich aufgeschrieben hat?"
"Ja, wenn Sie wollen ..."
"Und ob! Das interessiert mich tatsächlich. Vielleicht klärt das manches auf ..."
Einen Augenblick zögerte er und sah sich im Zimmer um. Die können noch warten, dachte er beim Anblick der Bücherstapel und unsortierten Zeitungen.
"Ich komme gleich heute Nachmittag. Passt es Ihnen?"
Sie hatte zugestimmt und so kam es, dass er noch am selben Tag erneut nach Emmenrode fuhr.
Auch am Sonnabend schien sich im Dorf nichts zu ereignen, das irgendjemanden ins Freie lockte. Nur am Dorfteich standen einige Jugendliche beieinander, die ihn nahezu gleichgültig ansahen, als er vorüberfuhr. Lässig lehnten sie auf den Sätteln oder Lenkern ihrer Sporträder, als wüssten sie damit nichts Besseres anzufangen. Auf der einzigen Bank am Ufer des Teiches standen griffbereit Colaflaschen und stapelten sich Zigarettenschachteln. Im Rückspiegel beobachtete Steffen Harburg dann jedoch, dass die Jungen sich schließlich erregt unterhielten und ihm hinterhersahen. Hatten sie vielleicht etwas mit den mysteriösen Vorgängen im Dorf zu tun? Er wollte nicht voreilig irgendwelche Schlüsse ziehen, nahm sich aber vor, diesen Gedanken nicht völlig zu verdrängen.
Die Frau schien ihn bereits erwartet zu haben. In der Küche standen zwei Tassen bereit und die Kaffeemaschine war in Betrieb. Damit war der noch am Vortag entstandene Eindruck der Sterilität aufgelöst. Der Raum hatte sich wieder belebt.
Bald saßen sie sich am Tisch gegenüber und Steffen Harburgs Blick hatte längst die Blätter erfasst, die sorgfältig in einer Mappe zusammengefügt waren und scheinbar nur seines Zugriffs harrten.
Plötzlich war er neugierig und konnte kaum die Zeit abwarten. Nachdem sie vom Kaffee genippt hatte, der noch sehr heiß war, ließ die Frau endlich ihre Hand zu der Mappe wandern. So sah er es tatsächlich - ihre Finger tasteten sich "schrittweise" zu dem Gegenstand seines Interesses heran.
"Ich bin ganz verwundert", meinte sie, indem sie die Blätter herauszog. Steffen Harburg erkannte eine sehr kantige Handschrift, die scheinbar jedes Blatt nahezu lückenlos ausfüllte. Er ahnte, dass es mühsam für ihn sein würde, Oberschmidts Aufzeichnungen zu lesen. Es würde ihn manche Stunde seiner Freizeit kosten, doch um den Preis einer interessanten Lektüre, die ihm Einblicke in das Leben des Verstorbenen gewähren würde, wollte er sich gern quälen. Vielleicht fand er Stoff für weitere Beiträge im "Tageblatt"?
Dann schob sie ihm die Blätter hinüber. "Das hat nun mein Adolf geschrieben ... Kann ich gar nicht fassen ..."
Steffen Harburg blickte auf den Papierstapel in seinen Händen. Dies war also jene unbestimmbare Erwartung, mit der er den Tag begonnen hatte. Bald wird sich jedoch das Unbestimmbare erklären lassen, dachte er und einem Räderwerk gleich rotierten seine Gedanken und entwickelten Fragen, für die er noch keine Antworten fand. Wie konnte es geschehen, fragte er sich, dass die Frau, diese aus dem Polnischen Gekommene, nichts von der Kindheit ihres Mannes gewusst hatte, wie sie selbst behauptet? Sodass sie völlig überrascht ist, nachdem sie dessen Aufzeichnungen gelesen hat?
Hielt er in diesem Augenblick eine Lebensbeichte als die Hinterlassenschaft Adolf Oberschmidts in den Händen? Hatte der Mann damit begonnen, als ihm bewusst geworden war, dass er einmal "weiße Flecken" auf der Karte seines Lebens hinterlassen würde, wenn ihm etwas zustoßen sollte?
Ohne unhöflich zu erscheinen, hatte Steffen Harburg seinen Besuch bald beendet. Er hatte noch eine Versammlung vorgeschützt, über die er berichten musste, und war losgefahren. Nahezu unbemerkt verließ er das Dorf. Nur eine mit einem Kopftuch und einer Kittelschürze ausgestattete alte Frau nickte ihm von ihrem Fenster aus zu, als sei er ein guter Bekannter. Die Jugendlichen hatten den Dorfteich verlassen. Trostlos und anscheinend nutzlos wirkte die hölzerne Bank. Doch statt in eine Versammlung trieb es Steffen Harburg nach Hause, wo er sich auf seine Couch warf, gewohnheitsmäßig die Beine über die Lehne schwenkte und Adolf Oberschmidts Aufzeichnungen neben sich ausbreitete.
Der Buchhalter hatte säuberlich Seite für Seite aus einem Journal, wie es früher bei dieser Büroarbeit Verwendung fand, getrennt und Steffen Harburg erkannte die Bezeichnungen "Soll" und "Haben", über die der offensichtlich zur Sparsamkeit erzogene Mann hinweg geschrieben hatte. Die Ränder waren so glatt, als hätte der Schreiber sie zuvor mit einer Schere bearbeitet.
Für wen hatte er sich so viel Mühe gemacht, fragte sich Steffen Harburg, oder widerstrebte es ihm, Blätter zu benutzen, deren Ränder ausgefasert waren, weil er ein überaus ordentlicher Mensch war? Mutete er denen, die später einmal seine Aufzeichnungen in die Hände nahmen und lasen, keine unsauber herausgerissenen Blätter zu?
Wie mir zum Beispiel, dachte Steffen Harburg. Nur für mich war der Text nicht gedacht. Wieso, fragte er sich, überlässt die Frau mir, einem Fremden, diesen Nachlass ihres Mannes, der eigentlich nur für die Familie gedacht sein kann? Was würde die Tochter sagen, wenn sie davon erfuhr?
Neugierig nahm er das obere Blatt in die Hand ...
Der Junge
Niemand der Beteiligten wird später bestreiten oder beklagen, dass mein Vater alles mit Vorbedacht getan und nichts unversucht gelassen hat, um mich an jenem ganz bestimmten Tag zum ersten Mal stolz umhertragen und -zeigen zu können.
Dabei soll mein Kopf wie eine Kugel in seiner Handmulde gelegen haben und irgendwer verband diesen Anblick mit dem Hinweis auf eine Leidenschaft meines Vaters - das Kegeln. Eine Kugel in der Hand sei ihm etwas sehr Vertrautes. Meine Mundwinkel wären jedoch verzerrt gewesen, als gefiele es mir nicht, als sein Vorzeigestück zu gelten. Seinen offensichtlichen Stolz sowie seine erkennbare Zufriedenheit teilte ich demzufolge nicht, sodass ich ihn in diesen ersten Augenblicken meines Lebens bereits enttäuschte, wie es sich später noch oft wiederholen sollte. Mein kleines Hinterteil füllte, den Berichten zufolge, nicht die Fingerspitzen seiner anderen Hand aus, in der auch der übrige Rest von mir Geborgenheit fand.
Bewunderung und Erstaunen haben sich in den unterschiedlichen Berichten einander ebenso abgewechselt wie ergänzt, doch die Fülle übereinstimmender Aussagen lässt mich gern daran glauben, dass es sich tatsächlich so ereignet hat. Darum kann ich mir auch eine wirkungsvolle, vom spärlichen Licht der Wohnzimmerlampe beleuchtete theatralische Szene sehr gut vorstellen, mit mir und meinem Vater als Hauptdarsteller. Die zum Ereignis meiner Ankunft versammelte und von meinem Vater herbeigerufene Verwandtschaft bildet das Publikum. Die kleinbürgerlich eingerichtete Wohnstube ist Bühne und Zuschauerraum zugleich, doch es wird nicht wie im richtigen Theater vor Begeisterung laut applaudiert. Die Freude über meinen Eintritt ins Leben fällt zwar heftig, doch unter den bezeichneten Umständen fast lautlos aus. Die allgemeine Anerkennung für die beiden Hauptdarsteller wird gestenreich und mimisch zum Ausdruck gebracht, nur meine Großmutter soll laut geschluchzt haben.
Mein Vater hat die neue und noch ungewohnte Rolle auf eine Weise ausgefüllt, als habe er in den vergangenen Wochen nichts anderes getan, als sich darauf vorzubereiten. Mit weit vorgestreckten Armen und mich als Bündel in seinen Händen, schreitet er parademäßig die Front der staunenden und still jubelnden Verwandten ab und präsentiert mich als sein unwiederholbares und damit einmaliges Werk. Niemand, außer meinem Großvater in seinem Rollstuhl, darf mich berühren. Aber auch seinem Vater erlaubt mein Vater nur einen luftzuggleichen Hauch seiner Fingerspitze über meine pulsierende Fontanelle, die der dünne Flaum weder schützt noch verbirgt. Danach trägt er mich vor das Bild seines Führers und hält mich Bündel diesem entgegen, als erwarte er, dass der Schnurrbärtige mich für das Leben in seinem Reich weihe. Dann wendet sich mein Vater wieder seinem Publikum zu, das ihm auch diesmal schweigend seine Zustimmung gewährt. Mein Vater hat keine Mühe gescheut und seinen Vater sowie dessen Rollstuhl die Treppe hinauf in die Wohnung meiner künftigen Eltern gewuchtet, damit der alte Mann an dem bevorstehenden Ereignis meiner Geburt teilnehmen kann. Bei jeder anderen Gelegenheit hätte sich mein Großvater geweigert, sich dieser aufwendigen Prozedur zu unterziehen und sich wie ein Gepäckstück von dem unteren in das obere Stockwerk tragen zu lassen. Doch für die bevorstehende Ankunft seines ersten Enkels erduldete er selbst diese würdelose Art seines Transports. So oder ähnlich gestand er mir es viele Jahre später. Es sei nach langer Zeit das erste Mal gewesen, dass er die obere Wohnung seines eigenen Hauses wieder betreten habe. Was allerdings nur im übertragenen Sinn richtig ist, denn "betreten" hat er sie auch damals nicht.
Sollte mein Großvater an jenem ereignisreichen Tag ausgesehen haben wie auf dem einzigen Foto, das ich von ihm kenne und das in der guten Stube der Großeltern über dem Sofa hing, trug er auf seinem kahlen Schädel seine schirmlose Soldatenmütze aus dem Weltkrieg, hatte sein Goldenes Verwundetenabzeichen sowie seine anderen Orden und Ehrenzeichen ans Jackett geheftet und begrüßte mich mit einem soldatischen Salut, bevor er mich schließlich zaghaft und sanft berühren durfte. Meine Großmutter, die den Rollstuhl führte, verharrte währenddessen hinter ihrem Mann und nickte zustimmend zu allem, was er tat und sagte. Das eifrige Nicken hatte zur Folge, dass ihr sorgfältig gewundener grauer Haarkauz auf und ab wippte, ohne sich jedoch aufzulösen. Ihr Mienenspiel allerdings löste sich gewissermaßen auf, indem es sich während des kurzen Vorgangs mehrmals veränderte und sich zwischen völliger Ehrerbietung, die dem Rollstuhlfahrer galt, und großmütterlicher Freude, die an mich gerichtet war, nicht zu entscheiden vermochte.
Meine Mutter war bis dahin völlig in Vergessenheit geraten und wurde erst durch die Hebamme wieder ins Bewusstsein der Versammelten gerückt, indem die kleine dralle Frau nun energisch Ruhe für die frisch Entbundene forderte und auch dem Neugeborenen diese zukommen lassen wollte. Weil mein Vater sich zunächst beharrlich weigerte, mich ihr zu überlassen, hat sie zunächst eine Weile hartnäckig, aber freundlich um meine Übergabe geworben, bevor sie danach endlich energisch gegen den Besitzanspruch meines Vaters einschritt und mich an sich nahm. Danach wurde ich dann von ihr an dem mir zugewiesenen Ort niedergelegt - in einem mit frischen Laken und Tüchern ausgekleideten Wäschekorb, der das Werk jener Großmutter war, die den Rollstuhl führte. Dort würde ich die erste Phase meines Lebens zubringen ...
Später erfuhr ich, dass meine Großmutter dazu vom Altbestand ihrer gut gehüteten Aussteuer opferte und Laken und Tücher von ihrer Vergilbung befreite, indem sie alles mehrmals wusch. Seit langer Zeit hatte sie dafür wieder die große hölzerne Truhe geöffnet, die in einem dunklen Winkel des lang gestreckten Flurs stand, von der stets eine karierte Tischdecke herabhing. Diese verdeckte das kleine Schloss, an das ich mich gut erinnern kann, denn es hatte mich in meinen folgenden Kinderjahren oft gelockt, es irgendwie zu öffnen. Meine Mutter, die sich anscheinend oft darüber beklagt hatte, von der großen, noch ungenutzten Aussteuer ihrer Schwiegermutter nie irgendeinen Vorteil genossen zu haben, soll sehr erfreut gewesen sein, als sich meine Großmutter in einer Art nachträglicher Großmut dazu überwand. Vielleicht aus Freude, nun noch Zeit zu gewinnen, um den Zustand "Großmutter" ausreichend genießen zu können.
Lange genug gewartet habe sie ja, hatte sie gemeint und schließlich hinzugefügt: "Von elwe bis mittach, wenn ihr wisst, was ich meine. Aber von nischt kommt eben nischt."
Ob sie damit auf die ehelichen Aktivitäten meiner Eltern anspielte, ist mir nicht bekannt. Einen Hinweis darauf hat sich meine Mutter in ihrem späteren Bericht an mich nicht erlaubt. Von den Sprüchen meiner Großmutter bekam auch ich noch genügend zu hören, sodass ich diese Überlieferung für glaubwürdig halte.
Ich soll in jenem Augenblick, als ich die Schoßhand meines Vaters verlassen musste, laut zu schreien begonnen haben, worauf mein Rollstuhl fahrender Großvater leutselig meinte, genau so habe auch mein Vater seinen Eintritt in die Welt begrüßt und jeder sehe, was aus ihm geworden sei. Und auch mir traue er nunmehr zu, ein echter Kerl werden zu können, der seinen Lebensweg fände, besonders unter jenen zukunftsträchtigen Voraussetzungen, die Männer wie er und mein Vater in Deutschland geschaffen hätten und auch weiterhin stützen würden.
Der Morgen nach meiner nächtlichen Geburt soll ein freundlicher mit wolkenlosem Himmel gewesen sein, für den der Ausspruch "typisch Aprilwetter" nicht zutreffend war. Mein Vater erklärte ihn geschwätzig zu seinem Schönsten, denn er ließ den Zeiger auf der Skala seiner Lebenswünsche ganz nach oben schnellen, sodass zunächst kein freier Raum für weitere Wunschvorstellungen blieb.
Ihm wurde an diesem bedeutsamen Tag ein deutscher Junge geboren, dem er den Namen seines geliebten Führers verleihen konnte. Wie einen Orden für eine Heldentat.
Ich weiß nicht, wie er statt meiner die Ankunft eines Mädchens aufgenommen hätte; wahrscheinlich hatte er diese Möglichkeit gar nicht ernsthaft erwogen.
Irgendwann erfuhr ich, dass er seit dem Tag, an dem die Schwangerschaft meiner Mutter zur Gewissheit geworden war, niemals von einer künftigen Tochter sprach, als habe er bei seinem erstgeborenen Kind ein verbrieftes Recht auf einen Sohn. Die Versuche meiner Mutter, ihn auf eine eventuelle Enttäuschung vorzubereiten, wies er schroff ab und berief sich auf das Schicksal, das es bisher stets gut mit ihm gemeint habe. Auch bei diesem für ihn ganz besonders wichtigen Ereignis würde es ihn nicht im Stich lassen. Worin er sich schließlich nicht geirrt hatte.
Zu Ehren des bevorstehenden bedeutsamen Tages hatte er bereits am Vorabend am hölzernen Rahmen des Wohnzimmerfensters die Fahne mit dem Hakenkreuz gehisst, die dann zu seinem Leidwesen jedoch wie ein schlaffes Tuch am Stock hing. Unter dem wolkenlosen Himmel regte sich an meinem ersten Tagesbeginn kein Lüftchen.
Der Volksempfänger im Wohnzimmer plärrte zwischen den Nachrichten geräuschvoll Marschmusik, die sich in der ganzen Straße echohaft fortsetzte, denn jedes der weit geöffneten Fenster entließ sie gleicherweise ins Freie. Als wäre die Welt der Deutschen an jenem Tag auf meinen Eintritt ins Weltgeschehen eingeschworen, wurde überall laut mein Name verkündet, und wäre ich bereits bei Verstand gewesen, hätte mir gewissermaßen der Kamm vor Stolz und Einbildung schwellen müssen.
Man sagt, mit allen ihm verfügbaren Lockungen und Versprechungen habe es mein Vater erreicht, dass ich genau zur richtigen Minute ins Freie schlüpfte und damit erfolgreich das Werk vollendete, dessen Grundlagen er zielgerichtet geschaffen hatte.
Ich habe meinen Vater nicht fragen können, ob die Behauptungen der Angehörigen wie auch Fremder zu Recht bestanden, denn als ich alt genug dazu gewesen wäre, hatte er sich bereits dem Mann geopfert, dessen Namen ich trug. 1935, an des Führers Geburtstag, schlüpfte ich jedenfalls ins Leben und mein Vater soll auf seine Weise dafür gesorgt haben, dass ich den Leib meiner Mutter keine Minute zu früh verließ.
Die Hebamme, die er bereits am Abend rechtzeitig herbeigerufen hatte, habe ein schwieriges Amt gehabt, hieß es, denn sie musste mein Erscheinen auf Wunsch und Drängen meines Vaters so lange verzögern, bis Mitternacht vorüber und der 20. April endlich angebrochen war.
Die Qualen meiner Mutter missachtete er in völkischer Absicht, obwohl ihm sonst in dieser Hinsicht keine männliche Stärke, umso mehr charakterliche Schwäche nachgesagt wurde, wie man mir nach seinem Tod berichtete. Jeder noch so geringfügige Anschein einer Unpässlichkeit meiner Mutter habe ihm Angstschweiß auf die Stirn getrieben. Er galt als unfähig, sich ohne meine Mutter sein Leben einrichten zu können und war somit völlig auf sie angewiesen.
Sein in anderen Fällen geäußertes wie auch bewiesenes Mitgefühl war nicht gespielt, sondern echt gewesen, weshalb es ihm seine Schwiegermutter sein Leben lang nachtrug, dass er meine Mutter wegen meines Geburtstermins leiden ließ und sich sogar über jede weitere Minute, während der sie sich quälte, offenkundig freute. Als er und die anderen Versammelten sich im Wohnzimmer aufhielten, voller Ungeduld schweigend, hörten sie aus dem Nebenraum das Stöhnen meiner Mutter, das mitunter zu heftigen Schreien anschwoll. Mein Vater hatte den Volksempfänger eingeschaltet, um das Zeitsignal nicht zu versäumen und hielt außerdem noch seine Taschenuhr in der Hand, offenbar, um völlig sicher zu sein, dass der Zeitpunkt meiner Geburt wirklich herangerückt war und meine Mutter endlich erlöst werden konnte.
Die Hebamme und meine Mutter schafften es tatsächlich, mich somit am Geburtstag des Führers ins Leben zu schicken und nicht einige Minuten zu früh. Etwas überreif soll ich ausgesehen haben, wie man mir Jahre später berichtete, was mich schließlich meine Kindheit lang verfolgte, indem es fortwährend hieß: "Adolfchen ist frühreif!"
Ich habe dann auch nie gelernt, zwischen beiden Begriffen unterscheiden zu können. Wenn ich später in der Schule für meine Leistungen und guten Noten gelobt und anderen als Muster vorgeführt wurde, habe ich meist erwidert: "Ich bin überreif, daher kommt das."
In wenigen Jahren hatte sich mein Vater vom kleinen Angestellten einer Betriebskrankenkasse zu einem ihrer stellvertretenden Abteilungsleiter hochgedient. Unzweifelhaft mit Fleiß und Einsatz, aber auch mit angepasster Treue gegenüber seinem Führer. Wenn er morgens sein Jackett angezogen hatte, strich er mit dem Handrücken über das große Parteiabzeichen an seinem Revers, als könnte ein Staubkörnchen es verunzieren. Niemals vergaß er, zu jedem geeigneten Anlass die Hakenkreuzfahne am Wohnzimmerfenster zu hissen und als wieder einmal bei einer derartigen Gelegenheit große Flaute herrschte und die Fahne wie ein am Zipfel aufgehängtes Betttuch schlaff herabhing, griff mein Vater zu einer List. Jedenfalls erfand er sie - um sie praktisch anzuwenden und auszuführen, reichten seine handwerklichen Fähigkeiten nicht aus. Darum bat er unseren Nachbarn, einen großen und breitschultrigen Mann vom Bau, seine Idee auszuführen, sodass der praktisch Veranlagte die Fahne mit einem hölzernen Rahmen umgab, wodurch sie selbst bei völliger Windstille ordentlich aufgespannt und das schwarze Hakenkreuz auf seinem weißen Grund gut zu erkennen war. Zufrieden soll mein Vater danach vor unserem Haus gestanden und das Werk seines Nachdenkens bestaunt haben. Mit untergeschlagenen Armen, aber manchmal an seinem Krawattenknoten zerrend, der ihn offenbar beim Atmen hinderte, solange er mit gerecktem Hals stand.
Die Erfindung meines Vaters blieb nicht unbemerkt und seiner Eitelkeit bekam es gut, dafür gelobt und zugleich befragt zu werden, wie er denn auf diese Idee gekommen sei. Die Liebe zu seinem Führer habe es ihm eingegeben, soll er bescheiden, doch selbstbewusst geantwortet haben.
Großzügig gestattete mein Vater dann anderen den Nachbau seiner Erfindung, sodass bald in den meisten Fenstern der Straße diese gerahmte Fahne hing, die nicht windabhängig war.
Irgendeiner der Parteioberen der Stadt war eines Tages in die Verwaltung des Arbeitgebers meines Vaters gegangen und hatte dort an der richtigen Stelle meines Vaters zu rühmenden Eifer gerühmt und PG Oberschmidt für würdig befunden, eine Stufe höher gestellt zu werden, was schließlich auch fast ohne Aufschub geschah. Seit dieser Zeit nahm mein Vater den Posten eines stellvertretenden Abteilungsleiters ein.
Meine eigene Erinnerung kann mir das folgende Geschehen nicht liefern, darum berufe ich mich auf den Bericht meines Großvaters, der seinen Sohn um viele Jahre überlebte:
An jenem maifrischen Tag saß mein Großvater wie üblich in seinem Rollstuhl in dem kleinen Vorgarten vor unseren Fenstern. Früher hatte er dort gewerkelt und die Bewunderung für seine Beete und Rabatten genossen. Jedenfalls geizten Vorübergehende nicht damit, wenn sie Lust auf einen Schwatz mit Meister Oberschmidt hatten. Sie wussten scheinbar genau, auf welche Art sie den einstigen Friseurmeister herauslocken konnten, dessen Salon ehemals ein Umschlagplatz von Neuigkeiten und Klatsch gewesen ist. Doch nachdem ihn seine Verwundung von der Somme nachträglich zwang, seinen Salon aufzugeben, wandte er seine verbliebene Physis für den Vorgarten auf, bis er auch dazu nicht mehr taugte und auf den Rollstuhl angewiesen war. Den musste Großmutter dann bei gutem Wetter hinausschieben, wo Großvater seine Blicke über das Gärtchen schweifen ließ, das sich nun in der Pflege der Großmutter und seiner Schwiegertochter, die meine Mutter geworden ist, befand. Er war rücksichtsvoll genug, um seine Änderungswünsche nicht zu äußern. Vieles machten die beiden Frauen anders, als er es gern gesehen hätte und nur noch selten sprachen ihn Passanten auf seinen Garten an, der längst nicht mehr so ein Blickfang war wie einst.
An jenem Nachmittag im Mai des Jahres nach meiner Geburt sah er meinen Vater ungewöhnlich gut gelaunt die Straße heraufkommen. Er bemerkte, dass mein Vater die Lippen gespitzt hatte, als würde er laut pfeifen. Es hieß später, mein Großvater hätte den Rollstuhl am liebsten verlassen und wäre meinem Vater entgegengegangen, weil ihm schwante, dass etwas Ungewöhnliches geschehen sein musste. Aber weil er keine zwei Schritte geschafft hätte, ohne zu stürzen, hatte er ausgehalten, bis sein Sohn endlich vor ihm stand. Mein Vater sei ihm wie ein Junge vorgekommen und Großvater sagte später, er wäre nicht erstaunt gewesen, wenn mein Vater plötzlich vor Lust und Lebensfreude wie ein Kind gehüpft wäre.
"Was gibt es?", hat er bereits gerufen, bevor mein Vater die Pforte des Vorgartens öffnen konnte.
Er rollte den Kiesweg so weit hinab, bis ihn ein stufenartiger Absatz zum Halt zwang. Ihre Blicke trafen sich wie Signale, die wichtige Nachricht übermittelten. Aber ohne Worte kamen sie dennoch nicht aus.
"Ich bin befördert worden, Vater", sagte mein Vater, jedes seiner Worte wichtig betonend. "Zum stellvertretenden Abteilungsleiter. Ich muss es gleich Luise mitteilen. Die wird Augen machen!" Er schlug sich die Faust vor die Brust und wiederholte: "Ich, der stellvertretende Abteilungsleiter! Wer hätte das gedacht ..."
"Ich!", soll mein Großvater darauf erwidert haben. Er habe immer an die große Chance seines Sohnes geglaubt. Als Vaterlands- und Führertreuer sei er ausgewählt, die Erfolgsleiter zu erklimmen und die Parteigenossen wüssten schließlich zu schätzen, zu welchem Einsatz PG Oberschmidt bereit und fähig sei. Luise war meine Mutter. Mich Leichtgewicht auf dem Arm stand sie bereits am oberen Treppenabsatz, der sich vor unserer kleinen Wohnung befand; die Küchentür war geöffnet, sodass mein Vater bereits im unteren Flur riechen konnte, dass seine Frau Kohlsuppe gekocht hatte. Bestimmt hätte meine Großmutter von unten gerufen, Mutter solle ihre Küchentür schließen, es stinke im ganzen Hause nach Kohl. Aber auch sie muss das Besondere jenes Augenblicks erkannt oder gespürt haben, denn ihre bei anderer Gelegenheit fällige Aufforderung blieb aus. Stattdessen wollte sie ihren Sohn im Flur abfangen, um ihm zu entlocken, was er unweigerlich mitzuteilen hatte.
Aber mein Vater stürmte an ihr vorüber und die Stufen hinauf, und weil ich zu dieser Zeit offenbar schon daran gewöhnt war, habe ich ihm meine wurstrunden Arme entgegengestreckt. So ist es überliefert. Doch mein Vater blieb in der Pose eines Schauspielers zwei Stufen unter meiner Mutter stehen, deutete mit dem Finger auf sich und fragte: "Luise, wen siehst du vor dir?"
Währenddessen habe ich mich nicht davon abhalten lassen, unbedingt von Mutters Armen in seine wechseln zu wollen, weswegen meine Mutter achtgeben musste, mich nicht fallen zu lassen.
"Na, wen schon?", fragte meine Mutter und lachte. "Meinen Mann ..." Sie hielt mich hoch und fügte hinzu: "Und seinen Vater ... Siehst du nicht, wie er nach dir verlangt?"
"Das ist die Stimme des Blutes", sagte mein Vater. Dann nahm er seinen Hut ab, ohne den er nie das Haus verließ und drückte ihn gegen seine Brust. "Du siehst den stellvertretenden Abteilungsleiter vor dir, Luise. Was sagst du dazu?"
Zunächst soll meine Mutter zu keinem Wort, überhaupt keinem Ton fähig gewesen sein. Ihre großen ovalen Augen waren, heißt es, starr auf meinen Vater gerichtet, ihr Mund war staunend geöffnet und ihr Atem schien stillzustehen. Langsam kehrte dann Leben in sie zurück. Sie übergab mich Leichtgewicht in die Arme meines Vaters, wollte ihn danach schließlich in ihrer Freude umarmen, hätte mich jedoch dabei womöglich erstickt, sodass sie ihre körperliche Reaktion unterdrückte und nur die Worte fand: "Ich kann es nicht glauben! Ich kann es nicht glauben!"
"Doch, du kannst es, Luise! Du kannst es!"
Er reichte ihr mich Bündel zurück und stellte sich vor den bodentiefen Spiegel im Flur, den auch ich bereits erprobt hatte und mich jedes Mal freute, wenn der "andere" Junge genau wie ich gegen die Scheibe klatschte und unsere Finger sich berührten.
Mein Vater rückte seine Krawatte zurecht, glättete eine Falte an seinem Jackett, schlug soldatisch die Hacken zusammen und lachte seine Spiegelfigur freundlich an.
"Weiter so!", rief er dieser zu. "Der Weg zum Abteilungsleiter ist geebnet!"
In der darauf folgenden Nacht zeugten meine Eltern meine Schwester Angelika.
Auf diesem "schönen" Namen hatte meine Mutter beharrt. Ich weiß nicht, was sie unternommen hat, meinen Vater umzustimmen, der seine Tochter deutschtümlich-nordisch lieber Edda oder Frauke genannt hätte.
Ich war und blieb in den folgenden Jahren stets das "Adolfchen" und Angelika wurde Mutters "goldiges Kind". Sie war, wie unsere Mutter es ausdrückte, von der Natur mit goldblonden Locken bedacht worden, hatte blaue Augen und eine wohlgeformte kleine Nase. Ihre Brauen seien wie Seide, hieß es, und ihre Fingernägel wiesen hübsche kleine Monde auf, wodurch ihre schmalen Finger wie die einer Käthe-Kruse-Puppe wirkten. Genau so habe auch sie einst ausgesehen, behauptete sie und berief sich auf ihre Mutter, die es schließlich wissen musste und bezeugen könnte.
Wenn ich mir meine kleine Schwester also nachträglich vor Augen führe, komme ich zu dem Ergebnis, dass sie eine rassisch reine Arierin geworden war, die für jedes Propagandabild des Reichspropagandaministers geeignet gewesen wäre. Ich aber besaß braunes Haar, wie ein Bär, war ähnlich tapsig und schwerfällig und wuchs nicht, wie ich sollte und wie vor allem von meinem Vater und dessen Vater im Rollstuhl erwartet wurde. Auch sonst stellte ich mich nicht wie "meines Vaters Sohn" an. Ich nässte lange ins Bett, weil ich nicht rechtzeitig wach wurde. Meine Mutter versuchte, mich zu schrecken und zu beschämen, indem sie das Laken, für alle gut sichtbar, auf dem Hof über eine Wäscheleine schlug. Das aber gefiel meinem Vater nicht; meine charakterliche Schwäche, wie er es nannte, sollte Fremden nicht zur Schau gestellt werden, denn aus den oberen Stockwerken der benachbarten Häuser konnte man sehr gut auf unseren Hof blicken.
"Was sollen die Leute von uns denken?", meinte er empört und erreichte, dass mein "Schandfleck" nicht mehr der Öffentlichkeit vorgeführt wurde.
Auch in anderer Beziehung verhielt ich mich nicht, wie es von mir als "meines Vaters Sohn" erwartet wurde. Ich sprang nicht mit einem hölzernen Gewehr in der Hand unter dem Tisch hervor, wenn mein Vater am späten Nachmittag nach Hause kam, ritt nicht auf einem umgekehrten Stuhl wie ein Indianer auf seinem Pferd und trieb auch keinen Ball über unseren Hof - trotz aller mühsamen Versuche meines Vaters.