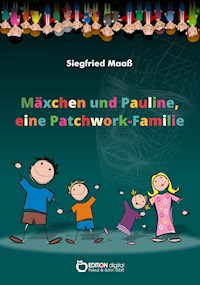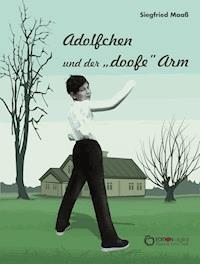7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Brückstedt - eine fiktive Kreisstadt in der realen DDR. Ein alleinstehender Mann beantragt ein Reisevisum, um seine schwer erkrankte Mutter in Westdeutschland besuchen zu dürfen. Das Visum wird ihm verweigert „Wenn Sie wenigstens verheiratet wären“, wird ihm lakonisch erklärt. Aber der Antragsteller ist katholischer Pfarrer Jahre später kann er endlich das Grab seiner Mutter besuchen und zugleich seine jüngere Schwester, die einst mit ihrem Freund nach Westdeutschland floh. Doch sie glaubt nicht, was er ihr berichtet und hält ihm vor, sich zwar um das Seelenheil anderer zu kümmern, aber seiner eigenen Mutter in ihren letzten Stunden nicht beigestanden zu haben. Der schon in der gemeinsamen Kindheit im Elternhaus entstandene Konflikt zwischen den Geschwistern spitzt sich zu; die von einem freudlosen Leben gezeichnete Schwester, vereinsamt und dem Alkohol zugeneigt, bietet keine Chance zu einem geschwisterlichen Ausgleich. Enttäuscht und mit sich selbst unzufrieden und sich zugleich seines Anteils an dem endgültigen Bruch mit seiner Schwester bewusst, verlässt der Pfarrer vorzeitig den Wohnort seiner Schwester. Während der nächtlichen Bahnfahrt begegnet er einer schwarz gekleideten Dame, die sich auf dem Weg nach Brückstedt zur Beerdigung ihrer Mutter befindet. Es ist die ehemalige Polizistin, die damals zu ihm gesagt hatte: „Wenn Sie wenigstens verheiratet wären ..." Eine scheinbar ganz private Geschichte mit einem politischen Hintergrund, vor dem sich der Konflikt von einst zu einem ganz aktuellen ausweitet und seine Konsequenzen fordert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 263
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Impressum
Siegfried Maaß
Sonntagspredigt oder Heimkehr auf die Insel
Novelle
ISBN 978-3-95655-636-4 (E-Book)
Umschlaggestaltung: Ernst Franta
Das Buch erschien erstmals 2004 im BK-Verlag, Staßfurt.
© 2016 EDITION digital®Pekrul & Sohn GbR Godern Alte Dorfstraße 2 b 19065 Pinnow Tel.: 03860 505788 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.edition-digital.de
1
Gestern bin ich aus S. zurückgekehrt. Einen Tag früher als beabsichtigt. Ich glaube, niemals zuvor hatte ich eine solche Erleichterung bei der Heimkehr von einer Reise empfunden. Als wäre ich auf der Flucht gewesen und endlich an einem sicheren Ort angekommen. Den sicheren, mir gut bekannten Ort hatte ich wirklich erreicht. Aber war ich vor Marie, meiner Schwester, tatsächlich geflohen? Oder gar vor Lydia?
Ich wusste es nicht und wollte jetzt auch nicht darüber nachdenken. Während der ganzen langen Fahrt hatte mich kaum etwas anderes beschäftigt als mein Verhältnis zu meiner Schwester Marie. Wäre nicht die schwarz gekleidete Frau mit dem Schleier vor ihrem Gesicht zu mir ins Abteil gekommen, hätte ich wahrscheinlich noch während der Fahrt etwas Abstand gewonnen und auch etwas schlafen können. Doch ohne Marie zu kennen und von unserer gestörten Beziehung zu wissen oder auch nur zu ahnen, auf welche Weise ich meine Schwester verlassen hatte, lenkte sie meine Gedanken ungewollt in die entgegengesetzte Richtung unserer Fahrt - nämlich zurück zu Marie und damit auch in jene Zonen meines Bewusstseins, die ich gern endgültig hinter mir lassen wollte.
Erst nachdem sich unsere Wege getrennt hatten, gelang es mir, ruhiger zu werden und mich auf meine Heimkehr zu freuen. Durch keine weiteren belastenden Überlegungen wollte ich meine Freude trüben lassen.
Auf dem Markt unserer kleinen Stadt verließ ich den Bus, mit dem ich aus unserer Kreisstadt gekommen war. Es erschien mir als glücklicher Zufall, dass er abfahrbereit am Bahnhof gestanden hatte, als ich die Stufen hinab stieg und schwer an meinem Koffer schleppte. Auf diese Weise entging ich der Entscheidung, mit einer Taxe fahren zu müssen, was für mich eine verschwenderische Ausgabe bedeutet hätte.
Vom Busfenster aus beobachtete ich meine ungebetene Reisegefährtin, von der ich mich bereits im Zug verabschiedet hatte. Flüchtig genug, um erkennen zu lassen, dass meinerseits kein weiterer Gesprächsbedarf bestand. Jedoch ausreichend beherrscht, um nicht als unfreundlicher und nachtragender Schwarzkittel, der einmal erlittenes Unrecht nicht verzeihen kann, in Verruf zu geraten.
Offenbar war sie bereits am Bahnsteig von ihrem Bruder in Empfang genommen worden; eindringlich, als wäre es von besonderer Bedeutung, hatte sie mich wissen lassen, dass er sie abholen wolle. Mit einem großen, kräftig wirkenden Mann sah ich sie aus dem Bahnhofsportal heraustreten. Er trug einen dunklen Anzug und eine schwarze Krawatte auf weißem Hemd. Den Koffer seiner Besucherin behandelte er, als sei er völlig leer und wechselte ihn leichthändig und schwungvoll auf die andere Seite, um seine Schwester mit der rechten Hand unterfassen zu können. Noch bevor mein Bus abgefahren war, hatten die beiden mit einem Taxi bereits den Bahnhofsvorplatz verlassen.
Für die etwa zwanzig Minuten währende Fahrt bis Burghausen richtete ich mich auf meinem Platz so bequem wie möglich ein. Von der langen Bahnfahrt schmerzte mich jede Faser meines Körpers. Am liebsten wäre ich im Mittelgang auf- und abgelaufen, unterließ es jedoch der anderen Fahrgäste wegen. Vielleicht konnte ich mich am Nachmittag mit Gartenarbeit wieder etwas in Schwung bringen. Doch mit dieser stillen Hoffnung betrog ich mich selbst. Auf meinem Schreibtisch würde ein Berg Arbeit auf mich warten. Und auch meine Sonntagspredigt schrieb sich nicht allein.
Zu dieser Stunde war der Bus aus der Kreisstadt nahezu leer. Nur einige Frauen fuhren mit mir, die mich beim Einsteigen erstaunt angesehen hatten. Sie arbeiten als Kassiererinnen in unserem ländlichen Supermarkt. Auf der Rückfahrt würde der Bus gut besetzt sein, weil viele Pendler in die Kreisstadt fahren.
Obwohl mir die Augen zufallen wollten, blickte ich während der Fahrt aus dem Fenster. In der waldlosen und flachen Landschaft, in der Fremde kaum Sehenswertes entdecken können, fühlte ich mich sofort wieder heimisch. Seit meiner Kindheit bin ich es gewöhnt, weit ins Land blicken zu können und kann Gebirge kaum länger als eine Urlaubswoche ertragen - schon bald spüre ich dann Beklemmungen, fühle mich eingezwängt und sehne mich nach der Ebene zurück.
Ähnlich erging es mir auch in S. Eingebettet in einen Talkessel, der von dichten Wäldern umgeben ist, erlaubt die Stadt keinen Blickkontakt mit dem Horizont. Lediglich vom Schloss aus, dem höchsten Punkt der Stadt, kann man über die Wipfel hinwegsehen. Aus dem Bus heraus erkannte ich nun die Turmspitzen der beiden Burghausener Kirchen, die mir stets wie ungleiche Geschwister erschienen. Hoch aufragend und erhaben der Turm der evangelischen St. Petrikirche, eines romanischen Bauwerks, mit dem nicht allein die Gemeinde, sondern auch die Stadt renommiert. Dagegen der kurze, gedrungene Turm „meiner“ Kirche - als stünde sie, schlicht und unansehnlich, ganz im Schatten der anderen. Dennoch erkannte ich auch „meinen“ Turm, dessen Schieferdach sich im Maimorgenlicht dunkel abhob.
Von diesem Augenblick an konnte ich es kaum erwarten, endlich mein Ziel zu erreichen. Außerdem war ich neugierig zu sehen, wie Juliane auf meine verfrühte und damit unerwartete Ankunft reagierte.
Am Rathaus stieg ich aus, während die Frauen bis zur Endstelle weiterfuhren. Wahrscheinlich würden sie von Juliane bei deren nächstem Einkauf wissen wollen, woher ich am frühen Morgen gekommen war, noch dazu mit einem schweren Koffer. War der Herr Pfarrer womöglich im Urlaub und hatte eine lange Reise hinter sich?
Oft genug hatte mir Juliane schon von der aufdringlichen Neugier berichtet, mit der sie manchmal bedrängt wurde. Einigen Leuten schien es zu gefallen und außerordentlichen Spaß zu bereiten, sie in Verlegenheit bringen zu wollen, indem sie anstößige Bemerkungen machten. Sie und der gut aussehende Herr Pfarrer unter einem Dach ... Na, wer weiß ...
Aber ich glaube Juliane, wenn sie sagt, dass sie sich von solchen dummen Verdächtigungen nicht aus der Ruhe bringen lässt. Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass sie sich kaum einmal zu unbedachten Äußerungen hinreißen lässt.
Im Rathaus herrschte noch Ruhe. Die Lampe über der breiten Portaltreppe war noch eingeschaltet, obwohl es längst taghell war. Die Fenster waren geschlossen und erweckten den Eindruck, als wären sie schon seit Tagen nicht geöffnet worden. Nichts deutete darauf hin, dass hier in kurzer Zeit vielleicht wichtige Entscheidungen über Wohl und Wehe der Stadt und ihrer Bürger getroffen werden könnten.
Früher hatte hier mein Skatbruder Henze „geherrscht“. Das war zu jener Zeit, als ich nicht nach S. zu meiner Schwester fahren durfte. Da hatte es auch nichts genutzt, dass sich der Bürgermeister dafür einsetzte, wie er mir glaubhaft versicherte. Darauf hatte er keinen Einfluss nehmen können. Aber ich rechnete es Henze damals als Zeichen seines Verständnisses und ebenso seines Mutes an, es wenigstens versucht zu haben. Obwohl er zu ihnen gehörte und an seinem Jackett ihr Abzeichen trug. Kopfschüttelnd hatte er mir gestanden, von so viel Uneinsichtigkeit und Engstirnigkeit enttäuscht zu sein. Es gab keinen Grund für mich, ihm nicht zu vertrauen. Auch meine innere Stimme hatte sich nicht warnend gemeldet, sodass ich mir völlig sicher war, dass er sich tatsächlich für mich verwendet hatte. Auf Internus, wie ich meine innere Stimme nenne, habe ich mich stets verlassen können.
Henze sitzt längst nicht mehr im Rathaus. Er altert langsam vor sich hin, und jedes Mal, wenn ich mich mit ihm zum Skat treffe, erschrecke ich. Dann ist seine Haut wieder sichtbar grauer geworden und tiefe Falten teilen sein Gesicht in verschiedene Zonen, die scheinbar nichts miteinander zu tun haben. Seit einiger Zeit leidet er an der Parkinsonschen Krankheit und von Mal zu Mal hat er mehr Mühe, die Karten zu mischen; seine Hände kommen keinen Augenblick zum Stillstand. Aber weder Ewald noch ich wagen ihm anzubieten, es für ihn zu tun. Nur beim Anzünden der unvermeidlichen Zigaretten nimmt er gern unsere Hilfe in Anspruch. Die Zigarette zwischen den Lippen, wartet er dann wortlos, bis einer von uns beiden die Streichholzflamme daran hält. Hechelnd inhaliert er danach und es scheint, als ob ihn das Nikotin vorübergehend belebe.
Ewald ist unser dritter Mann. Ehemals leitete er die Genossenschaft. Heute lebt er von seinem Ruhestandsgeld, obwohl ihm Ruhestand ebenso fremd ist wie irgendein fernes Land. Ewald bleibt auf seiner Scholle und verreist nicht. Dafür werkt er unentwegt in seinem Garten, in dem er immer wieder neue Züchtungen versucht, die er Juliane dann wortlos auf den Tisch legt und ihr zunickt ... Versuch’s mal, heißt das. Aber Juliane ist skeptisch. Was sie nicht gut genug kennt, verwendet und benutzt sie nicht.
Wenn einer von beiden aus unvorhersehbaren Gründen ausfällt, springt sie als dritter „Mann“ ein. Dann müssen die beiden anderen auf der Hut sein, um nicht von ihr „wie eine Weihnachtsgans ausgenommen“ zu werden. Weil ich es jedoch vom Beginn unserer wöchentlichen Skatrunden abgelehnt habe, für Geld zu spielen, sammelt sie als ihren Gewinn nur unsere männliche Ehre ein. Dieses Mal hatte sie nun statt meiner am Spieltisch gesessen, und ich war gespannt, ob Henze und Ewald wieder Tribut zollen mussten.
Zu Henzes Zeit war es zu dieser Morgenstunde im Rathaus bereits „lebendig“. Meist war er es, der die schwere Tür aufschloss. Heutzutage hat man es mit dem Tagesbeginn nicht so eilig und unser gegenwärtiger Bürgermeister hat außer der Stadt auch noch eine Firma zu leiten, die ihm seinen Lebensunterhalt sichert.
Beim Bäcker jedoch drängten sich die Kunden bereits, als wären sie kurz vor dem Verhungern. Bei diesem Gedanken spürte ich plötzlich, dass ich seit fast zwölf Stunden nichts gegessen hatte. Umso mehr freute ich mich auf Julianes kräftiges Frühstück. Sie konnte jedoch nicht wissen, dass ich bereits in wenigen Augenblicken vor der Tür stehen würde.Auf dem Steintritt meiner Tür hielt ich inne und blickte mich um, als müsste ich mich vergewissern, tatsächlich zu Hause angekommen zu sein. Ich sah auf die Grünanlage, die die Kirche und das Wohnhaus umschloss, weshalb ich manches Mal von meiner „Insel“ sprach, auf der ich mich wohlfühlte und wo ich gern lebte. Die ich dennoch jeden Tag verließ, um den Kontakt zu den Menschen meiner Gemeinde zu pflegen und ihnen nahe zu sein, wann immer sie meines Zuspruchs und Beistands bedürfen. Dann geschah es jedes Mal in dem Bewusstsein, dorthin wiederkehren zu können, wenn ich glaubte, meine Pflichten im Menschenmeer erfüllt zu haben. Mitunter teilte ich in diesen Augenblicken die Trauer einer Familie beim Verlust eines Angehörigen und begann bereits nach treffenden Worten zu suchen, mit denen ich den verstorbenen Menschen würdigen und ehren wollte, wie ich es kurz zuvor mit den Hinterbliebenen besprochen hatte.
Oder ich war zufrieden, Hoffnung und Zuversicht vermittelt zu haben, wenn es einer Krankheit oder eines anderen Unglücks wegen daran mangelte.
Am Schönsten war es jedoch, wenn ich von so erbaulichen Festen wie Trauung, Taufe oder Kommunion auf meine „Insel“ heimkehrte und mich anschließend noch eine Weile des Glücks hingab, das ich auf den Gesichtern der Beteiligten bemerkt hatte.
Gestern bin ich glücklich gewesen, mein „Inselreich“ vorzufinden, wie ich es vor einer knappen Woche verlassen hatte. Wie gewöhnlich plusterten sich die Rhododendronbüsche wie erschreckte Tauben auf; Besitz ergreifend schienen sie keine anderen Blumen und Sträucher neben sich zu dulden, sodass sich diese ihre Standorte in gebührendem Abstand gesucht hatten. Die beiden mächtigen Kastanien, die bereits einem meiner Vorgänger vor nahezu hundert Jahren einen Eintrag in die Kirchenchronik wert waren, standen in voller Blüte. Später im Jahr würden sie ihre stachligen Kugeln abwerfen, was ich, wenn ich in meinem Arbeitszimmer saß, mitunter hören konnte. Danach kämen dann die Kinder, um sie aufzusammeln und alle möglichen Tiere und lustige Männchen daraus zu basteln. Irgendwann kehrten sie mit ihren Kastanienfiguren wieder auf die Wiese zurück, um sie beim Kirchenfest für einen guten Zweck anzubieten. Damit hätte sich wie in jedem Jahr wieder ein Kreislauf vollendet.
Darauf freute ich mich plötzlich, und mir schien es, als lohne es sich allein deshalb, den augenblicklichen Groll sowie die tiefe Enttäuschung zu vergessen.
Die beiden Bänke zwischen den Kastanien, in deren Lehnen schon Angehörige mehrerer Generationen ihre Initialen und Daten hinterlassen hatten, waren nicht besetzt. Aber am fast wolkenlosen Himmel stand bereits die Sonne und ließ einen warmen Frühlingstag erwarten, und erst in diesem Zusammenhang wurde mir wieder bewusst, dass es früher Morgen war. Andere Leute begannen um diese Zeit ihr Tagewerk, während ich von einer Reise heimkehrte.
Bei diesem Gedanken warf ich unwillkürlich einen Blick auf die Turmuhr - schon seit Jahren zeigte sie die gleiche Zeit an, weil der Gemeinde ebenso wie dem Kirchenbauamt das Geld für die kostspielige Reparatur fehlte. Als wäre damit ein symbolisches Zeichen gesetzt für das Leben in unserem Ort. Zwar war mit der „Wende“ eine neue historische und politische Epoche eingeleitet worden, doch die damit eingetretenen Veränderungen schienen um Burghausen einen weiten Bogen zu schlagen.
Ich läutete an meiner Tür und lauschte dem bekannten Wohlklang des Gongs. Auch für mich hatte sich in diesem Augenblick ein Kreislauf vollendet.
Juliane, meine Haushälterin, erschrak, als ich so unerwartet vor ihr stand, wahrscheinlich mit vor Müdigkeit geröteten Augen und ganz offensichtlich erschöpft.
Ich fühlte mich jedoch nicht in der Lage, ihr meine gegenwärtige Befindlichkeit und Stimmung sowie mein Erscheinungsbild zu erklären. Obwohl ich meine Gefühle kaum einzuordnen wusste und Enttäuschung, Wut und verletzte Eitelkeit nicht voneinander zu trennen vermochte und meinte, dafür endlich ein Ventil zu brauchen, brachte ich es nicht fertig, Juliane das Vorgefallene auch nur andeutungsweise zu berichten. Wenngleich sie in ähnlichen Situationen stets meine Vertraute gewesen ist. Nie hatte sie sich beklagt, wenn ich sie in meine Angelegenheiten einbezog, sondern sich immer aufmerksam und geduldig gezeigt und mir zugehört, ohne mich zu unterbrechen. Womöglich machte es jedoch in diesem Fall für mich einen Unterschied, dass mein augenblicklicher Missmut sowie meine gedrückte Stimmung auf eine familiäre Ursache zurückzuführen waren. Im Gegensatz zu sonst, wenn ich mich aus „amtlicher“ Verärgerung bei ihr aussprach.
Meine Gesichtshaut spannte, als wäre sie mit Spangen an den Ohren befestigt und ich fühlte mich, als hätte ich mich seit Tagen nicht gewaschen. Im Zug hatte ich keine Minute Schlaf gefunden; zunächst, weil mich die nicht endenwollenden und manchmal recht boshaften Wortwechsel mit Marie, meiner Schwester, bis in das Abteil verfolgten. Wie ein sich auf einem Aufzeichnungsgerät ständig wiederholender Dialog, den ich eines technischen Defektes wegen nicht ausschalten konnte. Danach dann die ungewünschte Reisebegleitung, die dem Zank, den ich zuvor mit Marie auszufechten gezwungen war, ihren Teil hinzufügte und damit meinen Blutdruck gefährlich in die Höhe trieb.
Juliane hatte mich aufmerksam und eindringlich betrachtet, als könnte sie nicht glauben, mich vor sich zu sehen.
„Was ist mit Ihnen?“, fragte sie besorgt, und bevor ich antworten konnte, fügte sie sofort mahnend hinzu: „Sie sollten keine so langen Reisen mehr unternehmen, Herr Pfarrer. Da muten Sie sich etwas viel zu. Sie scheinen zu vergessen, dass Sie längst nicht mehr der Jüngste sind. Ganz geschafft sehen sie aus!“
Sie nahm meinen Koffer auf und trug ihn ins Haus, als handele es sich um ihren täglichen Einkauf. Obwohl sie fast ebenso alt war wie ich, kannte sie weder Schwäche noch Krankheiten. Ihr Geist war noch so rege wie vor gut drei Jahrzehnten, als sie zu mir kam. Selbst ihr Haar schien sich jeder altersmäßigen Färbung erfolgreich zu widersetzen und zeigte sich noch immer in seinem ursprünglichen Brünett. Im Gegensatz zu meinem: Die einstige gelbe Löwenmähne hatte sich inzwischen in silbriges Grau verwandelt. Außerdem war mein Haar sehr dünn geworden und ließ eine ungewollte „Tonsur“ erkennen, gerade so, als gehörte sie zu mir als Pfarrer.
„Ich lasse Ihnen gleich ein Bad ein. Damit Sie wieder wie ein Mensch aussehen und nicht wie ein gescheuchtes Reh.“
Als ich bereits hoffte, Juliane würde sowohl ihre Besorgnis wie auch ihre Neugier dieses Mal zügeln, fragte sie, bevor sie hinauf ins Bad ging: „Warum kommen Sie denn schon heute? Ich dachte, ich sehe nicht richtig, als Sie plötzlich vor mir stehen!“ Und als wollte sie ihre erkennbare Neugier herabspielen, meinte sie: „Es ist man gut, dass ich bereits alles besorgt habe. Aber nur, weil ich nie etwas auf die lange Bank schiebe.“
„Es ist nichts geschehen, Juliane“, sagte ich. „Ich bin nur müde. Sie können also unbesorgt sein.“
„Wie Sie meinen, Herr Pfarrer“, erwiderte sie, hob die Schultern und verschwand darauf im Bad.
Ich hätte ihr gern noch das Päckchen überreicht, das mein Geschenk darstellte, brachte es jedoch nicht fertig, jetzt den Koffer zu öffnen und verschob darum diesen Akt der Anerkennung auf später.
Nicht einmal in mein Arbeitszimmer warf ich einen Blick, als gelte meine Zufriedenheit, wieder zu Hause zu sein, nicht auch jenen vier Wänden, die die schwere Holztür mit den Ornamenten vor mir verbarg. In diesem Augenblick war es mir völlig gleichgültig, wie hoch der Stapel Briefe während meiner Abwesenheit auf meinem Schreibtisch gewachsen war. Wie immer, wenn ich für zwei oder höchstens drei Tage verreiste, würde Juliane auch diesmal sorgfältig die Post aufeinandergeschichtet haben, sodass ich die Reihenfolge ihres Eingangs genau verfolgen konnte. Sie meinte, es könnte womöglich wichtig sein zu wissen, wann ein bestimmtes Schreiben eingetroffen war. Eine Erkenntnis, die sich für die amtliche Praxis schon oft bewährt hatte. Auf diese Weise erfüllte Juliane sogar die Aufgaben einer gewissenhaften Sekretärin, was ich jedoch ihr gegenüber niemals anerkennend hervorhob, als scheute ich zuzugeben, mich auch in dieser Beziehung von ihr abhängig gemacht zu haben. Nachdem ich nun dieses Mal fast eine Woche von zu Hause weggeblieben war, musste der Stapel Briefe entsprechend angewachsen sein.
Ich bin einen Tag früher als vorgesehen zurückgekehrt. Mein vorzeitiger Aufbruch von S. kam einer Flucht gleich. Ein Eingeständnis, das mir nicht leicht fiel, und wie oft in ähnlichen Situationen lauschte ich auf meinen Internus, wie ich meine innere Stimme bekanntlich nenne. Aber er schwieg, woraus ich schloss, dass er mein Eingeständnis gut hieß. Dennoch war ich nicht sicher, ob ich in diesem Fall in gewohnter Offenheit und Ehrlichkeit mit Juliane darüber sprechen wollte. Sogar die Konzertkarte hatte ich verfallen lassen. Dabei hatte ich mich auf das Orgelkonzert in der Schlosskirche von S. ganz besonders gefreut. Außerdem bedurfte es zuvor meiner ganzen Überredungskunst, sie überhaupt zu erhalten. Offiziell waren bereits alle Karten verkauft. Bedauernd hatte die Frau an der Kasse die Schultern gehoben. Erst nach meiner wiederholt vorgetragenen Bitte, verbunden mit dem Hinweis, dass ich nur für kurze Zeit in der Stadt sei und darum das nächste Konzert nicht besuchen könne, ließ sich die Frau zu der Bemerkung herab, sie wolle sich noch einmal umhören ... Ich solle mich erst noch etwas in der Schlosskirche umsehen und dann später noch einmal zu ihr kommen.
Bestimmt wäre das Konzert der Höhepunkt meines Aufenthaltes in S. geworden. Und ein freundlicher und festlicher Abschied zugleich. Nicht von Marie, meiner Schwester, sondern von der Stadt. Mit wachsender Aufmerksamkeit und zunehmendem Gefallen hatte ich sie durchstreift und erkundet. Dabei war ich vor allem den Hinweisen und Empfehlungen Schwester Lydias gefolgt, deren Bekanntschaft ich ganz zufällig gemacht hatte. Sie hätte mich sogar gern zu einem Stadtrundgang begleitet, und, ehrlich gesagt, hätte mir ihre Begleitung auch sehr zugesagt. Doch leider war sie in ihrem Krankenhaus unentbehrlich, sodass mir nichts anders übrig blieb, als allein ihren Hinweisen zu folgen, als wären es Spuren, die sie gelegt hatte.
Lediglich an jenem späten Abend, als ich sie zu Dienstschluss überraschte und wir schließlich zu Hella Gutzeit in dieses palastähnliche Hotel vordrangen, wo wir die berühmte Pianistin in ihrer Suite aufsuchten, verbrachte ich einige Zeit mit Schwester Lydia. Doch ihre sachkundige Führung, verbunden mit ihrer lockeren Art, Dinge und Sachverhalte zu beschreiben, hätte mir besonderen Spaß bereitet. Aber ausgerechnet darauf musste ich wegen ihres Zeitmangels verzichten.
Die Lage der Stadt in einem weiträumigen Tal zwischen zwei bewaldeten Höhenzügen gefiel mir außerordentlich gut. Vom Schlossberg konnte ich die Kuppen, die S. wie Festungstürme umgaben, sehr gut erkennen. Die Wälder wirkten dunkel und schlossen einen Gürtel um die Stadt, der sie sichtbar einschnürte. Die auf diese Weise entstandene „Taille“ erschien mir als das Besondere dieses Panoramas. Lediglich die in der Ferne aufragenden Sendemasten empfand ich als störend.
Wie stets in einem fremden Ort hatte ich zuerst Kirchen und Friedhöfe aufgesucht, um mir einen Eindruck vom Wesen der Menschen dieser Stadt zu verschaffen. Weil ich glaube, dass sich daraus ein Zusammenhang herstellen lässt. Wo sich Kirchen und Friedhöfe in ungepflegtem Zustand befinden und nichts auf eine liebevolle Beziehung der Menschen zu ihnen spricht, kann es auch mit der Lebensart in der jeweiligen Stadt nicht gut bestellt sein. Jedenfalls ist das meine Ansicht, die Juliane allerdings nicht teilt. In diesem Fall hatte ich sogar einen ganz besonderen Grund, den Friedhof der Schlosskirche aufzusuchen: Dort befindet sich das Grab meiner Mutter. Einem Monument gleich stellt es einen unförmigen Klotz dar, dessen Ränder in künstlichem Marmor gefasst sind, wodurch es keineswegs gefälliger wirkt. Die Einfassung der Grabstätte gleicht der Bordkante einer Straße, womit die Geschmacklosigkeit des Schöpfers auf den Punkt gebracht worden ist. Die beiden Daten, die Anfang und Ende ihres Lebens bestimmten, waren unter dem Namen Mathilde Möbius eingraviert und wirkten bereits leicht verwittert. Offensichtlich handelte es sich um preisgünstigen Sandstein, der in Maries Auftrag zu einem protzigen Ungetüm gestaltet worden war.
Ich kannte das Grab bisher nur von einem Foto und ich hatte mir viel Zeit gelassen, es aufzusuchen, seit ich die Möglichkeit dazu hatte. Das Foto hatte mir meine Schwester bereits vor einigen Jahren geschickt. Kommentarlos hatte es in einem Umschlag gesteckt. Geradeso, als wollte sie mich darauf aufmerksam machen, dass sie das Grab ordentlich pflegte und ich deshalb in ihrer Schuld stand. Nicht mit Geld. Sondern moralisch. Ein Wort, das Marie sehr mag und schon früher gern gebrauchte. Sehr oft auch in seiner negativen Umkehrung: Das ist unmoralisch, ließ sie mich als Kind schon wissen, wenn sie an dem, was ich tat, keinen Gefallen fand. Dann schien es, als sei nicht ich der Ältere, sondern sie. Mit der Übersendung des Fotos zugleich einige Worte an mich zu richten, war ihr nicht in den Sinn gekommen. Auf diese Weise wollte sie mir zu verstehen geben, in welchem Verhältnis zu ihr sie mich sah - ich war der verständnis- und lieblose Bruder, der es nicht fertig gebracht hatte, der Mutter in ihren letzten Stunden beizustehen, dessen Amt als katholischer Pfarrer keinen Spielraum ließ, der eigenen Mutter auf dem Sterbebett Zuspruch zu gewähren. Der sich auch nicht nur vorübergehend von seiner eigenen Gemeinde löste, um die Sterbende noch einmal zu sehen. Und der somit „unmoralisch“ handelte.
Dies alles hatte sie mir zum Vorwurf gemacht. Vergeblich hatte ich mich zu rechtfertigen und ihr zu erklären versucht, dass ich keine Erlaubnis erhalten hatte, zu ihnen nach S. fahren zu dürfen.
Für sie stellte es jedoch eine fatalistische Ausrede dar, die ihr Anlass genug war, selbst unseren bisherigen sporadischen Briefwechsel einzustellen. Nur das Foto des Grabes unserer Mutter traf noch bei mir ein. Juliane hatte damals den auffälligen Umschlag wie eine Trophäe an das hölzerne Kruzifix gelehnt, das auf meinem Schreibtisch steht und ein Geschenk meines Bischofs zu meinem fünfzigsten Geburtstag war. Ich erinnere mich sogar, dass sie irgendeinen Vorwand fand, mir in mein Arbeitszimmer folgen zu können, gespannt darauf, wie ich diese Post aufnehmen würde. Sie hatte einen großen Teil der Entwicklung unserer „geschwisterlichen“ Beziehung miterlebt und fühlte sich davon ebenso betroffen wie ich. Ich konnte dann auch nicht verhindern, dass meine Hand zitterte, als ich den Umschlag öffnete.
Später erhob Juliane lautstarke Vorwürfe gegen sich selbst, weil sie, indem sie den Briefumschlag so auffällig aufgestellt hatte, unberechtigte Hoffnung in mir weckte, wie sie meinte. Doch meine Schwester hatte mir keine einzige Zeile zukommen lassen. Ich musste darauf nicht nur meine eigene Wut und Enttäuschung überwinden, sondern auch meiner Hausangestellten Trost zusprechen. Sie hatte sich wirklich nichts vorzuwerfen.
Einige Zeit lang ging sie dann weniger aufmerksam mit meiner Post um, kehrte jedoch bald wieder zu ihrer früheren Gewohnheit zurück. Gelegenheiten, einen privaten Brief auf die erwähnte Art augenfällig zu machen, boten sich ihr auch nicht oft. Meine Post betraf fast ausnahmslos mein Amt und die damit verbundenen Pflichten.
lch genoss das Bad, streckte mich wohlig aus und versuchte „abzuschalten“, indem ich die Augen schloss, um die Strapazen der Reise zu vergessen und an nichts zu denken. Ich spürte aber, dass es mir nicht gelingen würde. Allein der Vorsatz genügte, um das genaue Gegenteil zu erreichen. Das Bild meiner Schwester, die sich erregte und dabei heftig gestikulierte, während ihr eine Strähne ihres ungepflegten grauen Haars in die Stirn hing, entstand erneut vor mir, sodass ich die Augen wieder öffnete, um mich optisch abzulenken. Hatte Juliane vielleicht im Bad irgendetwas verändert? Den Spiegel anders gehängt oder die Flaschen mit den verschiedenen Shampoos auf ein anderes Regal gestellt? Doch darin enttäuschte sie mich. Die einmal errichtete Ordnung behielt Juliane endgültig bei. Lediglich mein Rasierzeug und meine Zahnbürste befanden sich noch in meinem Gepäck und hinterließen einen freien Platz auf der gläsernen Konsole.
Als müsste ich mich nun bei ihr für diesen ungerechtfertigten Gedanken entschuldigen und zugleich mein eigenes Gewissen beruhigen, dankte ich ihr im Stillen für das erholsame Bad ebenso wie für ihre allgemeine Umsicht. Immer schien sie im Voraus genau zu wissen, was gut und richtig für mich war. Ich nahm mir fest vor, endlich einmal einige Worte der Anerkennung zu finden. Auch mein Geschenk, das sich noch im Koffer befand, diente vielleicht dazu, dieses Versäumnis aus der Welt schaffen.
Natürlich konnte Juliane im Lauf der Jahre nicht entgangen sein, dass ich ihr fast ausnahmslos folgte, wenn sie etwas für mich „beschlossen“ hatte und mich ihr anvertraute, als sei ich wieder das Kind, das den Anweisungen der strengen Mutter gehorchte. Doch von der Kindheit unterschied mich jetzt nicht nur das Alter. Den mütterlichen Anweisungen war ich gewissermaßen als Abhängiger und dann auch nur unwillig nachgekommen. Julianes Entscheidungen hingegen setze ich gern und ohne moralischen Zwang in die Tat um.
Meine Füße stießen an den Wannenrand, und als ich sie bewegte, erzeugten sie ein unangenehmes quietschendes Geräusch, gegen das sich nicht allein mein Gehör, sondern der ganze Körper zur Wehr setzte. Wäre ich nicht selbst in der Wanne gewesen, hätten sich meine Härchen auf Armen und Beinen wahrscheinlich gesträubt.
Daran erinnerte ich mich noch aus der Zeit meiner Kindertage. Jedes Mal hielt ich mir die Ohren zu oder lief aus dem Bad, wenn meine Schwester in der Wanne saß und mit diesem schrecklichen Geräusch begann. Es bereitete ihr großes Vergnügen, mich auf diese Weise aus dem Bad zu vertreiben. Angeblich wollte sie nicht von mir beobachtet werden. Doch sobald ich die Tür von außen geschlossen hatte, rief sie mich, und kehrte ich dann nicht sofort wieder zu ihr zurück, brach sie in lautes Geschrei aus, das für unsere Mutter das Signal darstellte, der „lieben Kleinen“ zu Hilfe zu eilen.
Darauf wollte ich es jedoch nicht jedes Mal ankommen lassen. Besonders wenn Mutter Klavierunterricht erteilte, war im ganzen Haus Ruhe geboten. Fast immer galt somit ich als der Schuldige, weil ich mich nicht ausreichend um die kleine Schwester gekümmert hatte und Mutter sich in ihrer Arbeit gestört fühlte. Unter „Kümmern“ verstand Mutter, dass ich als der Ältere bereits genügend Verstand besaß, um sowohl für die nötige Ruhe wie auch für Maries Wohlbefinden zu sorgen. Dies wiederum „bekümmerte“ mich genau im Sinne des Wortes. Denn für meine Schwester bedeutete es außerordentliches Wohlbefinden, mir fortwährend Kummer zu bereiten, indem sie mich herausforderte, ihr jeden Wunsch und Willen zu erfüllen. Sonst setzte sofort ihr Geschrei ein, das meine Mutter auf den Plan rief. „Torvald Möbius!“, sagte diese dann laut, als befände ich mich in großer Entfernung. Ihre Hände stützte sie in die Hüften, wo sie eine gute Auflage fanden und wobei sie jedes Mal ihren Rock- oder Kleidersaum ein Stück in die Höhe schob, sodass ihre Knie zu sehen waren. „Wie stellst du dir das vor? Nennst du das etwa, deine Pflichten erfüllen? Rennst einfach hinaus? Und wenn nun deine kleine Schwester in der Wanne deine Hilfe braucht?“
„Ihr geschieht schon nichts“, erwiderte ich zaghaft und ließ offen, ob ich meinte, dass ich ja auf sie aufpasste oder sie alt genug sei, auf sich selbst aufpassen zu können. Außerdem wusste ich, dass Marie das Wasser höchstens bis zu den Schultern an sich herankommen ließ. Berührte ihre Kinnspitze auch nur kurz den Schaumberg, den sie sich auf den Körper geschaufelt hatte, begann sie sogleich wie eine Ertrinkende zu prusten, und ihre Hände umklammerten den Wannenrand. Natürlich wusste das auch unsere Mutter und bestellte mich darum an jedem Badetag zum Wachposten.
„Das ist aber sehr leichtfertig gedacht!“ Meine Mutter entlastete nun ihre Hüften, sodass auch ihre Knie wieder vom Rock bedeckt wurden. “Ich hoffe, in Zukunft handelst du zuverlässiger!“
Marie erkannte in diesem Augenblick die günstige Gelegenheit, mich auch die nächste Zeit für sich zu verpflichten. „Und danach öffne ich wieder meinen Salong!“ Wie einen Pfeil stieß sie ihren Finger in meine Richtung. „Und du bist dann mein erster Kunde!“ „Nein!“ Abwehrend hob ich meine Hände wie vor einem Angreifer. „Kommt nicht infrage! Ich habe zu tun, nämlich für die Schule.“ Ich hoffte, meine Mutter mit dieser Begründung überzeugen zu können, dass ich wirklich Wichtigeres zu erledigen hatte, als mich noch länger um Marie zu kümmern. Während sie bereits hinausging, meinte sie jedoch, dafür hätte ich später noch genügend Zeit, wenn sie selbst ihren Unterricht beendet hatte. Dann könne sie sich mit der Kleinen beschäftigen. So lange aber ... Mutter schloss die Tür, um zu ihrer Schülerin zurückzukehren, offenkundig einer Anfängerin, denn ihre Fingerübungen waren fremden Ohren kaum zuzumuten.
So saß ich bald darauf auf einem harten und unbequemen Küchenhocker, während sich meine Schwester in ihrem „Salong“ mit Kämmen und Bürsten an meinem Haar zu schaffen machte. Dazu hatte sie mir einen von Mutters geblümten Frisierumhängen um den Hals gebunden, von dem süßlicher Parfümgeruch aufstieg. f Das kleine Fläschchen, das Mutter Flakon nannte, hatte sie von Vater zum Geburtstag bekommen, und manchmal fragte er sie, warum sie das gute und teure Parfüm so selten benutze. Dann erfand sie immer schnell eine Ausrede, die unseren Vater allerdings nicht überzeugen konnte. Ich wusste aber, dass es ihr überhaupt nicht gefiel. Zufällig hörte ich einmal, dass sie, als sie glaubte, allein zu sein, zu schimpfen begann. Sie hielt dabei den Flakon in der Hand, und es sah aus, als wollte sie ihn vor Wut auf die Fliesen des Bades werfen.
„Wofür hält er mich? Für eine Puffmutter?“ Sie schüttelte sich und verbannte den Flakon schließlich in ihrem Wandschrank in die hinterste Reihe ihrer Fläschchen und Cremedosen, als hoffte sie, das Übel damit für immer beseitigt zu haben. Zumindest bis Vater sie wieder daran erinnern würde.
Mir gab sie mit ihrer Äußerung jedoch ein Rätsel auf. Als ahnte ich, dass sie mich aufgebracht und ärgerlich abweisen würde, vermied ich es, sie um dessen Lösung zu bitten und zu fragen, was „Puffmutter“ bedeutete. Ich hob mir meine Frage zunächst für meinen Vater auf, begriff aber noch rechtzeitig genug, dass er dann wissen wollte, woher ich das Wort kannte.
Dann hätte ich die Wahrheit gestehen müssen. Da ich aber sicher war, dass Mutter nichts Löbliches gesagt hatte, stiftete ich womöglich Unfrieden unter den beiden. Deshalb beschloss ich, das Rätsel selbst und ohne fremde Hilfe zu lösen, indem ich einen günstigen Augenblick abwartete und mir eins nach dem anderen von Vaters „schlauen Büchern“, wie er selbst sie bezeichnete, aus dem Regal fischte. Doch ich wurde enttäuscht: In keinem der väterlichen Nachschlagewerke konnte ich dieses Neugier weckende Wort finden. Vielleicht auch, weil ich es an den falschen Stellen suchte. Ich war Drittklässler und den Umgang mit diesen Büchern noch nicht gewöhnt. Erst viel später erfuhr ich völlig unvorbereitet seine Bedeutung,
Bis zu dieser Zeit trug ich die geheimnisvolle Ungewissheit mit mir herum, ein neues Wort zu kennen, das etwas Schlechtes bedeuten musste. Von dem ich nur ahnen konnte, dass es etwas mit süßlichem Parfüm zu tun hatte und dass, wer danach roch, eine Puffmutter war.
Mein Geheimnis Marie gegenüber preiszugeben, wie ich es manchmal gern getan hätte, brachte ich jedoch nicht fertig. Außerdem freute ich mich, etwas zu wissen, wovon sie keine Ahnung hatte. Es erschien mir als gerechter Ausgleich dafür, dass ich mich sonst für sie und ihren ausgeprägten Spieltrieb als Opfer zur Verfügung stellen musste.
Nun, mit Mutters Umhang über den Schultern, stieg mir der Geruch einer Puffmutter aufdringlich in die Nase und am liebsten hätte ich ihn heruntergerissen. Doch dann müsste ich befürchten, dass sich Marie sofort laut beklagen würde und damit Mutter das Signal sendete: Torvald kümmert sich nicht um mich!
Meine lange Mähne gelbblonden Haars, das mir bei meinen Mitschülern den Spitznamen „Löwe“ eingebracht hatte, legte, bürstete und schob meine Schwester mit ihren kleinen, kurzen Fingern zu unterschiedlichen Frisuren hin und her, für die sie jedes Mal sofort eine kühne Bezeichnung wusste, etwa „Prinzgemahl“ oder „Hexentöter“ - Namen, die sie aus den Märchenbüchern kannte, aus denen unsere Mutter manchmal vorlas. Zu „Rapunzel“ reichte jedoch selbst meine Löwenmähne nicht aus, was Marie sichtlich bedauerte. Wenn ihr eine Frisur besonders gelungen schien, hielt sie mir Mutters runden Spiegel vors Gesicht und forderte mit leuchtenden Augen mein Urteil heraus. Fiel es zu ihrer Zufriedenheit aus, nickte sie begeistert und rühmte sich lautstark als „beste Friseurin der Welt“, die nicht zu übertreffen sei. Drückte ich aber, je nach Laune, das Gegenteil aus, wurde sie sofort wütend und warf Kamm und Bürste auf den Fußboden.
„So ein knurriger und böser Kunde!“, rief sie, ein Wort unserer Mutter gebrauchend, die unseren Vater manchmal mahnte: ‚Sei nicht so knurrig im Haus, wenn dir in deinem Büro etwas daneben gegangen ist!“
Meine Schwester vergaß ihren Zorn aber gleich wieder, was mir als Beweis dafür schien, dass er hauptsächlich vorgetäuscht und gespielt war. Sie nahm ihren Kamm wieder auf und erfand sofort eine neue Frisur, ebenso den passenden Namen dafür. Dann nickte sie zufrieden, ehe sie linkisch abwinkte und meinte, sie könne es noch viel besser und danach nochmals von Neuem begann,/