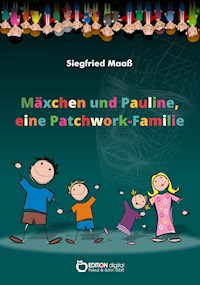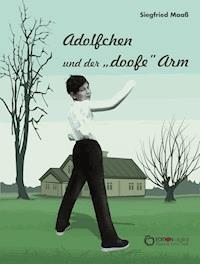7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Glückliche Jahre der Kindheit verbringt das Zwillingspaar Sebastian und Mathias gemeinsam mit Leonie, die anfangs der siebziger Jahre des letzten Jahrhunderts zu ihnen in die Siedlung am Rande einer ostdeutschen Kleinstadt zieht. Ihre Freundschaft soll ein Leben lang Bestand haben. Doch je älter die Brüder werden, desto deutlicher spüren sie, dass sich ihr Verhältnis zu dem jungen Mädchen verändert hat. Die bisher gesicherte Zusammengehörigkeit der Zwillinge erhält einen tiefen Riss, nachdem Leonie eine Entscheidung, trifft, die ebenfalls ein Leben lang Bestand haben soll.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 234
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Impressum
Siegfried Maaß
Federschnee
Roman
ISBN 978-3-95655-626-5 (E-Book)
Umschlaggestaltung: Ernst Franta
Das Buch erschien erstmals 2013 im Verlag Schumacher-Gebler, Dresden.
© 2016 EDITION digital®Pekrul & Sohn GbR Godern Alte Dorfstraße 2 b 19065 Pinnow Tel.: 03860 505788 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.edition-digital.de
DAS ZIMMER
1.
Thomas will kommen. Schon in den nächsten Tagen. Zum ersten Mal nach so vielen Jahren ...
Zuerst wollte ich es kaum glauben, war aber bald gern dazu bereit.
Ich weiß es von Grigori, seinem Freund. Für mich völlig überraschend stand der gestern Abend vor meiner Tür.
Zuerst hatte ich noch gehofft, mich verhört zu haben, als es klingelte und ich mir einbildete, der schrille Ton gehöre zum Film, den ich mir ausgesucht hatte. Wie für mich üblich und damit zu Neigung und Beruf passend, etwas Historisches. Aber diesmal sehr blumig sowie sentimental und wahrscheinlich hätte ich sowieso nicht bis zum Ende durchgehalten. Dann wäre ich wieder bei einer der vielen Natursendungen hängengeblieben, die mich jedes Mal erneut fesseln, sodass ich die Zeit darüber vergesse. Wie Thomas in früheren Jahren. Schon als Kind hatte ihn im TV nichts mehr als Filme und Reportagen über Natur oder Land und Leute begeistern können. Oft hatte ich in den letzten Jahren beim Betrachten solcher Filmbilder an ihn denken müssen und mir vorgestellt, wie er gebannt auf den Bildschirm starrt. Wie immer hat er dabei die Ellbogen auf die Schenkel gestützt und das Kinn mit seinen Händen umfasst, als schütze sich ein Boxer vor den Schlägen des Gegners.
Mit heftigem und hörbarem Atmen begleitete er dann das jeweilige Geschehen, als wäre er selbst unmittelbar daran beteiligt. Ganz besonders erregte ihn, wenn er auf diese Weise Zeuge menschlicher Brutalität im Umgang mit Wildtieren wurde.
Als würde es in diesem Augenblick geschehen, höre ich seinen entsetzten Protest, als er mit ansehen muss, wie eine Horde mit Äxten und Lanzen Bewaffnete einem Elefanten auf der Jagd nach dem kostbaren Elfenbein ans Leben geht, diesen mit ihren primitiven Werkzeugen regelrecht abschlachtet.
Empört und wütend rief er uns, damit auch wir diese Bilder der Gewalt zu sehen bekamen.
Warum er sich so etwas ansehe, wenn er sich darüber so errege, hatte ihn seine Mutter dann gefragt und schließlich geraten, beim nächsten Mal auf etwas Lustiges umzuschalten.
Aber als stehe er unter einem für uns unbestimmbarem Zwang, blieb er auch dieses nächste Mal wieder dabei und verfolgte das Grauen, das Menschen aus Eigennutz an Wildtieren begingen.
Er schlief danach unruhig und erwachte morgens mit Kopfschmerzen. Leonie nötigte ihm eine Tablette auf und bald fand er zu seiner gewohnten Aufmerksamkeit zurück und fühlte sich wieder wohl.
Die Strafpredigt mit der Drohung, ihm das Fernsehen endgültig zu verbieten, sparte sie für den Abend auf und fiel darum mäßiger aus, als von ihr am Morgen beabsichtigt.
Unsere Erwartung, dass Thomas sich für einen Beruf entscheiden würde, der seiner Neigung für Natur und Artenschutz entsprach, wurde enttäuscht. Noch nach dem mit »Gut« bestandenen Abitur hatte er sich für keine Studienfachrichtung entschließen können. Und eine spontane Entscheidung war von ihm nicht zu erwarten.
Doch dann wiederholte sich das Schrillen der Türklingel und riss meinen Gedankenstrang wie einen dünnen Faden ab. Ich musste mich aus meinem bequemen Sessel erheben. Bevor ich das Zimmer verließ, schaltete ich den Fernseher aus. Meine plötzliche Missstimmung der Störung wegen war sofort wieder verpufft. Im Grunde war mir jede Abwechslung angenehm. Das Alleinsein war mir noch nicht zur Gewohnheit geworden. Ich verweigerte mich dem Gefühl der Einsamkeit, indem ich noch mehr als früher las, als Leonie noch lebte. Oder ich spielte Schach gegen mich selbst und konnte mich fast nie entscheiden, ob ich für Weiß oder Schwarz Partei ergreifen sollte, weil ich meinte, neutral bleiben und jeden Zug ordnungsgemäß und folgerichtig ausführen zu müssen.
Ein sehr eitler Versuch des Selbstbetruges.
Die Schachfiguren erinnerten mich an meinen fünfzigsten Geburtstag. Obwohl Leonie zu dieser Zeit an den Folgen ihrer ersten Chemotherapie litt und sich psychisch wie physisch in sehr schlechtem Zustand befand, hatte sie die Kraft aufgebracht, die Figuren für mich zu beschaffen. Sie standen am Morgen meines Halbjahrhundertfestes auf dem Wohnzimmertisch, ein Strauß Winterastern daneben. Zwei schlanke weiße Kerzen gossen ihr Licht darüber und entwarfen ein festliches Bild.
Es war der geschickte Versuch einer Ablenkung sowie Selbsttäuschung. Die eingebildete Stimmung entsprach nicht unserer Befindlichkeit.
Auch das Match gegen mich selbst war nichts anderes als Selbstbetrug, ließ mich jedoch meine Trauer besser ertragen. Genau wie das Lesen. Oder auch meine Arbeit.
In der Schule hatte ich inzwischen für eine AG Stadtgeschichte geworben, gerade so wie ich einst als Schüler selbst an einer teilgenommen hatte. Leider blieb meinem Bemühen die erwartete und von mir erhoffte Beteiligung versagt. Schließlich gab ich mich damit zufrieden, mir selbst eine Pflicht auferlegt zu haben, die mir zusätzliche Beschäftigung und Ablenkung verschaffte. Freiwillig übernahm ich auch Vertretungsstunden, soweit es sich nicht um die Naturwissenschaften handelte. Der Direx musste nicht lange seine Stundentafel umstecken; hatte ich eine Freistunde, war ich stets bereit, einzuspringen.
Nun konnte ich mir nicht vorstellen, wer mich unangemeldet aus meiner Feierabendbequemlichkeit aufschreckte. Dann fiel mir aber meine junge Nachbarin ein. Vielleicht wollte sie wieder einmal ausgehen und mich bitten, nach dem Kind zu sehen? Wie schon öfter geschehen ...
Zu Leonies Zeit war so etwas nicht vorgekommen; die beiden grüßten sich und wechselten einige Worte übers Wetter und tauschten kurz Erfahrungen als Mütter aus - aber dabei ist es stets geblieben. Nach Leonies Tod hatte sie drei, vier Wochen vergehen lassen, bevor sie mich zum ersten Mal darum bat.
Besitzt sie so viel Einfühlungsvermögen, um meine augenblickliche Lage so treffend beurteilen und damit wissen zu können, dass sie mich auf diese Weise aus sinnloser Grübelei herausholen kann?
Einmal hatte ich mich dafür in ihr Wohnzimmer gesetzt und in einer Illustrierten geblättert und auf diese Art den neusten Klatsch erfahren, um den ich mich sonst nicht kümmerte. Ich wartete darauf, dass der Junge sich bewegte oder auch nur hüstelte oder irgendeinen anderen Laut von sich gab. Danach nahm ich ihn sofort vorsichtig auf den Arm und marschierte mit ihm durch die mir fremde Wohnung. Im Vorübergehen erklärte ich ihm, was wir sahen und wo wir uns befanden. Als wäre ich nicht Lehrer am Gymnasium, sondern Kindergärtner, einer von den wenigen.
Bis ich schließlich laut über mich zu lachen begann. Darüber erschrak der Junge und begann kräftig zu plärren, sodass ich Mühe hatte, ihn wieder zu beruhigen.
Früher hatte ich es mit Thomas ebenso gemacht, wenn Leonie nicht zu Hause war; mit dem Unterschied, dass Thomas damals bereits älter und vernünftiger war und sich selbst umsehen konnte und auch nicht plärrte, sondern munter nach diesem oder jenem zu greifen versuchte, sodass ich vorsichtig einen Bogen nach dem anderen schlug, damit er nicht etwas herunterriss. Ich hatte ihn zum ersten Mal gesehen, nachdem Leonie mit ihm zu mir gekommen war und er bereits laufen und die üblichen ersten Worte brabbeln konnte.
Jetzt freute ich mich auf den Abend als Bewacher des Jungen von gegenüber.
Bestimmt baumelte bereits das Schlüsselbund klingelnd in den Fingerhaken seiner Mutter, wenn ich öffnete. Dann wusste ich gleich Bescheid und sie konnte ganz entspannt ihre Verabredung wahrnehmen.
In dieser freudigen Erwartung riss ich ruckartig die Tür auf und die freundlichen Worte, mit denen ich die junge Frau begrüßen wollte, waren abrufbereit formuliert - aber dann stand ein bärtiger junger Mann vor mir und lächelte, als setzte er voraus, dass ich ihn kennen würde. Sein Bart rahmte das Gesicht von einem Ohr zum anderen. Etwas unsicher und verlegen knuddelte er seine Mütze in den Händen vor seinem flachen Bauch. Die Jeans waren ausgeblichen und abgewetzt, und bevor ich seine Erscheinung voreilig negativ bewertete, dachte ich an meine Schüler. So ist der Trend der Zeit. Und um in ihrem Jargon zu denken: Das ist cool! Gleichgültig, welches Elternhaus sie jeden Morgen verlassen. Glatte und nach meinem Empfinden untadelige Jeans waren verpönt.
Wer mochte der Bärtige sein? Vielleicht der neue Freund der Nachbarin, der mir in ihrem Auftrag den Schlüssel aushändigen sollte?
»Guten Abend, Herr Bechthold. Kennen Sie mich noch? Ich bin Grigori. Ein Freund von Thomas.«
Noch während er sprach, bemerkte ich seine kleinen Ohren an den Enden des Bartes und erkannte ihn daran. Wir hatten damals unsere Späße deswegen gemacht. Sein Haar war so kurz geschnitten, dass sie trotzdem sofort auffielen.
»Entschuldige«, sagte ich, »wenn es nicht gleich gefunkt hat bei mir. Aber der Bart ... Außerdem haben wir uns einige Jahre nicht mehr gesehen ... Damals warst du noch ein großer Junge ...«
Grigori also, der »Russe«, dessen Familie vor einigen Jahren uns gegenüber gewohnt hatte. Wenn ich mich richtig erinnere, waren sie aus Sibirien gekommen. Jedenfalls hatte Thomas, nachdem er ihn kennengelernt hatte, im Atlas die entsprechenden Seiten aufgeschlagen und auch anderswo nachgelesen, als wollte er einen Vortrag über Land und Leute halten. Am Liebsten hätte er uns beim Abendessen damit beglückt, aber Leonie ließ es nicht zu.
Ich ließ Grigori eintreten und führte ihn in mein Wohn- und Arbeitszimmer, wo eine Trennung des einen vom anderen nicht erkennbar ist. Ich überlegte, wann ich Grigori zum letzten Mal gesehen hatte. Dann wusste ich plötzlich, dass es am Abend jenes Tages gewesen war, an dem Thomas uns verlassen hatte. Uns - Leonie und mich. Getrieben von Enttäuschung und Wut.
Auch damals hatte Grigori plötzlich vor unserer Tür gestanden, um einige persönliche Sachen für Thomas zu holen, der sich inzwischen bei der Familie seines Freundes aufhielt.
Dieses unfreiwillige Aufeinandertreffen habe ich seitdem in unangenehmer Erinnerung.
Was hatte sein Kommen dieses Mal zu bedeuten? Oder trieb ihn einfach die Neugier, weil er sich zufällig in der Stadt aufhielt?
»Was führt dich denn zu mir? Thomas ist nicht hier ... Immer noch nicht. Leider. Ich weiß auch nicht, ob er sich noch einmal bei mir sehen lässt.«
Unbeholfen stand mein Besucher umher, sodass ich sagte: »Setz dich doch ...« Ich deutete zum Tisch und zog ihm zugleich einen Stuhl hervor. Dann setzte ich mich ihm gegenüber. Der Abendschein leuchtete ihn wie ein versteckter Scheinwerfer an.
»Ich weiß, dass er nicht hier ist.« Grigori lachte. »Er ist in Norwegen. Hoch im Norden. Ich soll Sie grüßen.«
Erstaunt blickte ich ihn an. Er soll mich grüßen ... Von Thomas.
Hatte sich unser Sohn etwa besonnen und sandte einen Boten aus, um es mich wissen zu lassen?
Ich hätte Grigori etwas anbieten müssen, aber ich bewegte mich nicht von der Stelle. Als hätte ich keine Gewalt über Willen und Wollen. Was bedeutete dieser unerwartete Abendbesuch?
»Nächste Woche will er kommen«, hörte ich Grigori sagen, als verkündete er mir etwas ganz Selbstverständliches.
Was geht heute Abend hier vor, dachte ich und versuchte, meinen Zweifel auszublenden. Warum sollte dieser junge Mann mir etwas verkünden, was nicht der Wahrheit entsprach?
»Sie können es glauben!«, sagte Grigori, nachdem er mir wohl meine Bedenken angesehen hatte.
Ich versuchte herauszuhören, ob er die frühere Diktion beibehalten hatte. Die jener Leute, die aus den weiten Gebieten Russlands gekommen waren, in denen die deutsche Sprache in der Nachfolge Katharinas zwar erhalten wurde, die Klangfärbung und Diktion des Russischen jedoch herauszuhören waren.
Aber Grigori war diese Herkunft nicht mehr anzumerken.
»Ihr seid also immer noch in Verbindung?«
»Die besten Freunde sind wir!« Grigori lachte. »Daran hat sich nichts geändert. Im Gegenteil! Ich bin bei ihm gewesen. Sogar einen ganzen Winter lang.« Er winkte ab. »Wie bei uns in Sibirien. Schnee bis unter das Dach. Morgens mussten wir uns manchmal ausgraben. Massen von Schnee. Den haben wir zur Küste hinunter gekarrt. Dabei vergingen jedes Mal Stunden. Aber die Zeit spielt dort keine Rolle. Es wird nie hell im Winter.«
Als er schließlich das Polarlicht beschrieb, schien es mir, als spiegelte es sich plötzlich in seinen Augen wider. So etwas Schönes hätte er vorher noch nie gesehen. Dafür würde er keine Worte finden. Manche Nacht habe er kaum geschlafen, weil er sich nicht vom Anblick dieses Naturereignisses lösen konnte.
»Ganz früh am Morgen sind dann wir rausgefahren zum Fischen. Heilbutt und Kabeljau ... Die Netze waren jedes Mal prall. Zum Glück esse ich sehr gern Fisch.«
Mir kam es vor, als genieße er noch nachträglich.
»Danach bin ich noch einmal dort gewesen. Zum Mittsommer. Das war angenehmer. Und sehr schön ... Sie verstehen es gut zu feiern. Ihre hellen Nächte. In bunten Trachten und mit Musik. Dazu haben sie getanzt. Auch Thomas. Wie einer von ihnen. Das kann ich nicht wieder vergessen.«
Seine Begeisterung schillerte mit jedem seiner Worte hervor und nichts ließ erkennen, dass er lediglich von seiner Erinnerung zehrte. Vielmehr konnte ich glauben, er berichtete etwas Unmittelbares, das er augenblicklich sah und erlebte.
Er ist bei Thomas gewesen. Ihre Freundschaft hat Bestand.
Schön für sie beide, dachte ich.
Ich wusste nicht, wohin ich blicken sollte, um zu verbergen, was in mir vorging.
»Er will wirklich zu mir kommen?«, fragte ich, noch immer zweifelnd.
Grigori nickte. Offensichtlich genügte ihm, es mir auf diese Weise nochmals zu bestätigen.
»Wo ist er eigentlich vorher gewesen? Ich meine damals, als er Zivi war?«, fragte ich und sprach aus, was uns seit Jahren beschäftigt hatte. Vergeblich hatten wir auf ein Lebenszeichen gewartet. Aber Leonies Enttäuschung und Groll sowie meine verletzte Eitelkeit hatten verhindert, dass wir ernsthaft etwas unternahmen, um seinen Aufenthaltsort zu erkunden. Erst von Norwegen aus hatte er sich bei mir gemeldet. Nach Leonies Tod. Von den Briefen, die er Leonie zuvor schon von dort geschrieben hatte, wusste ich damals noch nichts.
»Wo war er eingesetzt und wo hat er gewohnt? Weißt du auch darüber Bescheid?« Grigori nickte und lächelte. Etwas weise und herausfordernd zugleich, wie ich finde.
»Gewohnt hat er bei uns. Bei meiner Familie. In einer kleinen Stadt in der Eifel. Dort hatten wir alle Arbeit. Vater, Mutter, meine zwei Schwestern und ich. Anders als hier.«
Plötzlich stand mir eine Szene vor Augen, an die ich mich seitdem nicht wieder erinnert hatte: Der Möbelwagen vor dem Haus gegenüber ... Die ganze Familie schleppte Kleinteile und Koffer, während die stämmigen Transporteure sich die Möbel aufgeladen hatten und diese schließlich in den geschlossenen Wagen sperrten. Wie zuvor auf einer Zeichnung festgelegt, stellten, legten oder stapelten sie jedes Teil unverrückbar.
Ich weiß, dass ich damals gedacht hatte: Das sieht ganz nach einer sehr weiten Fahrt aus ... Dass ich damit richtig lag, bestätigte nun Grigoris Hinweis auf die Eifel.
»Aber wo leistete er seinen Dienst?«, wollte ich wissen. »Als Zivi. In einem Krankenhaus? Oder wo sonst?«
Grigori nickte. »Auf einer Kinderstation. Er war schon vor uns dort. Danach hat er dann bei uns gewohnt. War nur ein kleines Zimmer, aber er war ganz für sich ...« Grigori lachte wieder. »Wenn er schlafen musste. Sonst ...« Er hob die Schultern. »Er saß bei uns, ganz wie in Familie.«
Leonies Befürchtungen, dass der Junge irgendwo einsam und verlassen seine Zeit totschlagen müsste, wenn er nicht gerade im Dienst war, sind also völlig unnötig gewesen. Ich bedauerte, dass sie es nicht mehr erfahren hat.
»Im Krankenhaus,bei den Kindern, das hat ihm Freude gemacht. Aber manchmal war er sehr traurig, wenn ein Kind sterben musste ...« Wieder hob er die Schultern. »Als dann Schluss mit Zivi war, hat er sich verabschiedet und ist nach Norwegen getrampt.«
Grigori richtete sich auf, als wäre es ihm unbequem auf seinem Stuhl. Er zwirbelte seine Mütze, als müsste er unbedingt seine Hände bewegen. »Er kommt mit Meret. Ich soll Sie vorbereiten, sagt er.«
Ich war nicht so überrascht, wie Grigori wahrscheinlich vermutet hatte. Möglich, dass Thomas sich nicht erinnerte, das Mädchen in seinen Briefen an Leonie bereits erwähnt zu haben. Daher wusste ich es inzwischen.
Grigori sah mich erstaunt an. Wahrscheinlich hatte er absichtlich die Neuigkeit, an die er ja glaubte, bis zum Schluss aufgehoben und erwartet, dass ich vor lauter Überraschung nichts zu sagen wüsste.
Stattdessen sagte ich: »Es ist also ernst mit den beiden ...«
Grigori hatte sich wieder gefasst. »Sehr ernst ... Sie werden heiraten.«
In diesem Augenblick wusste ich tatsächlich nicht, was ich dazu sagen sollte. Bekam ich den Sohn zurück, um ihn sogleich wieder an dieses Mädchen zu verlieren? Dass er nur nach Hause kommt, um bald darauf wieder aufzubrechen?
Meret ... Sie hat sich Thomas gefischt, dachte ich und bemühte mich sogleich, diese Wortspielerei schnell wieder zu vergessen, die mir sehr kindisch erschien.
»Ist er jetzt Fischer, wie Merets Familie?«
Grigori nickte. »Mit Leib und Seele! Daran wird sich auch nichts ändern.«
Erst nach einigen Atemzügen begriff ich das Gehörte. Ich begriff es, wollte es jedoch nicht wahrhaben.
Offenbar bemerkte mein Besucher, was seine scheinbar nebensächliche Bemerkung bei mir bewirkt hatte.
»Tut mir leid!« Er streckte seinen Arm zu mir hinüber, ohne mich zu berühren. Ich verstand seine Geste als Entschuldigung. Auf diese Weise hatte er mir die Wahrheit nicht verkünden wollen. Aber nun ist sie gesagt. Thomas wird nicht bei mir bleiben.
Was sollte auch dieses Fischermädchen von einer kleinen Insel im Nordatlantik hier in unserer Gegend mit sich anfangen? Kinder großziehen? Anderes bliebe ihr kaum übrig. Aber sollte dies ihr Lebensziel sein? Ihres und Thomas’?
»Er freut sich, Sie wiederzusehen.« Grigori hatte seinen Arm zurückgenommen. Mit den Fingerspitzen betastete er die Tischplatte, als läse er eine Art Blindenschrift. »Er hat mir alles erzählt. Von Ihnen und seiner Mutter. Er will an ihr Grab.«
Grigori suchte meinen Blick. »Damals konnte er tatsächlich nicht kommen. Als es geschah, meine ich. Die Insel war eingeschlossen. Schnee überall. Aber er war auch noch nicht bereit. Das hat er zugegeben. Ich hoffe, er nimmt es nicht übel, dass ich jetzt mit Ihnen darüber spreche. Aber nun wissen Sie gleich Bescheid.«
Am späten Abend war ich wieder allein. Grigori musste am übernächsten Morgen pünktlich zur Arbeit. Er hatte eine lange Fahrt vor sich. Seiner Familie hatte er versprochen, sofort zurückzukommen. Sie warteten auf ihn. Vater, Mutter und Schwestern, die Zwillinge sind.
Wie Sebastian und ich, die Gestöber von Federschnee verursacht haben. Als Spiel.
Davon und dem, was folgte, sollte ich Thomas berichten. Vielleicht treibt ihn die Unruhe darüber, dass wir ihn so lange von der Wahrheit fernhielten, nach Hause? Um mehr über seine Familie zu erfahren? Aber zu spät, dachte ich, denn inzwischen ist seine Mutter am Krebs gestorben.
Nächste Woche kommt er. Mit Meret.
Ich halte es plötzlich in meinem Wohnzimmer nicht mehr aus. Als würden mich die Wände erdrücken. In der Küche trinke ich ein Glas Wasser, denn mein Mund ist so trocken, als hätte ich am ganzen Tag noch nichts getrunken. Danach laufe ich ins Schlafzimmer und bilde mir ein, etwas suchen zu müssen, das ich verlegt habe. Aber damit täusche ich mich selbst. Mein Blick fällt auf Leonies Bett, das die Tagesdecke verbirgt, und ich weiß nun, dass ich das Schlafzimmer aufgesucht habe, um vor ihrem Bett zu stehen. Wie so oft, wenn ich das Bedürfnis verspüre, Leonie etwas mitzuteilen. Oder sie um ihre Meinung oder ihren Rat zu bitten. Gleichgültig, wozu. So bin ich es gewöhnt gewesen und konnte mir diese Gewohnheit bisher nicht abgewöhnen.
Auch als sie nach ihrer ersten OP geschwächt die meiste Zeit im Bett zubrachte, habe ich ständig ihren Rat sowie ihre Meinung eingefordert. Weniger der Gewohnheit wegen, als sie spüren zu lassen, dass sie nach wie vor »das Heft in der Hand hat«. Damit verwendete ich einen Ausspruch ihrer Großmutter, den Leonie gelegentlich gebrauchte; ich wusste, dass es ihr gefiel, auf diese Weise an die alte Frau erinnert zu werden.
Ich fragte sie, was ich nach dem Schuldienst einkaufen sollte, worauf sie Appetit hätte. Dann würde ich mich an den Herd stellen und meine Kochkünste ausprobieren. Selbst wenn ich auch dabei noch ihre Zurufe herausfordern müsste. Auch um die Waschmaschine betätigen zu können und bei welcher Temperatur ich meine Hemden bügeln musste, benötigte ich ihre Ratschläge. Meistens wusste ich es wirklich nicht, aber ich fragte sie auch nach Dingen oder Handgriffen, die mir längst geläufig waren. Dass sie dann unwillig den Kopf auf ihren Kissen bewegte oder leicht abwinkte, störte mich nicht. Im Gegenteil, denn sie empfand sich dann ganz offensichtlich unentbehrlich. Und das war sie auch.
Lediglich unseren Sohn erwähnte ich nicht und war froh, wenn sie sich nicht erkundigte, ob er sich vielleicht gemeldet hätte.
Aber Thomas schien uns aus seinem Gedächtnis gestrichen zu haben.
Jetzt hat sich dein Sohn endlich besonnen, sage ich nun tonlos. Lange hat er dazu gebraucht. Aber nun will er kommen ... Auch zu dir ans Grab. Ich habe ihm damals eine SMS geschickt, damit er von dir wusste, von deinem Tod ...
Bestimmt bin ich vor lauter Erregung wieder rot im Gesicht. Ich atme heftig und spüre mein Herz rasen. Wie stets in solchen Situationen. Leonie war deswegen oft sehr besorgt. Doch geschickt gelang es mir, sie jedes Mal abzulenken und einen Arztbesuch damit zu verzögern. Aber sie vergaß es nie. Ich meine sie jetzt sagen zu hören: »Ich glaube, ich muss dich an die Hand nehmen und hinbringen.« Scheinbar empört fügt sie hinzu: »Was seid ihr Männer doch für Feighosen!« Sie lächelt.
Dieses Bild würde ich gern in mir speichern. Aber der Gedanke an Thomas’ bevorstehende Rückkehr und meine damit verbundene Verpflichtung, ihm die Lebensgeschichten seiner Mutter sowie seiner beiden Väter zu erzählen, lenkt mich von Leonie und meiner stummen Zwiesprache mit ihr ab.
Gedanken und Erinnerungen, Bilder und Vorstellungen mäandern wie ein verzweigter Flusslauf durch mein Gehirn. Als könnte Thomas’ Zimmer das Meer sein, in das die Gedankenströme münden, treibt es mich durch den Flur bis zu der seit Langem verschlossenen Tür. Vorsichtig, als müsste ich Widerstand erwarten, drehe ich den Schlüssel herum und drücke die Tür auf. Ein Streifen matten Lichts dringt vor mir in das Zimmer. Wie ein Zeigestock deutet er auf die Fensterfront und weist damit meinem Blick die Richtung.
Langsam gewöhnen sich meine Augen an das schattenartige Licht. Ich bin am Eingang stehen geblieben, als wäre ich unfähig, weiter zu gehen. Oder als hinderte mich ein unsichtbares Band, das Zimmer zu betreten. Faltenlos hängt die Übergardine herab und verdeckt die beiden Fenster wie ein Bühnenvorhang. Als verberge er mir eine Szene, die sich für eine spannende Handlung öffnen wird, sobald es Zeit dafür ist.
Der Vorhang ist Leonies Werk. Ihr hatte es so gefallen. Fast lautlose Flüche als Ausdruck ihrer Unzufriedenheit begleiteten ihre Handgriffe, die ihrem Ermessen nach ihren Zweck nicht erfüllten. Doch ausdauernd zupfend und richtend, verharrte sie auf der Leiter, bis der dichte Stoff herabfiel, wie sie es sich gewünscht hatte. Der halbe Nachmittag war darüber vergangen.
Längst hatte ich es aufgegeben, ihr meine Hilfe anzubieten. Ich war es gewöhnt, dass sie von mir weder Hilfe noch Rat annahm, wenn es sich um Tätigkeiten dieser Art handelte. Von Einrichtung und Raumgestaltung würde ich nichts verstehen, meinte sie lächelnd und lehnte meine »Einmischung« entschieden ab. Meistens vergaß sie bei Anlässen wie diesem auch nicht hinzuzufügen: »Dazu brauchst du doch einen Plan ...« Dann grinste sie und zwinkerte mir freundlich zu.
Und Thomas hatte sie gar nicht erst gefragt. Wahrscheinlich ist es ihm auch völlig gleichgültig gewesen. Ebenso gut hätte seine Mutter eine Scheibengardine anbringen oder die Fenster völlig ohne Schmuck und Sichtschutz lassen können. Wie in den drei Fenstern uns genau gegenüber. Damals.
Ohne sie jetzt zu erkennen, weiß ich, dass sich die Fensterflucht auf der anderen Straßenseite inzwischen genau wie meine präsentiert. Langweilig anzusehen, weil sich die jeweiligen Dekorationen kaum voneinander unterscheiden. Lediglich hinter einigen Fensterscheiben machen blühende Pflanzen in mehr oder weniger dekorativen Blumentöpfen auf sich aufmerksam. Doch selbst zu ihrer besten Blühzeit ließ nur eine einzige Orchidee ihre Blütenpracht sehen. Sie gehörten zu Leonies Lieblingsblumen. Nahezu sämtliche unserer Fensterbänke schmückten sie, und mit Sorgfalt pflegte Leonie »ihre Lieblinge« und verwehrte mir selbst das Gießen. Ich würde bestimmt zu viel des Guten tun, meinte sie mit einer Redewendung ihrer Großmutter, bei der sie ihre Kindheit verbracht hatte. Aber Orchideen würden zu vieles Wässern nicht vertragen.
Als hätten sie ohne Leonie nicht überleben können, gingen sie wie auf Verabredung binnen weniger Tage nach deren Tod ein. Enttäuscht entsorgte ich sie und seitdem herrscht in meinen Fensterbänken das blanke Nichts.
Den Fenstern jener Wohnungen gegenüber, in denen sich damals die »Russen« niedergelassen hatten, fehlte zu dieser Zeit jeglicher Schmuck. Ausdruckslos wie trübe Augen hatten sie gestarrt, scheinbar ohne irgendetwas wahrzunehmen.
In eine dieser Schwarzfensterwohnungen ist Thomas oft gegangen, um seinen Freund Grigori zu besuchen.
Daran muss ich jedes Mal denken, sobald ich an dem Haus vorübergehe und auf diese Fenster blicke. Von einer Straßenseite zur anderen haben die beiden fingerfertig mit Zeichen Informationen ausgetauscht und Verabredungen signalisiert. Einmal war ich zufällig hinzugekommen, erstaunt darüber, dass sich Thomas der »Fingersprache« bediente. Ich hatte keine Ahnung, dass er sie beherrschte. Wie ein Übersetzer für Taubstumme erschien er mir.
Ob er zugleich auch die Lippen entweder spitzte oder sie in die Breite zog, die Augen weit aufriss oder fest schloss, konnte ich nicht erkennen. Aber bereitwillig und dabei lächelnd gestand er es, nachdem ich ihn danach gefragt hatte. Ihm anschließend entlocken zu wollen, worüber sie sich in der Zeichensprache unterhielten, versagte ich mir. Ich hätte darauf auch keine Antwort erhalten.
Auch ohne sein überfallartiges Erscheinen zu später Stunde fühlte ich mich oft an Grigori erinnert. Seinen Anblick hatte ich so genau vor Augen, als wäre ich ihm erst neulich begegnet.
Ich hatte ihn als einen freundlichen Jungen in Erinnerung, an dem die zierlichen kleinen Ohren für mich am auffälligsten waren. Als wären sie seit seiner frühen Kindheit nicht mehr gewachsen.
Im Gegensatz zu ihm ist Thomas mit ausgesprochen großen Ohren ausgestattet.
Im Spaß bezeichneten wir sie als »Segelohren«, und ein Vergleich der beiden bot oft Anlass zu scherzhaften Bemerkungen. Ich weiß nicht, ob es sich bei Grigori ebenfalls um ein familiäres Erbe handelte wie bei Thomas. Mein verstorbener Zwilling Sebastian sowie ich selbst waren mit den großen Ohren unseres Vaters ausgestattet worden, die sich dann bei Thomas fortsetzten. Grigoris Eltern habe ich jedoch zu selten gesehen, um mir diese Frage beantworten zu können.
Jedenfalls sorgten die beiden oft für Witz und Spott, wenn sie bei uns gemeinsam am Tisch saßen.
Zum Glück fühlten sie sich nicht von uns ausgelacht; im Gegenteil: Sie lachten sogar am lautesten und heftigsten, sodass sich Grigori dabei an einem Bissen Kuchen verschluckte. Leonie war erschreckt hoch gesprungen, um ihm den Rücken zu klopfen.
Ob sich dieses Lachen sowie die Leichtigkeit auf der gegenüberliegenden Seite, hinter den schwarzen Fenstern, wiederholten, habe ich nie erfahren. Leonie und ich haben es immer vermieden, den stillen Jungen nach seiner Familie und deren Gepflogenheiten zu fragen, zumal uns Thomas gleich zu Anfang seiner Freundschaft mit dem »Russen« darum gebeten hatte. Diese neugierigen Fragen würden sie als Einmischung und Beleidigung empfinden, hatte er gemeint und sofort Beispiele dafür genannt. Sie wären Neusiedler aus Sibirien, die vor dem Gesetz Deutsche und damit uns gleichberechtigt sind und kämen nicht aus dem finstersten Winkel des Urwaldes, wie manche Leute böswillig behaupteten und gern hinzufügten, die Neusiedler hätten bleiben sollen, woher sie gekommen waren.
So deutlich ist er uns gegenüber geworden. Dabei waren Leonie und mir Gedanken dieser Art völlig fremd. Aber so ist er gewesen, unser Sohn: direkt und von Vorsätzen besessen, die er unumwunden vertrat. Darin ist er ganz nach seiner Mutter geraten.
Wir haben seine Worte respektiert und versucht, uns Grigori gegenüber so ungezwungen wie möglich zu verhalten.
Darum ist er stets gern zu uns gekommen, und wir haben ihn wie einen lieben Verwandten bei uns aufgenommen.
Einmal, ich glaube zum Kindergeburtstag, habe ich mit beiden am Ufer ein Zelt aufgestellt, das ich mir vom Hausmeister der Schule auslieh, nachdem ich mich zuvor der Genehmigung des Direx versichert hatte. An dieser Stelle war vom Fluss eine Landzunge gespült worden, die zu jener Zeit von Gestrüpp und anderem Wildwuchs vor Einsicht von der Straße aus geschützt war und die ich zufällig kurz zuvor entdeckt hatte. Thomas fühlte sich sofort wie Robinson und erklärte Grigori zu seinem Freitag, während ich ein leider notwendiger Butler war, für den Thomas keinen Namen wusste. So blieb es schlicht bei »Butler«, dem die Aufgabe zufiel, das Zelt zu richten und für Feuerung zu sorgen. Aber großzügigerweise gestattete Robinson, dass mich Freitag dabei unterstützte, sodass wir beide ausschwirrten, angeschwemmtes Holz sowie hartes Gestrüpp zu sammeln. Damit konnten wir das Feuer so lange genug in Gang halten, um unsere mit Speck gespickten Brotscheiben über den Flammen zu rösten.
Leider dauerte unser Abenteuer nicht lange, denn bald erschienen zwei Polizisten, die sich erkundigten, was wir unerlaubterweise veranstalteten. Aufmerksame Bürger, die von dem Rauch und Brandgeruch aufgeschreckt worden waren und sich außerdem belästigt fühlten, hätten sie benachrichtigt.
Wir brachen also unser Robinsonabenteuer ohne Reue ab und freuten uns noch lange über die schöne Stunde auf unserer Landzunge. Leonie war zwar erstaunt über unsere frühe Rückkehr,schien sich jedoch zu darüber zu freuen.
Mit Grigoris letztem Besuch verhielt es sich aber anders.
Unsere Stimmung war gedrückt. Thomas hatte uns verlassen, und um zu vermeiden, uns gegenseitig Schuld daran zuzuweisen, hatten Leonie und ich eine Wand aus Schweigen zwischen uns errichtet, die keiner von beiden einzureißen wagte.
Zuletzt hatte Leonie gemeint, bestimmt käme er bald zurück. Thomas sei weder stur noch uneinsichtig, aber ich konnte ihr nicht zustimmen und erreichte mit meinem Widerspruch, dass sie ausdauernd schwieg und mich nicht beachtete. Ganz offensichtlich verübelte sie mir, dass ich ihre letzte Spur Hoffnung gelöscht hatte.
In dieser Lage traf uns Grigori an, um Thomas einen Freundschaftsdienst zu erweisen. Offensichtlich war er sich bewusst, dass er bei uns damit nicht auf freundliches Entgegenkommen stoßen würde.
Etwas betreten, fast schüchtern war er im Flur stehen geblieben, während er bisher stets sofort in Thomas’ Zimmer gestürmt war, als fühle er sich hier wie zu Hause.
»Thomas ist nicht hier«, erklärte ich. »Aber du kannst trotzdem gern hereinkommen.«
»Ich weiß. Er ist drüben.« Ungeschickt deutete er mit einer Kopfbewegung in die Richtung, aus der gekommen war. »Bei uns.«
Inzwischen hatte sich auch Leonie zu uns gestellt und wiederholte nun die Einladung an ihn, hereinzukommen, doch Grigori ließ sich nicht davon beeindrucken. Umständlich und nach den richtigen Worten suchend, bat er uns, das Notwendigste für Thomas einzupacken, denn der käme nicht zu uns zurück. Vorläufig sei Thomas bei ihnen untergekommen, bis er irgendwann etwas für sich gefunden hätte. Außerdem würde ja seine Zeit als Zivi bald beginnen.
Seiner Aussprache mit dem fremden Akzent hatte ich immer gern zugehört. Dieses Mal konnte ich an ihr keinen Gefallen finden.
Noch heute sehe ich Leonie, wie sie mit verschränkten Armen vor Grigori steht und unentwegt den Kopf schüttelt. Entweder als Ausdruck ihres Unglaubens, denn dass ihr Sohn uns derartig straft, will sie nicht glauben. Oder weil sie meint, sie würde nichts für den Abtrünnigen einpacken.
»Warum kommt er nicht selbst?«, fragte ich und ahnte im Voraus die Antwort: »Er möchte nicht. Er sagt, dass er das ...« Dabei wies Grigori mit einer Kopfbewegung auf Leonie und mich, »... nicht verzeihen kann. Es tut ihm weh. Da drinnen.« Er pochte auf seine Brust.