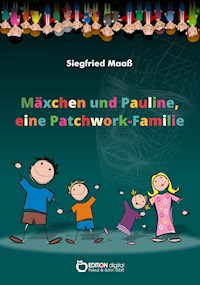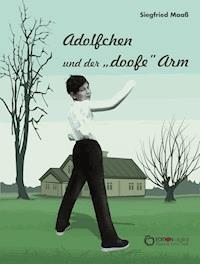7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Ein Junge tötet seinen Vater. Eine Nachricht, die zu anderen Gewaltnachrichten zu gehören scheint, die uns täglich erreichen. Beziehungen zwischen Menschen, Familienbindungen scheinen nichts mehr zu gelten, Werte verloren zu sein. Doch Siegfried Maaß zeigt, dass das Leben nicht so einfach ist. Gerade an der Tat, die scheinbar bestätigt, dass familiäre Beziehungen keine Basis mehr haben, weist er nach, dass ein Mensch zum Täter werden kann, gerade weil ihm noch Werte vermittelt wurden, er mit der Tat diejenige rettet, der er vertraut und die er liebt. Er hat einen realen Fall gewählt, um den Ursachen nachzuspüren, zu prüfen, ob das, was sich so in den Vordergrund drängt, das Bild bestimmt, auch die Wirklichkeit ist. Siegfried Maaß schreibt über Gewalt in der Familie. Es ist kein einfacher Stoff, aber so, wie er ihn behandelt, macht er Mut und Hoffnung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 244
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Impressum
Siegfried Maaß
Und hinter mir ein Loch aus Stille
Roman
ISBN 978-3-95655-638-8 (E-Book)
Umschlaggestaltung: Ernst Franta
Das Buch erschien erstmals 2000 im dr. Ziethen Verlag, Oschersleben.
© 2016 EDITION digital®Pekrul & Sohn GbR Godern Alte Dorfstraße 2 b 19065 Pinnow Tel.: 03860 505788 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.edition-digital.de
1.
Sie hat die Tür hinter sich geschlossen und mir die leeren Blätter zurückgelassen. Einen dicken Stapel weißer Blätter. Als Tapete könnte die Menge für die halbe Wand ausreichen. Für die Wand in diesem miesen kleinen Loch, wo sie mich schmoren lassen, um mich kleinzukriegen. Das einem kaum genug Luft zum Atmen lässt, weil das einzige Fenster, das sich fast unter der Decke befindet, dicht verschlossen ist. Kein einziger Laut kommt von außen an mich heran. Dieses Loch aus Stille heißt bei ihnen Verwahrraum.
Aber für mich bedeutet es: Freiheitsberaubung. Das Wort kenne ich von meinem Vater. Sie haben aber kein Recht dazu, mich hier einzulochen und darauf zu warten, dass ich schwarz wie Ötzi werde. Ich nicht! Eher sie selbst!
„Da kannst du aber warten, bis du schwarz wirst!“ Das ist so ein Satz von Herta für alle Gelegenheiten, wenn sie mich entweder abwimmeln oder mir klarmachen will, dass es nicht gibt, was ich gern möchte.
Wenn ich irgendwann etwas aufschreiben sollte, müsste ich ihnen dabei erklären, dass mit Herta meine Mutter gemeint ist Aber das wissen sie vielleicht schon.Wahrscheinlich wissen sie inzwischen alles und wollen nur, dass ich von mir aus sage, was ich weiß und sie gern hören möchten. Nämlich dass ich zugebe und gestehe, es getan zu haben. Sie wollen, dass ich mich selbst verrate. Oder Herta. Weil sie vielleicht doch noch im Dunkeln tappen?
Aber nichts werden sie von mir erfahren. Weil ich nämlich nichts sagen werde. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt schon einmal etwas gesagt habe. Ich habe keine Stimme. Deswegen kam die Frau mit dem Papierstapel. Als ich sie sah, musste ich gleich an die Nixe denken, die ich als kleiner Junge auf einem bunten Bild in einem Märchenbuch entdeckt hatte. Herta hatte es mir geschenkt und es stellte meine ganze Bibliothek dar. Sie versprach mir damals, manchmal daraus vorzulesen, und immer, wenn ich sie daran erinnerte, fiel ihr eine andere Ausrede ein, und sie vertröstete mich auf den nächsten Abend. Bis ich nicht nur auf sie, sondern auch auf das Buch wütend war und es zerfetzte. Nur das Bild der Nixe rettete ich und heftete es mit einer Reißzwecke an die Wand neben meinem Bett. Bevor ich einschlief, unterhielt ich mich mit ihr und beichtete ihr alle meine kleinen Geheimnisse. Sie konnte gut zuhören, wie niemand sonst, und wenn ich auch ihre Stimme nicht vernehmen konnte, so verstand ich ihre Antworten trotzdem. Sie klangen freundlich und verständnisvoll und ließen mich beruhigt und zufrieden einschlafen. Im Schutz der Nixe erwachte ich dann am nächsten Morgen und blinzelte zu ihr hinauf ...
So lange, bis mein Vater eines Tages das schöne Bild aufgebracht von der Wand riss und es zerknüllte. Er schimpfte Herta aus, weil sie es duldete, dass ich mir „Märchenfiguren“ hinhängte statt wie andere Jungen Fußballstars oder Rennfahrer.
„So wird nie ein richtiger Kerl aus ihm!“, schrie er, und ich starrte auf die Stelle an der Wand, von wo aus mir noch vor Kurzem die Nixe zugelächelt hatte.
Mein Vater wusste nicht, dass auch Herta das Bild an der Wand nicht gefallen hatte, doch aus einem anderen Grund - sie nahm es mir übel, dass ich das hübsche Buch zerrissen hatte.
Inzwischen hatte ich meine Nixe längst vergessen. Doch durch diese Frau werde ich wieder an sie erinnert. Natürlich hat sie keinen Fischschwanz, sondern im Vergleich zu Herta ziemlich lange Beine, die in engen Röhrenhosen stecken.
„Schreib einfach auf, was du erlebt hast und was du weißt. Das befreit, und dann kannst du auch bald wieder richtig Luft holen.“ Sie war schon an der Tür, als sie hinzufügte: „Und wenn du dich freigeschrieben hast, kannst du auch wieder sprechen. Danach reden wir dann über alles.“
Ich will aber nicht sprechen. Kein Wort. Ich bin sogar froh, keine Stimme mehr zu haben.
Ein dicker Stapel leerer Blätter. Vor mir auf dem Tisch. Und auch mehrere Stifte dazu. Die Nixe hat an alles gedacht.
Wenn ich eine Stimme hätte, könnte ich behaupten, nicht schreiben zu können. Aber sie wissen genau, dass ich es kann, denn ich habe meine alten Schulhefte bei ihnen gesehen, die sie aus unserer Wohnung mitgenommen haben. Wer weiß, wozu und warum. Haben ihnen vielleicht meine Geschichten gefallen, die darin aufgeschrieben sind?
2.
In der Schule werden sie bestimmt auch gewesen sein, um sich nach mir und meinem Verhalten zu erkundigen. Wenn sie dabei an Körner, den sturen grauen Esel geraten sind, haben sie nichts Gutes zu hören bekommen. Für den bin ich einfach nur ein fauler Schwänzer, der die Schule und die Lehrer für so überflüssig wie sonst nichts weiter im Leben hält. Für den jede Mühe, die die Schule ihm bereitet, umsonst ist, weil sowieso nichts aus ihm werden kann. So denkt Körner von mir. Das hat er mir auf den Kopf zugesagt.
Miss Betty wird jedoch gut für mich ausgesagt haben, Miss Betty, unsere Deutsch- und Englischlehrerin. Bei ihr beteilige ich mich gern am Unterricht, da schnipse ich schon mal mit den Fingern, weil ich die richtige Antwort weiß. Für Miss Betty sind wir keine wesenlosen Monster wie für Körner, die nimmt uns richtig ernst und macht trotzdem mal einen Spaß mit uns. Fragt auch nach unseren Vorstellungen vom Leben und unseren Wünschen. Von ihr werden sie erfahren haben, dass ich im Schreiben nicht schlecht bin, sogar über dem Durchschnitt liege.
Früher, noch in der Grundschule, als an Miss Betty noch nicht zu denken war, hat es mir immer am meisten Spaß gemacht, mir irgendeine Geschichte auszudenken. Das war eine Lieblingsidee unserer Lehrerin. Danach haben mich die anderen oft gefragt, ob ich das alles erfunden hätte oder ob es die Wahrheit wäre. Dass ich mir das alles ausdenken konnte, haben sie mir nicht zugetraut. Aber die Wahrheit?
Als ob es in Wirklichkeit vorkommen würde, dass eine Meute glitschiger Seehunde aus unserem schmutzigen Fluss heraufrobbt, dann über die Brücke patscht und den gesamten Verkehr lahmlegt. So war es nämlich in einer meiner Geschichten. Wohin man auch blickte - die Tiere glitzerten und glänzten im Sonnenlicht, als wenn die ganze Straße mit einer nassen Folie bespannt worden wäre. Langsam zog die Folie nun über Brücke und Straße und nahm einfach kein Ende.
Als ich mit meiner Geschichte begonnen hatte, wollte ich nur beschreiben, wie ein Rudel Seehunde durch unsere Stadt zieht und die Kinder sich über den ungewöhnlichen Anblick freuen. Die Mutigsten von ihnen liefen zu den Tieren, um sie zu berühren. Andere aber rannten kreischend davon und blieben erst in sicherer Entfernung stehen, um sowohl die Seehunde wie auch die mutigen Kinder zu bestaunen. Es sollte ja auch eine Geschichte zum Staunen werden. Die man eben gern liest, weil etwas geschieht, das nicht alltäglich ist. Aber plötzlich kam es mir in den Sinn, die Menschen böse und angriffslustig zu machen, weil sie sich über die verstopfte Straße ärgerten und deshalb wütend über die Tiere herfielen. Grausam schlachteten sie die Seehunde ab und zogen ihnen schließlich die Felle über die Ohren, und Brücke und Straße glichen hinterher einem einzigen großen Blutmeer.
Ich weiß noch ganz genau, wie mein Herz zum Hals hinaufschlug, als mich Frau Ruda, unsere Lehrerin, aufrief, weil ich meine Geschichte allen vorlesen sollte. Ihr Gesicht verriet mir leider nicht, was ihre Absicht dabei war. Hielt sie, was ich aufs Papier gebracht hatte, für so gut, dass es unbedingt jeder hören sollte?
Erst als sich am Ende meiner Geschichte die Mädchen fröstelnd über die Arme strichen, als ob es mitten im Sommer eiskalt in der Klasse wäre und die Jungen sich hinter ihrem merkwürdigen Lachen wie hinter einem Schutzschild verkrochen, sah ich wieder in das Gesicht der Lehrerin — es war zu einer leblosen Maske erstarrt.
Ich sollte danach unbedingt erklären, weshalb ich die Geschichte so grausam hatte enden lassen.Warum ich den „hübschen Einfall“ nicht genutzt hätte, daraus eine lustige Geschichte über Seehunde in der Stadt zu erzählen, in der sich die Menschen an den ungewöhnlichen Besuchern erfreuen.
Ich wusste es selbst nicht. Die Geschichte war so geworden.
Seit dieser Zeit behandelte mich Frau Ruda anders als bisher. Mir kam es vor, als beobachte sie mich andauernd. Ob sie vielleicht glaubte, dass ich selbst so sein würde wie die Menschen in meiner Geschichte und mit einem Knüppel umherlief und auf alle Tiere einschlug, die mir über den Weg kamen?
Dann vergingen einige Wochen, ehe sie uns wieder eine Geschichte schreiben ließ. Dieses Mal sollte es eine „Lügengeschichte“ werden. Jeder durfte darin so viel lügen, wie er wollte und konnte. Der Witz bestand letzten Endes darin, dass die, die sich sonst als die größten Lügner und Aufschneider hervortaten, dabei am schlechtesten abschnitten. Dazu, sich eine richtig gute Lügengeschichte auszudenken, die man sich gern anhörte, reichte es bei ihnen nicht.
Ich hatte mir eine Geschichte ausgedacht, in der ich mit einem selbst gezimmerten Floß den Fluss hinunterfahre, weil ich davon gehört hatte, dass in der nächsten Stadt, die unser Floß erreicht, ein Markt stattfindet. Ein ganz besonderer Markt, auf dem man sich, ganz wie man wollte, Vater oder Mutter kaufen konnte. Beide zusammen nicht, das war Bedingung. Jedenfalls bekam man sie im Zweierpack nur, wenn man den Händler ausreichend bestach. Oder man schickte einen anderen, der die fehlende Hälfte erwarb und einem anschließend brachte.
Aber darüber zerbrach ich mir nicht den Kopf, denn ich hatte ja Herta zu Hause und brauchte keine andere Mutter.
Der Fluss trieb mein Floß schnell voran. Das war auch gut und wichtig, weil ich gern auf dem Markt sein wollte, bevor die besten Väter schon ausgesucht waren.
Während ich also auf meinem Floß stand und mit der langen Stange etwas nachhalf, um die Strömung gut auszunutzen, überlegte ich, wie ich mir den Vater, den ich mir aussuchen wollte, eigentlich vorstellte. Ich fand aber nicht das richtige Wort dafür, und später erklärte meine Lehrerin dann, dass ich wahrscheinlich an sanft gedacht hätte. Aber dieses Wort kannte ich damals überhaupt nicht.
Es gefiel mir jedoch sehr gut, weil es mich an Samt erinnerte, und der ist sehr schön weich. Als kleiner Junge habe ich mein Gesicht immer gern in das Samtkissen gedrückt, das bei uns in der Stube auf der alten Couch lag, die Herta geschenkt bekommen hatte.
Ob ich mir aber einen weichen Vater aussuchen wollte, weiß ich nicht. Vielleicht einen, der nicht gleich losschreit, wenn ihm am anderen etwas nicht gefällt. Der freundlich und leise sein kann und trotzdem genau weiß, was er will.
So trieb ich mit dem Floß dahin und erreichte irgendwann mein Ziel.
Auf diesem Markt roch es nicht wie sonst auf Märkten nach Äpfeln oder gebratenen Würsten, und keine Schlagermusik dröhnte in den Ohren. Es standen auch keine bunten Buden dort, sondern nur einfache Podeste, auf denen die Verkäufer die Mütter oder Väter anboten, die noch übrig geblieben waren. Sie versuchten, sich gegenseitig zu übertönen, sodass ich kaum etwas verstehen konnte.
Ziellos und suchend lief ich umher. Aber die besten Väter schienen längst vergeben, und unentschlossen schob ich mich durch die anderen Kinder hindurch und hoffte, vielleicht doch noch einen Vater für mich zu entdecken.
Der eine Händler versuchte mir einen Mann anzupreisen, der genau wie er selbst aussah, sodass ich annehmen musste, ein Zwilling wollte den anderen verkaufen. Am meisten fielen bei ihnen der kugelförmige Bauch und die kurzen dicken Beine auf, die mich an Hertas eingelegte Gurken erinnerten. Die Finger der Männer waren dick und prall wie Würste. Beide Kerle sahen so aus, als hätten sie noch nie gern gearbeitet.
Auf solch einen Vater konnte ich gut verzichten.
Ein anderer sah mich von seinem Podest herab mit glasigen Augen an, die mir verrieten, dass er bereits jetzt, am zeitigen Vormittag, einen kräftigen Schluck aus der Flasche genommen hatte. Auch der kam für mich nicht infrage. Den einen wie den anderen Typen hatte ich in der Person meines Vaters bei mir zu Hause.
Schließlich folgte ich den lockenden Worten eines dunkelhaarigen Verkäufers, der auf seinen VATER wies, der hinter ihm auf einem wackeligen Podest stand, wie die anderen auch ein Pappschild mit Namen und Preis vor der Brust, und der mir zulächelte.
Er hieß Kurt und kostete mehr, als ich ausgeben konnte und wollte. Weder sein Aussehen noch seine Statur waren so, wie ich es mir vorgestellt hatte, und außerordentlich kräftig schien er auch nicht zu sein. Wahrscheinlich gehörte er deshalb zu den Übriggebliebenen. Aber dass er mich anlächelte und mir aufmunternd zunickte, als wollte er sagen: Du gefällst mir, Junge, und mit mir machst du einen guten Kauf!, erleichterte mir meine schnelle Entscheidung. Ein Vater, der lächeln und mit den Augen zwinkern konnte, musste der richtige für mich sein.
Ich gab dem Händler darauf zu verstehen, dass ich zu dem Geschäft bereit wäre und nannte ihm mein Angebot. Der Mann schien sehr erstaunt, dass ich so gut zu handeln verstand und gab nach einigem Feilschen endlich nach, sodass ich zufrieden den Markt verließ, Kurt, meinen neuen Vater, an meiner Seite.
Als ich ihn zum Fluss hinunterführte und auf das Floß wies, blieb Kurt überrascht stehen. Ungläubig blickte er mich an, seinen Finger auf das Floß gerichtet. Ob ich ihn vielleicht umbringen wollte, fragte er und gestand sogleich, Nichtschwimmer zu sein. Wir sollten doch lieber mit der Eisenbahn fahren, wenn ich schon kein Auto besitzen würde. Darauf lachte ich ihn aus. Seit wann denn Jungen wie ich, die noch in die Schule gingen, Autos besitzen würden, erwiderte ich. Außerdem würde er bei uns überhaupt keinen Luxus vorfinden, darauf sollte er sich schon jetzt einstellen. Der einzige Luxus, den ich mir leisten würde, sei er selbst — ein freundlicher und lächelnder Vater.
Endlich stand er dann neben mir auf dem Floß, und seine Hand krampfte sich um meinen Arm, sodass ich kaum die Leine von dem Baum lösen konnte, der gleich neben dem Ufer wuchs.
Nachdem ich das Floß dann in Schwung gebracht hatte, entdeckte ich, dass es in die falsche Richtung trieb. Ich hatte einfach nicht daran gedacht, dass es von sich aus nicht stromauf fahren würde.
Was sollte ich tun?
„Wohin bringst du mich?“, fragte mein neuer Vater und blickte ängstlich von einem Ufer zum anderen.
Unser Floß gewann immer mehr an Fahrt, und bald hatten wir die Stadt hinter uns gelassen. Kurt wiederholte seine Frage. Ich antwortete, dass ich es leider nicht wüsste, weil wir in die entgegengesetzte Richtung trieben.
„Nicht dorthin!“, sagte Kurt. „Dort bin ich lange genug gewesen, dort gefällt es mir nicht mehr. Ich möchte flussaufwärts.“ Er zeigte hinter uns, wo die Schlote und Türme der Stadt nur noch wie Streichhölzer aussahen. Als ich wissen wollte, weshalb er von dort, woher er kam, weggelaufen sei, schwieg er, und auch meine erneute Frage ließ er unbeantwortet. Wahrscheinlich durfte er nicht darüber sprechen. Von seinem freundlichen Gesicht, das mich verführt hatte, mich für ihn zu entscheiden, war längst nichts mehr zu bemerken. Vielmehr war ihm seine Angst anzusehen, die sein Gesicht verzerrte. Hatte ich mir nun einen Vater zugelegt, der gleich Schiss hatte, wenn er nur in die falsche Richtung fuhr? Ich hatte mir jedoch einen gewünscht, der zwar leise und freundlich, aber trotzdem bestimmend und führend sein würde.
War meine Entscheidung falsch? Konnte ich ihn vielleicht bei dem schwarzhaarigen Händler umtauschen, wenn sich tatsächlich herausstellen sollte, dass er ein Fehlgriff war?
Plötzlich hörte ich Kurts Schrei, und wieder spürte ich seinen derben Griff an meinem Arm. Mit der anderen Hand wies er nach vorn - da entdeckte ich den Grund seines Entsetzens: Ein Wehr befand sich unmittelbar vor uns, auf das wir mit großer Geschwindigkeit zutrieben. Bevor ich wusste, was ich tun könnte, erfasste uns ein trichterförmiger Strudel und riss das Floß herum, sodass wir einen Augenblick lang hoffen konnten, in die gewünschte Richtung zu fahren. Doch schon mit dem nächsten Lidschlag wurden wir vom Floß geschleudert ... Als ich kurz vor dem Wehr aus dem schäumenden Wasser auftauchte, sah ich Kurts Hände vor mir. Mir kam es vor, als winkte er mir zum Abschied. Danach habe ich ihn nicht mehr gesehen ...
Damit endete meine Lügengeschichte. Ich musste sie wieder vor der Klasse vorlesen, und auch die Aufforderung Frau Rudas, sie zu erklären, folgte ebenso wie beim vorigen Mal, als ich die Seehunde sterben lassen hatte.
Aber ich hatte auch diesmal nichts zu erklären oder hinzuzufügen. Es war eben so geschehen in meiner Lügengeschichte. Da konnten sie reden, soviel sie wollten: Ich hatte weder an einen Sklavenmarkt noch an Rache an den Vätern gedacht. Die Geschichte war einfach so in mir entstanden, da konnte und wollte ich nichts erklären.
Damit musste sich auch Frau Ruda zufriedengeben.
Nur ich selbst war nicht zufrieden, weil ich nun nichts über meinen neuen Vater erfahren hatte. Alles, was er hätte berichten können, war mit ihm im Fluss versunken. Darum nahm ich mir vor, bald noch einmal von diesem seltsamen Menschenmarkt zu berichten. Dann sollte der Vater, den ich mir aussuchte, überleben. Diese Geschichte von dem guten Vater, mit dem ich glücklich und zufrieden war, habe ich jedoch nie zustande gebracht, weil Frau Ruda immer wieder neue Gelegenheiten und Themen fand, an denen wir unsere Fantasie erproben sollten. Aber meine Geschichten gerieten immer ganz anders, als meine Lehrerin und auch ich selbst erwartet und gewünscht hatten. Deswegen trugen sie mir kaum einmal Lob und Anerkennung ein.
Als diese Zeit endgültig hinter mir lag, war ich ebenso wie die anderen aus der Klasse froh darüber, obwohl ich, im Gegensatz zu ihnen, Spaß daran gehabt hatte. Aber ich hätte es einfach nicht länger ertragen, dass sie mir „Märchenerzähler“ oder „Lügenbaron“ nachriefen. Noch schlimmer war es, dass ich immer als einziger übrig blieb, wenn Fußballmannschaften gewählt wurden. Dann musste ich mir auch noch gefallen lassen, dass mir die von ihren Mannschaftsführern Gewählten zuriefen: „Lauf doch auf deinen blöden Markt und stell dich aufs Podest! Vielleicht nimmt dich dann einer!“
Ob die Nixe weiß, dass ich früher gern „gesponnen“ habe? Vielleicht hat sie es von Miss Betty erfahren, der ich es selbst erzählt und ihr auch meine Hefte gezeigt habe.
Warum fällt mir das erst jetzt ein?
Ich hätte der Nixe einfach die leeren weißen Blätter vor die Füße werfen sollen. Will mich herauslocken aufzuschreiben, was ich nicht aussprechen will. Da hat sie sich geirrt!
Nie wieder werde ich ein Wort sprechen und nie wieder eins schreiben! Außer dem Spott meiner Mitschüler hat mir das Schreiben damals auch zu Hause nur Schaden und Ärger eingebracht. Als die Lehrerin nämlich darauf bestand, dass Herta oder mein Vater meine Lug- und Truggeschichten mit den Noten, die sie in Rot darunter gemalt hatte, unterschrieben. Herta rollte mit den Augen wie immer, wenn ihr irgendetwas nicht gefiel oder sie nicht verstand, wovon gesprochen wurde oder was sie gerade las.
„Das sind doch alles Lügen!“, meinte sie, und es konnte nicht ausbleiben, dass sie wieder einen ihrer Sprüche nachschickte: „Lügen haben aber kurze Beine!“ Sie schlug das Heft zu, obwohl sie vergessen hatte, ihr „Möhwald“ darunter zu schreiben. Dann fragte sie, warum ich mir so etwas „zurechtdenken“ würde.
Ich ging hinaus, ohne ihr zu antworten.
Ausgerechnet dieses Mal wollte auch mein Vater wissen, welche Noten mir die Lehrerin „verpasst“ hätte. Sonst scherte er sich kaum um Schule und was damit zusammenhing. Ich glaube, die Schule sah er nur als sinnlose Zeitverschwendung an.
Er wurde sofort rot vor Wut, nachdem er meine Geschichte zu lesen begonnen hatte. Er schluckte heftig, ich sah seinen dicken Knorpel im Hals zucken und ahnte bereits, dass es nichts Gutes für mich bedeutete.
Es war, als hätte ich in diesem Augenblick wieder eine neue Geschichte erfunden — diesmal von einem Vater, der zufällig in das Schulheft seines ältesten Sohnes sieht und dabei entdeckt, was dieser sich ausgedacht hat. Irgendwie fühlt sich der Vater getroffen. Warum zieht sein Sohn auf einen Markt, um sich einen anderen Vater auszusuchen? Der Vater schreit seinen Sohn an und stellt seine Frage, auf die der Sohn keine Antwort gibt. Dann fleddert er das Heft auseinander und gibt sich erst zufrieden, nachdem er die Schnipsel wie Bettfedern um sich verstreut hat. Langsam beruhigt er sich danach wieder. Die Geschichte, in der er sich verraten und angeklagt fühlte, gibt es nicht mehr. Er atmet auf. Doch ungestraft darf der kindliche Verfasser der Geschichte nicht davon kommen ...
Mein Vater, der sich sonst immer wie ein Haken krümmt, weil er mit seiner Körpergröße nicht zurechtkommt und wahrscheinlich Angst hat, mit dem Kopf irgendwo anzustoßen, richtete sich zu seiner ganzen Länge auf. Das war verdächtig. Doch bevor ich Zeit fand, auch nur an Flucht zu denken, griffen seine langen Finger wie eine Zange in mein Genick. Er duckte mich und schleppte mich dann auf diese Weise vor den Kühlschrank. Herta wollte uns den Weg versperren und rief: „Du tust ihm doch weh! Lass ihn sofort los!“
Aber er schob sie mit dem abgewinkelten Ellenbogen zur Seite. „Halts Maul!“, schrie er so laut,dass er im ganzen Haus zu hören sein musste. Aber darum kümmerte er sich nicht. „Mach ihn auf!“, befahl er mir dann, und anschließend stieß er meinen Kopf so weit wie nur möglich in den Kühlschrank hinein.
Herta hatte am Vormittag eingekauft, und der Geruch frisch geräucherter Wurst stieg mir verführerisch in die Nase.
„Los, riech!“
„Ich rieche ja“, sagte ich. „Es riecht gut nach Wurst.“
„Ich will es aber hören!“
Ich schnüffelte und sog hörbar den Geruch ein, bis mir fast übel wurde.
„Hast du jetzt Appetit?“, fragte mein Vater hinter mir und lockerte endlich seinen derben Griff.
„Ja“, erwiderte ich schnell, „ganz bestimmt.“
Er ließ mich endgültig los, und ich zog meinen Kopf aus dem Kühlschrank. Herta wollte sich jetzt schützend vor mich stellen, aber mein Vater ließ es nicht dazu kommen. „Hau ab!“, schrie er sie an. Doch sie steckte nur wimmernd die Hände in die Achselhöhlen und wich nicht von der Stelle, obwohl mein Vater seinen Befehl wiederholte.
Meine Geschwister hatten sich längst in ihre Zimmer verzogen; schließlich mussten sie aus Erfahrung damit rechnen, dass auch sie im Eifer des Gefechts (das ist wieder ein Spruch meiner Mutter) etwas von der Wut und dem Jähzorn meines Vaters abbekommen würden. Dieses Mal sollte es jedoch anders kommen.
So wie ich mir damals meine Geschichten ausdachte, so ließ sich auch mein Vater immer wieder neue Spielarten einfallen, um entweder Herta oder uns Kinder zu bestrafen.
Er rief die zwei zu sich, und nachdem sie sich wie gehorsame Soldaten vor ihrem Offizier vor ihm aufgebaut hatten, befahl er ihnen, den Kühlschrank zu öffnen. Dann ließ er sie, einen nach dem anderen, hineingreifen. Sie sollten sich so viel Wurst und Käse nehmen, wie sie wollten.
Dazu musste er sie kein zweites Mal auffordern, und bald standen sie, die Hände voller Wurst und Käsescheiben, kauend vor mir.
„Siehst du, wie es ihnen schmeckt? Die haben nämlich den Vater, den sie sich wünschen, der sie nicht verhungern lässt.“
Nun winkte er Herta heran, die noch lauter wimmerte, seit sie mit ansehen musste, wie ihr Vorrat, der für Tage gedacht war, in wenigen Minuten zu einem kläglichen Rest schrumpfte. „Jetzt du!“, kommandierte mein Vater. „Der Rest ist für dich!“
Sie schüttelte zwar den Kopf, aber als er sich bedrohlich neben sie stellte, stopfte sich Herta die übriggebliebenen Wurst- und Käsescheiben hastig in den Mund. Sie würgte, und gleich darauf lief sie zum Klo, und wir alle konnten dann mit anhören, wie sie sich übergab.
Meinen Vater schien das aber nicht zu stören. „Hast du Hunger?“, fragte er mich, und trotzig schüttelte ich den Kopf. Weil es jedoch so aussah, als wollte er mein Genick gleich wieder zwischen seine Zangenfinger spannen, nickte ich darauf sofort.
„Dann hau ab und such dir was!“ Er wies zur Tür. Ich blieb aber stehen, weil ich nicht wusste, ob er mich wirklich wegschicken wollte, damit ich mir irgendwo etwas zum Essen beschaffte. Er meinte es aber tatsächlich ernst, und selbst wenn ich an diesem Abend freiwillig ohne Essen ausgekommen wäre, hätte ich keine Möglichkeit gefunden, mich gegen seinen Befehl aufzulehnen. Er bestand darauf, dass ich sofort die Wohnung verließ und erst wieder zurückkam, nachdem ich etwas „beschafft“ hatte.
„Und komm ja nicht wieder, ohne für deinen Vater etwas dabei zu haben!“, sagte er und hob drohend den Finger.
Herta, die völlig erschöpft und blass aus dem Bad zurückkehrte, wollte mich im Flur aufhalten, doch ich rannte an ihr vorüber und warf die Tür hinter mir zu. Glaubte mein Vater vielleicht, ich könnte mir tatsächlich nicht selbst etwas zu essen besorgen? Ich kannte in der Umgebung genügend Jungen, die mir ‘ne Scheibe Brot und ‘ne Büchse Cola hinausreichen würden, wenn ich bloß bei ihnen anklopfte.
3.
Die Tür wird leise geöffnet, und die Nixe kommt herein. Ihre langen Beine stecken in engen Bluejeans, die wie Röhren aussehen. Das blonde Haar reicht bis auf die Schultern und ist zu vielen Korkenzieherlocken aufgedreht. Ich bemerke, dass ihr Blick sofort auf die leeren weißen Blätter gerichtet ist Sie sind noch genauso aufgeschichtet, wie sie sie selbst vor einigen Stunden hingelegt hat. Auch die Stifte bilden noch den gleichen wirren Haufen - als wenn Mikadostäbchen schlecht aus der Hand gefallen wären.
Da kannst du warten, bis du schwarz wie Ötzi bist, denke ich und sehe ihr in die Augen. Sie hält meinem Blick stand und zeigt nun sogar ein freundliches Lächeln.
„Weißt du nicht, wo du beginnen sollst?“, fragt sie und weist auf die unbeschriebenen Blätter. „Denk doch einfach, du wärst wieder der Junge von früher, der eine Geschichte schreiben will.“ Sie lacht auf. „Aber diesmal darf es keine Lügengeschichte sein. Ich habe mir nämlich berichten lassen, dass du die besten Lügengeschichten von allen geschrieben hast.“ Mit den Fingerknöcheln klopft sie auf das Schreibpapier. „Laden dich die schönen weißen Seiten nicht ein, aufzuschreiben, was wirklich gewesen ist? Ich will dir doch helfen. Darum muss ich wissen, weshalb ihr als Familie nicht friedlich miteinander leben konntet.“
Die Nixe kommt um den Tisch herum, der mir so lange als Barriere diente, und so weit ich kann, weiche ich vor ihr zurück. Hinter mir spüre ich die harte kühle Wand und wünsche mir, jemand zu sein, der durch die Wand gehen kann.
„Sieghart, denk’ doch mal darüber nach, wie alles begonnen hat. Vielleicht reicht es, wenn du dir zuerst nur ein paar Notizen machst. Dann kommt die Erinnerung wie von selbst. Glaub mir, ich weiß das aus Erfahrung."
Aus Erfahrung ...Wofür hält sie mich denn? Glaubt sie etwa, ich wäre so ein geistiger Blindgänger, der erst hochgeht, nachdem er lange genug bearbeitet wurde? Meine Erinnerung ist völlig in Ordnung, da muss ich keine Notizen machen, um sie in Gang zu setzen.
Aus Erfahrung ... Auch ich habe meine Erfahrungen gemacht, und nicht zu wenig. Aber das weiß sie, und gerade darum ist sie so neugierig. Meine Erfahrungen will sie nämlich unbedingt herausfinden. Das ist ihre Aufgabe, dafür wird sie vom Staat bezahlt. Aus lauter Spaß macht sie das nicht. Wer sucht sich schon aus Vergnügen einen Job wie diesen, nicht anders als im richtigen Knast? Wer hat schon Spaß daran, Typen wie mich wie reife Zitronen auszuquetschen?
Mich quetscht sie nicht aus, die Nixe nicht Ich spreche nicht, und ich schreibe nicht. Die Zeit, in der ich aus Spaß Geschichten aufschrieb, ist lange vorüber. Und meine eigene Geschichte würde sich wahrscheinlich genau wie eine meiner Lügengeschichten von früher anhören.Vielleicht würde die Nixe danach ebenso wie meine Mitschüler damals zweifelnd fragen: Ist die nun erfunden oder ist das alles Wirklichkeit?
Wie und wann alles begonnen hat? Das weiß ich ziemlich genau. Als mein Vater Herta zum ersten Mal geschlagen hat. Das ist keine Lügengeschichte, sondern die reine Wahrheit.
4.
Sie hatten sich wieder einmal ums Geld gestritten, was bei uns bald jeden Tag vorkam. Dann warf der eine dem anderen vor, entweder zu viel ausgegeben zu haben oder nicht richtig rechnen zu können. Damals waren beide schon einige Monate arbeitslos, und wir Kinder mussten uns damit abfinden, dass nur die wenigsten unserer Wünsche in Erfüllung gingen.
Wahrscheinlich war das an diesem Tag auch der Grund für ihren Streit.
Ich hatte Herta nämlich davon erzählt, dass man mich in der Schule ausgelacht hatte. Diesmal nicht wegen irgendeiner erfundenen Geschichte, sondern weil ich angeblich Klamotten aus der Altkleidersammlung auf dem Leib trug. Ich hatte eben keine Markenjeans wie die anderen an, und auch meine T-Shirts waren nicht von der teuren Sorte. Von den Schuhen will ich gar nicht erst reden. Darüber machten sie sich lustig. Zuerst wollte ich deswegen wütend um mich schlagen.Aber weil sie so viele waren und mich auf dem Pausenhof richtig eingekreist hatten, sodass ich immer einige von ihnen im Rücken hatte, egal, wie ich mich auch drehte, gab ich meinen Plan auf und versuchte, mir einen Durchschlupf zu verschaffen. Sobald ich jedoch in ihre Nähe kam, öffneten sie selbst ihren Kreis, als wollten sie auf keinen Fall mit mir in Berührung kommen. Ich wollte ihnen zurufen, ob ich vielleicht stinken würde. Doch auch dies unterließ ich dann, weil ich froh war, ihnen schnell entkommen zu können. Zu Hause schloss ich mich gleich in mein Zimmer ein, das eigentlich nicht nur mir gehört, sondern auch meinem Bruder Sven.
Herta trommelte gegen die Tür, aber ich stellte mich einfach taub. Später forderte dann auch Sven sein Recht; ich hörte ihn laut rufen, doch ich wollte lieber allein sein und ließ ihn draußen toben.
Als mich dann der Hunger hinaustrieb, empfing mich Herta in der Küche mit Vorwürfen: „Was ist denn mit dir los? Warum schließt du dich ein? Ich warte hier mit dem Essen auf dich. Denkst du vielleicht, ich habe nichts anderes zu tun?“
Auch mein Bruder hackte auf mich ein: „Das ist auch mein Zimmer! So, und jetzt gehe ich rein und schließe zu!“ Mit diesen Worten verschwand er, und ich war froh, mit Herta allein zu sein.
„Was ist mit dir los?“, fragte sie noch einmal, und nachdem ich endlich vor meinem Teller saß und zu löffeln begann, erzählte ich ihr, was ich in der Schule erlebt hatte. Dass ich es wirklich fertigbrachte, davon zu reden, wunderte mich selbst. Aber hinterher war ich froh, dass ich es los war. Herta würde mich bestimmt verstehen können.
Ich hatte mich auch nicht in ihr getäuscht. Sie trat an mich heran und strich mir über den Kopf - eine Handbewegung, die sie schon lange nicht mehr ausgeführt hatte. Wahrscheinlich, weil ich ihr oft genug ausgewichen war. Jetzt hielt ich jedoch still, und noch einmal fuhr ihre Hand über mein Haar. „Ich gebe mir doch die größte Mühe, euch immer ordentlich und sauber zur Schule zu schicken“, meinte sie dann und sah mich traurig an. „Wie aus dem Ei gepellt seht ihr immer aus.“ Sie setzte sich mir gegenüber und strich über ihre Arme. In diesem Augenblick hätte sie mir keine größere Freude bereiten können, als sich ebenfalls einen Teller Suppe zu nehmen und gemeinsam mit mir zu essen. Aber das war bei uns längst nicht mehr üblich. Jeder setzte sich zum Essen an den Tisch, wann es ihm gefiel oder wenn ihn der Hunger dazu trieb. Dass Herta dann immer etwas bereit hatte, schien uns allen selbstverständlich zu sein.
„Ich werde mit Papa reden. Er muss mir mehr Geld geben. Dann kann ich euch abwechselnd ‘ne gute Hose oder neue Schuhe kaufen.“
„Er hat doch bloß keins“, sagte ich und sah Herta in der Hoffnung an, sie könnte vielleicht sagen: Er hat aber etwas gespart. Stattdessen sagte sie, dass mein Vater ihr kaum ausreichend Geld für den Haushalt geben würde, weil er fast alles für sich behielt.
„Wozu braucht er denn so viel?“
Sie zuckte die Schultern. „Woher soll ich das wissen? Er spricht doch kaum noch mit mir.“