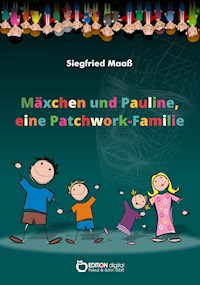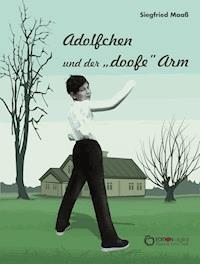7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Die Milchstraße
- Sprache: Deutsch
Wenige Jahre nach dem Ende des letzten großen Krieges in einer ostdeutschen Kleinstadt. Steffens Vater befindet sich noch immer in sowjetischer Gefangenschaft, und der Zwölfjährige hofft täglich auf die Nachricht von dessen Heimkehr. Inzwischen hat sich ein Fremder bei ihnen breit gemacht und zwingt ihm ein ungewohntes Leben auf. Seine Mutter ist schwanger. Zunächst freut er sich. Das Neugeborene empfängt er feierlich mit einer Girlande. Aber bald spürt er, dass die „halbe Schwester“ seiner Mutter scheinbar mehr bedeutet als er. Neid und Eifersucht beherrschen ihn und treiben ihn in seine „Höhle“. Auf der Flucht vor dem erdrückenden Alltag findet er in Fede einen wahren Freund. Schließlich begegnet er Susi, die im Laden ihres Vaters Milch verkauft. Umso bereitwilliger geht er nun seine „Milchstraße“ entlang, um sich von ihr bedienen zu lassen. Eines Tages dann steht der Vater vor der Tür. Neue Konflikte kündigen sich an, die ihn herausfordern und in der Welt der Erwachsenen ankommen lassen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 299
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Impressum
Siegfried Maaß
Das Haus an der Milchstraße
ISBN 978-3-95655-622-7 (E-Book)
Das Buch erschien erstmals 2008 beim Dorise-Verlag in Burg. Dieses Buch erschien mit freundlicher Unterstützung der Volksbank Börde-Bernburg.
Umschlaggestaltung: Ernst Franta
© 2016 EDITION digitalPekrul & Sohn GbR Godern Alte Dorfstraße 2 b 19065 Pinnow Tel.: 03860 505788 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.ddrautoren.de
1. Kapitel
Im frühen Herbst jenes Jahres, in dem ich meinen 12. Geburtstag feiern würde, heftete ich eines Morgens eine hellgrüne Girlande über unsere Wohnzimmertür, dazu ein Spruchband aus welligem Graupapier mit dem Aufdruck in großen, grünen Buchstaben: „Herzlich willkommen!“ Leider musste ich meinen Schmuck innerhalb der uns zugewiesenen Wohnung anbringen, die wir nur durch den Korridor und an den Zimmern unserer Vermieter vorüber erreichen konnten. Die Verzierung außerhalb unserer Wohnung vorzunehmen, hätte bedeutet, sie im Korridor der Vermieter anzubringen. Doch das hätten diese niemals zugelassen.
Ich weiß nicht mehr, ob ich jemals daran gedacht und es dann nach reiflicher Überlegung oder aus Furcht vor dem glatzköpfigen Hausherrn unterlassen habe. Aber wahrscheinlich ist es mir gar nicht eingefallen, weil der Korridor für uns ein unerlaubtes Gebiet darstellte. Dieses durften wir nur betreten, um unsere zwei Zimmer entweder zu erreichen oder zu verlassen. Notgedrungen hatten uns der Glatzkopf und seine zwei Frauen bei sich aufnehmen müssen. Die Stadtverwaltung hatte es an- und uns somit eingewiesen.
Der Mann lebte nämlich außer mit seiner Ehefrau auch mit seiner Schwiegermutter zusammen und noch heute höre ich die Worte meiner Mutter, die meinte, der Mann sei dafür zu bedauern. Sein Leben lang mit der Schwiegermutter unter einem Dach ...
Noch dazu mit dieser ...
Ich hatte damals zwar ihre Worte, jedoch nicht deren Bedeutung verstanden. Erst nachdem ich selbst meine Erfahrung mit jener bestimmenden Dame des Hauses gemacht hatte, begriff ich den Sinn der Bemerkung meiner Mutter. Wenn der Glatzkopf sich aber ebenso schleunigst wie ich vor der weißhaarigen Alten mit dem Dutt am Hinterkopf in Sicherheit bringen wollte, konnte ihm das kaum gelingen. Ich hingegen versuchte jede Begegnung mit ihr zu vermeiden, was aber auch nicht immer möglich war. Irgendwie lag sie stets irgendwo auf der Lauer. Offenbar bestand der Sinn ihres Lebens darin, die anderen zuerst genau zu beobachten und sie anschließend zu tadeln oder zu maßregeln. Ich war jedes Mal froh, wenn ich ihr entwischen konnte, nachdem es mir gelungen war, die Flurtür geräuschlos zu öffnen. Manches Mal stand sie jedoch mit untergeschlagenen Armen im Korridor und bestimmt hielt sie sich nicht ganz zufällig dort auf. Sie starrte auf meine Schuhe, die noch den Schmutz des Schulhofes trugen und schüttelte empört den Kopf. Sie hielt ihn so tief gebeugt, dass ich unwillkürlich auf ihren Dutt blicken musste, der wie ein Kamelsattel schaukelte. Schadenfroh stellte ich dann jedes Mal fest, wie klein sie war und dass ich sie bald einholen und sogar übertreffen würde. „Wie oft muss ich dir noch sagen, dass du die Schuhe vor der Tür auszuziehen hast!“
Ihre Worte bedeuteten eigentlich eine Frage, doch aus ihrem Mund gerieten sie stets zu einer strengen Ermahnung. Außerdem habe ich später nie wieder einen Menschen kennengelernt, der so hochgradig neugierig war wie sie. Oder lag es daran, dass sie nichts zu tun hatte und sich auf diese Weise die Langeweile vertrieb?
Vielleicht kam es daher, dass es in dieser Familie kein Kind gab?
Auch als ich an jenem Morgen mit meiner Neuerwerbung den Korridor betrat, hatte sie in der geöffneten Küchentür Posten bezogen und musterte die aus einer Zeitungsseite gedrehte Tüte in meinem Arm.
„Warst du schon einkaufen! Bleibst also heute zu Hause. Hast du dich auch in der Schule abgemeldet! Oder schwänzt du wieder wie neulich! Was hat denn dein Lehrer dazu gesagt! So ein guter Schüler bist du doch nicht, dass er es dir erlauben kann.“
„Er weiß aber Bescheid!“, sagte ich so höflich wie möglich und sah, wie die alte Frau auf die Zeitungstüte blickte, als wollte sie an deren Konturen den Inhalt erkennen.
„Du warst also schon einkaufen. Für deine Mutter, nehme ich an. Damit sie sich freuen kann, wenn sie wieder zu Hause ist. Hast du etwas Gutes bekommen!“ Ich glaubte bereits, dass sie im nächsten Augenblick ihre Hand nach meiner Zeitungstüte ausstrecken wollte und huschte flink an ihr vorüber.
Dann schloss ich eilig unsere Tür hinter mir und genoss die Schadenfreude, sie mit ihrer Neugier stehengelassen zu haben. Zufrieden strich ich über die knisternde Verpackung. Danach wickelte ich sie behutsam auf und betrachtete bei Tageslicht, was ich nach Hause gebracht hatte. Es gefiel mir. Nur das Grün der Girlande war etwas blass. Das lag wohl daran, dass sie so lange bei Schwarzkopf hinter dem Vorhang zugebracht hatte.
Kati war im Nebenraum, der uns als Küche diente, wo wir aber auch sonst beisammensaßen. Wahrscheinlich bereitete sie das Mittagessen für uns alle vor. Ich wollte sie mit der Girlande und dem Willkommengruß überraschen.
Kati war meine Tante, die Schwester meiner Mutter. Sie wohnte zu dieser Zeit noch in der großen Stadt an der Elbe, woher auch wir gekommen waren. Der Krieg hatte uns jedoch in die kleinere Stadt Brückstedt verschlagen. Dort wären wir vor Bombenangriffen sicher, hieß es. Tatsächlich überstanden wir die restlichen Monate des Krieges unversehrt und konnten nachts den Feuerschein über der großen Stadt sehen und bangten jedes Mal um Kati, die sich dort schon längere Zeit im Krankenhaus befand. Uns hatten Verwandte in ihrem Haus aufgenommen. Doch mit dem Ende des Krieges rückten auch die Alliierten heran und vertrieben sowohl unsere Verwandten wie auch uns aus dem villenähnlichen Gebäude. Seit dieser Zeit waren wir „Untermieter“ in dem großzügig angelegten Haus gegenüber der Kirche, wo wir nun einen Teil der großen Wohnung des Hauseigentümers belegt hatten.
Hierher war ich also an jenem Tag mit meinen Errungenschaften zurückgekehrt.
Beides, Girlande wie Spruchband, hatte ich in Schwarzkopfs Laden erhalten, wo ich auch meine Bücher und Hefte für die Schule bekam, wenn ich den Schein mit dem Stempel der Schule und der Unterschrift der Schulsekretärin vorlegte. Damit wurde mir „amtlich“ bestätigt, dass ich dieses oder jenes dringend brauchte. Bleistifte und Radiergummi holte ich ebenfalls von Schwarzkopf und auch die Tinte für meinen Füllfederhalter, der ein Geschenk von Onkel Franz war und in der Schule von allen bestaunt wurde. Er besaß nämlich eine goldene Feder. Deshalb durfte ich ihn eigentlich nicht mitnehmen. Darin waren sich meine Mutter und Onkel Franz einig. Aber trotzdem steckte ich ihn so oft es ging morgens unauffällig in meine Schultasche, um wieder damit angeben zu können. Ich war dann jedes Mal froh, wenn mich meine Mutter nicht nach dem Füller fragte. Schwarzkopf war schon ein alter Mann mit einem grauen Haarkranz, der seine Glatze so gleichmäßig umrahmte wie eine ordentlich geschnittene Rasenkante die Rabatte eines Vorgartens.
Ich ging gern in den kleinen Laden, in dem es immer angenehm nach Papier und Tinte roch und in dem es stets so dämmrig war, dass man sich in die Nähe der Tür stellen musste, um den Gegenstand, den man erwerben wollte, zuvor betrachten zu können. Die kleine Milchglasscheibe ließ im Gegensatz zu dem breiten Schaufenster genügend Tageslicht herein. Das Schaufenster jedoch war mit allen möglichen Dingen, die Schwarzkopf auf diese Weise seiner Kundschaft anpreisen wollte, zugestellt oder verhängt. Nicht allein wir Kinder standen oft in Grüppchen davor und streckten die Finger aus, um uns gegenseitig auf irgendetwas aufmerksam zu machen, das uns besonders gut gefiel. Auch Erwachsene hatten ihr Vergnügen daran, sich anzusehen, was Schwarzkopf in seinem Fenster ausstellte. Es schien, als glitten sie vorübergehend in eine schöne Scheinwelt, die sie für Augenblicke von den alltäglichen Sorgen und Nöten befreite. Wenn sie sich dann schließlich abwandten und sich wieder ihre Alltagslast aufluden, nahmen sie meist einen Schimmer Freude mit auf ihren Weg. Hätte man tatsächlich einmal vergessen, in welcher Jahreszeit man sich befand, so würde ein einziger Blick in Schwarzkopfs Schaufenster genügt haben, um sich Klarheit darüber zu verschaffen.
Am besten hatte mir die Dekoration zur Faschingszeit gefallen. Da ging es in dem Schaufenster fast so lustig zu wie auf einer richtigen Theaterbühne. Masken und Kostüme aus buntem Papier, Drachenköpfe und Wolfsgesichter mit aufgerissener Schnauze, Harlekine und Kittelmönche, Teufelchen und Glücksritter hatte Schwarzkopf ausgestellt und damit nicht nur uns Kinder zum Staunen gebracht. Die Erwachsenen wunderten sich vor allem, woher der alte Mann unter den Bedingungen des vierten Jahres nach dem großen Krieg derartige Raritäten aufgetrieben hatte. Ebenso bunt ging es auf dieser Schaubühne auch zur Osterzeit oder vor Weihnachten zu. Im Sommer zeigte Schwarzkopf Fotos von badelustigen Leuten und Plakate, die für irgendwelche Cremes aus der Vorkriegszeit warben, die der geschäftstüchtige Alte früher ebenfalls in seinem Sortiment zur Verfügung hatte. Doch auch jetzt brachte er manchmal zum Erstaunen der jeweiligen Kunden eine dieser Cremes in blauen Blechdosen hinter dem Vorhang hervor. Auch meine Mutter gehörte zu diesen Bevorzugten und ich weiß nicht, was sie zum Ausgleich dafür einsetzen oder aufwenden konnte.
Zu dieser Jahreszeit schnüffelte ich den Geruch des Ladens besonders gern; er erinnerte mich jedes Mal an das öffentliche Wannenbad, in das ich am Wochenende gehen durfte und stets so lange in der Wanne blieb, bis die Badefrau energisch an die Kabinentür klopfte und mich mit schriller Stimme aufforderte, endlich herauszukommen, denn meine Zeit sei längst abgelaufen. Natürlich verband ich damit auch meine Aufenthalte im Schwimmbad, wohin es mich im Sommer trieb. Manchmal ging ich auch nur hinunter an den kleinen Fluss und watete ein Stück hinein. Wenn sich dann Schlingpflanzen um meine Füße spannten, sprang ich jedes Mal erschreckt hoch, obwohl ich damit gerechnet hatte.
Dann bildete ich mir ein, ein schreckliches Unwesen würde nach mir greifen und rannte mit gestreckten Beinen an Land.
Einmal, in der großen Stadt, fuhren sie an den breiten Strom, um auf dem sandigen Ufer den Drachen steigen zu lassen, den sie selbst gebaut hatten. Gemeinsam mit dem Vater hatte der Junge auf dem Dachboden viele Stunden damit verbracht. Mit der großen Schneiderschere seiner Mutter hatte er das steife und knisternde Papier zugeschnitten, während der Vater sorgfältig die Spanten zurechtsägte. Auch das Gesicht des Drachens hatte der Junge malen dürfen: Pünktchen. Pünktchen, Komma, Strich - fertig ist das Mondgesicht. Und wie der Drachen dann die Backen aufblies! Gut meinte es der Wind mit ihnen dort unten am breiten Strom! Der Vater führte die lange Leine, immer am Ufer entlang, wo seine Füße nasse Spuren hinterließen. Genau wie die schwerfälligen Enten und die leichtfüßigen, stets bettelnden Möwen.
Der Drachen tänzelte, fiel und stieg, wie er gerade lustig war.
„Nun du, Steffen!“, rief der Vater und der Junge lief zu ihm und ließ sich dann vom Monddrachen davonziehen. Der breite Strom leckte an seinen Füßen und verbündete sich plötzlich mit dem Wind, sodass der Drachen über das Wasser trieb und der Junge nicht wusste, was er machen sollte. Einfach loslassen? Schon stand er bis zu den Knien im Wasser. Es war kalt. Als er den Vater rufen wollte, war dieser aber schon neben ihm und nahm ihm die Leine ab. Dann hob er seinen Jungen hoch, klemmte ihn sich unter den Arm und brachte ihn sowie den Drachen, diesen Ausreißer, sicher ans Ufer. Zu Hause erzählten sie, eine Welle des breiten Stroms sei auf den Ufersand geschwappt, hätte den Jungen erfasst und die Sachen nass gemacht.
Ob es die Mutter geglaubt hatte?
Nun, zur Zeit der Laubfärbung, glich das kleine Schaufenster einem Stoppelfeld.
Schwarzkopf hatte auf der gesamten Bodenfläche Strohhäcksel ausgebreitet, einen ausgestopften Hamster daraufgestellt, der sich angriffslustig auf die Hinterpfoten erhob. Auch ein Igel schob seine Schnauze über das Stroh. Mir schien, als käme er genau auf mich zu.
Als Blickpunkt schwebten darüber bunte Drachen, die teilweise bereits ausgebessert waren, mich aber trotzdem verführten, länger vor dem Schaufenster stehen zu bleiben, als ich beabsichtigt hatte. Ich stellte mir vor, mit einem dieser bunten Drachen auf die Felder vor der Stadt zu gehen und ihn vom Wind forttragen zu lassen, so weit es die Leine zuließ. Oder ihn mit einer Botschaft und meiner Anschrift davonfliegen zu lassen und abzuwarten, ob mir jemand antworten würde. Das musste sehr spannend sein. Vielleicht trug günstiger Wind meine Botschaft sehr weit und ein Junge aus Schweden oder England antwortete mir? Doch worin sollte meine Botschaft bestehen? Was hatte ich anderen, die mich nicht kannten, mitzuteilen?
Dass ich meine freie Zeit am liebsten in meiner „Höhle“ über aufregenden Hefterzählungen, die mich in ferne Zeiten und Länder führten, verbrachte? Oder jeden Tag auf eine Nachricht wartete, die die Heimkehr meines Vaters ankündigen würde?
Aber so gern ich mich beim Anblick der Drachen in Schwarzkopfs Schaufenster diesen Vorstellungen und heimlichen Wünschen überließ, so schnell trennte ich mich wieder von ihnen. Sie würden sich niemals verwirklichen. Dann tröstete ich mich mit dem Gedanken, dass Schwarzkopfs Drachen viel zu alt seien, um noch aufsteigen zu können.
Bei schlechtem Wetter hielt ich mich in dem kleinen Laden manches Mal Stunden lang auf und schmökerte in den Büchern, die Schwarzkopf entweder zum Kauf anbot oder auch gegen eine geringe Gebühr verlieh. Geld für den Kauf eines Buches war bei meiner Mutter nicht vorhanden; aber einmal in der Woche brachte sie die wenigen Groschen auf, um sich eines auszuleihen, denn ohne Buch, sagte sie oft, könne sie nicht leben. Und wenn ich auch sonst kaum etwas von ihrer Lebensart mitbekommen oder übernommen habe - ohne Buch kann auch ich nicht leben und konnte es schon damals nicht, als ich noch ein Schuljunge war. Das Lesen bedeutete für mich ein nie endendes Abenteuer, in dem ich Freud und Leid mit den Helden teilte. Am liebsten waren mir jene, die als Arme unter Armen für Gerechtigkeit und Gleichberechtigung eintraten und selbst ihr Leben dafür einsetzten. Aber längst hatte ich begriffen, dass sich auf diese Weise das Leben, wie es nun einmal beschaffen war, nicht ändern würde. Meiner Leselust hat diese Erkenntnis jedoch nicht geschadet.
Schwarzkopf ließ mich stets gewähren und nur, wenn ich zu einem Buch griff, das er für mich ungeeignet fand, nahm er es mir aus der Hand und stellte es zu den anderen zurück.
„Das verstehst du noch nicht“, meinte er lächelnd. „Das ist eher etwas für deine Mutter.“
Natürlich weckte er damit meine Neugier und seitdem blätterte ich in unbeobachteten Augenblicken zu Hause schnell einmal in Mutters Büchern, um zu überprüfen, ob ich tatsächlich nicht verstehen konnte, was für sie geeignet war. Aber diese Liebe, die dort beschrieben wurde, schien wirklich nichts für mich zu sein, und das, was ich gern gewusst hätte, konnte ich darin nicht entdecken. Woher war ich gekommen? Wie entstanden?
Meine Vorstellungen von der Vereinigung von Mann und Frau, die dem Wachsen eines Kindes im Mutterleib vorausgeht, wie ich wusste, war so verschwommen, dass ich immer, wenn ich ein Buch in die Hand bekam, nach aufklärenden Worten oder Zeichnungen suchte. Doch vergeblich. Jedenfalls duldete mich Schwarzkopf, obwohl ich anderen Kunden oft im Wege stand und außerdem Acht geben musste, um nicht die Tür ins Kreuz zu bekommen, wenn jemand eintrat. Offensichtlich gefiel ihm meine Leselust, die er manchmal belohnte, indem er mir kleine Texthefte schenkte, die ohne Umschlag und nur geheftet waren und meistens mehrere Erzählungen teils bereits bekannter, aber auch neuer, noch unbekannter Autoren enthielten. Damit verkroch ich mich dann in meiner „Höhle“ und ließ mich nicht eher wieder blicken, bevor ich das jeweilige Heft mit den unterschiedlichen Geschichten bis zum Ende „verschlungen“ hatte.
Meine „Höhle“ war eine säuberlich in den Erdboden eingelassene und gemauerte Aschengrube, die der Hauswirt jedoch längst nicht mehr nutzte, wahrscheinlich nie genutzt hatte, denn es war darin so sauber wie in unserem Hausflur, der mit einem farbigen Paneel versehen war. Bei jeder Flur- und Treppenreinigung mussten wir es mit heißem Wasser säubern.
Die Grube befand sich in einem Winkel unseres Hofes, zu zwei Seiten von der Hofmauer begrenzt. Außen verlief eine enge Gasse, wohl dafür gedacht, diese und andere Aschengruben leeren zu können. Zu diesem Zweck befand sich auf der Gasse fast zu ebener Erde eine Eisenklappe, die ein Vorhängeschloss vor unbefugtem Gebrauch schützte. Doch ich hatte unter vielen Schlüsseln, die meine Mutter sorgfältig aufbewahrte, einen passenden gefunden und seit dieser Zeit Zugang zu der Aschengrube, die meine „Höhle“ darstellte. Alte Decken sowie eine durchgelegene Matratze, die ich auf dem Hausboden gefunden hatte, boten mir eine gewisse Bequemlichkeit, sodass ich, so lange das Tageslicht durch die Ritzen der oberen Klappe drang, ungestört schmökern konnte. Ich war mir sicher, dass niemand von meiner „Höhle“ wusste und mich kein Mensch darin vermutete.
Dieses Mal hatte mich jedoch nicht die Gier nach neuer Lektüre zu Schwarzkopf geführt.
„Eine grüne Girlande und einen Willkommensgruß?“, wiederholte der alte Mann erstaunt, nachdem ich meinen ungewöhnlichen Wunsch vorgetragen hatte. Ich sah ihm an, dass er gern gewusst hätte, wozu ich so etwas brauchen würde.
„Kommt vielleicht dein Vater nach Hause?“
Er wusste natürlich, dass wir, im vierten Jahr nach dem Ende des großen Krieges, noch immer auf meinen Vater warteten, der sich in russischer Gefangenschaft befand.
Ich schüttelte den Kopf und erweckte wahrscheinlich den Eindruck eines naseweisen Kindskopfs, als ich sagte: „Nein, meine Mutter kommt morgen aus dem Krankenhaus. Sie hat ein Kind bekommen, ein Mädchen.“ Ich gab mir große Mühe, mich gut auszudrücken. Irgendwie schien mich der Anlass dieser Unterhaltung dazu zu verpflichten. Immer, wenn ich von meiner Mutter sprach, verfiel ich in diese Wortwahl. Wahrscheinlich deshalb, weil sie stets darauf achtete, dass ich nicht wie andere, solche „von der Straße“ nämlich, redete.
Schwarzkopf kratzte seine Glatze, und es hörte sich an, als streiche er über knisterndes Papier.
„Und nun willst du die beiden feierlich begrüßen?“ Er nickte, als beantworte er sich seine Frage selbst. „Da wird sich deine Mutter sicher freuen.“ Er sah sich darauf in seinem Laden um, als müsse er erst suchen, wonach ich gefragt hatte. Aber ich wusste genau, dass er selbst mit geschlossen Augen oder bei absoluter Finsternis jeden gewünschten Gegenstand finden würde. Gerade so, als besäße er eine Spürnase. „Eine Girlande“, murmelte er währenddessen vor sich hin, „und einen Willkommensgruß. Mal sehen, ob ich ...“ Schlurfend lief er in die Hinterstube, zu der kein Kunde Zutritt hatte, als handelte es sich um ein Geheimverlies oder eine Schatzkammer. Statt einer Tür trennte ein alter grauer Vorhang die beiden Räume voneinander, und Schwarzkopf vergaß niemals, ihn wieder zu schließen, sobald er auf dessen andere Seite gewechselt war. Staub wehte dann als Wölkchen von dem schweren Stoff auf. Nicht einen einzigen Blick gewährte er Fremden in die geheimnisvolle Welt hinter dem Vorhang.
Den Begriff „Schatzkammer“ hatte ich dafür erfunden, nachdem Schwarzkopf daraus die seltsamsten Dinge, die man sich wünschen konnte, hervorgeholt hatte. Umso größer war meine Neugier auf diese Hinterstube geworden. Doch auch für mich gestattete er in diesem Fall keine Ausnahme. Ein einziger Blick hinter diesen Vorhang wäre wahrscheinlich ein noch größeres Abenteuer gewesen, als irgendein Buch zu lesen.
Ich hörte ihn leise vor sich hinsprechen. Obwohl ich diese merkwürdige Gewohnheit längst kannte, fand ich es jedes Mal wieder aufregend und spannend, ihn zwar nicht sehen, aber seine Stimme vernehmen zu können, und im Geiste malte ich mir aus, was er in diesem Augenblick in seiner Schatzkammer trieb.
Schließlich trat er wieder hervor, in einer Hand das von mir Gewünschte und mit der anderen den Vorhang gerade so viel öffnend, dass er hasenschnell und geduckt hervortreten konnte.
„Da hätten wir es“, sagte er, auch wie üblich, nachdem er den Vorhang wieder geschlossen hatte. Er hängte mir eine lange, grüne Papiergirlande um den Hals, betrachtete mich erheitert und meinte, nun sähe ich wie ein Hulamädchen aus der Südsee aus, ich brauchte mir noch eine Blume ins Haar zu stecken, dann wäre es völlig echt. Damit spielte er auf eine Geschichte an, die ich erst vor kurzer Zeit in einem der Hefte gelesen hatte. Darin hatte ein auf solche Weise geschmücktes Mädchen auf einer einsamen Südseeinsel eine Bande Seeräuber besiegt, indem es diese in eine Felsenhöhle lockte, aus der sie ohne die Hilfe des Mädchens nicht wieder herausgefunden hätten. Doch dafür mussten die Männer ihre Waffen sowie die Beute, die sie auf ihrem Schiff verbargen, zurücklassen ...
Die Girlande roch nach Staub und altem Papier, anders jedenfalls, als es sonst in Schwarzkopfs Laden roch, und auch in der erwähnten Erzählung verströmte sie vielmehr den Duft von Blüten exotischer Pflanzen.
„Die hat den Krieg hier bei mir überdauert“, erklärte er mir und breitete zugleich das wellige Spruchband auf seinem Ladentisch aus. „Nicht mehr ganz taufrisch“, meinte er, indem er mit seinen Händen darüber strich. „Aber wer hängt heutzutage schon so einen Spruch auf ..." Er sah mich aufmerksam an und verkniff dabei seine Augen zu schmalen Schlitzen. „Außer dir, meine ich. Nun hast du also eine kleine Schwester ...“ Er tippte auf das Wort „Willkommen“. „Und du freust dich ... Was sagt denn der Papa dazu?“ „Der ist doch nicht da. Immer noch in Russland.“ Schwarzkopf schüttelte den Kopf, und als er bereits zu einer weiteren Frage ansetzte, wurde die Tür geöffnet und eine füllige ältere Frau zwängte sich herein. Sie war mit einer bunten Kittelschürze bekleidet, über der sie eine Strickjacke trug. Über den Arm hatte sie sich einen alten Korb gehängt, sodass sie wie eine schäbige alte Hexe wirkte, die einem Märchen entstiegen war. Ihre Füße steckten in schwarzen Schuhen, die ihr offensichtlich zu klein waren, denn die Spitzen waren abgeschnitten, sodass ihre Zehen über den Rand hinausragten. Auch wir hatten schon mehrfach von dieser Methode Gebrauch gemacht, weil ich immer zu schnell aus meinen Schuhen herauswuchs, wie meine Mutter es nannte und darum die Kappen abschneiden ließ.
Zunächst blickte die Frau mich erstaunt an und schien nicht zu wissen, was sie von meiner Hulamädchenverkleidung halten sollte, zumal es Herbst und die Faschingszeit damit entweder längst vorüber war oder noch nicht begonnen hatte. Dann fiel ihr Blick auf den Willkommensgruß, den Schwarzkopf darauf losließ, sodass er sich zusammenrollte. Wahrscheinlich hatte er seine lange Liegezeit in Schwarzkopfs Hinterstube in diesem Zustand verbracht. „Ach, ist es so weit?“, fragte sie in den Raum hinein, ohne einen von uns beiden anzusehen.
„Seine Mutter, ja“, sagte Schwarzkopf und wies mit einer Kopfbewegung auf mich. „Sie hat ein kleines Mädchen und kommt morgen nach Hause.“
„Und das machst du nun unten an der Haustür fest?“, fragte die Frau und gluckerte ein Lachen aus sich heraus und mir erschien es, als ersticke sie fast daran.
„Nein, doch nicht an der Haustür!“
„Das hätte ich mir bei eurem ,strengen Waldi‘ auch nicht vorstellen können!“
Damit meinte sie unseren Hauswirt, der zugleich auch noch der Bewohner jener Wohnung war, in die man uns vor einiger Zeit eingewiesen hatte. Flur und Toilette mussten wir uns mit unseren Wirtsleuten teilen, waren sonst jedoch von ihnen unabhängig. Der „strenge Waldi“ war ein kegelkugelköpfiger Mann, dessen Glatze nicht wie Schwarzkopfs von einer Einfassung gesäumt wurde, sondern in ihrer totalen Blöße glänzte. Vermutlich polierte er sie sogar jeden Morgen. Ich sah ihn selten, denn nach Möglichkeit ging ich ihm aus dem Weg, zumal ich seine Gewohnheiten schon bald nach unserem Einzug gut kannte. Diese bestanden vor allem darin, dass er jeden Morgen zur gleichen Zeit die gleichen Gänge ausführte - zur Toilette, zum Bäcker, um Brötchen zu holen, und schließlich nach dem Frühstück pünktlich um neun zu seinen Klienten. Er war Bücherrevisor, was immer das sein mochte. Ich wusste nur, dass es sich dabei nicht um solche Bücher handelte, die meine Mutter und ich so sehr mochten und uns bei Schwarzkopf ausliehen. Auch hatte ich keine Vorstellung von dem Wort „Revisor“, aber es klang wichtig und schien außerdem eine Menge Geld einzubringen, denn der „strenge Waldi“ war immer gut und vornehm gekleidet. Befand meine Mutter jedenfalls.
Mir erschien er eher wie eine Gestalt aus einer längst vergangenen Zeit oder aus einem anderen Land. Als wäre sie leibhaftig einer der Geschichten entstiegen, die ich gelesen hatte und die von amerikanischen Quäkern handelte.
Es hieß, während seiner Militärzeit hätte die wichtigste Beschäftigung seiner Frau darin bestanden, seine Anzüge, Westen und sonstigen Kleidungsstücke wenigstens einmal in jedem Monat hervorzuholen, sie auszubürsten und dann einige Stunden im Freien zu lüften. Erst danach wäre alles an seinen vorbestimmten Platz zurückgekehrt. Auf diese Weise, meinte auch meine Mutter, hatte die Frau vorausschauend für die Zeit nach dem Krieg und der Heimkehr ihres Mannes gesorgt, der nun seinen Klienten ebenso „exakt“ gekleidet gegenübertreten konnte wie vordem. Einmal hatte ich die Galerie der aufgehängten Kleidung gesehen und mich furchtbar erschreckt.
Unter einem ihrer Fenster, die zu dem geräumigen Hof wiesen, befand sich ein winziges Stück Rasen, das wir Kinder nicht betreten durften. Dort waren zwei hölzerne Pfähle eingerammt, zwischen denen eine doppelstarke Leine gespannt war. Darauf trocknete unsere Wirtin nicht nur ihre große Wäsche. Auch die Anzüge wurden hier zum Lüften aufgehängt. Diese Gewohnheit hatte sie auch fortgeführt, nachdem Waldi unversehrt aus dem Krieg und anschließender kurzer Gefangenschaft zurückgekehrt war. Dazu nutzte sie die Sonntage, sodass ich einmal, als ich über die Mauer klettern wollte, um den Weg zum Milchmann zu verkürzen, plötzlich vor den „Gehängten“ stand und vor Schreck die Kanne fallen ließ. Mir kam es vor, als wäre ich in eines der gefahrvollen Abenteuer geraten, von denen ich kurz zuvor in einem der Hefte von Schwarzkopf geschmökert hatte.
Seit dieser Zeit wagte ich es nicht mehr, sonntags über die Mauer zu steigen. Brav lief ich über die Straße und schließlich um die Ecke, außen an der Mauer entlang, wo meine „Milchstraße“ begann. Dennoch bereitete mir der sonntägliche Milchkauf jedes Mal weiche Knie. Denn in den kasernenmäßigen Häusern am Ende der engen Seitenstraße wohnte jene „Meute“, die uns Kinder aus den „vornehmen“ Häusern überfiel, um uns unsere vollen Kannen abzunehmen. Weil sie die „feinen“ Familien nicht leiden konnte, wurden wir gleich in ihre Wut mit einbezogen. Dass ich selbst dort nur geduldet war, weil man uns dort als Untermieter einquartiert hatte, schien ihnen völlig gleichgültig zu sein. Darin machten sie keinen Unterschied.
Meistens stand ich darum freiwillig sehr früh auf. Ich hoffte nämlich, sonntags würde die Meute lieber lange schlafen und sich nicht schon um acht als Wegelagerer auf die Lauer legen. Aber Irrtum! Selbst zu dieser frühen Stunde stürzte sie aus ihrem Versteck hervor, sobald sich jemand aus unserer Straße mit der vollen Milchkanne näherte. Nachdem ich zweimal auf diese Art von den Bosses und Stanges überfallen worden und darum ohne Milch nach Hause zurückgekehrt war, suchte ich Verbündete. Die fand ich schnell, denn auch andere Kinder aus unserer Straße wurden sonntags zum Milchholen geschickt. Ihnen erging es meist nicht besser als mir. Darum beschlossen wir, gemeinsam zu gehen und trafen uns seitdem an unserer Ecke der „Milchstraße“. Auf dem Hinweg waren wir vor der Meute sicher. Der Rückweg stellte jedoch jedes Mal eine Gefahr dar. Darum richteten wir es so ein, dass wir zwei von uns in die Mitte nahmen und wir anderen einen Kreis um sie schlossen. Die in der Mitte trugen unsere gefüllten Milchkannen. Beim ersten Mal blieb die Meute erstaunt stehen. Auf diese Art unserer Verteidigung war sie nicht vorbereitet. Ihre Denkpause nutzten wir, um unsere Milch gut nach Hause zu bringen. Noch am anderen Morgen in der Schule freuten wir uns über unseren Sieg.
Doch schon am nächsten Sonntag hatten Bosses und Stanges eine andere Taktik entwickelt. Sie drängten uns an die Hauswand, sodass wir nicht ausweichen konnten und entrissen uns die vollen Milchkannen. Voller Wut mussten wir mit ansehen, wie sie gierig unsere kostbare Milch austranken. In Rinnsalen lief sie ihnen über Kinn und Hals und schadenfroh lachend, wischten sie mit den Handrücken die weißen Spuren ab. Danach warfen sie uns die leeren Kannen vor die Füße.
Von meiner splitterte die weiße Emaille ab und hinterließ hässliche schwarze Flecke. Die Kanne war ein Erbe meiner Großmutter, das meine Mutter gepflegt und behandelt hatte, als sei es ein besonders wertvolles Stück. Verständlich, dass sie danach sehr ärgerlich war. Auch der fehlenden Milch wegen. Nun konnte es an diesem Sonntag keinen Pudding als Nachspeise geben. Darüber ärgerte ich mich jedoch am meisten.
Nachdem es ihnen auch am Sonntag darauf noch einmal gelungen war, uns an die Hauswand zu quetschen, schütteten wir ihnen wie auf Kommando unsere Milch in vollem Schwung über die Köpfe oder in ihre Gesichter. Wie erstarrt standen sie dann vor uns und blickten an sich hinab und es dauerte ein Weile, bis sie ihren Schreck überwunden hatten. Bevor wir schließlich wegrennen konnten, begann einer von den Stanges laut zu lachen. Er deutete mit dem Finger auf die übrigen und rief, sie sollten sich jetzt mal sehen ... Wie sie aussehen würden ... Na, und du selbst erst mal, meinte ein anderer und schon im nächsten Augenblick lachten sie so sehr, dass sie sich gegenseitig auf die Schultern klopften, um sich irgendwie zu beruhigen. Uns anderen aber, die wir uns als die erfolgreichen „Verteidiger“ fühlten, blieb nichts weiter übrig, als in die unerwartete Heiterkeit einzustimmen. Fast wären wir uns in der gemeinsamen Freude in die Arme gefallen. Dann wurde aber in dem Haus neben uns ein Fenster geöffnet und der „strenge Waldi“ rief wütend, er würde gleich die Polizei holen wegen des unverschämten Lärms am Sonntagmorgen! Dabei schwang er voller Zorn seine Faust, als drohe er uns mit Schlägen ... Als wir endlich Ruhe gaben, schloss er sein Fenster. Wir sahen, wie er in seiner Wut so heftig am Vorhang zog, dass dieser herabfiel. Das löste sofort eine neue Welle der Heiterkeit bei uns aus und die Schadenfreude vereinte uns und ließ die bisherige Feindschaft vergessen.
Seitdem stellte meine „Milchstraße“ keine Gefahr mehr dar. Die Wegelagerer hatten erkannt, dass ich und meine Milchholgefährten nichts mit den „Besseren“ aus dem vornehmen Haus zu tun hatten, sondern einfache Leute waren wie sie selbst. Unbeschadet brachte ich nun die sonntägliche Milch nach Hause. Stand dann mittags der Pudding auf dem Tisch, genoss ich ihn umso mehr und gefiel mir in der Rolle eines Siegers.
Als „strenger Waldi“ wurde unser Haus- und Wohnungswirt von Leuten bezeichnet, die entsprechende Erfahrungen mit ihm gemacht hatten. Das waren jene, die er entweder ausschimpfte, wenn sie mittags, während seiner Ruhepause, sich im Haus laut unterhielten oder wenn Kinder, darunter ich, auf seinem Hof Ball spielten und uns eine der Schuppentüren als Tor diente. Dann knallte und krachte es fast ohne Unterlass. Besonders, wenn ich der Torsteher war. Ich war nämlich viel zu ängstlich, um mich dem Ball entgegenzuwerfen. Damit machte ich den anderen immer die Freude, stets Gewinner zu sein. Wechselten wir und ich „schoss“, brachte ich den Ball kaum einmal in dem „Tor“ unter. Dann wenigstens knallte er nicht gegen die Schuppentür.
Hintenherum stellte das Haus nichts Besonderes dar. Der Hof unterschied sich kaum von anderen, die ich gesehen hatte. Stumpfe gelbe Steine bildeten die rückwärtige Front, die von braun gestrichenen Fensterrahmen unterbrochen wurde. Vorn jedoch hob sich das Haus in seiner Fassadengestaltung von den Nachbargrundstücken auffallend ab. Ein Fremder blickte erstaunt auf und ließ seinen Blick empor schweifen, sobald er in die Nähe des Hauses kam. Dann nahm er die Fensterbögen mit den darüber befindlichen Verzierungen wahr, die entweder Kränze darstellten oder Schlangen mit herausgestreckten spitzen Zungen sowie den Zierbogen über dem Eingang, für den der einfache Begriff „Tür“ nicht zutraf. Zwei Türmchen bildeten am First überflüssigen Zierrat, zumal sie nicht einmal zugänglich waren, wie ich bei einem meiner heimlichen Erkundungsgänge gleich zu Anfang feststellte.
In seiner sonst bescheiden wirkenden Umgebung erweckte das Haus den Eindruck eines Schlosses.
In dieses waren nun unverschuldet und ungewollt meine Mutter und ich geraten und somit in den Herrschaftsbereich des „strengen Waldi“, denn unser Wirt und Vermieter hieß Waldemar.
Unbeherrscht war der „strenge Waldi“ besonders, wenn ein anderer es wagte, die Toilette zu benutzen, wenn seine Zeit dafür angezeigt war. Niemals wieder als nur das eine Mal habe ich gewagt, mein Bedürfnis zu verrichten, solange nicht der „strenge Waldi“ den stillen Ort besucht hatte. Nicht allein mir, sondern vor allem meiner Mutter verdarb er danach den Tag, indem er sie belehrte, wer sich in dieser Wohnung nach wem zu richten habe ... Das Seltsame war, dass er dabei niemals laut wurde. -
„Wo bringst du es denn sonst an?“, fragte die Frau in Schwarzkopfs Laden. „Er darf es doch bestimmt nicht sehen.“
„Über unserer Wohnzimmertür. Aber innen.“
Ich sah, dass die Frau und Schwarzkopf Blicke tauschten. „Das Baby müsst ihr dann aber streng halten. Flennen darf es bloß, wenn es Waldi nicht stört.“ Sie gluckerte erneut ihr merkwürdiges Lachen. Schließlich besann sie sich darauf, etwas kaufen zu wollen und trug Schwarzkopf ihren Wunsch vor. Bald darauf verließ sie wieder seinen Laden. Ihre ausgeschnittenen Schuhe schlurften über die dunkelbraun gestrichenen Holzdielen.
„Ach, diese Frau Kramer“, meinte Schwarzkopf, nachdem sie die Ladentür hinter sich geschlossen hatte. „Mit ihrem Lachen ... Sie kann einen richtig anstecken.“
Er nahm die Girlande von meinem Hals und wickelte sie auf, indem er sie über seinen gebeugten Arm spannte, genauso wie meine Mutter ihre Wäscheleine. Einmal in der Woche, an einem vom „strengen Waldi“ bestimmten Tag, durfte sie ihre Wäsche auf dem Hof trocknen.
„So“, sagte Schwarzkopf, griff unter seinen Ladentisch und drückte mir danach wieder eines der dünnen Lesehefte in die Hand. „Das bekommst du dazu ...“ Dann reichte ich ihm mein Geld über den Ladentisch, aber Schwarzkopf schüttelte den Kopf. „Lass nur ... Weil du so lieb zu deiner Mutter bist ...“ Er wies auf Girlande und das zusammengerollte Spruchband. „Ich schenke es dir.“
Zufrieden verließ ich darauf seinen Laden.
Zu dieser Zeit befand ich mich „in Obhut“ meiner Tante Kati, der jüngeren Schwester meiner Mutter, die ebenfalls dickbäuchig war und meiner Mutter bald ins Krankenhaus folgen würde.
Ich mochte sie sehr und war sofort einverstanden, als mir meine Mutter erklärte, dass Kati zu mir käme, solange sie selbst in der Klinik bleiben müsse. Kati verstand es, mit jedem gut auszukommen und konnte sogar den „strengen Waldi“ gewissermaßen um den Finger wickeln.
Nie werde ich vergessen, wie sie prompt zu dessen allen bekannter Zeit zur Toilette ging und ihm die Tür vor der Nase zuschlug. Gespannt wartete ich hinter unserer Wohnzimmertür, die sich neben der Toilettentür befand, wie er sich verhalten, ob er fluchen oder toben würde oder ob ich das Vergnügen hätte, einige seiner Beschimpfungen zu hören — doch nichts geschah und nichts war zu hören. Ich staunte. Wäre meine Mutter oder ich an Katis Stelle gewesen, hätte er getobt und wäre rot angeschwollen und hätte uns nicht ohne anschließenden Vortrag über die Rechte von Untermietern entlassen.
„Jetzt hatte er es aber eilig“, sagte sie zu mir, nachdem sie zurück war und lachte. „Er ist es nicht gewöhnt, es sich verkneifen zu müssen.“
„Und er hat wirklich nichts zu dir gesagt?“
„Doch!“ Kati lachte laut. „Ich hätte mir doch ruhig Zeit lassen sollen.“ Sie winkte ab. „Macht sich bald in die Hose, aber noch großzügig sein und angeben. Das sind mir die Richtigen!“
Jedenfalls war ich in „ihrer Obhut“, wie unsere Vermieterin es ausgedrückt hatte, nachdem meine Mutter ihr Bescheid gesagt hatte, dass ich nicht allein in der Wohnung sein würde.
Und Kati „obhütete“ mich gut. Sie kochte und wusch für mich und abends spielten wir Halma. Oder wir lauschten einem Hörspiel, wozu sie mich nicht lange auffordern musste, denn ich fand es spannend und unterhaltsam zugleich, Stimmen zuzuhören, zu denen man sich die Sprecher vorstellen konnte. Wenn mir gleich zu Beginn eine Stimme besonders gut gefiel, stellte ich mich sofort auf ihre Seite und somit auch auf die der Person, der diese Stimme gehörte. War sie schließlich die des Schuftes und Bösen, war es mir auch egal. Dann hatte ich eben auf der falschen Seite gestanden.
Das kam jedoch zum Glück nicht oft vor. Erst viel später erkannte ich, dass die Stimmen nach dem Charakter der jeweiligen Figur und deren Bedeutung für die Handlung ausgewählt wurden. Deshalb waren die mit den unangenehm klingenden Stimmen meist die Miesen und Bösen. Kati war von meiner Idee mit der Girlande und dem Begrüßungsspruch, mit der ich sie am Morgen überraschte, begeistert, meinte darauf jedoch, dass wohl kaum irgendeine Aussicht bestehen würde, solche Raritäten auftreiben zu können. Mein Vertrauen in Schwarzkopfs Hinterstube vermochte sie nicht zu teilen, weil sie als Angereiste aus der Großstadt Schwarzkopfs Laden nicht kannte. Umso größer war ihr Erstaunen, als ich nun meine Schätze anschleppte und gleich darauf einen Stuhl heranzog, um eines wie das andere zur Probe über der Tür anzuhalten. Inzwischen war sie zu mir herausgekommen.
„Sieht gut aus!“, lobte sie und fragte dann, wie ich beides befestigen wollte, denn bestimmt ließe es die „Glatze“ nicht zu, dass ich hämmerte und seine schöne Tür verunstaltete.
Aber daran hatte ich selbst schon gedacht und eine alte Niveacremeschachtel hervorgesucht, in der ich sorgfältig Reißzwecken aufbewahrte, die ich aus alten Schrankteilen und anderen Brettern gerettet hatte. Kati war zufrieden und bald darauf begannen wir unsere Arbeit als Empfangs- und Willkommenheißungskomitee.
Danach betrachteten wir unser Werk und staunten, wie gut es uns gelungen war. Noch besser wäre es jedoch, wenn wir es außen hätten anbringen können, meinte Kati und zuckte zugleich die Schultern. Ebenso wie ich wusste sie, dass dies unmöglich war. „Außen“ hätte bedeutet, in Waldis Korridor, in dem sich die Zugänge zu den ihm verbliebenen Räumen wie zu den uns zugewiesenen befanden. „Außen“ hätte zur Folge gehabt, dass sowohl für Waldi wie für seine Frau und seine Schwiegermutter bei jedem Gang über ihren eigenen Korridor meine Girlande und das Spruchband zu Blickfängen geraten wären und den gewohnten Anblick einer ordentlichen Tür verdorben hätten.
Kati wollte dann unbedingt und recht genau wissen, auf welche Weise es mir gelungen sei, die beiden raren Artikel zu beschaffen und meine detailgetreue Antwort verlockte sie, selbst einmal Schwarzkopfs Laden aufzusuchen. Schon oft war sie auf dem Weg vom Bahnhof zu uns daran vorübergekommen, ohne sich allerdings seine ständig wechselnden Schaufensterauslagen anzusehen, was ich nicht verstehen konnte. So beschlossen wir, gelegentlich zu Schwarzkopf zu gehen, nachdem sich Kati ausgedacht hatte, was sie von ihm verlangen wolle. Ich bot ihr eine Wette an, dass er alles, was sie verlange, schließlich aus seiner Hinterstube hervorholen würde.
Das glaubte sie mir nicht und so freute ich mich bereits auf jenen Tag, an dem wir es darauf ankommen lassen wollten. Ich war fest davon überzeugt, dass ich meine Wette gewinnen würde. Darum hoffte ich, dass mich Schwarzkopf nicht im Stich lassen würde.
Dass sie sich aber ausgerechnet einen Springfrosch aus Blech ausdachte, überraschte mich jedoch sehr. Wahrscheinlich habe ich sie danach etwas dümmlich angesehen, denn sie begann sofort, mir diesen Gegenstand genau zu beschreiben: „Der sitzt richtig da wie ein echter. Da brauchst du nur auf den Kopf zu drücken und schon springt er los!“ Sie wies auf den Tisch. „Den nimmt er in drei, vier Sprüngen! Sollst mal sehen, wie lustig das ist! Daran hast auch du deinen Spaß ...“ Sogleich winkte sie jedoch ab. „Aber einen Springfrosch zaubert auch dein berühmter Schwarzkopf nicht hinter seinem Vorhang hervor. Wetten wir?“
Ich nickte. So ganz sicher war ich mir dabei allerdings nicht. Wie hätte ich annehmen sollen, dass sie ausgerechnet einen Springfrosch haben wollte!
Sie streckte ihre Hand aus. „Wenn ich verliere, lade ich dich zu Glöckner zu Kuchen und Eis ein! Abgemacht?“ „Und wenn nicht? Wenn ich verliere?“
„Dann kommst du mit mir zur Bibelstunde!“
Was Schlimmeres konnte sie sich nicht ausdenken. Ich schlug zwar ein, aber umso mehr hoffte ich, dass mich Schwarzkopf nicht enttäuschen würde.