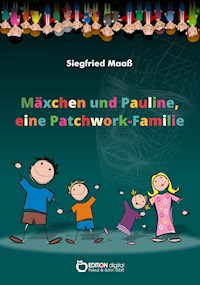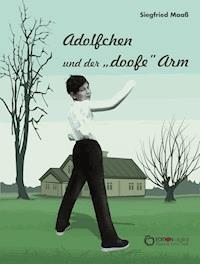7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Es müsste einen Turm geben, von dem aus man sein ganzes Leben überblicken kann – jenes, das bereits hinter einem liegt mit allen Glücksmomenten ebenso wie mit den Unbilden des Schicksals. Aber auch den bevorstehenden Lebensabschnitt, der sich Zukunft nennt. Das wünscht sich Günter, der als Kind von seiner Mutter verlassen wird. In der Familie seines Freundes Peter findet er Aufnahme, so dass beide sich wie Brüder fühlen. Von jenem Turm aus könnte er dann rechtzeitig die ‚Zopfliese’ erkennen, die eines Tages in sein Leben tritt und die Freundschaft beider Jungen erschüttert. Oder in weiterer Ferne das Mädchen Inge, das seinen Platz an Günters Seite sucht. Auch den wissbegierigen ‚Grübel’ und den einflussreichen Mann ‚Biber’ würde er vorzeitig wahrnehmen, und sich auf sie einrichten können. Er ahnt nicht, dass sie einmal sein Leben beeinflussen werden. Weil die Zukunft jedoch nicht von einem Turm aus sichtbar ist, muss der Heranwachsende unvorbereitet alle Konflikte lösen, die sich ihm in der schweren Zeit zwischen Kriegsende und Neubeginn aufdrängen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 470
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Impressum
Siegfried Maaß
Ich will einen Turm besteigen
ISBN 978-3-95655-201-4 (E-Book)
Die Druckausgabe erschien erstmals 1974 im Verlag Neues Leben, Berlin.
Gestaltung des Titelbildes: Ernst Franta
© 2014 EDITION digital®Pekrul & Sohn GbR Godern Alte Dorfstraße 2 b 19065 Pinnow Tel.: 03860 505788 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.ddrautoren.de
1. Kapitel, in dem der Held seinen Vater bekommt, die Benzingase eines Autos schluckt und mit einem dauerhaften Erbe ausgestattet wird
Ich erinnere mich genau an den Tag, als ich, ein Junge von fast zehn Jahren, neben einem befrackten Hochzeitskutscher auf dem Bock saß, eingezwängt in Weste und Hose, in denen ich mich nicht bewegen konnte, ohne ein Reißen in den Nähten zu verursachen. Ich betrat als erster das Portal der St.-Marien-Kirche und sah staunend die Frau in Kranz und Schleier aus der Kutsche steigen, die mich in ihrer merkwürdigen Aufmachung vergessen machte, dass sie meine Mutter war. Ein schwarz gekleideter Mann hielt ihr beim Aussteigen die Hand. Er wäre mein Vater, hieß es, und ich wusste gar nicht, wie es ist, mit einem Vater zu leben.
Von Neugier und Furcht geplagt, erwartete ich die kommenden Tage, denn die Erfahrungen meiner Mitschüler mit ihren Vätern waren zwiespältig.
Als ich schon ein wenig verständiger geworden war, erfuhr ich, dass meine Mutter in diesem ersten Nachkriegsjahr einen Mann auf der Straße verfolgt hatte, weil sie in ihm dem Vater ihres Kindes, meinem Vater, wiederbegegnet war.
Jakob Nentwig stammte aus Bernau, und in der Nähe dieser Stadt war meine Mutter Nachrichtenschreiberin gewesen.
Als sie nun diesem Mann in unserer Stadt nachgelaufen war, sagte sie eines Abends: „Du bekommst einen Vater, deinen eigenen sogar, und er wird dich adoptieren, wenn er erst mein richtiger Mann ist.“
Ich wusste, adoptieren heißt auf einen anderen Namen hören, aber ich begriff nicht, warum mich mein richtiger Vater adoptieren musste, und ich verstand nicht, warum ich plötzlich Nentwig und nicht mehr Apelt heißen sollte. Aber ich war froh, nun einen Namen in der Mitte des Alphabets zu bekommen, denn als Apelt kam ich in der Schule dauernd dran. Immer wieder hieß es: Nach dem Alphabet bitte! Die Tafel säubern, Kreide holen, Papier aufsammeln. Auch die Ausgabe der Zeugnisse und Kiassenarbeiten wurde mit meinem Namen begonnen. „Krähe“, unser Lehrer, machte sich einen Spaß daraus zu sagen: „Von Apelt bis Zeising erlogen!“ Peter Zeising war mein einziger Freund; wir stifteten damals manchen Unsinn an und kam uns Krähe auf die Spur, logen wir, solange es ging. Am Ende kamen fünf Seiten Strafarbeit heraus und die Bemerkung: „Von A bis Z erlogen, alles, was ihr sagt!“
Nach der Hochzeit meiner Eltern weihte ich meine Mitschüler in einen Plan ein: Wenn Krähe die nächsten Klassenarbeiten zurückgab, würde sich kein Apelt melden, Apelt würde tot sein, begraben. Es gab nur noch einen Günter Nentwig, der einen Vater hatte, und dieser konnte mal ein Wort reden mit Herrn Krähe, wenn der es zu weit trieb mit dem bisher Vaterlosen.
An einem schneereichen Wintermorgen war es so weit. In meinen flauschigen Paletot gehüllt und Schal und Pulswärmer tragend, stand Krähe, wie er immer stand: die weit auseinandergewinkelten Arme aufs Palt gestemmt, die Nickelbrille in die Stirn geschoben, vor sich das Klassenbuch, das wir die Bibel nannten. In dieser Pose eines um seine Gemeinde besorgten Gottesknechtes begann er die Zensurenverkündung der Klassenarbeit zu zelebrieren. Indem er das oberste Heft vom Stapel nahm, sagte er gewohnheitsmäßig: „Apelt, du taube Nuss, komm vor!"
Schweigen. Auf der letzten Bank unterdrückte einer das Lachen.
„Apelt, soll ich dir dein Ungenügend vielleicht auf einem Tablett servieren?“
Mein Freund Zeising war es, der sagte: „Wir haben keinen Apelt in der Klasse."
„Schwätzer!“, sagte Krähe und kam von seinem Pult herunter auf mich zu. „Steh auf, du!“, befahl er, und als ich zweifelnd fragte: „Ich?“, fauchte er: „Wer sonst, wer heißt hier noch Apelt?“
Ich sah mich um, zuckte die Schulter und sagte: „Keiner heißt so, ich jedenfalls kenne keinen.“
„Schwätzer!“, sagte Krähe wieder, doch ich bemerkte ein Zögern. Unsicherheit ließ ihn zurückgehen zum Pult und einen langen Blick auf den Namen werfen, der auf dem obersten Heft stand. „Wer ist Nentwig?“, fragte er, blass und hilflos, denn ich hatte vor Beginn der Stunde ein sauberes Etikett auf mein Heft geklebt, das meinen neuen Namen trug.
Neugierige Blicke richteten sich nach der Hochzeit meiner Eltern auf mich. Einmal hörte ich einen sagen: „Nazibengel!“ Andere aus unserer Straße, die mich und meine Mutter bisher nicht beachtet hatten, setzten plötzlich freundliche Gesichter auf, wenn sie uns sahen, und einige kamen und steckten uns heimlich etwas zu: einen Korb Kartoffeln, einen Eimer Kohlen oder ein Paar Schuhe für mich.
Warum die einen so freundlich, die anderen so gemein waren, erfuhr ich, als wir einmal Fußball gegen die Mannschaft einer anderen Klasse spielten. Für mich währte das Spiel nur einige Minuten, denn von den anderen sowie von einigen der eigenen Mannschaft wurde ich bald unsanft gelegt. So am Boden liegend, tief atmend und mich mit Händen und Füßen wehrend, sah ich über mir Gesichter, verzerrt, höhnisch, mit weit geöffneten Mündern, aus denen die Zähne mich anblitzten wie die von Wölfen. „Nazibengel!“ hörte ich und „Judenschreck!“ sagte eine andere Stimme, und dann traten abermals ihre Füße in Aktion. Plötzlich war es über mir wieder hell, und ich konnte den Himmel sehen, denn die Gesichter waren fort. Die lagen nun selbst im Dreck, denn diejenigen, die „Nazibengel!“ gerufen hatten, wurden massakriert von Peter und anderen.'
„Warum rufen sie mich so?“, fragte ich Peter, als wir nach Hause gingen. Er fasste mich am Arm, blickte sich um und sagte ungläubig: „Du weißt es wirklich nicht?“ Und als ich den Kopf schüttelte, sagte er, mein Vater sei ein bekannter Nazi gewesen, in unserer Stadt gäbe es einen, der es genau wüsste, weil er meinen Vater aus dieser Zeit kenne. Wie ein Lauffeuer habe sich das Wissen von meines Vaters Vergangenheit in der Stadt verbreitet.
„Aber warum“, fragte ich, „beschimpfen sie mich?“
Peter, der es auch nicht wusste, fragte seinen Vater, der seit Kriegsende als Bürgermeister in dem historischen Rathaus arbeitete und wohnte. Peters Vater sagte, alle, die mich beschimpft hätten, seien Kinder, deren Väter nicht aus dem Krieg heimkehren würden oder die noch heute in Russland in Gefangenschaft wären. Mein Vater sei zurückgekehrt, das mache die anderen neidisch.
Ich fand, sie hatten keinen Grund, auf meinen Vater neidisch zu sein, aber das konnten sie nicht beurteilen, denn ließ sich mein Vater mit mir auf der Straße sehen, war er der beste Mensch. Einmal holte er mich von der Schule ab, und ich hatte ihn noch gar nicht bemerkt, als ich einen sagen hörte: „Sieh mal, Nentwig sein Vater!“
Und ein anderer sagte: „Was der für’n schönes Fahrrad hat!“ Da erst sah ich ihn. Mein Vater lehnte an einem Baum und ich bemerkte, dass er einen in der Krone hatte, aber er hatte auch ein froschgrünes Fahrrad, das ganz neu aussah und das mich neugierig machte.
„Deins“, sagte mein Vater, und er drückte sich mit dem Rücken vom Baum ab. „Deins“, wiederholte er und schob mir das froschgrüne Rad vor den Bauch. Ich ergriff es am Sattel und sah stolz um mich. Alle aus meiner Klasse standen dabei, und einer rief: „So’n Vater haben, Mensch, was’n Dusel!“
Aber sie wussten nicht, wie er zu Hause war.
„Komm“, sagte mein Vater nun, „probier es aus.“
Ich schwang mich aufs Rad. Alle, die herumstanden, wichen zurück, einen Kreis zu bilden, rund wie eine Manege. Und als ich darin entlang fuhr, stehend, denn meine Beine waren zu kurz, war ich stolz und kam mir dennoch wie ein Clown vor, der zum Ergötzen der anderen seine Nummer abzog.
Jeder wollte eine Runde fahren, und mein Vater teilte mit großspurigen Gesten die Reihenfolge ein.
„Woher hast du es?“, wollte ich zu Hause wissen, und auch meine Mutter fragte es, aber mein Vater lächelte und schwieg.
Was nutzt ein Fahrrad, wenn man darauf nicht fahren darf? Schon am anderen Tage verprügelte mich mein Vater, weil ich es ohne seine Genehmigung aus dem Schuppen geholt hatte, aber jedes Mal, wenn ich fragte, lehnte er ab.
Eines Tages kam ich früher als sonst aus der Schule und schlich unbemerkt in den Geräteschuppen. Leere und Dunkelheit nisteten darin, und die Ratten pfiffen in ihren Löchern. Das froschgrüne Fahrrad war weg.
Am Abend kam mein Vater betrunken heim, er trug einen Rucksack, in dem Flaschen klirrten. Da wusste ich, wo das Rad geblieben war, denn schon einmal war er mit Schnapsflaschen nach Hause gekommen, und er hatte für Mutters große Standuhr Mehl und Kartoffeln eintauschen sollen.
Meine Mutter schien nichts zu ahnen und fragte nach dem Rucksackinhalt. Mein Vater zog die Stiefel aus und schwieg. Da wurde auch Mutter stutzig, sie verfärbte sich und warf das Nähzeug aus der Hand. Als sie den Rucksack erreichte, schleuderte sie mein Vater mit einem Fußtritt weg. Mutter raffte sich auf, sie weinte nicht, schaute meinen Vater nur ungläubig an. Sie ging erneut zum Rucksack, diesmal auf die Bewegungen meines Vaters achtend. Der ließ sie erst gewähren, als sie jedoch die Flaschen entdeckte, eine hervorzog und in ihrem Zorn gegen meinen Vater erhob, schlug er ihr ins Gesicht. Die Flasche fiel und zerschellte. Ich war zu meiner Mutter gesprungen, um sie zu schützen. Mein Vater kroch winselnd am Boden entlang und schleckte den Schnaps auf, der sich in Rinnsalen unter den Tisch und die Stühle ergossen hatte.
Später saßen Mutter und ich im Schlafzimmer. „Das Gift“, sagte sie, „er wird sich noch die Blindheit ansaufen.“
Ich verstand sie nicht. Beruhigend strich ich über ihr Haar. Wir warteten ängstlich darauf, dass mein Vater die von uns verschlossene Tür sprengen und Mutter von Neuem misshandeln würde. Aber er war müde geworden, wir fanden ihn schnarchend auf meinem Bett, als wir den Mut aufbrachten, unser selbst gewähltes Gefängnis zu verlassen.
Schon damals wusste ich, dass der Sinn einer Hochzeit nicht darin besteht, eine Frau, die vordem lachen konnte, zum Weinen zu bringen. Aber wenn mein Vater etwas verstand, dann war es dies: Er konnte das Gesicht meiner Mutter böse machen und ihre Augen tränenreich.
Einmal erwachte ich, weil, wie ich glaubte, eine Detonation unser Haus erschüttert habe. Meine Mutter schrie, und irgendwo klirrten Fensterscheiben, während die laute Stimme meines Vaters alles übertönte. Als ich die Tür meiner Kammer aufriss, hangelte eine Schattenfigur zum Wohnzimmerfenster herein, es war mein Vater, der rief: „Ich schmeiß euch raus!“
Von seinen zittrigen Händen gehalten, wippte er, den Oberkörper im Zimmer, die andere Körperhälfte außerhalb, über dem Zweietagenabgrund wie ein Brett auf und ab. Meine Mutter hatte sich in eine Ecke gepresst, die Faust in den Mund gestopft und sah dem Betrunkenen bei seinem Balanceakt zu. Mein Vater getraute sich nicht, die Hände vom Fensterbrett zu nehmen, denn die Knobelbecher hätten ihn in die Tiefe gezogen. Zwischen Weinen und Lachen sprang ich ans Fenster und riss meinen Vater ins Zimmer. Er schlug mit dem Kopf auf die Dielen, blieb dort liegen in seinem Suff und grunzte vor Bequemlichkeit. In dieser Nacht floh meine Mutter zu mir, und wir vergaßen nicht, ein Brett unter die Klinke der Kammertür zu stellen.
Ein anderes Mal kam Peter Zeising gelaufen, es war finster, und der Wind pfiff durch unser verpapptes Fensterloch. Sein Vater, der Bürgermeister, schicke ihn, denn im Rathaus hielten sie meinen Vater fest, der gegen die neue Ordnung räsoniere.
Auch meine Mutter und ich konnten ihn nicht beruhigen, als wir hingelaufen waren, um das Schlimmste zu verhüten. Zeisings Vater und zwei Hilfspolizisten hatten meinen Vater mit seinem eigenen Gürtel an das Geländer geschnallt, hinter das man nicht durfte, wenn man als Fremder, als Bittsteller oder Bestellter, ins Rathaus kam.
Mein Vater hing wie leblos in dem Riemen, und nur seine baumelnden Arme brachten Bewegung ins Bild.
„Reni“, sagte Zeisings Vater, denn meine Mutter hieß Irene, „sag du ihm was Beruhigendes!“
Aber meine Mutter hatte die Hand vors Gesicht gehalten, als sie meinen Vater so hängen sah, sagte nichts, schluckte nur und presste, und einer der Hilfspolizisten machte den Fehler zu sagen: „Deine Dummheit, Reni, alleine wärste besser gefahren. Sieh dir doch das Schwein an!“
Da schrie meine Mutter auf, und mein Vater kam zu sich. „Macht doch Licht“, lallte er, „warum lasst ihr mich denn im Dunkeln? So macht doch endlich Licht!“
Zeisings Vater riss den Kopf meines Vaters hoch und ließ den Lichtstrahl seiner Taschenlampe ihm ins Gesicht scheinen. „Hier haste Licht“, sagte er, „aber hoffentlich ist bei dir bald Licht im Kopp!“
Ich ging ans Geländer und löste den Gürtel, die anderen fingen den schweren Körper auf.
„Wartet mal“, sagte Peter Zeising und rannte hinaus. Polternd kehrte er mit einer Mistkarre zurück, und wortlos sackten wir meinen Vater hinein. Einer der Hilfspolizisten schob die Fuhre zu uns nach Hause, begleitet vom Wortgestammel meiner Mutter, aus dem wohl nur ich einen Sinn wie: Schwein ist nicht zuviel gesagt! heraushören konnte. Dann wieder seufzte sie laut und schnäuzte sich mit dem Schürzenzipfel.
Am anderen Tag verlangte mein Vater noch immer nach Licht, aber es war taghell und die Sonne stand hoch. Meine Mutter war aufs Land hamstern gefahren, und ich stand am Bett und hörte ihn sagen: „Mach die Lampe an, es ist so gruselig.“ Ich tat, als wäre ich nicht da, hatte Angst, mich zu rühren. Aber dann bekam ich Mitleid, ich ging an die Tür zum Lichtschalter, knipste an und gleich wieder aus, so schnell, dass er nicht merkte, dass ich ihn betrog, und sagte in ärgerlichem Tonfall: „Mal wieder abgestellt“, und als mein Vater etwas Unverständliches murmelte, sagte ich noch einmal: „Stromsperre, Vater, da müssen wir eben weiter im Dustern sitzen.“
Als ich nun wusste, wie es ist, mit einem Vater zu leben, war schon alles wieder vorbei.
„Er ist erblindet“, sagte der Arzt, „wir bringen ihn am besten in eine Anstalt.“
Meine Mutter sagte nichts, strich nur mit der Hand durch ihr Haar, und ihre Augen blieben trocken.
Als sie meinen Vater zum Krankenhaus brachten, biss er einen der Krankenwärter in den Arm und trat um sich. Meine Mutter ließen die Wärter nicht zu meinem Vater steigen, sie musste neben dem Fahrer Platz nehmen, während der andere meinen Vater unter Kontrolle hielt.
Ich sah dem Fahrzeug nach, seine Benzingase krochen mir in die Nase, und immer, wenn ich später Bezingase roch, dachte ich an den mit meinem Vater abfahrenden Krankenwagen.
In der Anstalt verbrachte mein Vater nur kurze Zeit. Wir begruben ihn neben der Grabstelle meiner Großeltern.
Ich trug seinen Namen als einziges Erbe.
2. Kapitel, in dem der Held vor einer Reise flieht, eine Papptafelaufschrift entziffert und an einem stillen Ort Tränen vergießt
Bald nach meines Vaters Tod begann für mich und meine Mutter ein neues Leben, aber neu heißt nicht besser. Ich lebte nun wieder allein mit ihr, doch die Zeit mit meinem Vater hatte meine Mutter verändert. Sie überließ mich mir selbst, fand kaum ein gutes Wort für mich und trug mir immer mehr Arbeiten auf, die ich in ihrer Abwesenheit zu erledigen hatte. Meist ging sie aus dem Haus, wenn die Dunkelheit kam, und kehrte zurück, wenn der Tag schon vor den Fenstern stand. Sie kam nicht immer allein nach Hause, und der Mann, der dann bei ihr war, war nur selten derselbe wie am Tag zuvor.
Einmal erwachte ich, weil gegen die Scheibe meines Kammerfensters geworfen wurde. Ich fuhr hoch und erschrak, denn es musste schon spät sein. Wenn mich meine Mutter sonst weckte, fiel durch das obere Fensterdreieck ein einziger Sonnenstrahl ins Zimmer. An diesem Morgen aber stand die Sonne prall und rund im Oberlicht.
„Was ist denn los?“ Das war die Stimme von Peter Zeising.
Ich riss das Fenster auf. Es muss Sonntag sein, dachte ich, denn meine Mutter hatte mich nicht zur üblichen Zeit geweckt.
„Du pennst noch?“, rief Peter. „Mensch, nun beeil dich aber! Wir kommen sonst zu spät!“
Es war also kein Sonntag. Ich zog mich schnell an, griff zur Mappe, und weil die Wohnung leer und verschlossen war, schlug ich die Türscheibe kaputt und kletterte hindurch.
Ich rufe schon eine kleine Ewigkeit“, sagte Peter vorwurfsvoll, „dabei bin ich heute besonders früh gekommen, weil du mir noch mal den Ansatz zeigen solltest.“
„Jetzt ist es zu spät“, sagte ich, als vom Rathausturm die Glocke schlug.
Als wir die Straße hinunterrannten, rief Peter neben mir: „Und heute ’ne Arbeit schreiben! Du meine Güte, ich habe keinen blassen Schimmer von dem Ansatz!“
Wir überstanden aber die erste Stunde und mit ihr die Klassenarbeit, und erst danach konnte ich zu Peter Zeising sagen: „Ob ihr was passiert ist? So lange ist sie noch nie weggeblieben.“
„Ach“, sagte er, „deine Mutter ist doch überall bekannt. Man hätte dich schon benachrichtigt. Was soll denn passiert sein?“
Das wusste ich ja selbst nicht, und ich dachte auch an nichts Schlimmes, aber trotzdem berührte mich das Wegbleiben meiner Mutter mehr, als ich zugab. Ich hatte keine klare Vorstellung von dem, was meine Mutter während ihrer nächtlichen Ausflüge trieb, aber es musste eine Art von Beschäftigung sein, durch die sie Geld verdiente. Wir hatten vordem nie so reichlich zu essen, und meine Mutter konnte sich jetzt Kleider und Strümpfe leisten. Für mich war ein Paar Schuhe abgefallen, das neu und ganz aus Leder war.
Meine Mutter öffnete mir, als ich aus der Schule kam. Sie strich mir das Haar aus der Stirn, und ich sah, dass sie geweint hatte. Sic fragte mich, ob ich Hunger hätte, was sie sich ja wohl denken konnte.
„Ich kann dir ein Stück Fleisch braten“, sagte sie, aber ich lehnte ab, obwohl mir das Wasser im Munde zusammenlief. „Bist du krank?“, fragte sie.
„Nein, aber ich habe schon gegessen.“
Meine Mutter glaubte mir nicht, das sah ich ihr an, darum fügte ich hinzu: „Du kannst ja Peter Zeising fragen, bei ihm habe ich nämlich gegessen.“
„Beim Bürgermeister?“, fragte sie.
Ich bemerkte, wie peinlich es ihr war, sagte aber trotzdem: „Ja, beim Bürgermeister.“ Es war nicht einmal die halbe Wahrheit, weil mir Peter nur von seinem Frühstücksbrot abgegeben hatte. Seine Einladung zum Mittagessen hatte ich abgelehnt. Was hätte ich denn sagen sollen, wenn sich sein Vater nach meiner Mutter erkundigt hätte? Ich wusste, dass ihr die Leute vorwarfen, sich nicht genügend um mich zu kümmern, und ich vermied es, ihnen Gelegenheit zu geben, mich darum zu bedauern.
Zugleich mit dem Winter zog ein Mann bei uns ein, den meine Mutter bediente, der die Beine nur unter den Tisch oder die Bettdecke zu stecken brauchte. Da oder dort blieben sie den ganzen Tag. Seitdem hatte ich noch mehr zu tun, weil ich für den Fremden, der plötzlich mein Onkel sein wollte, Wege gehen und Geschäfte erledigen musste, das heißt Pakete und Päckchen von einer Stelle an eine andere bringen. Die Brieftasche des Fremden stand prall unterm Jackett.
Was abends hinter der verschlossenen Zimmertür geschah, weiß ich nicht. Sehen oder hören konnte ich nichts, denn meine Mutter hatte von innen einen dicken Vorhang angebracht.
Eines Morgens, als ich gerade zur Schule gehen wollte, kam meine Mutter aus ihrem Zimmer heraus. Sie war in einen Bademantel gehüllt, trug die Haare aufgelöst, und ihre Stimme klang brüchig. „Wo willst du hin?“, fragte sie, und ich dachte, dass sie vielleicht vergessen hätte, dass ich zur Schule musste, denn sie hatte mich auch nicht geweckt. Jetzt fiel ihr Blick auf meine Schultasche, und sie sagte: „Schule? Heute nicht, ich gebe dir frei.“
Ich sah sie ungläubig an, griff die Tasche und wollte wortlos an ihr vorbei.
„He, was soll das?“, hörte ich den Mann rufen, der in Unterhosen hinter meiner Mutter stand, groß und jung.
„Ich muss zur Schule“, sagte ich.
Der Mann schüttelte lächelnd den Kopf. „Du hast doch gehört, heute nicht.“
„Wir verreisen“, sagte meine Mutter, „wir müssen noch ein paar Sachen packen.“
„Na, beweg dich, steh nicht rum! Nimm deinen Rucksack und stopf hinein, was du kannst. Hast doch gehört, dass wir verreisen.“
Nun sah ich plötzlich jenes Bild vor mir, das meine Mutter vor Tagen in lebhafter Weise und vielversprechend entworfen und das die farbigen Tupfer von Apfelsinen und Schokolade enthalten hatte. Beides sah ich nun greifbar nahe vor mir. Meine Mutter hatte es mir im Ton einer Märchentante vor Augen geführt.
„Er ahnt schon was“, sagte sie zu dem Mann und kam auf mich zu. „Ich habe dir doch davon erzählt“, sagte sie, „es wird dir dort gefallen, du wirst dich dort wohlfühlen. Aber nun beeile dich!“
„Ich will nicht“, rief ich, und als der Mann mich am Handgelenk packte, presste ich meine Zähne in seinen behaarten Arm. Er ließ mich los und holte zum Schlag aus, aber ich warf ihm meine Schultasche ins Gesicht und rannte an ihm vorbei, an ihm und meiner Mutter, deren Schritte ich hinter mir hörte.„Günter“, rief sie mehrmals, doch ich stob über die Straße und hielt erst inne, als ich im Rathaus stand, wo ich die Stimme von Zeisings Vater vernahm. Dann kam Peter die Treppe herab, sah mich, stutzte.
„Was ist denn los?“, fragte er und zog mich aus dem Haus. „Komm hier weg, ehe mein Vater uns sieht, der ist heute nicht gut auf euch zu sprechen. Hat denn deine Mutter was ausgefressen, oder der Heini vielleicht, der bei euch wohnt?“
„Ich weiß nicht“, sagte ich und blickte ihn unsicher an.
„Na, ich auch nicht, habe nur gehört, wie mein Vater fürchterlich auf deine Mutter geschimpft hat. Er hat heute früh einen Anruf bekommen, und dann ist er wie wild durchs Zimmer geschossen. Weißt du wirklich nicht, was passiert ist?“
„Nein“, sagte ich und wollte lächeln, was aber misslang, denn mir war zum Heulen zumute.
„Mensch, du machst ’n Gesicht wie ... Wo hast du deine Mappe?“
Ich deutete hinter mich.
„Was denn, zu Hause gelassen? Bist du etwa abgehauen? Darum dampfst du auch wie ein Gaul.“
Ich nickte.
„Wieder mal Krach, was? Na, gehen wir, nach der Schule haben sie sich vielleicht wieder beruhigt.“ Er zog mich am Jackenärmel mit sich, und ich hatte nicht den Mut zu sagen, was zu Hause vorging.
Zur Vorsicht nahm ich meinen Freund nach dem Unterricht mit, denn ich hatte die Erfahrung gemacht, dass meine Mutter freundlicher war, wenn ich in Begleitung kam. Peter war nicht ängstlich, er ging voran und klopfte forsch an unsere Wohnungstür. Aber es blieb still dahinter, auch als Zeising die Faust nahm.
„Nicht da“, sagte er dann, „um so besser. Du kannst so lange zu uns kommen.“
Wir trabten die Straße entlang, und Zeising trieb einen Stein vor sich her.
„Nun komm schon, mein Alter frisst dich nicht. Er sieht es zwar nicht so gern, dass ich mich mit dir abgebe, aber eigentlich hat er nichts gegen dich. Er hat nur eine Stinkwut auf deine Mutter. Du tust ihm leid, glaube ich.“
„Hör auf“, sagte ich, „außerdem geht es mir gar nicht um deinen Vater.“
„Was hast du eigentlich?“
„Meine Mutter kommt überhaupt nicht mehr wieder.“ Zeising blieb stehen und wandte sich nach unserem Haus um, als würde er so den Sinn meiner Worte begreifen. „Wieso? Verstehe ich nicht.“
Ich schilderte ihm meine Flucht am Morgen und die Worte, die zuvor gesagt worden waren. Wir stürmten ins Rathaus, und Peter wollte ins Zimmer seines Vaters. Herr Zeising hatte darin eine Konferenz, und das Fräulein im Vorzimmer fuhr uns an, was wir uns wohl herausnähmen.
„Er ist mein Vater“, sagte Peter, „und ich kann ihn sprechen, wann es mir passt.“ Er schob sie zur Seite, und sie musste sich auf den Schreibtisch stützen, dabei fiel ein Stuhl um.
Durch das Geräusch kam Herr Zeising von selbst heraus. Er erkannte die Situation und rief: „Was randaliert ihr? Was soll das? Für dich bin ich zu Hause zu sprechen, merke dir das endlich! Hier bin ich im Dienst!“
„Vater“, sagte Peter Zeising, „bei Günter hört keiner, für immer weg, abgehauen! Du musst was tun!“
Peter ging in großem Bogen um das Fräulein herum, dem Vater nach, der schon in sein Zimmer zurück wollte. Auf der Türschwelle drehte sich der Bürgermeister um und ließ Peter herankommen. „Was sagst du?“
„Alles zu, für immer weg, sagt Günter.“
Der Bürgermeister riss den Kopf zu mir herum und blitzte mich aus hervorquellenden Augen an. „Wer ist weg?“
Das klang wie eine Formel, und ich wusste, dass sie jedes Mal aufs Neue hinter vorgehaltenen Händen getuschelt wurde, wenn wieder einer der Schaufensterreklame gefolgt und nach drüben gegangen war.
„Deine Mutter etwa?“
Ich nickte nur, und der Bürgermeister rief die anderen Männer aus seinem Zimmer, erklärte ihnen, was vorgefallen war, und allen voran lief er auf die Straße und unser Haus zu.
Aber auch als Herr Zeising seinem zaghaften Pochen ein Krachen von Fußtritten folgen ließ, öffnete niemand, und er beauftragte Peter, den Schlosser zu holen. Während wir warteten, musste ich berichten, was am Morgen passiert war. „Und du solltest den Rucksack packen?“
„Hm. Aber ich wusste, was das bedeutet.“ Und ich erwähnte, was meine Mutter mir Tage zuvor in bunten Bildern wie eine Glück versprechende Märchentante geschildert hatte.
„Und warum bist du nicht sofort zu uns gekommen und hast alles erzählt?“, fragte einer und kam mir bedrohlich nahe.
Herr Zeising hielt ihn zurück. „Sollte er denn seine Mutter verpfeifen? Außerdem war doch gar nicht sicher, dass die beiden abhauen.“
„Du siehst es ja nun, hauen ab und lassen den Jungen hier.“
„Wahrscheinlich haben sie Wind bekommen“, sagte ein anderer, „sie wussten, dass wir ihnen auf der Spur sind.“
Herr Zeising drückte mich plötzlich an sich und zog meinen Kopf an seine Brust.
Dann kam Peter mit dem Schlosser. „Bitte!“, sagte der nach kurzer Zeit, drückte die Klinke herunter, und die Tür sprang auf. Herr Zeising nahm mich bei der Hand, setzte entschlossen einen Fuß über die Schwelle, reckte den Hals und blickte in den Raum. Es war die Küche, und es sah darin wie nach einer Schlacht aus: Zerbrochene Teller und Tassen, Scherben von der Büfettscheibe, Holzsplitter und Kissenfedern lagen herum, wohin wir traten, klirrte und knackte es. Im Zimmer dahinter hingen die Gardinen in Fetzen, der Schrank war umgekippt, und an der Lampe baumelte eine Papptafel.
„So ein Aas!“, sagte einer der Männer, die uns gefolgt waren. Er trat von der Papptafel zurück, und ich drängte mich heran und entzifferte die Aufschrift: „Leckt uns am Arsch! Versorgt den Jungen gut! Ich hole ihn nach!“
Die unteren Sätze, in denen von mir die Rede war, waren von meiner Mutter geschrieben, ich erkannte ihre schnörkellosen Buchstaben, die nach vorn kippten. Den ersten Satz musste der Mann geschrieben haben, der seine Beine unter unseren Tisch gesteckt und für den ich Botengänge gemacht hatte.
Peter Zeising legte den Arm um meine Schulter und sah mich an. „Mach dir nichts draus“, sagte er, während die Männer aufgeregt über das Vorgefallene sprachen. „Weißt du was?“, rief er dann, „du kannst doch zu uns kommen! Mensch, das ist ein Gedanke!“ Er boxte mich vor die Brust, sagte, ich solle nicht traurig sein, und ging zu seinem Vater hinüber.
Im Innersten war ich noch nicht davon überzeugt, dass meine Mutter mich wirklich verlassen hatte.
Da trat Peter wieder zu mir und sagte: „Komm nach Hause, mein Vater ist einverstanden. Du kannst erst mal bei uns bleiben. Denk nur nicht, dass du ohne deine Mutter nicht auskommst.“
Wir gingen mit den Männern zum Rathaus zurück, und als habe er einen Halt nötig, stützte sich Herr Zeising auf mich. Ehe er mit den Männern die Diensträume betrat, sagte er zu mir: „Nun lass den Kopf nicht hängen, Junge! Wir drei Männer werden schon gut miteinander auskommen. Und was später wird, wird sich finden!“
Am Abend blieb ich lange auf der Toilette, weil dort niemand meine Tränen bemerkte.
3. Kapitel, in dem der Held zum Lebensunterhalt beiträgt, von Hundeschnappern überfallen wird und den Bürgermeister vor eine Entscheidung stellt
Ich heulte noch manches Mal, wenn ich an meine Mutter dachte, von der ich kein Lebenszeichen erhielt, nicht mal eine Karte. Aber nach und nach fand ich mich damit ab, denn Peter und sein Vater gaben sich Mühe, mich auf andere Gedanken zu bringen. Dann glaubte ich, ohne meine Mutter vielleicht viel eher ein richtiger Kerl zu werden, und stellte mir vor, jeden Morgen mit der Sonne erwachen zu können im freudigen Vorgefühl auf das Kommende. Ich wollte aus meinem Leben etwas machen. Doch dann hörte ich die Leute über meine Mutter reden, sie sagten, nur durch ihre Flucht habe sie sich der Festnahme entziehen können. Sie wäre in die Schiebergeschäfte jenes Mannes verwickelt gewesen, für den ich Botengänge gemacht hatte.
Eines Abends, als ich schon nicht mehr wegen meiner Mutter weinen musste, fragte Herr Zeising, ob ich eine Vorstellung vom Inhalt der Pakete gehabt hätte, die ich für den Mann austragen musste.
„Nein“, sagte ich, und es entsprach der Wahrheit. Ich besann mich nur, dass die Empfänger immer schnell die Tür hinter mir schlossen, mich also nie auf dem Treppenflur stehen ließen. Sie führten mich in irgendeinen Raum, gingen mit dem Paket hinaus, und ich nahm an, dass sie es öffneten und den Inhalt prüften. Wenn sie dann wiederkamen, stellten sie mir eine Quittung aus, die ich dem Mann, der bei uns wohnte, aushändigen musste.
„Du weißt es also nicht?“, fragte Herr Zeising nochmals.
„Nein“, sagte ich und berichtete, wie sich die Leute verhalten hatten.
„Wie man nur Kinder in solche Sachen hineinziehen kann!“, sagte Herr Zeising, wohl zu sich selbst, weckte aber damit meine Neugier.
„Die Leute sagen, dass man meine Mutter eingesperrt hätte, wenn sie nicht gerade noch rechtzeitig über die Grenze gegangen wäre.“
„Das stimmt, aber es wäre besser für sie gewiesen“, sagte Herr Zeising, „ich weiß nicht, ob du das verstehen kannst.“
Wir saßen in der Küche um den Herd, nachdem wir das Abendbrotgeschirr abgewaschen hatten.
„Deine Mutter war an den Schiebergeschäften dieses Fremden beteiligt, der zuletzt bei euch gewohnt hat. Er hatte einen Schwarzhandel mit amerikanischen Zigaretten und anderen Dingen, die er aus den Westzonen bekam, aufgezogen. Deine Mutter hat ihm neue Abnehmer besorgt, zu denen du die Pakete bringen musstest. Aber du hast auch Pakete abgeholt, nicht wahr? Das waren nun wieder Leute, die eine Art Zwischenhandel betrieben. Der Freund deiner Mutter hatte sie alle in der Hand.“
„Und das haben Sie gewusst?“
.Leider nicht“, sagte er, „wir wussten damals nur, dass deine Mutter und ihr Freund damit zu tun haben, ahnten aber nicht, dass sie quasi das Hauptquartier waren.“
„Und wie war das mit dem Anruf?“, fragte Peter seinen Vater. „An dem Morgen, als Günters Mutter abgehauen ist, hast du doch einen Anruf bekommen. Du hast dann furchtbar auf Frau Nentwig geschimpft.“
Herr Zeising strich mit der Hand durch sein Haar und nickte. „Der Anruf kam ein paar Stunden zu spät“, sagte er, „denn durch ihn erfuhr ich, wo das Hauptquartier der Schieber war. Wir wollten alles gründlich vorbereiten und warteten auf die Genossen der Volkspolizei, die gerade einen anderen Einsatz hatten. Aber dann war es zu spät, die beiden waren schneller.“
Er erhob sich und öffnete die Herdklappe, das Feuer dahinter glomm nur noch schwach. Und weil die Frühlingsabende noch sehr kalt waren, schüttete Herr Zeising etwas Kohlenstaub auf die Glut, und aus den Herdritzen drang bald beißender Rauch. Herr Zeising sagte, nachdem er sich von einem erstickenden Husten erholt hatte: „Es tut mir leid für dich, Günter, und deine Mutter hat schlimm an dir gehandelt. Für deine Mutter wäre es sicher besser gewesen, wenn wir sie gefasst hätten, jetzt ist sie den Schiebern völlig ausgeliefert, und es gibt keinen, der ihr je helfen wird.“
Ich konnte mir nicht vorstellen, wie Mutter dort lebte, wo sie jetzt war, doch ich war froh, dass sie nicht im Gefängnis saß, aber ich wünschte, dass die anderen, die wie meine Mutter schuldig waren, dorthin kamen.
„Ich könnte die Leute nennen, zu denen ich die Pakete gebracht habe. Würden die dann ins Gefängnis kommen?“ Herr Zeising sah mich aufmerksam an. Seine schmalen weißen Augenbrauen lagen fast waagerecht über den forschenden Augen. Peter lehnte an der Tür und schwieg. Wie mich, interessierte auch ihn die Antwort seines Vaters.
„Das kommt drauf an“, sagte Herr Zeising. „Wenn sie mit der Not der einen und dem Geld der anderen spekulieren, wenn sie Wuchergeschäfte machen und die Ordnung stören, kennen wir eine unangenehme Art der Erziehung. Sie werden eingesperrt.“
„Bei Wasser und Brot?“, fragte ich.
Herr Zeising lachte auf. „Du willst es aber genau wissen.“
„Viel mehr als Wasser und Brot haben wir auch nicht“, sagte Peter, „und wir haben nichts verbrochen und sitzen nicht im Gefängnis.“
Peter hatte recht. Ich konnte jetzt, da ich bei Zeisings lebte, ermessen, wie gut es uns durch die Geschäfte meiner Mutter und ihres Freundes gegangen war. Dagegen herrschte bei Zeisings Not, und der Lederriemen hielt meine Hose nicht mehr. Ich musste erst ein neues Loch hineinbohren.
Dabei störte mich Peter am anderen Tag. Ich stand im Stall vor dem Hauklotz, auf dem der Riemen lag, und schlug mit dem Hammer einen Nagel durch das Leder.
„Was machst du da?“
„Nichts weiter“, sagte ich, „ich schlage nur ein neues Loch in den Gürtel, damit die Hose nicht rutscht.“
„Du hast Hunger“, sagte er, „gib es zu.“
Ich schwieg. Hatte ich einen Grund, hatte ich überhaupt das Recht, mich zu beklagen? Ich wusste doch, dass fast alle Kinder so wenig hatten wie ich. Nur die beiden Bauernjungen aus unserer Klasse kamen mit dick belegten Frühstücksbroten, und auch Manni, dessen Vater Arzt war. Aber während Manni fast jeden Tag einem anderen von seinem Frühstücksbrot abgab, stellten sich die Bauernsöhne mitten in die Klasse oder auf den Schulhof, fraßen um die Wette und hatten ihr Vergnügen an den hungrigen Blicken der Umstehenden. Wenn sie satt und besonders guter Laune waren, hielten sie die Reste ihrer Mahlzeit zwischen zwei Fingern und ließen die Hungrigsten von uns danach schnappen. Dazu mussten sich diese hinhocken und auf das Kommando „Fass zu!“ warten. Wenn sie dann hochsprangen, zogen die Fresssäcke die Happen zurück und wollten sich vor Lachen ausschütten. Manchmal schnappte einer der hockenden Jungen schon vor dem Kommando zu, riss dem Satten den Brotrest aus der Hand und rannte davon. Dann stand der Bengel da und stampfte mit dem Fuß, schrie auf und rief, man habe ihn bestohlen. Ein herbeieilender Lehrer musste ihn beruhigen, er tat das, indem er versprach, den „Dieb“ zu bestrafen. Mit einem zufriedenen Lächeln auf dem dicken, rot geäderten Gesicht ging der Bauernjunge davon. Derjenige aber, der nach dem Brot geschnappt hatte, musste eine Strafarbeit schreiben: „Warum muss ich das Eigentum anderer achten?“
„Du hast Hunger, nicht wahr?“, fragte Peter wieder.
„Du etwa nicht?“
Er schwieg, und ich erzählte ihm von meinen Gedanken an die Hundeschnapper. Peter rieb sich die Fäuste und verzog hasserfüllt das Gesicht. „Wenn die das nächste Mal Hundeschnappen spielen wollen, schlage ich ihnen die Zähne ein!“
„Gegen die kommst du nicht an, die haben Bärenkräfte.“
„Egal“, sagte er.
„Ich weiß was Besseres“, sagte ich, legte meinen Gürtel um und zwang den Dorn durch das neue Loch.
„Was hast du vor?“
„Wir holen uns von ihnen, was wir brauchen!“
Peter sprang zur Tür und zog sie ins Schloss, im Schuppen war es nun dunkel, nur durch die Bretterritzen drangen einige Streifen Frühjahrssonne. „Mensch“, sagte Peter, „willst du klauen?“ Er stützte sich auf den Hauklotz und sah mich erschrocken an.
„Sieh mal“, sagte ich und nahm einen Spaten von der Bretterwand.
„Ein Spaten“, sagte Peter, „und was willst du damit?“
„Kartoffeln ausgraben! Du brauchst ja nicht mitzumachen, ich mach’s auch alleine.“
Eine Zeit lang herrschte Stille in dem Bretterverschlag, ich hörte meinen Herzschlag und Peters Atem.
„Und wo?“, fragte er schließlich.
Ich hatte beobachtet, dass die beiden Bauernjungen mit ihrem Vater aus einer Scheune am Stadtrand Kartoffeln geholt hatten, es war ein ganzer Pferdewagen voll. „Sie haben dort eine Miete, verstehst du? Denkst du vielleicht, die merken, wenn wir uns einen Sack voll holen?“
„Und was sagen wir meinem Vater? Woher haben wir dann die Kartoffeln?“
„Ach, es wird uns schon was einfallen!“ Ich hatte erwartet, dass Peter sofort begeistert von meinem Plan sein würde, nun war ich enttäuscht. Begriff er denn nicht, dass ich nur etwas zum Lebensunterhalt beitragen wollte? Ich sah, dass Peter und sein Vater das Wenige, das sie besaßen, mit mir teilten. Nun hatte ich eine Möglichkeit entdeckt, etwas von dem, das ich ihnen entzog, zurückzuerstatten. Konnte Peter mich wirklich nicht begreifen?
„Überleg mal, von wem wir es nehmen. Meinst du, die würden deshalb hungern? Denk ans Hundeschnappen! Verprügeln können wir sie immer noch!“
Peter schwieg, und ich hoffte noch, dass er mitmachen würde, aber er fragte nur wieder: „Und mein Vater? Stell dir vor, es kommt heraus, und die Leute sagen, der Sohn vom Bürgermeister klaut bei Bauern Kartoffeln!“
„Es kommt nicht heraus, verlass dich darauf!“
„Trotzdem“, sagte er, „nein, lass die Finger davon!“
„Gut“, sagte ich, „dann mache ich‘s alleine!“ Ich öffnete die Tür und ging hinaus.
Ich kam unbemerkt aus dem Haus und schlich über den Hof in den Schuppen. Den Spaten und einen Sack hatte ich am Nachmittag dort bereitgelegt. Der Mond stand über dem Wolkengebirge, das er in weißes Licht tauchte. Ich wusste, dass Peter in seinem Bett tausend Ängste ausstand, er hatte mich bis zuletzt von meinem Plan abhalten wollen.
Ich schwang mich über das eiserne Tor. Mein Fuß schlug polternd dagegen, aber es blieb überall still. So sehr ich auch den Atem anhielt und lauschte, ich vernahm kein anderes Geräusch als entferntes Hundegebell.
Ich befand mich zum ersten Mal auf einem solchen Beutezug. Noch konnte ich umkehren. Wie sollte ich aber dann zum Lebensunterhalt beitragen? Unsinn, dachte ich, deswegen wirst du nicht zum Verbrecher. Nutzte ich etwa die Not anderer, um zu wuchern? Der Bauer würde nicht einmal bemerken, dass Kartoffeln fehlen.
Am Ende der Straße blieb ich einen Augenblick stehen. Bis zur Scheune war es nicht mehr weit. Mir fiel plötzlich ein, dass sie verschlossen sein würde. Was sollte ich tun? Zurückkehren und Peter die Freude lassen, weil nun doch nichts aus meinem Plan geworden war? Ich lief den Feldweg entlang, der von der Straße abzweigte. Regen hatte ihn aufgeweicht, und die Lederschuhe, die noch von meiner Mutter stammten, glitten in den Morast und sogen die Feuchtigkeit auf.
Endlich sah ich die Scheune vor mir, sie erhob sich aus der nächtlichen Einöde wie ein Fels.
Vor das hölzerne Tor war ein Riegel geschoben, der von einem Schloss blockiert wurde. Es war also eingetreten, was ich befürchtet hatte. Ich schlich um die Scheune, weil ich hoffte, irgendwo eine Lücke in der Bretterwand zu entdecken. Ich fand einen schmalen Zwischenraum, in den ich das Spatenblatt steckte. Mit ganzer Kraft stemmte ich den Spatenstiel zur Seite. Es krachte und splitterte, und ich hatte ein Brett gelöst. Ich zwängte mich durch die Lücke. Hinter der schützenden Bretterwand zog ich die Taschenlampe hervor, die zu den wenigen Dingen gehörte, die ich aus der Wohnung meiner Mutter mitgenommen hatte. So weit der Lichtstrahl reichte, sah ich nur Stroh. Nichts, was auf eine Kartoffelmiete hinwies. Aber ich hatte selbst gesehen, dass der Bauer mit seinen Söhnen den Wagen in dieser Scheune mit Kartoffeln beladen hatte. Ich suchte jeden Meter des Erdbodens ab. Plötzlich sank ich bis zum Bauchnabel in ein Loch. Ich wühlte Stroh zur Seite und ließ den Lichtfinger der Taschenlampe über den Boden des Loches tasten. Es war die Miete, aber sie war leer. Warum, dachte ich, legt der Bauer Stroh darüber, wenn sie leer ist? Ich tastete mich vorwärts und riss das Stroh weg. Am Ende des Grabens entdeckte ich, was ich suchte! Vor Freude warf ich mich auf die Kartoffeln und breitete die Arme darüber. Am liebsten hätte ich meine Freude hinausgeschrien, aber ich schwieg und strich liebevoll über die runden Früchte. Ich erhob mich und stopfte den Sack und die Hosentaschen mit Kartoffeln voll. Ich hatte Mühe, den schweren Sack über die Kante des Grabens zu ziehen, und als ich ihn endlich hochgewuchtet hatte, nahm ich ein Geräusch wahr, das mir das Blut in die Adern trieb. Ein großes Tier kroch auf mich zu. Zuerst dachte ich an eine Ratte, weil ich gelesen hatte, dass eine Schiffsbesatzung von Ratten überfallen worden war. Aber es musste größer als eine Ratte sein, das Stroh gab unter den Tritten des Wesens nach und raschelte unheimlich. Der Bauer, dachte ich und kollerte mich in die Miete. Du musst ihn mit der Lampe blenden, dachte ich, in die Augen blenden und abhauen! Ehe er sich in der Dunkelheit wieder zurechtfindet, bist du durch die Bretterlücke verschwunden.
„Günter, wo bist du? Gib Zeichen!“
In meiner Vorstellung überschlugen sich die Angstbilder, und es dauerte eine Weile, bis ich antworten konnte, denn mir versagte die Stimme. „Peter“, rief ich, „bist du es?“
„Wo steckst du denn? Verdammt, ich sehe nicht die Hand vor den Augen!“
Ich griff zur Lampe und gab Lichtzeichen, bis Peter Zersing vor mir stand.
„Du hast Mut!“, sagte er. „Mein Gott, ist das hier dunkel.“ Erschöpft ließ er sich neben mich fallen.
„Was willst du denn hier?“, fragte ich und verschwieg meine Angst, von der ich mich kaum erholt hatte.
„Hast du welche?“
„Hier“, sagte ich und leuchtete auf den prallen Sack.
„Lass uns verschwinden. Ich bin froh, wenn ich hier wieder raus bin.“
Als wir den Sack bis zur Öffnung in der Wand geschleppt hatten, sagte er: „Den hättest du nie allein geschafft.“
Ich gab ihm recht und war froh, dass er doch noch gekommen war.
Am nächsten Abend, als schon die Dämmerung über der Stadt lag, saßen Peter und ich im Wohnzimmer und spielten bei Kerzenlicht Schach. Ich hatte schon zwei Partien verloren, weil ich nicht bei der Sache war, sondern in Gedanken noch immer nach Worten suchte, die ich Herrn Zeising sagen müsste, wenn er fragte, woher wir die Kartoffeln hätten. Peter wollte mit der Geschichte nichts zu tun haben, er war froh, unentdeckt vom nächtlichen Ausflug zurückgekehrt zu sein. Unsere Beute hatten wir im Keller hinter Gerümpel verborgen, das der frühere Bürgermeister bei seiner Flucht vor den sowjetischen Soldaten zurückgelassen hatte. Auf dem Herd stand nun ein Topf mit Kartoffeln, und ich erschrak, wenn ich im Hause Schritte hörte, weil ich jedes Mal dachte, Herr Zeising käme.
„Was ist denn nur mit dir los?“, rief Peter, „du verlierst ja schon wieder!“
Ich blickte zu ihm auf und bemerkte das Licht- und Schattenspiel des flackernden Kerzenscheins auf seinem Gesicht. „Siehst du nicht, dass deine Dame hopsgeht?“
„Dann musst du sie nehmen“, sagte ich.
„Du gewinnst sonst fast jedes Spiel“, sagte Peter, und neben dem Erstaunen schwang auch eine gewisse Freude in seiner Stimme mit. „Ich glaube, die Kartoffeln stecken dir noch in den Knochen.“
Ich antwortete nicht, weil ich Schritte hörte, die diesmal die Treppe heraufkamen. Knarrend wurde die Tür geöffnet. Ich sprang auf und warf dabei das Schachspiel um, Peter fluchte und rief, ich hätte einen Knall, aber ich hatte Angst. Als ich in die Küche kam, hob Herr Zeising gerade den Topfdeckel ab, und als er mich bemerkte, sagte er: „Kartoffeln, Menschenskind, das ist gut! Sind sie bald gar?“
„Ja“, sagte Peter, der nach mir in die Küche gekommen war, „wir können bald essen.“
„Habe ich nicht recht gehabt?“, sagte Herr Zeising. „Ich habe immer behauptet, es müssten noch Kartoffeln im Keller sein. Ich konnte einfach nicht glauben, dass sie alle sind. Du, Peter, hast ja immer am heftigsten gestritten. Wer hat sie denn entdeckt?“
„Ich“, sagte ich und war froh, dass ich Herrn Zeising den Rücken zuwenden konnte, denn ich stand am Schrank und nahm Teller heraus.
Herr Zeising setzte sich an den Tisch und streckte die Beine aus. „Heute lasse ich mich mal bedienen“, sagte er. „Ihr beide zusammen gebt eine gute Küchenfee ab.“
„War der Dienst heute wieder so anstrengend?“, fragte ich. Es war Herrn Zeisings Lieblingsthema; er schimpfte jeden Tag über den schweren und verantwortungsvollen Dienst und verwünschte den sowjetischen Major, der ihn als Bürgermeister eingesetzt hatte. Ich wusste aber, dass Herr Zeising seine Arbeit sehr ernst nahm, und die Leute sagten, er würde sich kaputtmachen, wenn er nicht bald langsamer trete.
„Ach“, sagte er, „reden wir lieber nicht davon! Es ist jeden Tag dasselbe, die Leute kommen mit den unmöglichsten Sachen. Um alles muss sich der Bürgermeister kümmern, und keiner denkt daran, dass ich auch nur ein einfacher Mann mit Volksschulbildung bin.“
Wir saßen nun alle drei am Tisch und füllten unsere Teller mit Kartoffeln, und vor jedem Teller lag in kleinen Haufen die klebrige Pelle.
„Ausgerechnet heute Morgen, als unser Polizeichef schon unterwegs in die Kreisstadt war, wo er den ganzen Tag zu tun hatte, ausgerechnet heute Morgen kommt also einer und will eine Anzeige erstatten. Ihr kennt doch die Scheune am unteren Feldweg. Dort ist über Nacht eingebrochen worden. Was hast du denn? Ist dir schlecht?“
„Nein“, sagte ich, „ich habe mich nur verschluckt.“
„Trink ’nen Schluck Wasser“, sagte Peter und riss mich vom Stuhl hoch. Er klopfte heftig auf meinen Rücken und raunte mir zu: „Reiß dich zusammen!“ Dann füllte er Wasser ein und hielt mir das Glas hin.
„Du musst nicht so hastig essen“, meinte Herr Zeising
„Und wie war das nun mit der Scheune?“, fragte ich, obwohl ich das Schlimmste befürchtete, aber die halbe Geschichte hätte mich im Ungewissen gelassen, und das war schlimmer als die schlimmste Wahrheit.
Herr Zeising winkte ab. „Kaum der Rede wert. Zehn Zentner Kartoffeln, sagt der Bauer, sind ihm geklaut worden. Ich bin hingegangen und hab mir die Stelle angesehen, Tatortbesichtigung nennt man so was. Der halbe Erdboden ist in der Scheune aufgewühlt, eine riesige Miete, und alles voller Kartoffeln. Da kann er die paar Zentner verschmerzen. Aber er wollte seine Anzeige nicht zurücknehmen, was sollte ich machen?“
„Zehn Zentner?“, fragte Peter. „Das ist ja ’ne halbe Wagenladung.“
„Ich kann nicht nachprüfen, wie viel es war“, sagte Herr Zeising.
„Und was unternehmen Sie?“
„Morgen ist unser Polizeichef, der Holzmann, wieder hier. Er wird die Sache in die Hand nehmen. Was soll werden? Ich kann ja die armen Schweine verstehen, die nichts auf dem Tisch haben. Aber wir müssen schließlich auf Ordnung achten. Wo kämen wir hin, wenn wir solchen Sachen nicht nachgingen ?“
„Vielleicht kriegt ihr gar nicht heraus, wer es war“, sagte Peter, „habt ihr denn Spuren gefunden ?“
„Du fragst, als wenn du was davon verstehst! Spuren, ich weiß nicht, da war ein Loch in der Wand und davor alles mächtig zerwühlt. Ich bin schließlich kein Fährtenhund. Jetzt lasst mich aber mal in Ruhe essen.“
Ich sah, dass Herr Zeising mit großem Appetit die Kartoffeln aß, und am liebsten hätte ich seine Hand festgehalten, wenn sie die Gabel zum Mund führte. Es war schlimmer gekommen, als ich befürchtet hatte, weil ich außer Acht ließ, dass der Bürgermeister der Erste war, der so etwas erfuhr. Was sollte ich tun? Sollte ich vielleicht sagen: Die Kartoffeln, die Sie gerade essen, sind die, die der Bauer vermisst, ich habe sie geklaut, aber nicht zehn Zentner, sondern nur einen Sack voll?! Das aber könnte ich nur beweisen, wenn Peter es bestätigen würde. Nein, ihn werde ich auf keinen Fall nennen, beschloss ich, denn sein Vater wäre als Bürgermeister erledigt.
Ich quälte mir die letzten Bissen hinunter, und als wir mit dem Essen fertig waren, räumte ich das Geschirr ab.
„Die Geschichte lässt mir keine Ruhe“, sagte Herr Zeising, „wenn wir nicht herauskriegen, wer die Einbrecher waren, geben wir den Reaktionären einen Trumpf in die Hand. Die neue Ordnung, werden sie sagen, ist nicht in der Lage, einen friedfertigen Bürger vor Verbrechern zu schützen. Aha, sagen sie dann, so ist das im Kommunismus, jeder nimmt sich, was er braucht, und es gibt keine Macht, die das persönliche Eigentum schützt!“
Peter sah mich an, als wolle er von mir wissen, was ich tun würde, und ich zuckte die Schulter und schüttelte den Kopf.
„Es hat geklopft“, sagte Herr Zeising. Ich erhob mich und öffnete.
„Entschuldige, Herbert, aber ich muss dich noch sprechen“, sagte Wachtmeister Holzmann, der Polizeichef, wie ihn alle nannten.
Herr Zeising führte ihn ins Wohnzimmer, und an der Tür wandte er sich zu uns um und sagte lachend: „Geheime Dienstbesprechung, nicht stören! Kartoffelklau auf der Spur!“
Als Herr Zeising die Tür geschlossen hatte, ließ sich Peter auf den Stuhl fallen, er sah bleich und ängstlich aus. „Mensch!“, sagte er. „Da hast du uns was eingebrockt! Und wenn er spitzkriegt, dass ich dabei war ... Also hör mal , sagte er und kam auf mich zu, fasste nach meinem Hemd (das eigentlich ihm gehörte) und zog mich an sich, „damit wir uns richtig verstehen, ich habe mit der Sache nichts zu tun! Schließlich hast du’s mir zu danken, dass du hier ... ich meine ..."
Er brachte seinen Satz nicht zu Ende, aber ich begriff ihn auch so, stieß seine Hände weg und lief zur Tür. „Ich habe gedacht, dass du es aus Freundschaft getan hast“, sagte ich, „aber ich kann ja gehen. Und du brauchst nicht zu denken, dass von mir einer was erfährt!“
Ich schlug die Tür hinter mir zu und rannte die Treppe hinunter. Es war stockfinster, und im Flur hing der muffige Geruch alter Mauern.
Ziellos irrte ich durch die Straßen der Stadt. Inzwischen war die Stromsperre aufgehoben worden, und hinter erleuchteten Fenstern sah ich Eltern mit ihren Kindern an Tischen sitzen. Ich stellte mir vor, dass ich zu ihnen gehörte und wie sie dort am Tisch saß. Warum gibt es Mütter, die von ihren Kindern weggehen?
Plötzlich befand ich mich vor der Schule. Es war ein altes Backsteingebäude, von einer flachen Mauer umgeben. Ich wusste, dass auf der Hofseite ein Kellerfenster kaputt war, stieg über die Mauer und schlich zu dem Kellerloch. Mit den Beinen zuerst ließ ich mich hinunter, kroch über den holprigen Boden und stieß an Heizungsrohre. Als ich die Tür zum Kellergang gefunden hatte, richtete ich mich auf. Bald erreichte ich die Treppe, und als ich endlich in unserem Klassenraum war, atmete ich auf. Ich legte mich auf meine Bank und sah zu den Sternen, die mir durch das Fenster zublinzelten.
Wie ich später erfuhr, hatten sie bis zum Morgengrauen nach mir gesucht. Als sie müde und erschöpft in den Dienstraum des Wachtmeisters zurückkehrten, hatte dieser darauf bestanden, dass der Bürgermeister nun einige Stunden schlafe. Am Morgen hatten sie die Suche fortsetzen wollen.
Wachtmeister Holzmann saß mit einigen Polizeihelfern und zwei weiteren Polizisten an dem großen Tisch, der den halben Raum ausfüllte, er erläuterte gerade seinen Plan für die Suchaktion, als ich ins Zimmer trat. Dem Wachtmeister erstarben die Worte auf den Lippen, er blickte mich aus weit aufgerissenen Augen an, als wäre ich eine Traumgestalt, die plötzlich leibhaftig vor ihm steht. Ich stand an der Tür und schwieg, ich sah die Männer an. und sie sahen mich an, keiner bewegte sich.
Dann sprang Wachtmeister Holzmann auf, lief auf mich zu und streckte die Hände nach mir aus, er befürchtete wohl, dass sich die Traumgestalt in Nebel auflösen würde, ehe er sie ergriff. „Du Landstreicher“, sagte er endlich und zerrte mich an den Tisch, und die Männer kreisten mich ein, als hätten sie einen gefährlichen Verbrecher gefangen, „willst du uns mal erklären, woher du plötzlich kommst!“
„Aus der Schule“, sagte ich.
„So , sagte der Wachtmeister, „aus der Schule. Du hast wohl dort übernachtet?“
„Ja“, sagte ich.
„Und wir ... Er fasste sich an den Kopf und blickte ratlos um sich, und mit einem Male begann einer der Männer zu lachen, und das Lachen pflanzte sich fort und der Wachtmeister lachte schließlich mit. „Mensch!“, rief er. „Dir müsste man die Ohren lang ziehen!“
„Ich wusste doch nicht, dass Sie mich suchen“, sagte ich, „ich wollte nur alles aufklären. Die Kartoffeln habe ich nämlich genommen.“
„Die aus der Scheune?“
„Ja, vorige Nacht.“
„Was hast du dir dabei gedacht? Nun sag schon, warum du es getan hast.“
Da berichtete ich, wie sich alles entwickelt und zugetragen hatte, und ich verschwieg nicht, dass Herr Zeising mit großem Appetit von den Kartoffeln gegessen hatte und dass ich ihm am liebsten die Gabel aus der Hand gerissen hätte. „Ich bin aber zu feige gewesen, und außerdem hatte Herr Zeising so großen Hunger." Von Peter erwähnte ich nichts.
Der Wachtmeister ging im Raum auf und ab, die Sohlen seiner derben Stiefel knarrten. „Es wäre fast zum Lachen, aber es ist zum Heulen!“, sagte er zu den Männern. „Stellt euch vor, der Bürgermeister isst von den geklauten Kartoffeln! Er ist ahnungslos und denkt, sie wären aus seinem Keller!“
„Waren sie auch“, sagte ich, „sie waren dort versteckt.“
„Wie bringe ich ihm das nur bei?“ Der Wachtmeister sah sich Hilfe suchend um, aber die Männer redeten alle durcheinander. Er schickte die Polizeihelfer nach Hause und ging mit mir ins Rathaus.
Herr Zeising kam uns auf der Treppe entgegen.
„Du hast ihn schon?“, rief er, „wo hast du ihn denn aufgestöbert?“
„Das wird er dir selbst erzählen, das und noch einiges mehr.“
Zum zweiten Male an diesem frühen Morgen berichtete ich, was ich getan hatte, und es fiel mir jetzt noch schwerer, weil Herr Zeising mit jeder Einzelheit mehr in Erregung geriet. Ich erwähnte auch das Hundeschnappen und gestand, dass ich mich auf diese Weise an den Jungen rächen wollte.
Peter lehnte am Türpfosten, er hatte die Arme verschränkt und hörte scheinbar teilnahmslos meiner Beichte zu.
Wenn Herr Zeising seiner Wut Luft gemacht und mich angeschrien hätte — es wäre mir verständlich gewesen. Aber er sagte nichts, kam nur auf mich zu und strich mir übers Haar. Seine weißen Brauen lagen schmal und gerade über den großen dunklen Augenhöhlen. Ich sah ihm die Müdigkeit an.
„Was willst du tun?“, fragte er nach einer Weile den Wachtmeister.
„Es liegt eine Anzeige vor, du weißt, was da zu tun ist.“
„Ja, ja, aber lass uns noch mal in Ruhe überlegen.“ Er winkte den Wachtmeister hinaus, und sie stiegen die Treppe hinab, um das Gespräch im Dienstzimmer des Bürgermeisters fortzusetzen.
Peter zog die Hände unter den Achseln hervor, steckte sie in die Hosentaschen, ging wie gelangweilt an mir vorüber und heftete seinen Blick auf das Bild seiner Mutter, das mit einem Trauerflor versehen an der Wand hing.
„Peter“, sagte ich und starrte auf seinen Rücken.
„Lass mich aus dem Spiel“, sagte er zur Wand hin, „ich bin blöd genug gewesen, dir nachzulaufen. Ich wollte nicht, dass dich Holzmann erwischt. Aber jetzt musst du selbst sehen, wie du dich herauswindest.“
Es war sinnlos, mit ihm zu sprechen, denn er hatte nichts begriffen. Seine Angst, ich könnte ihn verraten, war völlig unbegründet, deshalb fühlte ich mich ihm überlegen, denn ich war bereit, für alle Folgen der Kartoffelgeschichte geradezustehen. Wortlos nahm ich meine Schultasche und verließ das Haus. Ich kam sehr zeitig auf den Schulhof. Die wenigen, die vor mir da waren, hatten sich um die Brüder geschart, die wieder Hundeschnappen spielten. Ich rannte zu dem Jungen, der vor den Bauernsöhnen hockte und sich Mühe gab, das in die Luft gehaltene Wurstbrot mit den Zähnen zu erreichen. Ich riss ihn hoch und rief: „Los, steh auf!“, und als er mich willenlos anstarrte: „Siehst du denn nicht, dass sie nur ihren Spaß daran haben?“
Der Junge blickte ratlos die Umstehenden an, aber keiner sagte ein Wort. Einer der Bauernjungen rempelte mich an und hielt mir seine Faust unter die Nase. „Willste mal kosten, wie Blut schmeckt?“, rief er. „Hau ab, ehe du ’ne Wucht beziehst!“
Ich wich keinen Zentimeter, und als der andere mir seine Faust auf die Nase stieß, schlug ich zurück. Die Menge feuerte mich an und hielt den Bruder meines Gegners zurück, der sich auch auf mich stürzen wollte.
Ich weiß nicht, wodurch es mir gelang, den anderen niederzuschlagen. Plötzlich lag er auf dem Boden, und der Kies knirschte unter uns. Die Jungen feierten mich als Sieger.
„Steh auf“, sagte ich, „und wenn du noch mal Hundeschnappen spielst, kriegst du wieder ’ne Abreibung!“
Mein Ruhm währte bis zum Schulschluss, und auch Zeising erfuhr davon, aber weil er und ich getrennt nach Hause gingen, hatte das satte Brüderpaar leichtes Spiel. Es stürzte plötzlich hinter einer Mauer hervor, und als es wieder davonlief, mussten Stunden vergangen sein, es war dunkel um mich, und ich war überhaupt nicht ich, ich war alles andere als ein Mensch. Weil es eine abseitige Straße war, fand man mich erst am Nachmittag, es war eine alte Dame mit Hund. Der Dackel leckte mein Gesicht und winselte, und ich dachte zuerst, er hätte Schmerzen wie ich. Aber er winselte wohl aus Mitleid. Die Frau holte den Hausmeister der Schule, der mich erkannte und ins Rathaus trug. Die Sekretärin im Vorzimmer schrie bei meinem Anblick auf und lockte damit den Bürgermeister heraus.
„Kleine Keilerei, Herr Bürgermeister“, sagte der Hausmeister und berichtete, wo er mich gefunden hatte. Herr Zeising trug mich die Treppe herauf, mein Kopf lag auf seiner Schulter, und ich spürte das Hämmern in seiner Brust. Er rief nach Peter, der daraufhin aus unserem Zimmer kam und bei meinem Anblick blass wurde. Herr Zeising fragte ihn aus, aber Peter sagte immer nur, er wisse von nichts, er sei ja nicht dabei gewesen. Doch sein Vater ließ ihm keine Ruhe: Warum wir nicht wie sonst gemeinsam nach Hause gegangen wären und ob wir uns gestritten hätten. Herr Zeising hatte mich inzwischen aufs Bett gelegt und wusch mir das Gesicht ab, das verkrustete Blut färbte den Lappen. Ich fühlte mich schon besser, und weil Peter noch immer schwieg, beantwortete ich seines Vaters Fragen. Ich erzählte von dem Vorfall auf dem Schulhof und davon, dass sich die Hundeschnapper aus dem Hinterhalt auf mich gestürzt hatten. Herr Zeising nickte und sagte, er werde nach dem Arzt telefonieren.
Ich musste eine Woche im Bett bleiben. Eines Nachmittags verließen Herr Zeising und Peter das Haus, ich hörte einen Handwagen über das Pflaster rattern, und als beide zurückkehrten, waren Stunden vergangen.
Ich erfuhr, dass sie beim Vater der Hundeschnapper gewesen waren und dass Herr Zeising Peter gezwungen hatte, seine Mittäterschaft beim Einbruch zuzugeben und dem Bauern die Kartoffeln auszuliefern. Da der Bauer noch immer darauf bestanden hatte, dass es zehn Zentner gewesen seien und von der Zurücknahme seiner Anzeige nicht die Rede sein konnte, hatte Herr Zeising erklärt, er würde Gegenklage wegen schwerer Körperverletzung beantragen. Daraufhin hatten die Söhne des Bauern zunächst bestritten, mich überfallen zu haben, doch schließlich alles gestanden.
Als Herr Zeising mir dies berichtete, stand Peter am Fußende meines Bettes, er hielt den Kopf gesenkt und krampfte die Finger um die Bettkante. Die Entscheidung seines Vaters hatte ihn schwer getroffen, und scheinbar wusste er so wenig wie ich, woher und seit wann sein Vater Kenntnis von seiner Mittäterschaft hatte. Peter versuchte vor mir zu verbergen, dass er sich schämte, doch es gelang ihm nicht recht. Die restlichen Tage meiner Krankheit war er sehr besorgt um mich und wich nicht von meinem Bett.
4. Kapitel, in dem der Held ein Geheimnis des Bürgermeisters entdeckt, von wütenden Hunden fast zerrissen wird und schließlich ein Mädchen mit Zöpfen kennenlernt
Fast ein Jahr lebte ich nun schon bei Zeisings. Ich hatte manchmal geglaubt, dass mich Herr Zeising auf Peters Bitte nur vorübergehend aufgenommen hatte, aber spätestens seit dem Kartoffeldiebstahl wusste ich, dass er mich nicht anders als seinen Sohn behandelte, und ich hatte Gefallen an der Vorstellung, hier immer bleiben zu können.
An meine Mutter dachte ich immer seltener. Ich hatte jetzt das Gefühl, ein richtiges Zuhause gefunden zu haben, und ich war sogar ein wenig stolz, wenn die Leute sagten, sie hätten den richtigen Mann zum Bürgermeister, denn er setze sich dafür ein, das Leben, das noch immer voller Not und Entbehrung war, zu verbessern. Wo solche Gespräche geführt wurden, blieb ich manchmal stehen und lauschte. Einmal, im Bäckerladen, verpasste ich deswegen das Weiterrücken und bekam kein Brot mehr ab. Nun rannte ich zum nächsten Bäcker, der aber hatte auch nichts mehr.
„Mein Vater ist der Bürgermeister“, sagte ich zu der Frau hinterm Ladentisch, „immer ist er für die Leute unterwegs, aber er selbst hat nicht mal Brot.“
Die Frau strich die weiße Schürze glatt und sah mich prüfend an. Hinter ihr bemerkte ich die leeren Regale. Ich solle mal warten, sagte sie, und als sie zurückkehrte, trug sie ein dunkelbraunes Brot vor sich her, das sie mir über den Ladentisch reichte. „Weil es für den Bürgermeister ist“, sagte sie. Ich gab ihr die Marken und das Geld und bedankte mich.
Ich stellte fest, dass ich auf diese Weise manches bekam, und probierte die Wirkung meiner Worte täglich aus. Aber Herrn Zeising sagte ich nichts davon.
Wenn die Leute den Bürgermeister lobten und mich wie seinen Sohn behandelten, kam es mir vor, als wäre ich an den guten Taten Herrn Zeisings beteiligt. Manchmal hatte ich den Wunsch, ihn bei seiner Arbeit zu unterstützen, aber Peter sagte, sein Vater hätte es nicht gern, wenn man sich in seine Angelegenheiten mische.
Manchen Abend saß Herr Zeising im Wohnzimmer, er zeichnete und rechnete, und wenn Peter oder ich eintraten, deckte er das Papier zu.
„Ich bekomme noch heraus, was er da so heimlich tut, verlass dich darauf!“, sagte Peter. Auch ich hätte gern gewusst, um was es sich dabei handelte.