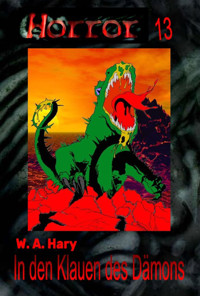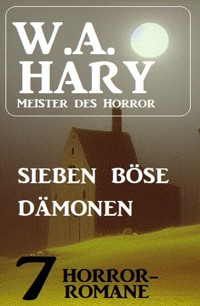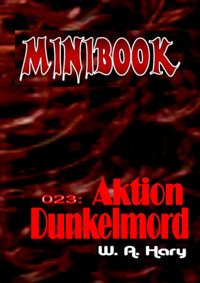Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alfredbooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Als der Krieg schon zu Ende war: Ein Nachkriegsroman von W.A.Hary Über diesen Band: Eine Kindheit in den 1950er Jahren im Saarland: Der Krieg ist zwar schon Jahre vorbei, aber trotzdem prägt er noch immer das gesamte Leben. So auch bei dem Jungen Wilfried. Der Vater ist ein traumatisierter Kriegsheimkehrer, die Kinder spielen in Ruinen. Aber es gibt Hoffnung auf bessere Zeiten. Wilfried A. Hary ist ein bekannter Autor, der vor allem durch seine Science Fiction-Romane und die von ihm erfundene Gruselserie Mark Tate hervortrat. In diesem autobiografischen Roman kehrt er dorthin zurück, wo alles begann. Dieser Band enthält die ersten beiden Teile der autobiografischen Romanserie "Aichiens Sohn"
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 310
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Als der Krieg schon zu Ende war: Ein Nachkriegsroman
W. A. Hary
Published by BEKKERpublishing, 2020.
Inhaltsverzeichnis
Title Page
Als der Krieg schon zu Ende war: Ein Nachkriegsroman
Copyright
Aichiens Sohn - Die ersten Jahre: Eine Kindheit in den 1950er Jahren
Aichiens Sohn - Die ersten Jahre
Copyright
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Don't miss out!
Aichiens Sohn – Die wilden Jahre: Eine Jugend in den frühen 1960ern Jahren
Aichiens Sohn – Die wilden Jahre
Copyright
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Don't miss out!
Sign up for W. A. Hary's Mailing List
About the Publisher
Als der Krieg schon zu Ende war: Ein Nachkriegsroman
von W.A.Hary
Über diesen Band:
Eine Kindheit in den 1950er Jahren im Saarland: Der Krieg ist zwar schon Jahre vorbei, aber trotzdem prägt er noch immer das gesamte Leben. So auch bei dem Jungen Wilfried. Der Vater ist ein traumatisierter Kriegsheimkehrer, die Kinder spielen in Ruinen. Aber es gibt Hoffnung auf bessere Zeiten.
Wilfried A. Hary ist ein bekannter Autor, der vor allem durch seine Science Fiction-Romane und die von ihm erfundene Gruselserie Mark Tate hervortrat. In diesem autobiografischen Roman kehrt er dorthin zurück, wo alles begann.
Copyright
Ein CassiopeiaPress Buch: CASSIOPEIAPRESS, UKSAK E-Books, Alfred Bekker, Alfred Bekker präsentiert, Casssiopeia-XXX-press, Alfredbooks, Uksak Sonder-Edition, Cassiopeiapress Extra Edition, Cassiopeiapress/AlfredBooks und BEKKERpublishing sind Imprints von
Alfred Bekker (https://www.lovelybooks.de/autor/Alfred-Bekker/)
© Roman by Author /
© dieser Ausgabe 2020 by AlfredBekker/CassiopeiaPress, Lengerich/Westfalen .
Die ausgedachten Personen haben nichts mit tatsächlich lebenden Personen zu tun. Namensgleichheiten sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Alle Rechte vorbehalten.
www.AlfredBekker.de
Folge auf Twitter:
https://twitter.com/BekkerAlfred
Erfahre Neuigkeiten hier:
https://alfred-bekker-autor.business.site/
Zum Blog des Verlags
Sei informiert über Neuerscheinungen und Hintergründe!Verlags geht es hier:
https://cassiopeia.press
Alles rund um Belletristik!
Aichiens Sohn - Die ersten Jahre: Eine Kindheit in den 1950er Jahren
Aichiens Sohn - Die ersten Jahre: Eine Kindheit in den 1950er Jahren
Wilfried A. Hary
Published by BEKKERpublishing, 2019.
Table of Contents
UPDATE ME
Aichiens Sohn - Die ersten Jahre
Eine Kindheit in den 1950er Jahren
von Wilfried A. Hary
Der Umfang dieses Buchs entspricht 131 Taschenbuchseiten.
Eine Kindheit in den 1950er Jahren im Saarland: Der Krieg ist zwar schon Jahre vorbei, aber trotzdem prägt er noch immer das gesamte Leben. So auch bei dem Jungen Wilfried. Der Vater ist ein traumatisierter Kriegsheimkehrer, die Kinder spielen in Ruinen. Aber es gibt Hoffnung auf bessere Zeiten.
Wilfried A. Hary ist ein bekannter Autor, der vor allem durch seine Science Fiction-Romane und die von ihm erfundene Gruselserie Mark Tate hervortrat. In diesem autobiografischen Roman kehrt er dorthin zurück, wo alles begann.
Copyright
Ein CassiopeiaPress Buch: CASSIOPEIAPRESS, UKSAK E-Books, Alfred Bekker, Alfred Bekker präsentiert, Casssiopeia-XXX-press, Alfredbooks, Uksak Sonder-Edition, Cassiopeiapress Extra Edition, Cassiopeiapress/AlfredBooks und BEKKERpublishing sind Imprints von
Alfred Bekker (https://www.lovelybooks.de/autor/Alfred-Bekker/)
© Roman by Author / Cover: Wilfried A. Hary
© dieser Ausgabe 2019 by AlfredBekker/CassiopeiaPress, Lengerich/Westfalen .
Die ausgedachten Personen haben nichts mit tatsächlich lebenden Personen zu tun. Namensgleichheiten sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Alle Rechte vorbehalten.
www.AlfredBekker.de
Folge auf Twitter:
https://twitter.com/BekkerAlfred
Zum Blog des Verlags geht es hier:
https://cassiopeia.press
Alles rund um Belletristik!
Sei informiert über Neuerscheinungen und Hintergründe!
1
Sie nannte ihn „Aichien“, was auf Deutsch so viel bedeutete wie: Eugen. Zwar war seine Frau tatsächlich auch eine Deutsche, aber sie stammte aus dem beschaulichen Dorf Rubenheim im Bliesgau. Da tickten nicht nur die Uhren anders damals, sondern da sprach man auch seine eigene Sprache. Zum Beispiel sagte man zu Rubenheim eben nicht Rubenheim, sondern „Ruwenum“. Und so wurde zwangsläufig aus Eugen halt Aichien.
Ich denke gerade daran, dass man mir damals, als ich vom Dialekt mehr oder weniger konsequent umstieg auf Allgemeindeutsch, vorgeworfen hat, „meine Muttersprache zu verleugnen“.
Wie bitte? Ich habe Ruwenumerisch nie beherrscht, noch nicht einmal im Ansatz. Was also für eine Muttersprache? Etwa die Sprache meines Vaters? Dann müsste man ja wohl Vatersprache sagen, und die hatte es ebenfalls „in sich“. Nicht so wie in Ruwenum allerdings, sondern halt so wie in Dengmat.
Dengmat?
Auf Deutsch heißt das übrigens Sankt Ingbert! Nur zur Info. Und bevor ich es vergesse: In Dengmat heißt Maria auch nicht Maria, sondern Maja! Zumindest wenn man nach der Sprache meines Vaters (Aichien!) gehen sollte. Denn sein Dialekt war damals schon das, was man vielleicht altmodisch hätte nennen können. Er war ja schon in einem Alter, in dem manch einer bereits Großvater genannt wird, als ich zur Welt kam.
Aber ich sehe schon: Ich greife vor! Sollen wir nicht doch lieber von vorn beginnen, also von Anfang an, als das Schicksal bestimmte, dass Aichien Soldat wurde?
Nein, ich korrigiere mich: Eigentlich war dafür nicht das Schicksal verantwortlich, sondern die Partei. Ihr wisst schon: Die Partei vor dem zweiten Weltkrieg. Aichien war damals beruflich bedingt unabkömmlich, was normalerweise bedeutete, dass er kein Soldat werden musste. Normalerweise bedeutete jedoch auch: Mitglied in der Partei werden. Das wurden damals viele, einfach nur aus schierem Überlebenswillen heraus, keineswegs aus Überzeugung, wie vielleicht später, nach dem Krieg, behauptet wurde. Aichien jedoch bewies viel mehr Mut als jene. Todesmut sozusagen, denn weil er sich konsequent sträubte, musste er die Folgen tragen, und die hatten es wahrlich in sich:
Aichien wurde zur Wehrmacht gezwungen und gleich dorthin geschickt, wo es am schlimmsten war. Nicht einfach nur irgendeine Front, sondern an der schlimmsten Front auch noch dorthin, wo man mit hoher Wahrscheinlichkeit ums Leben kam. Mit anderen Worten: Aichien war dazu ausersehen, sogenanntes Kanonenfutter zu werden! Niemanden interessierte, dass er daheim Frau und Kind zurückließ. Nein, mich noch nicht, sondern meinen großen Bruder Werner. Auf mich kommen wir ein wenig später zurück.
Jedenfalls war Aichien insofern vom Glück gesegnet, dass er einer der Wenigen war, die all die Massaker überlebten. Nicht im Sinne der Partei jedenfalls, die ihn hatte verheizen wollen, zur Strafe für sein Sträuben, klar. Nach vier Jahren in der Hölle, während denen er Frau und Kind ganze dreimal kurz gesehen hatte, damit sie ihrerseits begriffen, dass er überhaupt noch lebte, geriet er in Gefangenschaft. Bei den Franzosen.
Einerseits sein Glück, weil er fließend Französisch sprach, was ihm einen winzigen Bonus verlieh. Andererseits eben auch sein Pech, weil er drei Jahre verschollen blieb. Wobei wirklich niemand wusste, dass er überhaupt noch lebte, um dann Anfang 1947 als an Leib und Seele gebrochener Mann in Lumpen vor der heimatlichen Wohnungstür zu stehen.
Nicht nur seine Frau war geschockt, vielmehr auch sein Sohn Werner, der in diesem Jahr neun Jahre alt wurde und seinen Vater eigentlich nur vom Hörensagen kannte. Die dreimalige kurze Begegnung hatte er, wie es bei Kleinkindern in der Regel der Fall ist, glatt vergessen.
Dieser Landstreicher, der förmlich nach einem ausgiebigen Bad schrie und so ausgemergelt war, dass er jeden Augenblick des Hungers sterben konnte, sollte... sein Vater sein?
Nie und nimmer!
Und wieso nahm die geliebte Mutter diesen abgerissenen Landstreicher jetzt trotzdem auf und vergaß glatt, dass sie auch noch einen Sohn hatte?
Ein Konflikt, der lange anhielt, darf ich hier verraten. Ein Konflikt, der sich vorübergehend sogar auch noch verschärfte, als ziemlich genau neun Monate später sein Bruder auf die Welt kam: Ich nämlich!
Genauer: Am 27. Oktober 1947, nachts um halb drei. Im Elternbett. Das heißt, eigentlich war ich schon auf der Welt, als zu dieser Zeit endlich, total abgehetzt, Aichien mit der Hebamme auftauchte. Die tat ihr übriges Werk, und erst dann gab es mich ganz offiziell.
Beinahe wäre es ja schief gegangen. Nicht nur weil die eigentliche Geburt ohne Hebamme stattgefunden hatte, die ja erst gerufen werden musste - persönlich, denn Telefon, geschweige denn Handy, kannte man natürlich noch nicht im Heime Aichien... Vor allem auch, weil Aichien ja eigentlich zum Sterben an die Front geschickt worden war, von denjenigen, die nicht nur ihn, sondern ganz Deutschland und darüber hinaus die halbe Welt auf ihr Gewissen hatten laden wollen. Falls sie überhaupt so etwas wie Gewissen jemals besaßen...
2
Wenn ich so zurückblicke, bin ich tatsächlich der leibliche Sohn eines Naziverfolgten, den es nur deshalb überhaupt gibt, weil Aichien trotz indirektem Todesurteil hat überleben können.
Aichien, als überzeugter Sozialdemokrat, hat nie versucht, mich politisch zu erziehen, aber seine Geschichte hat bei mir natürlich trotzdem eine Vorbildfunktion. Obwohl ich mich mit Aichien viel zu viele Jahre lang leider gar nicht so richtig verstand: Ich musste erst einmal begreifen lernen, weshalb er sich so verhielt, wie er sich verhielt. Ich musste begreifen, dass sieben Jahre Krieg und Gefangenschaft niemals spurlos an einem Menschen vorübergehen können. Sie zerstören einen Menschen, der am Ende nur noch so tut, als würde er noch leben, aber in Wirklichkeit sein Menschsein weitgehend verloren hat. Um es sich mühselig zurück zu erobern, Stück für Stück. Ohne dass es ihm jemals zur Gänze gelingen kann.
Heute gibt es dafür ausgebildete Psychotherapeuten. Damals hat sich kein Mensch dafür interessiert, geschweige denn, dass es so etwas wie Hilfe gegeben hätte.
Wie gesagt: Ich brauchte viel zu lange, um die Zusammenhänge zu begreifen und sehen zu können, dass die Vaterliebe eines Kriegsgeschädigten sich zwangsläufig anders äußert als die eines Vaters, der nicht die Hölle persönlich hat durchleben müssen. Nicht nur für ein paar schlimme Tage, sondern für ganze sieben Jahre.
Ganze sieben Jahre!
Wen wundert es, dass ich nicht gut zu sprechen bin auf Leute, die so etwas gut heißen? Ohne jetzt ins Detail gehen zu wollen, und dieses Detail gab es schon sehr früh in meinem Leben, lange bevor ich in der Lage gewesen war, meinen Vater zu verstehen, den ich auf meine eigene Weise liebte – bis heute, da er schon lange nicht mehr unter uns weilt. Genauso wenig wie meine geliebte Mutter.
Aber dies wäre eine andere Geschichte. Bleiben wir bei dem, um das es hier geht:
Aichiens Sohn – und die ersten Jahre!
Der sich schon so früh für Politik interessierte, als alle anderen Kinder noch lieber im Sandkasten spielten und sich mit typisch kindlichen Albernheiten beschäftigten. Klar, ich beschäftigte mich ebenfalls damit, aber eben nicht nur: Als damals beispielsweise die Saarabstimmung war, regte ich mich über unflätige Wahlpropaganda auf und versäumte nicht eine einzige Nachricht am Radio (Fernsehen gab es bei uns noch nicht), wenn es nur irgendwie möglich war.
Das, was bei mir an in meinen Augen verabscheuungswürdiger Wahlpropaganda am meisten bis heute im Gedächtnis hängengeblieben ist, war der Spruch:
„Der Dicke muss weg, er hat zu viel Speck!“
Damit spielte man auf die Fettleibigkeit des damaligen Staatsoberhauptes im Saarland an: JoHo oder ausgesprochen: Johannes Hoffmann!
Was, bitteschön, hatte seine Fettleibigkeit mit der Politik zu tun?
Ich war damals der festen Überzeugung, dass JoHo ein besonders guter, weiser und umsichtiger Staatsmann war, der das Saarland zu beispiellosem Wohlstand gebracht hatte. Aber nein, die Krakeeler gewannen trotzdem mit ihrem „Heim ins Reich!“.
Ach ja, ich glaube, das muss ich erklären. Wer sollte heute noch wissen, was „Heim ins Reich!“ bedeuten soll. Ja, wer sollte außerhalb des Saarlandes und jünger als ich überhaupt auch nur ahnen, was „Reich“ in diesem Zusammenhang bedeutete?
Ich fasse mich kurz: Zu Deutschland sagte man an der Saar damals „drüben“. Und näher bezeichnet nannte man Deutschland „das Reich“. Oder: „Drüben im Reich!“ Heim ins Reich bedeutete demgemäß: Erneute Eingliederung an Deutschland, was Adenauer den Saarländern damals angeboten hat.
Im Saarland selber indessen gab es damals drei verschiedene Hauptfraktionen: Die einen waren für die Rückgliederung, nachdem ja das Saarland nach dem Krieg von den Franzosen annektiert worden war. Die zweite Fraktion war die der Separatisten, die weder französisch noch deutsch sein wollten, sondern einfach nur saarländisch. Unter ihnen gab es auch welche, die von BeNeSaarLux (Belgien, Niederlande, Saarland und Luxemburg im Verbund) träumten, was später nur zu BeNeLux wurde, wie wir es heute noch als Bündnis in Erinnerung haben, falls wir an der Geschichte interessiert waren.
Ach ja, und dann gab es ja noch die Fraktion der Frankophilen. Was nichts mit dem damaligen Staatspräsidenten von Spanien zu tun hatte, sondern mit Frankreich: So nannten sich die Leute, die am liebsten endgültig „Saarfranzosen“ geworden wären.
Übrigens nannte man uns in Deutschland damals tatsächlich so: Saarfranzosen! Wann immer wir es wagten, die Grenzen zu Deutschland zu überschreiten, die ziemlich streng bewacht wurden. Vor allem wegen des regen Schmuggels zwischen Saarland und Frankreich, wobei Zweibrücken eine Art Schmuggelhochburg war. Hier saßen die Kanadier und später die Amerikaner mit einem Heer von Soldaten, als sogenannte Besatzungsmacht, und hierher strebten die Saarländer, um Dinge einzukaufen, die auf der französischen Seite nur viel teurer zu kriegen waren. Umgekehrt kamen die Menschen aus dem „Reich“ und deckten sich beispielsweise mit Lebensmitteln ein, die umgekehrt hier, im Saarland, günstiger waren.
So richtig französisch waren wir damals ja nicht, sondern in der Tat eher saarländisch. Das hieß, die Franzosen mochten die Saarländer immerhin so sehr, dass sie ihnen Privilegien einräumten, die andere Teile Frankreichs nie kennengelernt haben. Was in erster Linie übrigens JoHo zu verdanken war!
Dass umgekehrt Deutschland unter Adenauer unbedingt die Saar wieder zurückgewinnen wollte, erzeugte eine Art Wettbewerb um das Saarland, was die Saarländer natürlich schamlos ausnutzten. So kam es ja auch bei der Rückgliederung zum sogenannten Saarstatut:
Jetzt gab es keine Grenzen mehr zwischen Deutschland und der Saar, aber zwischen der Saar und Frankreich. Obwohl das Saarland immer noch die Vorteile der Franzosen genießen durfte – einerseits! -, um andererseits die Werbegeschenke von Adenauer voll und ganz in Anspruch zu nehmen. Dadurch war das Saarland ein verhältnismäßig reiches Land mit Wohlstand für alle. Wenn auch nur vorübergehend, denn das Saarstatut war leider zeitlich begrenzt – und danach interessierte sich eigentlich keiner mehr so recht für das winzige und entsprechend eigentlich wenig bedeutende Land an der Grenze zu Frankreich.
Doch kommen wir zurück zu Aichiens Sohn, der in diese Zeit hinein wuchs und sich an viele Dinge noch heute erinnert, die für den Rest der Menschheit scheinbar für immer verloren ging.
Scheinbar, aus meiner Sicht gesehen, denn wann jemals liest man irgendwo etwas über die Fünfziger und die näheren Umstände damals für das Saarland, von denen jeder Saarländer unmittelbar betroffen war, auch wenn er erst drei Jahre zählte und sich immer noch standhaft weigerte, zu sprechen.
Ja, richtig, jeder, der mich persönlich kennt, wird jetzt ungläubig die Stirn runzeln, weil er mich nicht anders kennt als äußerst redselig. Und doch war ich das als Kleinkind, was man eben redefaul nennt.
Und ich kann mich sogar noch daran erinnern!
Habe ich schon erwähnt, dass ich zu den wenigen Menschen gehöre, die sich an ihre früheste Kindheit erinnern können? Zwar nur fragmentarisch, aber die meisten Menschen haben überhaupt keine Erinnerungen mehr daran, habe ich mir sagen lassen. Umgekehrt habe ich selber eine Weile gebraucht, um zu begreifen, dass ich darin anscheinend eine Ausnahme bin. Ob das ein Vorteil ist oder ein Nachteil, wage ich nicht zu beurteilen. Aber zumindest ist es zum Vorteil dahingehend, dass ich nun über Dinge berichten kann, die ansonsten längst verloren gegangen wären...
3
Nachdem mein Bruder seine geliebte Mutter erst mit einem weitgehend fremd gebliebenen Vater teilen musste, kam also am 27. Oktober 1947 auch noch ein kleiner Bruder hinzu, der natürlich die volle Aufmerksamkeit der Mutter verlangte. Das machte sicherlich Werner zu schaffen. Etwas, worüber er niemals reden wollte, was aber sowieso nur vorübergehender Natur blieb, denn angesichts des hilflosen Babys entstand in ihm eine Fürsorglichkeit für diesen Kleinen, die später, als ich im entsprechenden Alter war, durchaus erwidert wurde. Diese gegenseitige Fürsorglichkeit endete nie mehr! Und ich weiß, dass es für viele unglaubwürdig klingt, obwohl ich lügen müsste, um etwas anderes zu behaupten:
Mein Bruder und ich hatten niemals in diesem Leben wirklich Streit miteinander!
Obwohl es sich für andere zuweilen durchaus so anhören konnte, denn Werner und ich diskutierten immer gern miteinander. Wohlgemerkt: Wir diskutierten, aber wir stritten nicht! Dabei lernten wir voneinander. Ich darf sogar behaupten, dass ich von meinem älteren Bruder in den frühen Jahren meiner Kindheit mehr gelernt habe als von meinen Eltern, die natürlich beide von ihren Kriegserlebnissen gezeichnet waren und niemals so richtig mehr Anschluss an die Wirklichkeit fanden. Vor allem nicht Aichien, der bis zuletzt in Angst und Schrecken lebte, wenn ich wieder einmal im Ausland war, um dort meinen Urlaub zu verbringen. Für ihn war ein Auslandsaufenthalt immer mit seinen Erlebnissen als Soldat an den Fronten des zweiten Weltkrieges verbunden und natürlich mit drei Jahren Gefangenschaft irgendwo in Frankreich, als es ihm schlechter ging als einem Tier in Gefangenschaft, trotz seiner Französischkenntnisse. Immerhin nicht schlecht genug, um wie viele andere dabei sein Leben zu lassen, aber spätestens nach mindestens einem Erschießungskommando, vor dem er wegen eines Missverständnisses stand, waren Glück und Unglück sehr relative Begriffe für ihn geworden.
Tatsächlich hat er ja sogar das überstanden. Irgendwo noch lebendig, aber halt bis zur Unkenntnis zerschunden an Leib und Seele.
Ich habe ihn zwar als bemüht lebensbejahenden Menschen schätzen und lieben gelernt, aber die Narben in seiner Seele reichten immerhin so tief, dass er im Leben bis zuletzt Probleme hatte, sich vollends zurecht zu finden. Nicht nur, wenn ich im Urlaub war und er bei meiner Rückkehr erleichtert seufzte:
„Gottlob, du lebst noch!“
Ja, nicht nur bei einer solchen Gelegenheit wurde das ersichtlich. So hatten wir, ab dem Zeitpunkt, an dem ich die Zusammenhänge endlich begreifen konnte, so etwas wie ein umgekehrtes Verhältnis. Eher also Sohn-Vater als Vater-Sohn. Das hieß, wenn ich Probleme hatte, konnte ich mich niemals an ihn wenden, sondern immer umgekehrt: Er wandte sich mit seinen Problemen an mich, weil er wusste, dass ich geduldiger Zuhörer war. Nicht um ihm irgendwelche unerwünschten Ratschläge zu erteilen, sondern einfach nur, um zuzuhören. Danach bat er mich immer inständig, dies möge unter uns bleiben, und am besten würde ich es gleich wieder vergessen.
Das versprach ich ihm – und ich hielt mich daran, ohne jegliche Ausnahme!
Kein Wunder, dass ich dadurch meinen Vater Aichien besser kannte als er sich selber. Was meine Liebe zu ihm nur noch tiefer machte, aber auch seine Liebe zu mir.
Sorry, dass ich die Tränen bekämpfen muss, wenn ich nur daran denke...
Aber es sind keine Tränen der Trauer, sondern ich sehe es im Nachhinein so, dass alles, was passiert ist, die logische Konsequenz dessen war, was er hatte erdulden müssen in der schlimmsten Zeit seines Lebens.
Aichien war ansonsten der festen Überzeugung, sein Sohn müsse sich seine eigene Meinung über die Welt bilden, die er in keiner Weise beeinflussen wollte. So etwas wie Politik und auch die Ereignisse, die zu diesem schrecklichsten Krieg aller Zeiten geführt hatten, waren für ihn Tabuthemen bis zum Schluss.
Ein nobler Ansatz, wie ich finde – einerseits. Andererseits vielleicht nicht ganz so richtig, weil ja ein Vater eigentlich seinen Sohn auf das Leben vorbereiten soll, und dazu gehört natürlich auch so etwas wie eine politische Meinung.
4
Aichien blieb übrigens bei alledem nach seiner Rückkehr aus der Hölle nicht arbeitslos. Er hatte ja in der Stahlindustrie gearbeitet, die ihm jetzt gleich wieder einen Job anbot. Deutschland musste ja wieder aufgebaut werden, nachdem die Alliierten daraus eine gigantische Schutthalde gemacht hatten. Ohne Schuldzuweisungen natürlich: Was zerstört war, musste trotzdem neu aufgebaut werden. Es sei denn, alle damals betroffenen Deutschen wären geflohen, aber wohin? Niemand hätte sie haben wollen.
Böse Zungen behaupten heute noch, dass zumindest den Saarländern die Flucht gelungen sei – in die Obhut der Franzosen, die es wirklich gut mit ihnen meinten. Auch eine Methode, die damaligen Verhältnisse zu umschreiben, zugegeben, aber bis heute nicht im Geringsten meine eigene Sichtweise. Klar waren die Franzosen gut zu uns, aber aufbauen mussten die Saarländer ihr geschundenes Land schon selber! In dieser Hinsicht ging es ihnen keineswegs besser als sonst einem Bundesland von heute in der damaligen Zeit.
Eine Zeit, an die ich mich nur zu gut erinnere, obwohl es doch heißt, dass Unangenehmes gern vergessen wird und Angenehmes mit der Zeit überwiegt. Beides, das Unangenehme wie das Angenehme, waren jedoch so dicht miteinander verwoben, dass ich es gar nicht vergessen konnte, selbst wenn ich das gewollt hätte.
Zum Beispiel der Säbel, den wir fanden. Er stammte noch aus dem ersten Weltkrieg, weil es im zweiten Weltkrieg keine Säbel mehr gegeben hatte, auch nicht als Symbol für Führungskräfte wie Offiziere. Übrigens nannten wir den Säbel damals Schwert, weil wir den Unterschied noch nicht gekannt haben...
Wir kleinen Kinder, zu Beginn der Fünfziger, hüteten ihn wie einen Schatz. Das hieß, eigentlich wurde er meiner eigenen Obhut überlassen. Ich brachte ihn in den Kellerverschlag, in dem allerlei Krempel untergebracht war, den niemand stehlen wollte. Deshalb gab es auch kein Schloss am Eingang zu diesem Verschlag.
Damals wohnten wir in Miete. Mein Bruder erzählte mir später, dass wir vorher im ersten Stock des Hauses gewohnt hatten, mit Bad und Toilette, aber für Aichien, der niemals wirklich gesund geworden ist nach dem Krieg, war die Miete zu hoch gewesen. Also war er mit Frau und Kind ein Stockwerk höher gezogen, unter das Dach, ohne Toilette oder gar Bad. Die Toilette im ersten Stock durften wir mit benutzen.
Der Umzug erfolgte zu einer Zeit, an die ich mich nicht erinnern kann, oder gibt es jemanden, der weiß, was außerhalb des Mutterleibes geschah, während er zum Baby heranwuchs? Natürlich nicht! Ohne meinen Bruder wüsste ich es gar nicht, weil unsere Eltern dies niemals mehr angesprochen haben.
Nur der Bretterverschlag im Keller blieb derselbe, und dort traf ich mich mit den anderen Kindern, um das alte, rostige Schwert (das ja in Wirklichkeit ein Säbel war) aus dem ersten Weltkrieg in die Hände zu nehmen. Es war dermaßen schwer für uns, dass wir uns unmöglich vorstellen konnten, wie man damit umgehen sollte.
Es kam, wie es kommen musste: Wir fielen auf. Logisch, es fiel auf, dass sich die Kinder aus der Nachbarschaft mit mir immer wieder in diesem Kellerverschlag trafen. Was war da im sprichwörtlichen Busch? Und wir waren noch zu klein, um uns darüber im Klaren zu werden. So war der Schock besonders groß, als ich zur Rede gestellt wurde von meinen sehr besorgten Eltern.
Gerade Aichien, immer noch vom Krieg gezeichnet, konnte absolut nicht verstehen, dass so ein Schwert/Säbel für uns eine Art Schatz sein sollte.
Das Ding verschwand. Bis heute. Ich habe wirklich nie erfahren, was daraus geworden ist, aus unserem Schatz. Das einzige, was uns Kindern damals geblieben war, das war die gemeinsame Erinnerung an diesen Schatz, der in unserer Erinnerung von Tag zu Tag wertvoller wurde und uns irgendwie eine ganze Weile noch regelrecht zusammenschweißte.
Bis ich zur Schule kam und ab da ganz andere Sorgen hatte.
Ich hatte mich übrigens enorm auf die Schule gefreut und mich vorher sachkundig gemacht, soweit dies ging. Da wurde von Schultüten geredet und einem großen Fest bei der Einschulung. Als es dann für mich endlich so weit war, blieb beides aus. Mehr noch: Ich ging in eine Klasse, die sich mit einer anderen Klasse abwechseln musste, weil nicht genügend Räumlichkeiten zur Verfügung standen. Wenn ich mich recht erinnere, waren wir fast vierzig Kinder in einem engen Raum, um jeweils entweder morgens oder mittags Unterricht zu haben. Die andere Klasse haben wir nie kennengelernt. Wenn wir da waren, fehlten sie und umgekehrt.
So richtig Spaß machte das absolut gar nicht. Obwohl ich es mir vorher so sehr gewünscht hatte. Nicht etwa wegen Fächern wie Französisch, Mathematik oder so, sondern nur wegen einem einzigen Fach: Deutsch! Ich wollte endlich richtig lesen können, weil es für mich ungemein faszinierend war, wenn mein Vater täglich die Zeitung las. Er starrte dabei auf riesige Blätter mit kaum erkennbaren Schwarzweißbildern, deren Aussage ich nicht wirklich begreifen konnte, und es langweilte ihn überhaupt nicht, irgendwelchen Symbolen zu folgen, die diese riesigen Blätter füllten.
Ich kann mich auch noch an Illustrierten erinnern, die Aichien mir zeigte. Nicht das, was darin geschrieben stand, sondern Bilder, mit denen versucht wurde, die Vorgänge vor dem zweiten Weltkrieg aufzuarbeiten.
Als Kleinkind, das kaum sprechen konnte, starrte ich darauf, ohne etwas zu sehen. Das waren für mich lediglich Grauschattierungen bis hin zu Schwarz, ohne die Begriffe hierfür natürlich zu kennen. Sonst nichts. Wieso wurde mir das gezeigt? Was war der Sinn? Wenn Aichien das wenigstens kommentiert hätte, aber das war und blieb ja für ihn tabu.
Mir dämmerte allerdings, dass etwas dahinter stand, was ich noch nicht begreifen konnte, also weckte es meinen Ehrgeiz, dies eines Tages begreifen zu lernen.
In einem war Aichien ganz besonders vorbildlich: Er versuchte mir schon früh, das Lesen beizubringen, als er bemerkte, wie sehr mich das interessierte. So richtig geklappt hat das zwar nicht, weil ihm die pädagogische Erfahrung fehlte, aber zumindest habe ich dabei gelernt, diese Schwarzweißschattierungen als Bilder zu erkennen. Da wurden Personen und ihre Handlungen gezeigt! Als ich das endlich begriff, wobei die Darstellungen wie aus einem Nebel des Unverständnisses heraufstiegen, war es ein Gefühl, wie ich es niemals wieder vergessen würde.
Ein ähnliches Gefühl entstand dann in der Schule, als ich begann, diese halbwegs sinnlos erscheinenden Zeichen und Symbole als Texte zu interpretieren. Das war dermaßen faszinierend für mich, dass dabei in meinem kleinen Kopf Bilder entstanden, nur weil ich diese Texte las. Dabei wagte ich mich an Texte heran, die ich so jung unmöglich schon begreifen konnte. Sie erzeugten trotzdem eine Resonanz in meinem Kopf.
Später erst erfuhr ich, dass man dies Kopfkino nennt. Und ich habe auch erfahren, dass nicht jeder Mensch so etwas wie ein Kopfkino besitzt. Das haben nur Menschen, die Spaß am Leben kriegen. Alle anderen werden das möglicherweise nie und nimmer verstehen können, weil für sie Texte einfach nur aneinandergereihte Wörter sind, ohne dass in ihrem Kopf so eindringliche Bilder entstehen können.
Ich bin mir sicher, dass ich das so offen niederschreiben kann, ohne jemanden zu verärgern, weil dies ja keiner jemals lesen wird, der über kein Kopfkino verfügt. Die lesen in der Regel ja gar nichts. Höchstens so etwas wie Fachliteratur. Vielleicht auch die neuesten eMails oder sonstige Kurznachrichten, aber ansonsten... Sie werden keinen Grund haben, sich über mich ob meiner Bewertung zu ärgern, weil sie es ja nie erfahren werden.
Ich habe hingegen die Freude am Lesen sehr früh erfahren, und sie ließ mich nie mehr los. Nicht nur was Pflichtlektüre in der Schule betraf. Mit sieben Jahren war ich zum Beispiel längst glühender Fan der Heftchenserie „Rolf Torrings Abenteuer“. Sie erschienen alle zwei Wochen im Kleinformat. Mein Bruder kaufte sie im Wechsel zu der Serie „Jörn Farrow“. Diese war damals seine Lieblingsserie, ich hingegen bevorzugte Rolf Torring beziehungsweise dessen Freund und Erzähler Hans Warren. Der schrieb damals übrigens beide Serien, gemeinsam mit seinem Bruder, wie ich erst Jahrzehnte danach erfahren sollte.
Ich erinnere mich auch noch daran, dass mein Bruder eines Tages nach Hause kam und Exemplare von Rolf Torring mitbrachte, die in alter deutscher Schrift geschrieben waren. Sie waren vor dem Krieg erschienen, bis die damaligen Machthaber sie verboten hatten, als „Schmutz und Schund“.
Nebenbei bemerkt: Als einer meiner Lehrer in der Schule später Romanheftchen als „Schmutz und Schund“ bezeichnete, machte ich ihn darauf aufmerksam, dass genau das auch als Argument der Gründer des sogenannten Dritten Reiches gedient hatte. Man wisse ja, wie so etwas endet...
Was soll ich sagen: Man weiß bis heute, wie es endet, wenn ein Schüler solches zu seinem Lehrer sagt! Wir hatten niemals die Chance, Freunde zu werden, was ich einerseits begrüßte, aber was mir andererseits das Leben in der Schule durchaus erschwerte.
Das ging durch alle Klassen so weiter: Außer meinem ersten Lehrer, bis in die vierte Klasse hinein, hatte ich nur Lehrer, die mich zu hassen schienen. Nicht ganz ohne Grund, wie ich leider zugeben muss, denn ich galt als unruhig und aufmüpfig. Das wollte ich gar nicht, aber es entsprach halt meiner Natur, dass ich stets alles hinterfragen musste und mit einfachen Erklärungen niemals einverstanden war. Vor allem nicht mit schwarz-weiß begründeten Erklärungen, die ich bis zum Ende meiner Tage wohl hassen werde. Obwohl nach meiner Erfahrung die meisten Menschen gerade solche zu bevorzugen scheinen, um gegen jeden anzugehen, der es wagt, davon abzuweichen.
Nun, es hat mir ziemlich viel Gegenwind eingebracht, nicht nur vonseiten der Lehrer, was mich allerdings besonders geformt hat, ohne mir wirklich zu schaden.
Aber kommen wir doch mal auf die Epigenetik zurück, die ja viel später erst bewiesen wurde: Sie besagt, vereinfacht ausgedrückt, dass tiefgreifende Erlebnisse sich im Erbgut verankern. Die Epigenetik bestimmt nämlich, welche Genteile freigeschaltet werden.
Aber wenn die Epigenetik so mächtig ist, gibt es keinen Grund, die Annahme zu bezweifeln, dass ich die Kriegserlebnisse meines Vaters in mir trage, und zwar in diesem Fall garantiert freigeschaltet!
Man stelle sich vor: Aichien überlebte sieben Jahre Hölle – und gab dies an mich weiter.
Deshalb muss ich im Zusammenhang mit mir natürlich auch erzählen, was meinen Vater vor meiner Geburt heimsuchte, um zu verstehen, was mich bis heute noch bewegt.
Ich war zwar nicht persönlich mit dabei, aber ich habe im gewissen Sinne die Erinnerung in mir, in meiner Epigenetik. Nicht als Gedanken oder Bilder, sondern eben als freigeschalteten genetischen Code.
Mit anderen Worten: Ich fürchte alles, was den Krieg ausmacht, allerdings mit dem Willen gekoppelt, diese Hölle zu überleben.
Ohne diesen Willen hätte ich niemals geboren werden können, weil Aichien es nicht überlebt hätte. Und es erklärt auch mein Verhalten zum Beispiel während meiner Bundeswehrzeit später, was allerdings wiederum eine andere Geschichte wäre...
5
Es ist ja nicht nur die Epigenetik, die einen bestimmt. Logisch. Es sind natürlich auch Kindheitserlebnisse, die für spätere unbesiegbare Ängste sorgen und seien diese noch so irrational.
Nennen wir ein Beispiel: Meine Mutter hat mir quasi zweimal das Leben geschenkt. Sie, Maria, genannt „Maja“, war eine korpulente Person gewesen damals, kaum größer als ein Meter und fünfzig Zentimeter und wohl ungefähr fünfundneunzig Kilogramm schwer. Für mich als Kleinkind durchaus ein Problem, vor allem als ich älter wurde und eine Größe erreichte, die meine Schultern in dieselbe Höhe ihrer Ellenbogen brachten.
Um es einmal zu verdeutlichen, wie das damals ablief: Unsere Küche war winzig, schon für ein Kind wie mich, insbesondere halt auch für Erwachsene, selbst wenn sie nicht größer waren als meine Mutter.
Und wenn meine Mutter in dieser Küche arbeitete, bewegte sie sich ziemlich schnell und für mich geradezu hektisch-chaotisch. Das Durchqueren der Küche wurde dadurch zum Problem. Ich musste genau kalkulieren, wie ihre nächsten Bewegungsabläufe sein würden, um eine Kollision mit ihren Ellenbogen zu vermeiden.
Um es kurz zu machen: Es gelang mir niemals, die Küche ohne eine solche Kollision zu durchqueren!
Man könnte mich jetzt fragen, wieso ich dann überhaupt noch die Küche durchquert habe. Dafür gibt es eine ganz einfache Erklärung: Im Winter war sie der einzige beheizte Raum. Geheizt wurde lediglich über den Küchenherd, den Aichien morgens in aller Frühe anwarf und dessen Glut erst im Laufe der Nacht verglomm.
Im Sommer war der Herd übrigens ebenfalls in Betrieb, auch bei größter Hitze, weil meine Mutter gern und reichlich kochte und dabei eben auf den Herd zwingend angewiesen war.
Das Durchqueren der Küche hatte allerdings noch einen weiteren Grund, wie ich nicht vergessen darf zu erwähnen: Auf der anderen Seite, dem Eingang schräg gegenüberliegend, gab es eine Couch. Sie stand mit dem Fußende unter dem Fenster, ragte also in einen kleinen Erker hinein. Diese Wand dort war ja ziemlich schief, weil sie dem Dachverlauf folgte. Nur im Erker konnte man als Erwachsener aufrecht stehen, und wenn ich als Kind auf die Couch kletterte, war es mir möglich, mich bäuchlings auf die Fensterbank zu lehnen und hatte einen großartigen Ausblick über die ganze Stadt St. Ingbert.
Vor allem in der Silvesternacht bekam diese Aussicht eine ganz besondere Bedeutung. Meine Eltern mussten mir jedes Mal versprechen, mich pünktlich zu dem Spektakel zu wecken: Die Bierbrauerei Becker, die es damals noch gegeben hat, auf der anderen Seite der Stadt, ebenfalls höher gelegen, hatte zudem auch noch einen hohen Turm, der wie ein Wahrzeichen die ganze Stadt überragte. Auf diesem Turm gab es das tollste Feuerwerk, das ich jemals in meinem ganzen Leben erlebt habe. Jedes Jahr aufs Neue. Da riss ich die zwar müden, aber ungeheuer neugierigen Augen auf und konnte mich gar nicht satt sehen an dem bunten Farbenspiel, den Wasserfällen aus Funken, die vom Turm hinab prasselten, und dergleichen.
Eigentlich darf ich sagen, dass dieser Platz auf dem Fußende der Couch, bäuchlings auf der Fensterbank am offenen Fenster liegend, mein Lieblingsplatz war. Außer im Winter, weil es dann meiner Mutter zu kalt wurde und sie das Fenster geschlossen hielt, egal wie sehr ich darum bettelte, dass sie es für mich öffnete.
Ach ja, einmal die Woche war Waschtag. Da befand sich meine Mutter unten in der Waschküche am großen Waschtrog für die Kochwäsche – eigentlich gab es nur Kochwäsche damals – und hängte die frisch gewaschene Wäsche hinter dem Haus im Hof auf. Die Waschküchentür war ebenerdig, weil das Haus am Hang stand. Auf der anderen Seite, oben, war der Haupteingang – und dort unten, aus der Waschküche hinaus führend, befand sich der Hinterausgang.
Und ich war in dieser Zeit allein in der Wohnung.
Meine Mutter hatte wohlweislich das Küchenfenster geschlossen während ihrer Abwesenheit, obwohl es an diesem Tag schön warm war draußen. Etwas, was ich nicht akzeptieren konnte, und es stellte sich nach einigem Bemühen heraus, dass ich inzwischen immerhin an den Fenstergriff hoch reichte. Nicht nur das: Mit aller Kraft gelang es mir sogar, den Griff zu drehen und das Fenster zu öffnen.
Das war ein echtes Erfolgserlebnis, das mich ziemlich euphorisierte. Ich lehnte mich bäuchlings auf die Fensterbank und spähte. Tief unter mir war der Garten hinter dem Haus. Zwischen Haus und Garten gab es ja noch den Hof, in dem meine Mutter die Wäsche aufhängte. Ich befand mich also einschließlich Keller vier Stockwerke höher und hörte zwar meine Mutter, aber die Regenrinne verbarg mir die Sicht zu ihr. Also rutschte ich weiter vor, hinaus auf das sehr steil abwärts führende Stück Dach unterhalb des Erkers.
Noch ein Stückchen, bis ich über den äußeren Rand der Dachrinne spähen konnte.
Da war sie, meine Mutter, nicht zu übersehen, wie sie fleißig Wäsche aufhängte.
„Hallo, Mama!“, rief ich erfreut.
Sie sah zu mir auf – und war im nächsten Augenblick spurlos verschwunden.
Ich rückte noch ein kleines Stückchen weiter, um sie wieder sehen zu können. Nur ein kleines Stückchen, aber in diesem Moment wurde mir bewusst, dass ich es niemals wieder schaffen würde, zurück zu kriechen. Es gab kein Halt auf dem glatten Dach für meine kleinen Händchen. Ich spürte zudem, dass ich zu rutschen begann. Schier unendlich langsam zwar, aber unaufhaltsam.
Panik befiel mich, doch ich blieb äußerlich ruhig, hoffend, dass nichts passieren würde. Obwohl die Regenrinne immer näher kam und ich ganz genau wusste, dass sie mich nicht aufhalten konnte. Vor allem, weil ich nicht in der Lage war, mich daran festzuhalten. Geschweige denn, mich daran hoch zu ziehen, um zurück in das Fenster zu kriechen.
Ich gab keinen Laut von mir, war starr und steif, während ich ganz langsam weiter glitt.
Und dann packte mich etwas mit ungeheurer Macht an den Füßen. Ich flog durch die Luft und knallte schließlich mit voller Wucht auf die Couch.
Bevor ich überhaupt begriff, was geschehen war, brüllte ich gotterbärmlich los, brüllte mir alles aus dem Leib, was ich empfand.
Bis mir bewusst wurde, in welch beklagenswertem Zustand sich meine arme Mutter befand:
Sie, die sie mit Fug und Recht behaupten konnte, so ziemlich die unsportlichste Person weit und breit zu sein, war im Rekordtempo die ganzen Treppen hoch gehetzt und hatte mich im buchstäblich letzten Moment gerettet.
Sie hatte mir ein zweites Mal das Leben geschenkt!
Ich weinte. Jetzt nicht mehr, weil ich schockiert über die plötzliche Rettung war, auch nicht mehr, weil in mir die Todesangst vor dem Absturz in die Tiefe nachhallte, sondern um Sorge um meine arme Mutter.
Aber sie erholte sich, bekam wieder die gewohnte Farbe ins Gesicht, und dann herzte und drückte sie mich, dass ich keinen Atem mehr bekam.
Ein Augenblick, den ich niemals wieder vergessen konnte. Wie denn auch? Immerhin einer der wirklich dramatischsten Augenblicke meines ganzen Lebens.
Muss ich jetzt noch erwähnen, dass ich seitdem eine ausgeprägte Höhenangst habe?
6
Noch ein Beispiel gefällig, wie Kindheitserlebnisse das ganze Leben beeinflussen können?
Stichwort: Regenwürmer!
Ja, die gab es zuhauf hinter dem Haus, das meine Eltern einige Jahre später in der Stadt kauften. Ein Haus mit Garten wohlgemerkt. Ein Garten, den irgendjemand umgraben musste, während Aichien unsere Brötchen verdiente und mein großer Bruder ebenfalls keine Zeit hatte. Unsere Mutter war dafür nicht zuständig. Also traf es eben mich. Obwohl ich noch ziemlich klein war, mit gerade mal neun Jahren, aber immerhin längst kein Kleinkind mehr. Ich schnappte mir also den Spaten und machte mich ans Werk.
Auf einen Streich schaffte ich den Garten natürlich nicht, also teilte ich mir das ein und hatte eine Beschäftigung für mehrere Tage. Danach würde Aichien mit dem Rechen alles einebnen, in Beete aufteilen und die Saat ausbringen. Er besorgte auch die Bewässerung, falls erforderlich, und unsere Mutter nahm dann die Ernte vor, sobald es an der Zeit war.