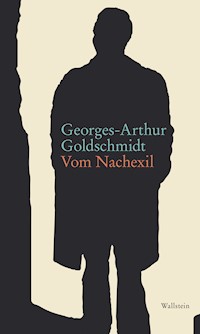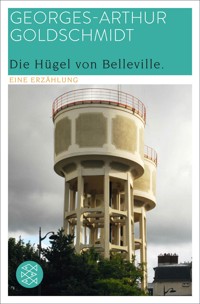9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein wunderbares Buch über die Sprache, die wie der Blutkreislauf unsere Existenz durchzieht. Goldschmidt, der gebildetste und feurigste Vermittler zwischen Frankreich und Deutschland, schreibt auf erstaunliche Weise über das Leben in zwei Sprachen und das Übersetzen. Leidenschaftlich und spannend öffnet er die Bedeutungsräume zwischen den beiden Sprachen, in dem Wissen, dass sich hinter dem Gesagten ungeahnte Kostbarkeiten verbergen. »Ein verblüffendes Buch über die Sprache« Peter von Matt
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 255
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Georges-Arthur Goldschmidt
Als Freud das Meer sah
Essay
Über dieses Buch
In verblüffenden Beobachtungen arbeitet der Schirftsteller und Übersetzer Georges-Arthur Goldschmidt – der gebildetste und feurigste Vermittler zwischen Frankreich und Deutschland – die Verschiedenheiten der Sprachen seines Lebens heraus. Das deutsche Wort schafft einen Sinn, dem im Französischen kein Ausdruck entspricht und umgekehrt. So entsteht beim Übersetzen immer ein Zwischenraum des Unsagbaren. Wie kommt es aber, dass der nicht in Worte zu fassende Sinn dennoch an die Oberfläche tritt? Goldschmidt hat nicht umsonst Freud zum Paten seiner Überlegungen gewählt. Wenn der Begründer der Psychoanalyse das Unbewusste ins Bewusste übersetzt, bewegt er sich wie Goldschmidt zwischen zwei Sprachen, in dem Wissen, dass sich hinter dem Gesagten ungeahnte Kostbarkeiten verbergen. Das Bild vom Meer macht dieses Verhältnis auf wunderbare Weise deutlich. Unter der sichtbaren Wasseroberfläche verbirgt sich in der Tiefe Geahntes und Ungeahntes, das die Strömung manchmal nach oben spült.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
Die Originalausgabe erschien 1988 unter dem Titel »Quand Freud voit la mer – Freud et la langue allemande« bei Editions Buchet/Chastel, Paris
© 1988 Buchet/Chastel, Paris,
Die deutschsprachige Erstausgabe erschien 1999 im Ammann Verlag & Co., Zürich.
© 2018 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung: Nicole Lange, Darmstadt
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-490844-1
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Widmung
Motto
Vorwort zur deutschen Ausgabe
Die Fluten der Sprache
I Freud und die Sprache
1. Das Unbewußte
2. Verdrängung und Wiederholung
3. Der Reim aufs ver- oder der Leib des Ménalque
4. Die Strömungen des Meeres
II Das Unbewusste der Sprache
1. Woran denkt die Sprache?
2. Die Begierden und Zwänge der Sprache
III Gibt sich der Wahnsinn einem Wahn hin?
1. Die Illusionen des Wahns
2. Die Illusionen der Seele
3. Die Seele zum Reden bringen
IV. Das Geständnis auf der Zungenspitze
Wie soll man es loswerden?
Der Diskurs über die Juden
Eine schweigende Auslöschung
Die Auslöschung auslöschen
Die Endlösung
»L’impensé radical«/Das radikal Ungedachte
Ein großes Schweigen
Der Ort des Verbrechens
Die Gegenwart des Verbotenen
Das unsagbare Begehren
Die Bedingungen einer Analyse
Wahnwitz und Diskurs
Anhang
Literatur
[Kapitel]
Für Judith Dupont in Freundschaft
»Herbert brauchte keinen, der ihm beibrachte, das tobende Meer zu lieben; er keuchte und schrie vor Lust zwischen den riesigen Wogen, denen er keine zwei Minuten standhalten konnte, bis sie ihn, der vor Begeisterung lachte, zu Boden warfen. Er aalte sich in den tobenden Fluten wie ein junges Seetier, er stürzte sich den Wasserschlünden entgegen, die ihn mit einem einzigen Wellenschlag bäuchlings hinstreckten, er schmiegte sich an ihren weichen, unerbittlichen Busen, er rang mit der See wie ein Liebender mit seiner Geliebten, er warf sich mit aller Kraft auf sie und ergab sich ihr, wenn sein von der Gischt gepeitschter Körper sich von den Schultern bis zu den Knien rötete, entzückt von ihrer Macht. Dann kam er zum Strand zurück, glühend, atemlos, aber unbezähmt.«
A. C. Swinburne, Lesbia Brandon
»Aus meiner Darstellung erhellt, daß wir von äußeren Ursachen auf viele Weisen bewegt werden und hierhin und dorthin schwanken wie die von entgegengesetzten Winden bewegten Wellen des Meeres, unkundig unseres Ausgangs und Schicksals.«
Spinoza, Ethik
»In der Wasserwelt des Inneren wird jede Geste begleitet von einer Berührung, getragen, geführt, erfüllt von einer Zärtlichkeit, die weniger neutral ist als die der Luft: einer Zärtlichkeit halluzinierten Wassers, das erstarrt, Materie geworden ist, ohne den Zauber des Flüssigen zu verlieren. Darin badet der Körper mit fast all seinen Sinnen.«
Christian Pierrejouan, L’envers
Vorwort zur deutschen Ausgabe
Wie kaum ein anderer vor ihm hat Freud die »Sprachlichkeit«, wie man so sagt, »an den Mann gebracht«, die Blickrichtung, die sonst immer nur die Sprache als solche anvisiert, umgedreht und sie zu deren eigentlichem Ausgangspol, dem jeweils Sprechenden, zurückgeführt, so daß sich jeder die Frage stellen kann: Wie fühlt sich die Sprache an, wenn ich mit ihr umgehe, oder besser noch: Was passiert mit mir, wenn ich rede? Denn die Psychoanalyse ist doch nichts anderes als eine Frage nach der Sprache, eine Aufdeckung dessen, was sie (sich) selber verschweigt oder im Gegenteil hervorhebt, im Gegensatz zu einer anderen Sprache. Von einer Sprache zur anderen verlagern sich die Wahrnehmungen und die Begriffe sowie auch der Ausdruck der Gefühle, denen keine Übersetzung wirklich entspricht (im Deutschen z.B. »das Unheimliche« oder im Französischen »jouir«).
Einleuchtend wird es gerade da, wo sich eine Sprache dem Zugriff der anderen verweigert, wo also die Übersetzung nicht mitkommt, wo der Zwischenraum bestehen bleibt und mehr vielleicht noch als der übertragbare Wortlaut den »Sinn« enthält, aber nicht vermittelt. Je weniger sich ein Wort oder ein ganzer Satz übersetzen lassen, desto mehr drängen sie zum Übersetztwerden, so, als ob gerade die Sprache am deutlichsten zu hören wäre, wo sie eben schweigen muß. Warum schweigt die eine Sprache, wo die andere spricht und umgekehrt? Aber die andere Sprache hat wiederum nicht, was der ersten fehlt, und jener fehlt, was die andere hat. Jede öffnet andere Wege, die sich nur stellenweise kreuzen, alle aber führen durch denselben Wald der menschlichen Sprachlichkeit.
Man kann eine Sprache, das Deutsche insbesondere, viel eher beschreiben, als daß man sie übersetzen könnte. Es bleibt aber immer sowohl in der Übersetzung wie in der Beschreibung ein »Rest«, der nicht durchkommt und hängenbleibt. Jener Rest ist aber nie in der Sprache selber, die es ohne die Sprechenden doch gar nicht geben könnte, sondern gerade bei ihnen, in ihrem Verstehen, und auf das »Wie« jenes Verstehens kommt es an.
Das Deutsche kommt dem unmittelbaren Verstehen anscheinend viel mehr entgegen als das Französische, welches viel verschleierter und mittelbarer, auf ganz anderen Wegen die Sachen zum Ausdruck bringt. So setzt Freud da mit der Sprache an, wo das Französische nicht mitmacht, wo es sich sozusagen der Untersuchung verschließt, als gäbe es so etwas wie eine metaphysische Scham. Die beiden Sprachen liegen anders vor der Realität, das Deutsche angeblich ursprünglicher, mit einem vermeintlich »offenen« Zugang zur seelischen Wirklichkeit, das Französische verhaltener, mit vielleicht mehr historischer Geschliffenheit, so daß sich derselbe Text von einer Sprache zur anderen verschiebt und auf eine andere Sprachebene verlagert. Die übersetzten Texte kommen anderswo anders an, bleiben jedoch in ihrem Sinn unverändert, denn es gibt im menschlichen Denken keine Unzugänglichkeit, und die Rolle Freuds bestand darin, eben jene »durchsprachliche« Zugänglichkeit aufzudecken.
Die Idee zum vorliegenden Buch hat sich in einer Wohnung mit Blick auf die Seine auf der einen Seite und die Place Dauphine auf der anderen ergeben, während einiger gemeinsamer Nachmittage mit französischen Analytikern, die zusammen die »Die Verneinung« von Freud neu übersetzen wollten. Es erwies sich dabei, daß Kollektive von Übersetzern nicht richtig arbeiten können und daß die Sprache der Psychoanalyse öfters Wesentliches beiseite läßt oder einfach überspringt. Es stellte sich die Frage, ob diese Auslassungen von Bedeutung waren, ob die rein »psychoanalytische« Übersetzung, bei welcher das Technische den Vorrang hat, überhaupt noch dem Wortlaut gerecht war und ob umgekehrt eine exzessive Treue dem Verständnis nicht schaden könnte. Wie war der Text rein sprachlich anzusehen und wiederzugeben? Das kleine Vergleichsspiel der beiden Sprachen miteinander schlug sich dann in diesem kleinen Buch nieder.
Es ging also darum, die deutsche Sprache, wie sich Freud ihrer bedient hat und wie sie ihm zu denken gab, dem französischen Publikum in ihrem Funktionieren darzulegen zu versuchen, um so mehr, als die Psychoanalyse im französischen Sprachbereich eine große Bedeutung erreicht und die Entwicklung des Französischen beeinflußt hat, so z.B. ist aus der Notwendigkeit des Übertragens 1906 das Wort pulsion entstanden, als Übersetzung des Wortes Trieb. Es ist die Frage zu stellen, ob nicht gerade die Übersetzungsprobleme, die immer das Zeichen einer in der Schwebe gebliebenen »Sinnmasse« sind, der Psychoanalyse ihren Reichtum verliehen haben.
Die beiden Sprachen gehen völlig andere Wege mit demselben psychoanalytischen Objekt. Schon der grammatikalische Aufbau, so wie er sich bei Freud immer wieder manifestiert, ist im Französischen völlig unbekannt, der Nebensatz gestaltet sich völlig anders: Im Deutschen versteht man ihn nicht, solange das Zeitwort nicht gefallen ist, im Französischen wird das Wesentliche sofort ausgedrückt. Im Französischen gibt es kein Neutrum, und so wird das Unbewußte maskulin (l’inconscient) und aktiv, wie es auch kein Weib gibt, sondern nur eine Frau (la femme).
Die meisten Wörter des Französischen kommen aus dem Lateinischen oder dem Griechischen und zeigen sehr oft recht wenig von ihrer Bestimmung, wo sie im Deutschen meistens direkt aus der Sprache heraus lesbar und von selber zugänglich sind. Die beiden Sprachen haben eine ganz andere Geschichte, eine gewisse Form der Soziabilität und eine Art Understatement dominieren im Gebrauch des Französischen, eine gewisse Naivität, wenn nicht Gravität herrscht im Deutschen vor, wie auch eine besondere Fähigkeit, die konkrete Räumlichkeit zu beschreiben, das hatte seinerzeit schon Leibniz gemerkt.
Gerade aber jene mögliche Feierlichkeit führte in jüngster Zeit zu besonders krassen Mißverständnissen wie der besonders dummen Behauptung eines Hotzenwälder Denkers[1], daß sich das Französische für das philosophische Denken nicht eigne, eine haarsträubende, von selten prätentiöser Ungebildetheit zeugende Beurteilung. Es wurde genauso behauptet, das Französische sei eher »leichtfüßig« und neige mehr zum Politischen.
Es geht nun eben darum zu zeigen, daß keine Sprache irgendeiner anderen überlegen ist, daß keine geeigneter zum Denken oder zum Poetisieren (um das Wort »Dichten« zu vermeiden) sei als eine andere. Jede aber drückt ihren Bezug zur Wirklichkeit oder zur Realität verschieden aus. Dasselbe sieht anders aus in der anderen Sprache, und da liegt auch das Entscheidende an der Entdeckung Freuds. Die Psychoanalyse bleibt sich gleich – trotz der »Verschiedenheiten des menschlichen Sprachbaues«. Es gibt keine sogenannten »Volksseelen«, keine unübertragbaren Eigentümlichkeiten, es gibt von der Geschichte gestaltete Sprachgebräuche, die sich die Vertreter der »geistigen« Obrigkeiten mehr oder weniger angeeignet haben, die sich auch durch die Zeiten wiederholt, vervollständigt und entwickelt haben. Sprachgeschichte ist oft auch zu einem gewissen Grad eine Geschichte der Unterwerfungsschemen der Völker und der Einzelnen unter die Gebote des Über-Ich, die sich immer anders, von einer Kultur zur anderen ausdrücken.
Freuds Werk entsteht aber auch parallel zum Entgleiten Europas in den kollektiven Wahn, der in Deutschland seine kriminellsten Formen angenommen hat, als ob die psychoanalytischen Schriften Freuds eine Art unbewußte Voranalyse des Nazismus gewesen wären, daher kommt auch seinem Wortschatz eine überindividuelle, sozialhistorische Bedeutung zu, die die Wichtigkeit der Übersetzungsarbeit noch unterstreicht und eine Veranschaulichung des Sprachinhalts in der anderen Sprache um so mehr verlangt. Die Frage ist nämlich diese: Was kommt wirklich der Ausgangssprache zu, was ist ihr und der Zielsprache gemeinsam? Was bedeutet eigentlich »Unübersetzbarkeit«, ist sie zufällig, oder sind die Schwierigkeiten immer dieselben, gibt es eine durchgehende, immer ähnliche sprachliche Abgrenzung? Was hat eine solche Unübertragbarkeit zu bedeuten, ist sie auf ein sprachliches Unbewußtes zurückzuführen, welches sich in jeder Sprache jeweils auf eine andere Weise manifestieren würde?
Jedenfalls sind aber solche Sprachhindernisse nur holprige Pflastersteine, welche die Weiterfahrt auf der Straße nur ein wenig beeinträchtigen. Trotz oder gerade dank solcher Hindernisse kommt die jeweilige Sprache zu sich selber, ihr Inhalt verschärft, verdeutlicht sich angesichts desselben, nur anders ausgedrückten Inhalts in der anderen Sprache. Es ist wie im Wald, in der Mitte steht der schöne Biergarten, aber jeder Weg, der hinführt, zieht durch andere Waldpartien, durch andere Landschaften zum selben Wanderziel.
Die Sprachen sind wie das Meer, weit und grenzenlos, alle Küsten sind verschieden, überall ist das Wasser anders und bleibt sich dabei doch immer gleich, daher die Wichtigkeit des freudschen Sprachabenteuers, es deckt nämlich die grundlegende Einheitlichkeit der verschiedenen Verhaltensweisen auf, die sich jeweils auch durch die Sprachen hindurch ausdrücken und ineinanderfließen, so daß die Frage zu stellen ist, ob und wie eine Sprache zur Aufdeckung der unbewußt gebliebenen Formen des Über-Ichs verhelfen kann.
Dieses Buch wurde 1985 geschrieben, seitdem hat sich der Lauf der Geschichte, wie sie bereits in den vierziger Jahren unseres Jahrhunderts verlief, bestätigt, daß die »Shoah« sich immer weniger als ein nur deutsches Problem erweist und immer mehr als ein allgemein europäisches. Seitdem sind auch weitere Veröffentlichungen zu diesem Thema erschienen, die aber anscheinend doch noch nicht mit dem Tabu von der Trennung von Politik und Sexualität fertig geworden sind, mit der Ausnahme von Nicolaus Sombart, dessen 1991 erschienenes Buch Die deutschen Männer und ihre Feinde auf hoch aufschlußreicherweise diese Frage wieder aufnimmt, und doch kann man dieses eigenartige Buch nicht ohne ein gewisses Unbehagen lesen. Deutschland war vielleicht nur der jeweilige Ort, wo sich das allgemein ins kollektive Unterbewußte Verdrängte am deutlichsten unter der Bewußtseinsschwelle manifestierte. Die Geschichte hatte nichts verdecken können, es gab kein übermächtiges Über-Ich wie in so vielen anderen europäischen Kulturen, oder jedenfalls war ein solches Über-Ich leichter abzugrenzen, es hatte sich noch nicht derart ins Bewußtsein der Menschen eingeprägt, daß sie vielleicht oft kaum noch wissen konnten, was »ihnen« oder ihrem Über-Ich zuzuschreiben war. In satirisch, boshaft überspitzter Form könnte man in post-freudianischem Jargon behaupten, daß sie noch nicht ganz die Instrumente ihrer eigenen Unterdrückung waren, um es dann, begeistert, bis in die Katastrophe hinein, zu werden.
Vielleicht war der deutsche Sprachbereich nicht von ungefähr das Terrain für die Entstehung und Ausarbeitung der Psychoanalyse gerade zur Zeit des Sichausbreitens der absoluten Barbarei und der Hinrichtung der Völker. Der Gebrauch der deutschen Sprache hat, aus der Perspektive der historischen Entwicklung heraus, den Zugang zu den überdeckten Bereichen des Seelenlebens vielleicht erleichtert, wenn nicht gefördert.
Ich danke von Herzen meiner Übersetzerin für die schöne Arbeit, die sie geleistet hat.
Georges-Arthur Goldschmidt
Fußnoten
[1]
Siehe Der Spiegel, Nr. 23, 31. Mai 1976, S. 217.
Einleitung
Die Fluten der Sprache
»Es nehmet aber und giebt Gedächtniß die See …«
Hölderlin, Andenken
Die Sprache des Menschen ist wie die See: Unzählbar sind ihre Gestade, ihre Inseln; über unbekannte, unsichtbare Tiefen nimmt man Kurs aufs Unendliche. Das Wasser ist stets dasselbe und ändert sich ständig, es fließt, weicht zurück, schmiegt sich an alles, was eintaucht, wechselt dauernd die Farbe, den Himmel über sich spiegelnd; in der Sonne schillert es blaßgrün bis tiefblau, je nach Breitengrad und Augenblick.
Die geringste Berührung prägt sich der See wie der Seele des Menschen ein; sie gibt allem nach, bei Windstille läßt der leiseste Hauch sie erschauern, und wenn eine Wolke die strahlende Sonne plötzlich verdunkelt, wird sie düster und drohend.
Gezeichnet vom Wechsel der Farben, vom Wandel der Stimmungen, die von Jahrhundert zu Jahrhundert, von Jahrtausend zu Jahrtausend unendlich variieren und sich doch immer wiederholen, bleibt sie sich gleich: Alles ist Meer, nirgends ein Bruch; vom höchsten Norden bis zum tiefsten Süden erlauben dieselben Fluten eine stetige Fahrt.
So ist es auch mit den Sprachen: Dasselbe Gewässer, von anderen Ufern gesehen, erlaubt die unendliche Reise rund um die Welt, ohne das Schiff zu verlassen, die Reise von Sprache zu Sprache. Abends auf See ein Wolkenband, weit entfernt, der Gipfel einer Insel, die sich eines Morgens aus den Fluten erhebt, und doch ist man immer auf See. Sprache ist, was zwischen den Sprachen auftaucht, und ist doch die See selbst, die uns trägt.
Reisende aller Zeiten und Länder haben sie vielfach beschrieben, indes sie kannten den Grund nicht tief unter ihnen, träumten wohl von geheimnisvoll schaurigen Tiefen und schöpften doch keinen Verdacht, bis das Meer sie verschlang.
Erst unlängst, Ende des letzten Jahrhunderts, begann man den Grund des Meeres zu erforschen, zur gleichen Zeit, als die Psychoanalyse sich aufmachte, die Seelengründe des Menschen zu entdecken. Man fand, daß das Sonnenlicht nur 250 bis 300 Meter unter die Oberfläche dringt, und Freud erkannte, daß nur die Oberfläche der Seele bewußt und das Bewußtsein weit davon entfernt ist, deren Gesamtheit zu durchdringen. Man hielt die Tiefen des Ozeans für unbewohnt und wußte noch nichts vom Leben des Unbewußten.
Die Stille des Meeres und das Schweigen der Seele sind heute gleichsam umzingelt vom Sprechen, doch dieses Sprechen enthält auch alle Tiefen des Schweigens. Denn die Stille (le silence) ist das Schweigen der Dinge, wo das Schweigen (le silence) die Stille hinter den Worten ist; schweigen (se taire) bedeutet: nichts sagen, aber das Deutsche besitzt hier ein Substantiv, wo das Französische keines hat.
Le silence de la mer – ist das die Stille der See oder das Schweigen des Meeres? Auch hier drückt das Deutsche sich anders aus. Die See bedeutet das offene Meer, das Meer als Element: Wir fahren an die See – nous allons à la mer. Das Meer ist entfernter, geographisch definiert, an einem bestimmten Ort gelegen und, streng betrachtet, nicht dieses fundamentale Element im individuellen Fühlen: Das Meer hat einen allgemeinen Charakter, den die See nicht hat.
»Es beginnet nemlich der Reichtum im Meere«, sagt Hölderlin in dem eingangs zitierten Gedicht[1], denn größer als jenes, umfängt die hoch aufpeitschende[2] See das Meer; und wenn auch das Deutsche das Wortspiel mer/mère (Meer/Mutter) nicht kennt, gelangt es doch auf anderen Wegen, anderen Umwegen zu demselben Ergebnis.
Es ist, als berge die deutsche Sprache die ursprüngliche Brandung der See, bewahre ihr Wiegen, Ebbe und Flut. Wie der Spaziergänger am Strand mit dem Wellenschlag atmet (und das nicht weiß), ist das Deutsche durchdrungen von der Bewegung der Lunge.
Die ganze deutsche Sprache ist auf dem Wechsel von Hebung und Senkung des Brustkorbs aufgebaut, auf An- und Abstieg, Hin und Her im Raum: Das berühmte Fort-Da des kleinen Kindes in Freuds »Jenseits des Lustprinzips« verleiht dem Ausdruck. Im Deutschen geht alles vom Körper aus, kehrt zu ihm zurück, geht durch ihn hindurch: Der Leib (der das Leben selber ist) hat denselben Ursprung wie das Leben (la vie, life). Der Leib ist das Lebendige selbst, das Leben, wie es leibt und lebt; der Leib (le corps) ist etwas ganz anderes als der Körper (le corps), der dem lateinischen corpus entsprungen ist, der organische Körper und auch der Lehrkörper, le corps de métier, die Körperschaft. Der Leib dagegen ist der Körper, der ich bin, mein Leib und Leben.
Die Sprache ist ihm eingepflanzt, unaustilgbar. Es gibt wirklich keine größere Dummheit, als vom abstrakten Charakter des Deutschen zu reden: Keine andere Sprache ist so konkret, so räumlich; das Deutsche ist, genaugenommen, unfähig zu jeder Abstraktion. Seine abstrakten Begriffe bezieht es aus dem Französischen oder konstruiert es nach dem Französischen. So bei Hegel: immanent, positiv, negativ, das Subjekt, die Reflexion, das Princip usw. Bewahrt nicht das Deutsche in der physischen Präsenz des Körpers eine vage Erinnerung an die verlorene Einheit von Leben (Leib) und Erkenntnis? Und die Räumlichkeit trägt noch zum konkreten Charakter der Sprache bei: Freud mußte nur ihren Übergängen folgen, ihren Linien, ihrem Ansteigen und Abfallen.
Nichts einfacher, nichts unmittelbarer als das philosophische Vokabular. Das erste Kapitel von Hegels »Phänomenologie des Geistes«[1] besteht nur aus Wörtern, über die schon ein fünfjähriges Kind verfügt (mit Ausnahme vielleicht der Begriffe Vermittlung und Unmittelbarkeit). Je tiefer sich die deutsche »Philosophie« gibt, desto simpler und konkreter ihre Sprache, in jedem Fall aber sehr nahe dem leiblichen Befinden, dieser inneren und äußeren Befindlichkeit des Leibes.
Alles Denken nimmt seinen Ausgang notwendig von einem bestimmten Punkt des Raumes aus, an dem sich das Ich (je) befindet. Dieses Ich kann übrigens niemals moi sein, das in ihm ruht, ohne sich selbst meinen zu können, als ob es ein Ich (moi) gäbe, das in der Sprache eingemauert ist. Wilhelm von Humboldt (der etwas zu oft vergessen wird) stellte fest, daß die Sprache sich immer von diesem synästhetischen Punkt aus organisiert[2] – vielmehr: Sie nimmt dort Platz.
Die Gesamtheit der deutschen Sprache bildet sich von der Lage und der Bewegung im Raum aus. Das wird sehr hübsch veranschaulicht durch einen Würfel mit Figuren, der jungen Franzosen, wenn sie Deutsch lernen, die Präpositionen auf, über, neben usw. begreiflich machen soll, die entweder den Dativ oder den Akkusativ regieren, je nachdem, ob ein Ortswechsel stattfindet oder nicht.
Die Sprache ist um einige Grundwörter wie stehen, liegen, sitzen und die ihnen entsprechenden Faktitiva stellen, legen, setzen aufgebaut – das heißt um Verben, die eine Bewegung im Raum ausdrücken. Diese Grundwörter, zu denen noch viele andere kommen, haben im Französischen kein Äquivalent, kommen aber praktisch in jedem dritten deutschen Satz vor und lassen sich unbegrenzt mit einer Vielzahl von Partikeln kombinieren: Legen kann man mit mindestens zwanzig Partikeln zusammensetzen, deren jede wiederum mindestens zehn verschiedene Bedeutungen hat, wie ablegen, anlegen, auslegen.
So verhält es sich auch mit der Mehrzahl der Verben, deren Kombinationsmöglichkeiten, die immer auch eine räumliche Bedeutungsnuance haben, unerschöpflich sind. Leicht lassen sich vollkommen kohärente und grammatikalisch korrekte Wörter finden, wie umfenstern oder durchlöschen, für die es noch keine Bedeutung gibt.
Stehen, die Senkrechte, und Liegen, die Waagrechte, bestimmen den Sinn jeder sprachlichen Äußerung im Deutschen. Nicht zufällig hat Luther vor dem Landtag zu Worms gesagt: »Hier stehe ich und kann nicht anders.« Er hätte auch sagen können: Darauf bestehe ich. Hier ist Luther, aufrecht steht er für seine Wahrheit ein, und niemals würde er gestehen, wozu er nicht stehen kann[1]. Dafür wäre er fähig, kerzengerade alles durchzustehen und bis zum Ende zu leiden, ohne gestanden zu haben. Das Wort stehen ist eine der Hauptstützen der deutschen Sprache, einer der im Meer des Sinns aufragenden Pfähle, an denen sie ihre Pontons baut.
Unermüdlich schwappt Wasser um diese Pfosten, es kommt und geht, steigt und fällt, dieses Flüssige, aus dem die Sprache entsteht; See und Sprache sind so eng verwandt, daß im Deutschen (wie wir noch sehen werden) sogar die Seele, die bei Freud eine so große Rolle spielt, aus dem Wasser kommt. Sie hat den Geschmack der See, sie treibt in ihr, wie sie in der Lymphe schwimmt oder im Likör, den so viele Jünglinge zu schmecken bekamen. Die deutsche Sprache versteht es, den Geschmack eines jeden zu treffen, ihm zu schmeicheln und selbst darüber noch hinwegzutäuschen.
In seinem schönen Buch über Friedrich Hölderlin[1] wies Pierre Bertaux darauf hin, daß der Geist (l’esprit) auf schwäbisch (und Hölderlin war Schwabe) »Geischt« gesprochen wurde, Gischt also, das Emporschießende, Schäumende, Sprühende, vor dem man sich mit einem Südwester schützen kann, vielleicht auch die Springbrunnen jugendlicher Trunkenheit. Jedenfalls mußte der »Geischt« Hölderlin und seinen Freunden vom Tübinger Stift so erscheinen. Für sie gab es im Herzen der Sprache keine Trennung zwischen Seele und Leib.[2]
Das Deutsche beschwört ununterbrochen die Urszene herauf – nicht die scène primitive des Französischen, sondern jene Urszene, von der Freud spricht. Die Urszene müßte eher scène originaire heißen: Ur- ist so etwas wie ein verwandtes Präfix von er- (das aus, hervor i.S. von entsprungen, hervorgegangen bedeutet) und läßt sich unzähligen gebräuchlichen Wörtern voranstellen. Es zeigt einen Ursprung an, einen Urzustand dessen, wovon man spricht, und die Umgangssprache hat daraus sogar ein Adjektiv gemacht: urig, nett (wie Kinder sind), gemütlich, ursprünglich, unverstellt.
Freud folgend, dessen Studie über den kleinen Hans eigentlich eine Analyse der Einsetzung der deutschen Sprache ist, sah Ferenczi[3] die Sprache im Leiblichen wurzeln und zur Regression neigen; alle Wörter hätten ursprünglich erotische Bedeutung, und das Obszöne sei nur eine Rückkehr zu diesem infantilen Stadium der Sprache.
Beim Vergleich des Deutschen mit dem Französischen wird deutlich, daß das Deutsche bis in sein Innerstes an die Gebärden und Begierden des Körpers gebunden ist. Die Interpunktion dient im Deutschen dazu, die Stellen anzuzeigen, an denen man Atem holt, sie zerschneidet den Satz in Propositionen, das heißt Atemgruppen. Die untergeordnete Proposition mit ihrem berühmten »Schlußverb« folgt ganz einfach der absinkenden Bewegung des Brustkorbs. Das Deutsche ist auf der Stimme aufgebaut: Allem Sprechen liegt Muskelarbeit zugrunde, durch welche jenes zutiefst im Körper verankert ist. Die Oberfläche zeigt sich, wenn sie durch die eigenen Tiefen gegangen ist; nur einen Augenblick lang treten ihre Wasser an der Oberfläche, ständig werden sie durcheinandergewühlt, auf den Grund des Ozeans getrieben und wieder emporgewirbelt. Das Meer atmet.
Nicht ohne Grund heißt es, man spricht mit dem Brustton der Überzeugung; es gibt keinen Text, keine Rede, wo man nicht den Atem anhält. Ich atme ein und aus,[1]einen Atemzug lang war nichts zu hören; das Hecheln, das Auf und Ab, der stoßweise Atem, die der schuldige Jugendliche zu verbergen sucht: Von diesem Rhythmus hebt die deutsche Sprache zu sprechen an.
Von diesem Auf und Ab und Hin und Her skandiert, erinnert das Deutsche an die Urszene, bei der einst das Kind die Eltern überrascht und wohl mehr gehört hat als gesehen. Vielleicht ist das vom rhythmischen Spiel der Sprache geprägte Fort-Da, das Freud es einleuchtend erklärt hat, ja auch eine Erinnerung daran.
Für die deutsche Dichtung ist dieser Rhythmus konstitutiv. Bertaux hat gezeigt, in welchem Maße die besondere Rhythmik der Hölderlinschen Poesie aus dem Gehen entstand. Ein ständiges Hin und Her, sagt das Deutsche, wobei hin und her Präpositionen sind, hin eine Bewegung bezeichnet, die etwas vom Sprechenden entfernt, und her die spiegelgleiche Annäherungsbewegung.
Hin und her, auf und ab finden sich wieder in der Mehrzahl der zusammengesetzten Verben. Sieh nicht hin, sagt man zu einem deutschen Kind, das nicht anschauen soll, was es doch sehen will. Diese Bewegung von Ebbe und Flut, das Hin und Her, der zweitaktige Rhythmus – man denkt an gewisse unzüchtige Handlungen, die deutsche Jugendliche in ihrer verzögerten Pubertät später als andere entdecken und wahrscheinlich viel länger ausüben – ist eigentlich die Basis der deutschen Sprache, welche im Grunde und von Natur aus nur solche Dinge im Sinn hat. Gründet das Deutsche nicht im Rhythmus der kindlichen Praktik? Beim Lesen mancher Dichter könnte man das glauben. Die dritte von Rilkes »Duineser Elegien« hat uns dazu, wie wir noch sehen werden, viel zu sagen.
Im Deutschen herrscht eine Art Urwüchsigkeit, die Sprache wächst aus sich selbst heraus und läßt gewissermaßen ständig ihre linguistische Kindheit wieder aufleben. Man sieht das am Beispiel der zusammengesetzten Wörter, von denen man zumindest sagen kann, daß es ihnen an Gewichtigkeit mangelt: Sie sind jedermann unmittelbar verständlich. Wer außer Hellenisten oder Botanikern wüßte denn, was eine allophile Pflanze ist? Der Deutsche nennt sie ganz einfach eine salzliebende Pflanze. Von sich selbst ausgehend, baut das Deutsche seine zusammengesetzten Wörter, überaus und allgemein verständlich: Die Psychographie ist ganz einfach die Seelenbeschreibung; ein Otorhinolaryngologe ist ein Hals-Nasen-Ohren-Arzt; das Peritoneum heißt auf deutsch Bauchfell, Erythrozyten sind rote Blutkörperchen. Es scheint, als ob die wissenschaftliche Forschung nie versucht hätte, sich vom Allgemeinverständlichen zu entfernen. L’hydrogène, der Wasserstoff, der Stoff, aus dem das Wasser ist; l’oxygène, der Sauerstoff, der Stoff, der sauer macht. Die Sprache selbst weist so jedem deutschen Kind den Weg. Es wäre müßig, alle französischen Wörter mit lateinischen oder griechischen Wurzeln (oder beidem) aufzuzählen, für die das Deutsche stets eine konkrete Übersetzung bereithält. Die Geographie ist im Deutschen die Erdkunde: Ohne weiteres versteht jeder gleich, worum es sich handelt.
Le mammifère heißt das Säugetier, dessen einer Stamm, saugen, übrigens auch ein Faktitiv säugen hat. Das Deutsche – und das geschieht oft, wenn nicht immer – verkehrt hier im Verhältnis zum Französischen die Blickrichtung: Wo das französische Wort mammifère die Mutter auf ihr Junges hinabblicken läßt, geht das Deutsche vom Jungen aus und hebt den Blick zur Mutter. Ein Bandwurm heißt auf französisch ver solitaire, einsamer Wurm, und während den Franzosen die Leberzirrhose von außen befällt (être atteint d’une cirrhose du foie), zieht sich die Leber des Deutschen in sich zusammen und wird zur Schrumpfleber. Jeder Knochen, jeder Muskel ist mit einem leicht wiederzuerkennenden Namen versehen: Die Tibia wird zum Schienbein, die Fibula zum Wadenbein, der musculus orbicularis oris zum ringförmigen Mundmuskel, der musculus zygomaticus zum Herabzieher und das Pankreas zur Bauchspeicheldrüse.
Fast unnötig, auch noch an das berühmte Stilleben zu erinnern, dieses stille, ruhige Leben, das mit nature morte (tote Natur) eher schlecht als recht übersetzt ist. Wer hat eigentlich dieses seltsame Wort ins Französische eingeführt, das viel zu schnell auf das Wesentliche zu sprechen kommt? Ist die Sprache unschuldig? Was will sie nicht sehen, indem sie einige Wörter umgeht, um aus ihnen andere zu machen? Was will sie übersehen?[1]
Wo das Französische von der Todesgefahr (danger de mort) spricht, sagt das Deutsche Lebensgefahr, Gefahr für das Leben. Wo das Französische poetisch die Sonne Schlafengehen (se coucher) und wieder aufstehen läßt (se lever), gibt es im Deutschen bloß Sonnenaufgang und Sonnenuntergang.
Alles ist verschieden von einer Sprache zur anderen, obwohl von denselben Dingen gesprochen wird: Dem Schweigen der einen mag das Sprechen der anderen entsprechen; doch ist die Sprache abhängig von dem, was sie sagt. Ihr Unbewußtes zeichnet sich an der Oberfläche der Wörter ab: Nicht zufällig steckt in Gedenken und Gedächtnis (mémoire), Gedanken und Denken (pensée) ganz offensichtlich dasselbe deutsche Wort. Die Verbindung zwischen dem französischen Wort mémoire und dem lateinischen mens (Geist) dagegen ist längst vergessen.
Denke daran – ich gedenke deiner. Denken wird in der Vergangenheit zu gedacht, daraus ist das Gedächtnis entstanden. Das Gedächtnis erlaubt mir, Dinge in mein Inneres zu holen, sie zu verinnerlichen, daher kann ich mich an sie erinnern, sie wieder zurückholen – das heißt sich erinnern. Die Sprache hat hier sichtlich für Freud gearbeitet, sie ist ihm letztlich vorangeeilt. Bringt man nämlich etwas nach innen, bedeutet das, daß es zuvor außerhalb des unmittelbaren Zugriffs des Bewußtseins war. Das Französische sagt dagegen se souvenir, also von unten zu Bewußtsein kommen, sub-venire, und nähert sich auf diese Weise dem Unbewußten weiter an. So reden die Sprachen offen, es genügt, ihnen zuzuhören. Das gesamte Freudsche Unterfangen – von dem dieses Buch vor allem handelt – bestand darin, die Sprache zum Reden zu bringen und dem, was sie zu sagen hatte, seine Aufmerksamkeit zuzuwenden.
Alle Sprachen folgen ihrem eigenen Faden, ihren speziellen Neigungen, sie gleiten Schritt für Schritt an sich selbst entlang, aber sie sind so sehr an sich gewöhnt, daß sie sich selbst nicht mehr reden hören, sie überhören sich: Sie tun, als hörten sie nicht, was sie sagen.
Aus dem, was man überhört, kommen die Einfälle, die plötzlichen Ideen, die einem ganz unerwartet einfallen, ohne daß man sie erwartet hätte. Cela vient de me revenir