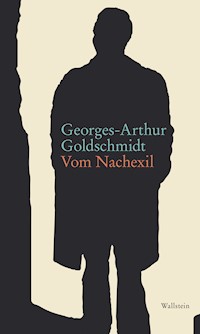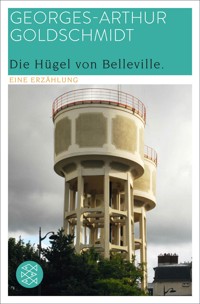9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Georges-Arthur Goldschmidt über die Sehnsucht nach Bestrafung und die Scham, überlebt zu haben Für den zehnjährigen Georges-Arthur ist es der Albtraum, entdeckt und deportiert zu werden. Der Albtraum endet aber nicht. Denn der Junge schämt sich, überlebt zu haben, deshalb sehnt er sich nach Strafe. Die bekommt er im Internat, das ihn nach der Flucht aus Nazideutschland aufgenommen hat. Aber auch die Scham endet nicht, denn er empfindet Wollust bei der körperlichen Züchtigung. Das ist das unlösbare Dilemma des Georges-Arthur Goldschmidt, und das ist die nicht versiegende Quelle für sein literarisches Schaffen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 166
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Georges-Arthur Goldschmidt
Der Ausweg
Eine Erzählung
Biografie
Georges-Arthur Goldschmidt, 1928 in Reinbek bei Hamburg geboren, musste als Zehnjähriger in die Emigration nach Frankreich gehen. Er lebt heute in Paris. Für sein umfangreiches Werk wurde er u.a. mit dem Bremer Literatur-Preis, dem Nelly-Sachs-Preis und dem Joseph-Breitbach-Preis ausgezeichnet. Im November 2013 erhält er den Prix de L’Académie de Berlin. Zuletzt erschien seine Erzählung ›Ein Wiederkommen‹.
Weitere Informationen, auch zu E-Book-Ausgaben, finden Sie bei www.fischerverlage.de
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel ›Le Recours‹
bei Éditions Verdier, Paris
© Éditions Verdier, 2005
Für die deutschsprachige Ausgabe:
© S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 2014
Covergestaltung: SCHILLER-DESIGN
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-403081-4
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Widmung
Motto
Vorwort
Deckblatt
I Ein Dachboden am Meer
II Ausblick
III Tage der Buße
IV Reisegeheimnisse
V Vom höchsten Wissen
VI Initiation
VII Die Denunziantin
VIII Paris phantasiert
IX Der Schwarzfahrer
X Ein Türrahmen bei Goethe
Literatur
Für Christoph Geiser
Er zog sich mutwilligerweise in der Schule Schläge zu, und hielt sie alsdann mit Trotz und Standhaftigkeit aus, ohne eine Miene zu verziehen, und dies machte ihm dazu ein Vergnügen, das ihm noch lange in der Erinnerung angenehm war.
Karl Philipp Moritz,Anton Reiser
Niemand hat wohl mehr die Wonne der Tränen (the joy of grief) empfunden, als er bei solchen Gelegenheiten.
Karl Philipp Moritz,Anton Reiser
Vorwort
Dieses Buch ist bei weitem keine Autobiographie, obgleich es Elemente aus dem Leben ziemlich treu wiedergibt, es ist aus vielen Bildern entstanden: aus Wachträumereien oder aus Erzählungen anderer, die den Stoff der Selbsterfassung mitgestalteten. So spielten auch die Lektüren eine grundlegende Rolle, sie eröffneten dem Leser die meistens verborgene oder unerlaubte Innenwelt, wie zum Beispiel das wunderbare Büchlein Schwester Monika von E.T.A. Hoffmann oder die Lesbia Brandon von Algernon Swinburne, ohne die das eigene Schreiben vielleicht gar nicht erst entstanden wäre. Sie stimmen mit dem überein, was man schon lange in sich trug, sie bestätigen, wenn auch nur im Anflug, im Vorbeiziehen die »kleinen Gedanken«, die Phantasieschwaden, die man in sich trägt. Diese Bücher, aber allen voran der Anton Reiser von Karl Philipp Moritz legitimieren die eigene Existenz und das Verbotene zugleich.
Erzählt wird hier aus dem jungen Leben eines verstörten Jünglings, der auf Fremde angewiesen ist, die ihm überhaupt nichts Böses wollen, ihn aber nach den Prinzipien und Standpunkten der damaligen Zeit 1944–1947 erziehen, das heißt mittels so vieler Strafen wie nur möglich, wie es vor allem in Institutionen für Kinder die Regel war, wo möglichst viel geschlagen und geohrfeigt wurde. Die Verwirrungen und Ängste der Kinder des vorigen Jahrhunderts wurden überwiegend von der Erziehung bestimmt, von einer oft erniedrigenden, demütigenden, unreflektierten Erziehung, die eine wesentliche Rolle bei der Entstehung des Ersten Weltkrieges und seiner Fortsetzung im Zweiten gespielt hat. Kinder haben sich zu fügen, meinte man, sie sind nur Gegenstände der Erziehung, nicht von ungefähr hieß früher in Deutschland das Gesäß die »Erziehungsfläche«. Der durch solche Zucht angerichtete Schaden, denn von Erziehung kann nicht die Rede sein, ist unermeßlich, wie man heute zur Genüge weiß. Man kann sich heute kaum noch vorstellen, was nicht nur in den Familien, sondern vor allem in den Heimen und Waisenhäusern geschah, und dies bis mindestens 1998, als der Europarat die Körperstrafe als gesetzeswidrig einstufte. Sie wurde erst ab 2000 von den verschiedenen europäischen Parlamenten abgeschafft. Seit den sechziger Jahren aber werden zum Glück die Kinder immer seltener geschlagen.
Der Stoff dieser Erzählung ist die damalige »Körperstrafe«, die schon als solche nie ihrem Objekt entspricht, die als solche in keinem Verhältnis steht zu dem, was ein Kind auch nur »verbrochen« haben könnte – nicht gemachte Hausaufgaben, Plaudern im Unterricht, sogenannte Frechheit oder Gott weiß was –, eine Strafe, die an sich schon unangemessen ist, denn inwiefern kann der Schmerz überhaupt einen »Fehler« berichtigen? Kein Kind hat jemals aus solch einer Strafe etwas anderes gelernt als heimliche Verachtung für seine sogenannten »Erzieher«. Wie sehr diese Zeiten von Unterdrückung und Dressur der Kindheit geprägt wurden, zeigt neben vielen anderen Büchern Die Welt von Gestern von Stefan Zweig. Das Unheil des 20. Jahrhunderts wurde auch dadurch verursacht. Seitdem ist viel über die »Schwarze Pädagogik« geschrieben worden, und man kann nun nicht mehr so tun, als wisse man nichts davon.
Einer Waise in Gefahr, die dazu noch in den Jahren 1943–1944 in der stetigen Angst lebt, abgeholt zu werden, ihrer Herkunft wegen, für die sie nichts kann, bleibt nichts anderes übrig als Verzweiflung und Selbsthaß: Warum bin ich gerade der, der ich bin, und kein anderer. Solch ein Kind kann von sich selbst sagen, wie es schon einmal gesagt wurde: Ich möcht’ ein solcher werden, wie ein anderer schon gewesen ist. Von den Erwachsenen gescholten und von den Mitschülern gepiesackt, sieht er keinen anderen Ausweg als die Wollust an der Selbstaufgabe und der Selbstzerstörung. Die Jahre waren ein Albtraum, der Junge fürchtete jederzeit, entdeckt und deportiert zu werden. Doch der Albtraum endet nicht. Unablässig macht er sich Vorwürfe, überlebt zu haben, sehnt Strafe herbei. Seit der Befreiung hatte er sich seines Lebens wollüstig geschämt, und so genießt er mit derselben Wollust, für seine Vergehen im Internat gezüchtigt zu werden, schreibt Jörg Aufenanger über ein anderes Buch (Die Befreiung).
Als die Zeiten sich dann wandelten und das Land von der Infamie der Okkupation erlöst wurde, konnte der Jüngling sich aber nicht vom jahrelangen Heimweh befreien, das immer weiter an ihm nagte und ihn aushöhlte, der Kummer ließ nicht von ihm ab, unentwegt, und doch hatte ihn die Lebensfreude nie verlassen. Die Begeisterung für das Existieren wurde trotz allem jeden Tag größer. Es gab auch die täglichen Überraschungen der Landschaft. Daß er am Leben war, der Deportation entkommen, geschützt, erfüllte ihn mit Dankbarkeit, und so nahm er die oft nicht verdienten Strafen auf sich, als Bestätigung, daß es ihn gab. Er wurde des öfteren gezüchtigt, aber nie sehr streng, es war eher als Zurechtweisung als als Demütigung gedacht und vielleicht auch zweideutig gemeint, so daß jegliche Wirksamkeit der »Strafe« sowieso ihren Zweck verfehlte und dem bestraften Jüngling im Gegenzug die Sicherheit in seiner Unerreichbarkeit, seiner fast glorreichen Selbstheit hinterließ.
Er fügte sich, und seine Fügung war nichts anderes als Herausforderung, er, die Waise, gab nicht nach in seiner Renitenz. Er drehte nur den Spieß um, und was ihm Schmerzen bereiten sollte, wurde für ihn ein Instrument der Freiheit. Der Ausweg bestand aus den Wonnen des Danach und seiner göttlichen Schärfe. Es stürzt ihn jedesmal in eine sonderbare Verwirrung. Im nachhinein wandelt sich die Scham in Lust, das ist il mondo alla riversata (die verkehrte Welt), durch die sich das verzweifelte Kind selbst konstituiert, als Herausforderung der Standpunkte seiner sogenannten »Erzieher«. Welche verdeckten Wunschfelder diese Strafe eröffnen kann, hat Freud in seinem zu Recht berühmten Text Ein Kind wird geschlagen zur Genüge gezeigt.
Die Züchtigung erweckt bei diesem Jüngling die leibliche Begeisterung, daß es ihn gibt. So wird es auch möglich, Kummer und Heimweh dank irgendeines erträumten, eingebildeten Ersatzes zu unterhöhlen. Körperliche Erfahrungen können manchmal derart prägnant sein, daß sie die Verzweiflung überdecken.
Die Umkehrung des Schmerzes und der Scham in Wollust bedeutet Zurückfindung der freien Welt. So ist der Masochismus eine Art Integration, ein nicht anzweifelbarer Selbstbeweis. Durch die Schmerzenslust, die mir zugefügt wird, stehe ich dann wieder mit dem anderen in Verbindung, er ist es, der von mir abhängt, indem er mich bestraft, ohne mich ist er nichts: So gibt es mich, um so mehr, als es in jenem Fall ohne Grausamkeit oder Sadismus abläuft. Ähnlich erging es vor sehr langer Zeit Jean-Jacques Rousseau, der eine solch triumphale Selbstentdeckung in den Bekenntnissen (Les Confessions) sehr einleuchtend dargestellt hat. Nach einer Züchtigung durch eine junge Frau, die, obgleich streng, etwas Spaßiges hat, wird er sozusagen in sich selbst bestätigt und gestärkt, er ist sein eigenes Lustobjekt, so sucht er nichts anderes mehr, als es wieder zu erleben. Der Taumel, in den ihn jenes Abenteuer des Körpers versetzt, beweist ihm, durch die Hand des anderen, seine Gegenwart und die eigene unersetzbare Einmaligkeit.
Einige Tage aus dem Leben eines Namenlosen
IEin Dachboden am Meer
Am Hügelhang zeichnen die Straßen in alle Horizontrichtungen den Lauf alter Wege nach. Sie stoßen auf das indigo-graue Gewirr der Ferne, bis in alte Landschaften hinein.
Der Blick folgt unerwarteten, schattenüberzogenen Berghängen, den Windkehren ausgesetzt, die an den Häuserkreuzungen abflauen. Der Wind ist der von ehemals, der Föhn. Es ist, als erweitere er den Dachboden. Es kommen die dumpfen Talgeräusche wie abgerundet herauf. Bräunlich und geräumig steht die klare Dunkelheit in diesem großen umgestülpten Schiffsrumpf des Dachstuhls des Internats. Über der See wird es Nacht, und manchmal hält der Sturm an, holt aus, hebt wieder an, und er, der Knabe, ist der Schiffsjunge, dessen Geschichte er gelesen hat, zart und kindlich, der es mit den rauhen Matrosen zu tun hat und der ganz am Rande der Schiffsflanke schläft, der Offizier hat ihn dort hingewiesen, damit er den Männern entkomme.
Mit dem kleinen Taschenmesser, ein Geschenk der Mutter zum Abschied – mit den Fingern tastet er immer wieder die beiden runden Metallnieten im Perlmutt ab –, hat der Schiffsjunge einen winzigen Trichter ins Holz einer Spante gebohrt, der von Tag zu Tag tiefer und breiter wird. Er hat die Ränder geglättet, geduldig, und streicht gerne mit den Fingern darüber, es zerrt an seinem Körper, und er erträumt sich Waldfahrten unter Baumwipfeln im Mondlicht vom Wolkengetrabe beschattet, erträumt, wie er auf Samtkissen sitzt in der lederbezogenen Kutsche und wie er zu Schlössern mit hohen Türmen gefahren wird, so wie er sie auf den Bildern gesehen hat.
Man beschrieb ihm zwischen den anderen Matrosen, wie er die Takelage erklettert und des Abends zu seiner Koje zurückfindet, wo manchmal die Matrosen zu ihm kamen. Er bohrt unablässig. Eines Nachts hatte sich der Trichter zum besternten Himmel hin geöffnet, und er hatte sich einen Stöpsel dazugeschnitzt, den er in den Balken stieß, wenn er ihn herauszog, wehte der Wind ihm ins Gesicht, er ließ sich den Windstrahl in den Mund hineingleiten, die Lippen entlang, füllte sich den Gaumen damit, bis in die Kehle hinein, und es ergriff ihn die Verwirrung. Manchmal bei Mondwetter sah er das Auf und Ab des Meerespegels.
In den Abenteuerromanen ist der Schiffsjunge immer vierzehn oder sechzehn Jahre alt, weint oft und wird bestraft. Die Matrosen stehen um ihn herum, spielen mit ihm, jagen ihn über das Deck zwischen den zusammengerollten Tauen und den umgekippten Eimern, und das Bild der Mutter kommt in ihm auf. Seine Schreie verlieren sich inmitten des Sonnengestöbers, die Wellen brechen gegen die Felsenriffe. Zeitweise erscheinen im Dunst dachförmige Küstenwalme, die bis in die See hinunterreichen.
Eines Tages durchdröhnt ein großes Krachen den Schiffsrumpf, der am Felsen zerbirst. Später entdeckt eine Reiterin den Schiffsjungen an einem Riff liegend, im Sand hat das Wasser Furchen gegraben. Die Hufe des Pferdes haben runde, schnell wieder geglättete Öffnungen hinterlassen. Von weitem hatte sie jenen weißen Körper gesehen, ein Kind. Sie hatte das Pferd gezügelt, das sich vor dem gelbgrauen Hintergrund, dem Metallgrau des Meeres aufbäumte.
So wie der kleine Schiffsjunge da vorbeigeht und sich beeilt, ahnt man nichts von all den Häfen, die er gesehen hat, sehr weit weg vor dem blauen Dunst der Städte. Er trägt sein Bündel geschultert und rennt jetzt unentwegt seit dem Anlegen, er sieht vor sich nur die helle Linie des Weges. Das Gemälde – es ist ein englisches Gemälde – zeigt ihn dann, wie er im Gras liegt, den Kopf auf dem Arm, der noch das Bündel am Stock hält; das Kind weint. Im Hintergrund das Haus mit Strohdach. Die Tür steht halb offen.
Es hatte lange gedauert, die Anlegeleiter war erst spät heruntergelassen worden, die Ketten hatten sich verfangen, und die Passagiere hatten Vortritt gehabt, und dann das Aufklatschen der Holzschuhe der Matrosen auf den Stufen. Er hatte sich zwischen den Ständen auf dem Markt verirrt; endlich dann hatte er die Landstraße zwischen den Hecken unter dem Grau des Himmels erreicht. Er hatte nichts gesehen, nichts angeschaut, nur gelaufen war er, wie von einer inneren Mechanik vorangetrieben. Dann war es die letzte Straßenkurve gewesen, der leise Anstieg, der kurze Gartenzaun gegenüber, der dunkle Türrahmen und dahinter das hohe Bett, wo die Mutter gerade gestorben war – die Mutter, die sich doch so lange nach ihm gesehnt hatte, sie, die der Gedanke an ihren Kleinen bis dahin am Leben erhalten hatte. Sie wußte nicht, daß die Matrosen ihn ab und zu herbeiwinkten und daß er ihnen bis ins Zwischendeck gefolgt war und sie ihn sich in irgendeinem Winkel vorbeugen ließen. Dieses Bild seiner selbst kam ihm immer wieder in den Sinn, und er schämte sich. Und nun lag er im Gras und weinte.
Solche Tagträume überkamen ihn, den siebzehnjährigen Internatsschüler, die Waise, wenn es ihm in der Sommerschwüle gelang, ungesehen bis unter die ockergraue Verästelung des Dachgerüstes zu steigen. Das Gebäude überragte das ganze Tal, und darüber hinweg entdeckte man noch weitere Talschaften. Das Haus stand so hoch, daß der Blick auf der Treppe vom dunklen Kellergrund bis ins schwindelhelle Licht der Berggipfel reichte. Die Sonne drückte gegen das Dach, man zwang sich mit dem Körper heran, bis man mit Mund und Wange Mauer und Walmblech zugleich berühren konnte.
Immer wieder kam ihm dann jene Fotografie in den Sinn: Man sah die See, die See, die immer wieder in ihm schlug, mit glatten Wellenbergen, aus denen ab und zu die hell und dunkel gestreifte Insel ragte. Die Fotografie war von Mahagoni eingerahmt, sie stammte aus dem Jahre 1905, war von einem gewissen Franz Schelsky aufgenommen worden und stellte die Insel Helgoland dar.
Unter der großen Dachschräge tauchten vor ihm weite baumgesäumte Landschaften auf, über die die Wolken dahinjagten. Kein Brett, kein Dübel im Holz, der ihm nicht vertraut gewesen wäre. In der Stille der Sommernächte ging er den anderen barfuß voraus, schob die kleine Tür auf.
Draußen, auf den Nachmittagsgängen, konnte man sich am Sims des Internats orientieren, der zwischen den Tannen am hell hervorstechenden Dach eine deutliche Linie zog. Wenn man anderen Kindergruppen begegnete, erkannte er sofort unter ihnen die Waisen oder die Bestraften an dem ein wenig geweiteten, aufmerksamen Blick, den er auch von sich kannte, wenn man ihn sich hinknien ließ und heranbog, und an den leicht aufgeblähten Nasenflügeln. Sie erkannten einander an den abgelaufenen Stiefeln, an den dicken, gestutzten Herrenmänteln, an der warmen Kleidung, wie für das Abwetzen an Holzbänken vorgesehen. Ihre Gesten waren ein wenig unsicher, langsamer, sie zuckten zusammen, wenn man an sie herantrat, und doch war an ihrer ganzen Haltung zugleich etwas Fügsames und Untertäniges und auch etwas Keckes und Zähes, eine wache Selbständigkeit. Sie verhedderten sich öfter, als sähen sie immer noch etwas anderes als nur die Straße, gereckten Halses gingen sie mit schlenkernden Armen und blieben hinter den anderen zurück. Wenn die Waisen woanders untergebracht wurden, wußten sie sofort, wo sich Speisesaal und Abtritte befanden, sie waren immer zur Strafe bereit. Die Strafe, das war ihr eigenes Abenteuer, man sah es ihren geschickten, erfahrenen Händen an, die alle Raffinessen kannten. Sie wußten vom Ausweg. Die Strafe, das war ihre Sicherheit, darüber wußten sie Bescheid, durch sie entdeckten sie sich selbst und wußten sich, wenn nicht immer unschuldig, dann doch einzig, einmalig und unersetzlich. Ob sie dabei die Heiligkeit erfuhren?
In England, das hatte er in einer Erzählung gelesen, wurden die Schiffsjungen in den Boarding-schools angeheuert: Man wußte, daß sie ergeben, demütig und zuvorkommend waren, und sowieso hätte ihnen niemand Glauben geschenkt.
Im Winter bekam der Knabe keine Fausthandschuhe wie die anderen, auch daran erkannte man die Waisen: Man konnte die Kälte an ihrem Körper ablesen. Er war stolz, daß die anderen sich seiner nackten Hände ein wenig schämten. Er konnte nichts mehr halten, und es dauerte lange, bis er sie wieder spürte. Die Kälte schnürte ihm den Leib zu, wie von innen, Metallenes blieb an seinen Fingern kleben. Oft bediente man sich der Kälte, um ihn zu bestrafen, im Winter setzte man ihn zur Buße ohne Handschuhe vor die Tür. Er blieb ganz in der Nähe, um schnell wieder hineinzukönnen, wenn er wieder hereingerufen wurde. Ihn überragte der riesige Giebel, tiefbraun angestrichen, ein Wetterschutz, dunkel vor dem Schneehintergrund. Die Kälte ergriff ihn senkrecht, erstarrend. Nach drei Schritten war er erfroren, und die Landschaft lag wie versteinert. Er hatte dann kaum noch die Kraft, mit den Füßen zu trampeln oder mit den Armen herumzuschlagen. Er konnte nicht anders, als sich zu krümmen und die Hände zwischen den Schenkeln zu halten, es gefror ihm dann so sehr den Rücken entlang, daß er nur noch hüpfen oder sich im Kreis drehen konnte. Die Kälte schnitt in die Konturen der Ohren, man konnte sich nur noch in dem eisigen Windfang in die Ecke kauern und wimmern. Vor Kälte spitzte man den Mund, um den eisigen Luftzug anzuwärmen, das ergab ein Geräusch, das er bei sich selbst noch nicht gehört hatte. Wenn dann die Aufseherin kam, um ihn hereinzuholen, war sie beinahe entsetzt.
Durch die Fenster des Lernsaals sah er dann die vom Frost versteiften, reglosen Tannen, er konnte die Hände nur noch baumeln lassen, sie konnten nichts mehr greifen, Gegenstände konnte man nur noch mit den Handballen anfassen. Und doch war es, als ob nichts gewesen wäre, als hätte er die Strafe noch nicht erlitten, und so mußte er, der zu allem unfähig war, alles falsch machte, allen im Wege stand, nichts konnte, nichts wußte und nur kostete, mit noch vor Frost gelähmten Händen tausendmal die ihm auferlegten Strafzeilen schreiben: »Ich soll nicht reden, wenn ich nicht gefragt werde«, so schrieb man beinahe ein ganzes Heft voll. Eine Woche hatte er gebraucht. Vierzehn Tage lang bekam er keinen Nachtisch, das ersetzte das derart vergeudete Heft. Er konnte die Buchstaben nun aber immer rascher und sogar lesbarer formen. So lernte er endlich auch richtig schreiben. Er konnte es jetzt, ohne mit der Feder beim Eintauchen zu klecksen.
Man strafte ihn dennoch weiter, aber unter anderen Vorwänden. Für jede Rutenstrafe waren es zweihundert zusätzliche Linien (acht Seiten): »Ich verdiene eine Strafe, weil ich faul und unsauber bin« oder: »Für acht Fehler im Diktat verdiene ich sechzehn mit der Gerte« oder sogar: »Ich bitte mich wegen meiner Gefräßigkeit wie verdient zu strafen«, dabei gab es wegen des Krieges kaum zu essen, es war das Jahr 1943, die Restriktionen wurden immer strenger, 350 g Brot pro Tag; 90 g Fleisch pro Woche (mit Knochen, 75 g ohne Knochen). Jeder in Frankreich hungerte, und in den Kinderheimen und Anstalten konnte man sowieso nichts besorgen, es wurde zuwenig Pension bezahlt, als daß man für die Kinder auf dem Schwarzmarkt hätte einkaufen können.