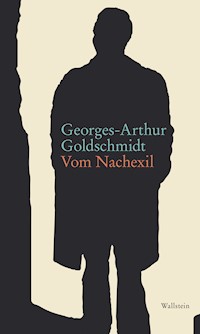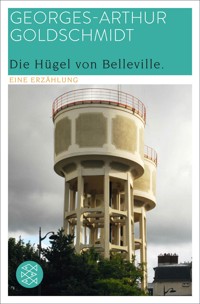9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Wie hältst du's mit der Religion? - diese Frage stellt und beantwortet Georges-Arthur Goldschmidt sich selbst vor seinen Lesern. Als Kind jüdischer, zum Protestantismus konvertierter Eltern 1928 in Hamburg geboren, muss Georges-Arthur Goldschmidt vor der Judenverfolgung in Deutschland fliehen. Er entkommt nach Frankreich, findet Unterschlupf bei savoyischen Bauern. 1949 nimmt er die französische Staatsbürgerschaft an und konvertiert zum Katholizismus. Vor den Bildern des nationalsozialistischen Terrors wendet er sich schließlich vom Glauben ab. Heute, dem Schlimmsten entkommen und inzwischen durch drei Bekenntnisse gewandert, ersetzen ihm Seinsbegeisterung und Feier des Augenblicks den Glauben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 70
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Georges-Arthur Goldschmidt
In Gegenwart des abwesenden Gottes
Essay
Über dieses Buch
»Die menschliche Existenz an sich, sie ist es, die wir für Gott halten. Seine ganze Geschichte hindurch blieb der Mensch, sich selbst und seiner Bestimmung entfremdet, für sich der große Unbekannte, das größte Geheimnis.«
Wie hältst du’s mit der Religion? - diese Frage stellt und beantwortet Georges-Arthur Goldschmidt sich selbst vor seinen Lesern. Als Kind jüdischer, zum Protestantismus konvertierter Eltern 1928 in Hamburg geboren, muss Georges-Arthur Goldschmidt vor der Judenverfolgung in Deutschland fliehen. Er entkommt nach Frankreich, findet Unterschlupf bei savoyischen Bauern. 1949 nimmt er die französische Staatsbürgerschaft an und konvertiert zum Katholizismus. Vor den Bildern des nationalsozialistischen Terrors wendet er sich schließlich vom Glauben ab. Heute, dem Schlimmsten entkommen und inzwischen durch drei Bekenntnisse gewandert, ersetzen ihm Seinsbegeisterung und Feier des Augenblicks den Glauben.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Georges-Arthur Goldschmidt, 1928 in Reinbek bei Hamburg geboren, musste als Zehnjähriger in die Emigration nach Frankreich gehen. Er lebt heute in Paris. Für sein umfangreiches Werk wurde er u.a. mit dem Bremer Literatur-Preis, dem Nelly-Sachs-Preis und dem Joseph-Breitbach-Preis ausgezeichnet. Im November 2013 erhielt er den Prix de L’Académie de Berlin. Zuletzt erschien seine Erzählung ›Der Ausweg‹.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
Die Originalausgabe ist 2001 unter dem Titel »En présence du Dieu absent« im Verlag Bayard Éditions, Paris erschienen.
© 2018 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Die erste Ausgabe dieses Bandes erschien 2003 im Ammann Verlag & Co., Zürich.
Covergestaltung: Nicole Lange, Darmstadt
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-490843-4
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Ein wartender Gott
Ein fehlender Gott
Ein abwesender Gott
[Kapitel]
Ein wartender Gott
Gott, der große Abwesende, wich mir zeit meines Lebens nicht von den Fersen, und fast hätte ich dafür den höchsten Preis bezahlt. Als Christ »jüdischer Herkunft« geboren, Agnostiker, wenn nicht Atheist geworden, hatte ich wirklich alle Chancen, von niemandem als seinesgleichen angenommen und vom Schicksal dazu verdammt zu werden, als Seife oder Rauchfahne zu enden. Alle hielten mich für etwas, das ich nicht war, für unecht die einen, für einen Verräter die anderen, und heute, angesichts der Abwesenheit Gottes, bin ich glücklich wie ein Fisch im Wasser. Zur lange geplanten Vernichtung geboren, habe ich mich durchgeschummelt und bin immer noch da, wofür Gott nichts kann; nur ein Gendarm, eine verdrehte, perverse Heimleiterin, ein Dorfvikar und ein paar savoyardische Bauern können was dafür.
Wie jeder weiß, ist die Shoah nicht aus dem Nichts entsprungen, sondern dem Schoß des Christentums, dem christlichen Bewußtsein. Auschwitz, dem ich »unverdientermaßen« entgangen bin, wurde von Menschen entworfen und verwirklicht, die sich auf denselben Gott beriefen wie die von ihnen Ermordeten, sie führten diesen Gott ständig im Munde, ja, er zierte sogar ihre Koppel: »Gott mit uns«. Die folgende Geschichte, so unbedeutend sie ist, mag als Beleg und Widerlegung des Gesagten dienen.
Ich bin der Sohn evangelisch-lutherischer Eltern, die ihre religiöse Inbrunst, ihren neuerworbenen, aufrichtigen Glauben bei jeder Gelegenheit zeigten. Tatsächlich ist meine Familie eine der alteingesessenen Hamburger jüdischen Familien, meine Vorfahren (die sich über sechzehn verschiedene Nachnamen bis zur Mitte des XVII. Jahrhunderts zurückverfolgen lassen) sind allesamt Juden, wahrscheinlich waren sogar Rabbis dabei. Gottes wegen konnte man ihnen das Leben schwermachen, ihnen den Zugang zu allen Rechten verweigern und sich ihnen gegenüber alles herausnehmen, sofern es nicht die öffentliche Ruhe und Ordnung störte, nur umbringen durfte man sie nicht.
In Hamburg war nicht einmal darauf Verlaß. Bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts konnte man im Namen Gottes leicht diejenigen ermorden, die immer noch darauf beharrten, vom selben Gott zu sprechen. Pastoren hetzten von der Kanzel zum Pogrom auf, das gab schöne Judenjagden, damals Hepp!-Hepp!-Krawalle genannt. Von diesem Zeitpunkt an machte die Assimilation trotz ihrer teilweisen Ablehnung durch die jüdische Gemeinde und gegen den Widerstand der städtischen Behörden große Fortschritte, und schon bald nahmen die Juden aktiv am gesellschaftlichen Leben teil.
Zum Glück hatten meine Urgroßeltern nicht unter Verfolgungen zu leiden. Mein Urgroßvater, geboren 1794, und meine Urgroßmutter, geboren 1806, gehörten der reichen jüdischen Bourgeoisie an und waren daher relativ geschützt. Beide traten dem »Verein des Neuen Tempels« bei, der 1817 gegründet wurde und unter dem Einfluß von Moses Mendelssohn und der »Haskala« stand, der jüdischen Aufklärung, deren Ziel es war, die rigide Glaubenspraxis aufzuweichen und das Jiddische aufzugeben. Obwohl meine Urgroßeltern mit den Protestanten in ihrer Umgebung freundschaftlich verkehrten, weigerten sie sich doch standhaft, deren Glauben anzunehmen.
Meine Urgroßmutter, Johanna Goldschmidt, hat einen Briefroman geschrieben, Amalia und Rebecca, in dem eine junge Frau eine »gute Partie« ausschlägt, um dem Glauben ihrer Väter treu zu bleiben. In einem anderen Buch von ihr, Muttersorgen und Mutterfreuden, findet sich folgende Mahnung an die Religionslehrer: »… aus dem zarten Alter aber entfernt den Hochmutsteufel der sogenannten konfessionellen Tugenden, denn dem Erzieher kann es, darf es nicht unbekannt sein, daß jede Religionslehre dieselben gebietet und man daher für die Vortrefflichkeit der Menschen am besten sorgt, wenn man ihnen die Grundlage alles Guten als festwurzelnd in den ewigen Geboten heiliger Menschenliebe zeigt.«
Es ist vielleicht solchen freien Geistern zu verdanken, daß es am 23. Februar 1849 in Hamburg zur religiösen Gleichstellung von Juden und Christen kommen konnte. Das Bürgerrecht gab es für Juden erst 1869, gleich, was sie alles für die Stadt getan, wie viele Krankenhäuser und andere Gebäude sie womöglich gestiftet hatten. Im Namen des einen, gemeinsamen Gottes verweigerte man ihnen die Anerkennung als vollwertige Menschen. Ihre »gottgläubigen« evangelischen Nachbarn konnten ihnen ihre Treue zu Gott nicht verzeihen.
Mein Großvater trat am 1. Juli 1868 aus der jüdischen Gemeinde aus. Mein Vater, 1873 geboren, wurde im lutherischen Glauben erzogen, und dieser blieb der Mittelpunkt seines gesamten Lebens. Als er nach dem Tod meiner Mutter 1942 ins Konzentrationslager Theresienstadt kam, übte er dort die Funktion eines Pastors für die evangelischen Juden aus, wie es das Kirchenrecht für den Notfall bestimmt (67. Schmalkaldische Bestimmung).
Für mich war Gott von Anfang an gegenwärtig. Acht Monate nach meiner Geburt, am 30. Dezember 1928, wurde ich von Pastor A. Fries in meinem Geburtshaus getauft, wie es bei den Lutheranern damals Sitte war. Ich habe noch heute meinen Taufschein, in doppelter Ausführung, vom Pastor eigenhändig unterschrieben und mit dem Stempel der Kirchengemeinde versehen.
Mit sechs Jahren kam ich in die »Sonntagsschule«, den evangelischen Religionsunterricht. Die Gleichnisse gefielen mir, weil Jesus eine solche Güte ausstrahlte und den Schwachen half. Ich hörte andächtig zu. Die beweglichen Ziffern auf weißem Grund, die die Kirchenlieder anzeigten, begeisterten mich, ich träumte davon, sie eines Tages selbst auf der Holztafel verschieben zu dürfen. Von den Predigten des Pastors Fries, eines alten Herrn mit weißem Bart, schwarzem Talar und weißem Beffchen, war ich so hingerissen, daß ich auf einen Hocker im Badezimmer meines Vaters stieg und es ihm nachtat. Ich fand mich großartig, doch es mischte sich noch etwas anderes in die kindliche Eitelkeit, eine objektlose innere Gewißheit, die mich nie verlassen hat, aber es sollte noch Jahrzehnte dauern, bis ich wußte, was es war: Ich fühlte mit höchster Intensität die Seele, die in mir war.
Ich konnte mich nicht satt sehen an meiner illustrierten Kinderbibel mit den berühmten Holzschnitten Ludwig Richters. Wenn mein Vater mir vorlas, nahm er Die Bibel oder die ganze Heilige Schrift des Alten und Neuen Testaments nach der deutschen Übersetzung Dr. Martin Luthers, 6. Ausgabe, Halle, in der cansteinschen Bibelanstalt, 1830