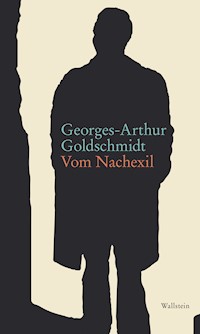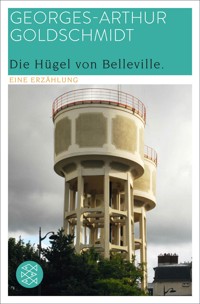
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Schreiben bedeutet für Georges-Arthur Goldschmidt Überleben. Im Schreiben und Übersetzen entwirft er sich selbst, er wird zum Zeugen seines Ichs, das unter den Nationalsozialisten nicht sein durfte, aber schon immer einen großen Drang verspürt, etwas zu erschaffen und die Welt, Literatur, Malerei begeistert in sich aufzunehmen. In »Die Hügel von Belleville« spricht Goldschmidt, der als 10-Jähriger vor den Nationalsozialisten nach Frankreich floh, erstmalig darüber, was es bedeutete, 1953 als französischer Soldat in der Kaserne von Karlsruhe den Wehrdienst zu leisten. Eine Zeit der Unruhe, in der er über das Sprechen in zwei Sprachen zu sich selbst fand.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 182
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Georges-Arthur Goldschmidt
Die Hügel von Belleville
Eine Erzählung
Über dieses Buch
Schreiben bedeutet für Georges-Arthur Goldschmidt, Überleben. Im Schreiben und Übersetzen entwirft er sich selbst, er wird zum Zeugen seines Ichs, das nicht sein durfte, aber schon immer einen großen Drang verspürt, etwas zu erschaffen und die Welt, Literatur, Malerei begeistert in sich aufzunehmen. In den »Hügeln von Belleville« spricht Goldschmidt, der als 10-Jähriger vor den Nationalsozialisten nach Frankreich floh, erstmalig darüber, was es bedeutete, 1953 als französischer Soldat in der Kaserne von Karlsruhe den Wehrdienst zu leisten. Eine Zeit der Unruhe, in der er über das Sprechen in zwei Sprachen zu sich selbst fand. Wie in all seinen Büchern, erzählt Goldschmidt in »Die Hügel von Belleville« von seinem Lebensstoff, dem Glück und dem Schuldgefühl, überlebt zu haben.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Georges-Arthur Goldschmidt, 1928 in Reinbek bei Hamburg geboren, musste als Zehnjähriger in die Emigration nach Frankreich gehen. Er lebt heute in Paris. Für sein umfangreiches Werk wurde er u.a. mit dem Bremer Literatur-Preis, dem Nelly-Sachs-Preis und dem Joseph-Breitbach-Preis ausgezeichnet. Im November 2013 erhielt er den Prix de L’Académie de Berlin. Zuletzt erschien seine Erzählung ›Der Ausweg‹.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
Die Originalausgabe erschien 2015 unter dem Titel ›Les collines de Belleville‹ bei Actes Sud/Jaqueline Chambon, Arles, 2015
Auf Wunsch des Autors und Übersetzers weicht die deutsche Ausgabe teilweise von der Originalausgabe ab.
© Actes Sud/Jaqueline Chambon, Arles, 2015
Für die deutschsprachige Ausgabe:
© 2018 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung: kreuzerdesign Agentur für Konzeption und Gestaltung
Coverabbildung: shutterstock
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-490730-7
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Vorwort
Widmung und Motti
I
II
III
IV
V
Vorwort
Diese Erzählung, wie so viele andere, liegt genau in der Mitte zwischen Wahrheit und Erfindung, zwischen Wirklichkeit und Phantasie.
Alles hätte zu jedem Augenblick völlig anders verlaufen können, durch eine winzige Gegebenheit, eine kleine Verspätung, ein anderes Licht, einen Mantel, den man holen geht, einen Bahnsteig, auf dem man wartet, Abertausende von solchen Kleinigkeiten, und die tatsächliche Geschichte wäre völlig anders verlaufen … Die Nase der Kleopatra usw. Jedes noch so kleine Ereignis ist nur durch Zufall so, wie es ist. Jede Erzählung baut sich immer in solchem Dazwischen auf, es ist, als wäre sie der Versuch, das Verfehlte, das Umgangene wieder einzuholen. Und hier nun soll aus fast einem Jahrhundert Geschichte erzählt werden, nicht unbedingt, wie sie wirklich stattgefunden hat, sondern wie sie erlebt wurde; ein Jahrhundert des absoluten Verbrechens und des Terrors, in dem jeder es früher oder später mit Angst und Schrecken zu tun hatte, vielleicht aber nur ein kleines Vorspiel, von dem der französische Philosoph und Mathematiker Jean-Toussaint Desanti einmal sagte: »Die Shoah, das war eine liebliche Messe im Vergleich zu dem, was kommen wird.«
Wir sind noch ein paar unerwünschte Zeugen aus der Zeit zwischen 1933 und 1945; uns, die wir auf der falschen Seite geboren wurden, dürfte es eigentlich nicht mehr geben, aber wie man weiß, Unkraut vergeht nicht. Als Unkraut verschont geblieben sein, obgleich man als getauftes »jüdisches« Kind doch spätestens 1944 hätte eliminiert werden sollen, fungiert man immer noch als überflüssiger Esser, der es sich dazu auch noch hat schmecken lassen. Es gibt doch nichts Skandalöseres als solch unerlaubtes Leben. Das hatten die Hitlerburschen bestens kapiert: »Wer leben darf, bestimme ich«, sie dachten, über Leben und Tod entscheiden zu dürfen. Sie alleine waren Menschen und konnten also problemlos Menschen opfern; ob das nicht aus den weitesten Tiefen der germanischen Vorgeschichte kommt? Man kann sich immerhin die Frage stellen, wie konnte es kommen, daß das »absolute Verbrechen« gerade in Deutschland geschah, von Deutschen erdacht? Ob es mit den verfehlten Kindheiten zu tun hat?
Jedenfalls war immer irgendein Gespenst hinter einer deutschen Kindheit her, Angst erregend und verlockend zugleich, sei es doch nur der »gelbe Onkel« oder die Grimmschen Märchen. Eine deutsche Kindheit stand immer unter dem Zeichen irgendeiner Drohung, die zur damaligen großen deutschen Zeit sich als Wirklichkeit niederschlug: Deutsche wurden aus der Heimat verjagt, weil sie geboren wurden und von nun an sich selbst als Last durch die Geschichte trugen.
Wo sie dann auch waren, ob verstoßen oder großzügig aufgenommen, blieben sie für immer Exilierte, sollten sie durch Wahl der Aufnahmenation nun voll angehören, wenn auch nur auf Widerruf. Dennoch, welche Ereignisse es auch seien, besteht der Seinsstoff immer mehr aus den Bildern, den Landschaften, den Menschen und der Geschichte des Landes, der Vertreibung und (mehr) des Landes der Aufnahme.
Bereits als Zwölfjähriger schon wußte man, daß Pétain ein ekler Verräter war und General de Gaulle Frankreich verkörperte. Rebellion, Wachsamkeit und Denkfreiheit bildeten irgendwie ein Fundament des sozialen Einverständnisses in diesem Land, wie auch die wohlklingende Sprachwucht des Hofpredigers von Ludwig XIV., Jacques Benigne Bossuet, in der Versailler Pracht. Wie schon immer war es die innere Opposition zwischen Gehorsam und Widerspenstigkeit, wo das eine oft in das andere überschlagen kann und umgekehrt, wie zur Zeit der Résistance, als die Nazis in vermeintlicher Zivilbekleidung zur Wonne der französischen Kollaborateure die französischen Juden nach Auschwitz brachten. So wurden Menschen, die früher links standen, ehemalige Dreyfusards z. B., Verteidiger der Freiheit und der Menschen, zu Denunzianten und Verfolgern, andere aber, die als rechtsradikal eingestuft wurden, nahmen bei sich verfolgte jüdische Kinder oder Erwachsene und Widerstandskämpfer auf, so gab es pétainsche Dorfgeistliche, die dennoch, ohne zu zögern, Verfolgte versteckten, als die Kirchenhierachie vorsichtig den Blick abwendete. Man selber war unaufhörlich dem Zwiespalt, den man so intim in sich trug, ausgesetzt.
Man hatte die wundervolle, so klangrobuste Sprache in sich, das kräftige und doch oft so zarte Deutsch, das nun nichts anderes mehr als Todesdrohung war, aber auch die andere, die Sprache der Präservation, vertraut schon, so melodisch und subtil, der man sich zu Dank verpflichtet meinte, aber um so lieber las und sprach, das zur Muttersprache gewordene Französisch. Es war Alltags- und Instinktsprache geworden, die man nie gelernt hatte, die einem aber in jedem Augenblick einfach zukam, sei es nur im Schlafsaal, im Lernzimmer, und das man vollkommen, sogar mit Lokalfärbung sprach.
Geburts- und schutzschuldig lebt man im schlechtem Gewissen, mit dem man sich im Laufe der Zeit ein wenig zynisch arrangierte, es galt aber vor allen Dingen, sich nicht aus den Augen zu verlieren, wie es der Romanheld aus dem 18. Jahrhundert Anton Reiser doch so großartig vermochte, der seinen Seinskern trotz aller Lebenswidrigkeiten immer in sich gegenwärtig hatte. Dieser Seinskern ist ein ununterbrochenes, wortloses Selbstraunen, das inhaltslos für immer den inneren Heimwehschrei überdecken soll, auf den es unbedingt galt, sich auf keinen Fall einzulassen.
Manche nämlich wurden, wie es der Fall war, von ganz einfachen anonymen Franzosen unter Lebensrisiko geschützt, so daß man das Wesen des Landes in sich noch eingehender aufnahm. Frankreich nämlich ist auch das Land der »laïcité«, also nicht nur der Trennung von Kirche und Staat, sondern auch der Staat, in dem keiner fragt, ob man glaubt oder nicht, wo jeder denkt, wie er will, jenseits jeglicher Obrigkeit.
Als Jüngling wurde man im Internat sorgfältig erzogen und entsprechend scharf jeden zweiten Freitag mit der Rute gezüchtigt, nach Jesuitenart, bis ins Alter von achtzehn Jahren, um zur Exaltation des Geistes gebracht und zugleich im Zimmer des Erziehers initiiert zu werden. So haben die Liebschaften von Bett zu Bett viele Schüler von einem wahrhaftig tötenden Heimweh erlöst und sind weltgestaltend gewesen. Es war auch die Zeit der ersten Gedichte, als tüchtig gehölderlint wurde, in der einen Sprache und gerimbault in der anderen, die Zeit der Wonne der Tränen, der Dichtung, damals der einzige Ausweg, um nicht von innen vom Kummer ausgeschabt zu werden.
Es gibt tatsächlich solche vielleicht sonderbaren Anhaltspunkte, die zu allem Weiteren öffnen, zur Lebensbegeisterung führen und vor allem zur Wunderbarkeit des Existierens, eine gleichsam erotische Wahrnehmung, die die eigene Körperlichkeit an die der anderen anschließt. So wird man wie überwältigt von der unerreichbaren Nähe jenes anderen, der neben einem sitzt, der näher kaum sein kann und der doch, bis in die Unendlichkeit, entfernt ist, viel weiter in seiner Nähe als alle Galaxien des Universums, die nur Lichtjahre entfernt liegen, wo der andere, man könnte ihn Jahrtausende kennen und alles von ihm wissen, unerreichbar und unersetzlich bleibt wie man selber.
Georges-Arthur Goldschmidt,
Paris im Oktober 2017
Für Joachim Helfer,den Freund und Schriftsteller
»Unser Leben ist so vergeblich, dass es nur der Widerschein unseres Erinnerns ist.«
François-René de Chateaubriand, Erinnerungen von jenseits des Grabes
»So lang und grausam waren die, obwohl die weißen dicklichen Hände nicht grausam waren, sondern sanft. Und obwohl er vor Kälte und Furcht bebte beim Gedanken an die grausamen langen Nägel und an das hohe Pfeifgeräusch des Rohrstocks und an das Frösteln, das man hinten unten am Hemd spürt, wenn man sich auszog, war ein Gefühl komischen leisen Behagens tief in ihm drin beim Gedanken an die weißen dicklichen Hände, sauber und stark und sanft.«
James Joyce, Ein Porträt des Künstlers als junger Mann
I
Einmal angekommen, muß man, nachdem man an der Gare du Nord umgestiegen ist, auf dem Plan die Militäranlage Charras in Courbevoie suchen. Der fünf Jahre lange Studienaufschub war nun abgelaufen. Man mußte sich dem Militärdienst stellen und bei der Einberufung melden, das war am 17. November 1953 um 14 Uhr. Während der Fahrt von Pontoise nach Paris unter blendender Nachmittagssonne war der lange hohle und leere Vorstadtbahnwagen mit den gelben Sitzbänken abwechselnd von langen Schatten und Lichtzungen in der Form der Fenster durchschnitten worden. Von draußen gesehen war Kellerlicht irgendein Reisender auf der Strecke Pontoise–Paris. Er war sein Selbstzeuge, der Zeuge jenes »Ich«, das ihn seit je begleitete, nie von ihm abließ, ihm überallhin folgte, ihm ununterbrochen seit fünfundzwanzig Jahren den Weg versperrte. Nie hatte er jenes Selbst loswerden können, das immer dabei war, alles wußte und ihn gewähren ließ.
Als er aus dem Bahnhof von Courbevoie trat, neigte sich schon das Nachmittagslicht, etliche andere junge Leute gingen denselben Weg wie er, verirren konnte man sich nicht, die langen einstöckigen Gebäude mit roten Backsteinsimsen über den Fenstern, das war es also, die berüchtigte Militärlandschaft. Jeder tat, als ginge es ihn nichts an. Seit 1950, schon mehr als zwei Jahren, hatte er ständig Angst gehabt, nach Indochina geschickt zu werden, wo Frankreich sich abmühte, damit sich bloß nichts ändere. Da wurde im Sumpf gekämpft und möglichst stumm gestorben, damit man im Frieden der Salons in der Avenue Bosquet nichts davon erfahre. Diese Furcht stand in ihm wie ein Möbelstück, und die ganze Welt drehte sich drum herum.
Er ging mit den anderen, die Brust von einer Kommode mit Schiebladen, die er in sich selber trug, verstellt. Sie war ihm seit den Internatsstrafen vertraut, sie ließ nicht von ihm ab, man mußte sich lange auf die Strafen vorbereiten, manchmal zwei Tage lang, das Warten lastete dann auf dem Körper und erlöste ihn von dem Heimweh, der den Atem nahm, den Leib zusammenbog und die Seele durchschnitt. Man schrie vor Verzweiflung bei der Vorstellung der Eltern, des hinterlassenen Spielzeugs, der Bäume im Garten.
Eine Unzahl flüchtiger Gedanken, so kurz, daß sie zeitlos erschienen, schwirrten in ihm, überdeckten den einförmigen Hintergrund, das beinahe gleichgültige Gefühl, man werde deportiert. Man mußte sich nur gehenlassen. Man war nur noch ein Ding und konnte sich ganz der sonderbaren Betrachtung ausliefern und vorerleben, was alles auf den militärgrün gestrichenen Korridoren stattfinden würde.
Es war ein weiter, geräumiger Hof, groß wie ein städtischer Platz, überall standen junge Menschen, die wie zum Schutz von Zeit zu Zeit wie Stauden in kurzen Bewegungen zusammenrückten. Zu allen Seiten ein Horizont von Werkstätten und Wohnsilos, zwischen denen sich Landschaftsschneisen öffneten, von überall her überrollte einen das Geratter vorbeifahrender Lastwagen, entfernter Züge oder aufeinandergeworfener Bretter. Man beneidete alle, die da draußen waren. Es kamen einem Vergleiche, die man kaum zu ziehen wagte, alle Eindrücke behielt man für sich. Ihm war es, als sei er ein Mieter auf Wohnungssuche, den er vor Ort begleitete, um ihn bei der Visite nicht alleine zu lassen.
Es kam Bewegung in das Durcheinander der Menge, wie eine dichter werdende Strömung, da, wo Koffer getragen wurden. Kellerlicht hatte keinen, er hatte gar nichts. Dann die Abfahrt mit aneinanderstoßenden Koffern. Man überquerte die Seine auf der Pont de Neuilly. Sie mußten dann unter einem länglichen Gewölbe auf einem unterirdischen Bahnsteig warten. Man plauderte allseits mit gedämpfter, vom Warten beschlagener Stimme und wunderte sich über die grau angestrichenen Metrowagen, die noch niemand gesehen hatte. Zusammengedrängt stieg man ein. Die Metro fuhr sehr schnell, und die Bahnhöfe zogen vorbei wie Lichterketten. Die Unterkellerungen der Gare de l’Est waren ungeheuer breit und riesig. Zementierte Orte für in den Krieg ziehende Armeen, für Kolonnen von Gefangenen oder Deportierter. Es war merkwürdig, in einen solchen »Sonderzug« zu steigen, man konnte wieder auf fast obszöne Weise die mehrere Monate lange Abwesenheit – einige Wochen Ausbildung und dann Faulenzerei – vergleichen mit der Zeit kurz vor der Adoleszenz, denn 1943 wäre er beinahe deportiert worden, der Herkunft wegen, von der er doch nichts gewußt hatte. Er hatte sich an einem hohen Stacheldraht gesehen, wie er die anderen Häftlinge vor lauter Intelligenz und religiöser Inbrunst entzückte: Jesus war sein großer Freund. Ihm war nichts groß genug, und besonders zweifelte er nicht an seiner Erhabenheit, was dann durch unzählige Essensentzüge, dem Knien auf einem viereckigen Lineal und Züchtigungen mit vom Empfänger selbst präparierter Gerte umgekehrt bestätigt wurde.
Der Zug fuhr langsam im Rotgold der untergehenden Sonne um Strasbourg herum, von Rangierbahnhof zu Rangierbahnhof, an verfallenen und verrosteten Militäranlagen entlang, die an 1914 bis 1918 erinnerten, als hätte der Zweite Weltkrieg keine Spuren hinterlassen.
Man war bloß nur noch ein Etwas, fühlte sich aber von den großen Schlachten der Geschichte weggetragen. Zum erstenmal in seinem Leben fühlte sich Arthur Kellerlicht legitim unter all diesen anderen mit demselben Schicksal: achtzehn Monate Militärdienst, er würde der Nation dienen, ein anonymes Schicksal haben. Sie fuhren zur Einkasernierung nach Casseroue[*], wie die jungen Franzosen Karlsruhe nannten, und er, den alles Militärische überhaupt anwiderte, hatte auf einmal das Gefühl von Zugehörigkeit: Er gehörte dazu, er stand im Dienst Frankreichs, so verhinderte man die Rückkehr des Nationalsozialismus in Deutschland, diese hübsche Illusion machte alles wieder gut. Der Zug aber hätte auch genausogut von Drancy abfahren können, die letzten Konvois der deportierten und bald vergasten Juden hatten vielleicht auch Strasbourg umfahren.
Der Winter 1953–954 war besonders streng, die Temperatur fiel öfter bis unter minus zehn, morgens stieg eine riesige rote Sonne auf. Man wurde per Lastwagen durch reifbedeckte Landschaften befördert, und am Kaffee der Gulaschkanone verbrannte man sich die Finger, das Existieren war herrlich. Man stand am Munitionslager zwischen zwei Stacheldrahtwänden Wache, es war, als ob die Geschichte einen beim leisesten Geräusch überrumpeln würde. Er war einer der wenigen, die nicht über den Fraß meckerten, gab es Nudeln, suchte er die Tische nach Nachschlag ab. Mit seinem Sold schlug er sich den Bauch im Foyer de garnison voll, dem Soldatenheim, Ecke Waldhornstraße und Kaiserstraße, inzwischen eine Pizzeria. Zum ersten Mal in seinem Leben aß er butterschäumende Schnecken in schillerndem Gehäuse, zu zwölft auf einer Sonderplatte mit zwölf Aushöhlungen serviert. Noch nie hatte er solch einen feinen Geschmack erlebt. Sie wurden natürlich extra aus Frankreich importiert, körbeweise, die man am Bahnhof, La Banoffe, abholen mußte.
Schon in den ersten Tagen hatte sich seine deutsche Herkunft, wie ein Lauffeuer, verbreitet. Man hatte ihn, der er nicht einmal richtig zu grüßen wußte, bei der Verwaltung vorsprechen lassen; deutsche Bahnbeamte hatten diese feuchten Körbe, aus deren Ritzen glitschige Schnecken herauskrochen, bestaunt und begutachtet. Er hatte übersetzen müssen. In Begleitung eines Unteroffiziers hatte man ihn im Jeep zum Bahnhof geschickt. Ein halb flacher, halb abgerundeter Giebel überragte eine fünffenstrige Fassade, die sich für großes Fahnenhissen und Hakenkreuze bestens eignete. Es war sonderbar, dieses Gebäude so vor Augen zu haben, zu dem sich so viele verängstigte Menschen hatten begeben müssen. In dieser hellen Halle mit einem Gewölbe aus Tausenden von kleinen Glaswürfeln hatten die Juden der Stadt gewartet, die man nach Gurs und dann nach Auschwitz deportierte. Es blieb nicht einmal ein Schimmer, ein Geruch. Keine Spur von Angst, dieser dichtesten aller Materien, kaum eine vage Erinnerung daran, und doch hatte man dort das Gewieher und Gebrülle der Hitlerjungen oder der SA-Leute schallen hören.
Eines anderen Morgens bei einem der ersten Appelle, an denen Kellerlicht teilnahm, als alle strammstanden, sah man die Passanten durch das hohe Eisengitter. Der Unteroffizier verlas die Tagesordnung, auch deutsche Einladungen für französische Soldaten zum zweiten Weihnachtstag. Es galt die Versöhnung, die nach dem Ersten Weltkrieg gescheitert war, wieder in die Wege zu leiten. Es war, als sollten sich die Franzosen für Verbrechen entschuldigen, die sie ja gerade nicht begangen hatten.
Kellerlicht meldete sich als einziger; es lagen mehr als zehn Angebote vor, eins kam sogar von gegenüber der Kaserne, Grenadierstraße. Es war sonderbar, so ins Intimste der Deutschheit zurückgeführt zu werden, als französischer Staatsbürger in Uniform, also in voller Demonstration seiner zivilen und politischen Zugehörigkeit. Es war eine jener Paradoxien, die einem ganzen Leben Richtung geben und die Zwischenzonen des Gedächtnisses wieder hervorbringen.
Hinter einer schweren, eisenbeschlagenen Doppeltür, die auf einen dunklen Eingang führte, lag eine Erdgeschoßwohnung, deren Fenster zur Kaserne hin lagen. Solche Erdgeschoßwohnungen hatten Kellerlicht seit je gewundert, man mußte nur die Mauer zur Seite schieben und man lag im Bett auf der Chaussée mit Nachttisch und schmutziger Wäsche. Wohnen bedeutete für ihn immer Etage oder Garten.
Natürlich staunte man über sein perfektes Deutsch. Ein französischer Soldat, der wie ein Buch sprach, das erklärte er vage mit elsässischer Herkunft, in der Familie würde man seitjeher deutsch sprechen. Er merkte nicht, daß sein spitzes Hamburgerisch, fast messinggefärbtes Deutsch, keinen täuschen konnte. Er verhedderte sich in gewundenen Erklärungen, die er sich für alle Fälle schon lange vorher zurechtgelegt hatte, die alle das kurze Wörtchen verbergen sollten, das ihm die Lippen verbrannte, wie ein Schandfleck, der unvermeidlich den Rest an den Tag bringen würde, die Schuld, die bösen Gewohnheiten, die ihm im Internat immer solche Strafen einbrachten. Er gehörte zu denen, die man gerne stellte, die man gerne hecheln hörte, er war einer von denen, die sich aus Panik gerne auf der Flucht im eigenen Regenschirm verfingen und die man so gerne mit Füßen tritt, er war einer von denen, die man leben lässt, aber schnappen kann, wenn es einem danach ist, und die einem stets zu einem konkreten Zweck zur Verfügung stehen. Es lohnte sich, so ein Etwas anzusehen, wenn es so vor Angst nur noch trippelte, man durfte den Arm gehenlassen und mitten ins Gesicht schlagen und die Brillen schön mit dem Absatz kaputttreten. Man mußte doch nur an 1933 denken.
Was hatten die aus ihrem Erdgeschoß wohl alles gesehen? Hatten sie jemals an die senkrechten Körper gedacht, die da hinter dem Gitter warteten, vielleicht hatten sie sie reden hören oder die Lastwagen vorbeifahren sehen? Wie war es denn diesem französischen Soldaten dubioser Herkunft gelungen, daß er so ungeschoren davongekommen war, jenem Vergasen, von dem die Rede war, jener stummen Schicht, in der es vor Umgekommenen nur so wimmelte.
An diesem zweiten Weihnachtstag war es, als sollte er die Gesten, die Geräusche, die Gerüche und Farben seiner Kindheit wiederfinden. Zehnjährig hatte man ihn von zu Hause verjagt, der falschen Geburt wegen, aber die Weihnachtstage und Stille Nacht, heilige Nacht waren in ihm so tief geblieben, daß ihm jedesmal die Tränen kamen; alles war in ihm erhalten geblieben, der Geruch der angebrannten Tannenzweige und erwärmten Kerzen oder der Freßteller voll Zuckerwerk und Lebkuchen. Weihnachten, das war das Auftauchen hinter dem Weihnachtsbaum, die Zukunftslandschaften auf dunklem Nachtgrund.
Es war eine Art ethnologischer Reise in eine Vergangenheit gewesen, die nicht mehr die seine war. Am Tisch saßen die sehr protestantisch und gütig aussehenden anständigen Eltern, sie waren leicht ergraut und hatten bestimmt nicht dazugehört, die Kinder schon erwachsen, Tochter und Sohn, kinderlos: die Wohnung ziemlich dunkel, behäbig möbliert, beleibte Sessel mit integriertem Aschenbecher, die Teekanne mit Tropfenfänger an der Tülle. Alles war solide und schwer, dunkel und sicher.
Es war das betuliche Deutschland, wie es im Märchen steht, als sei es im Niedlichen steckengeblieben, samt Gartenzwergen, Teetrinken und Weihnachtsvorbereitungen. Liebenswürdig wurde er ins Wohnzimmer gebeten, welches durch eine weißlackierte Schiebetür mit eingelassenem Kupfergriff mit dem Eßzimmer verbunden war. Es stand da ein großer mit Lametta, Glaskugeln und Kerzen geschmückter Tannenbaum, dessen Flämmchen ein Flimmern ergaben, aus dem der vertraute Weihnachtsgeruch aufstieg, wie die wiedergefundene Kindheit. Ihm zu Ehren erklang vom Plattenspieler Stille Nacht, heilige Nacht,