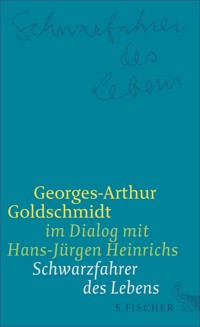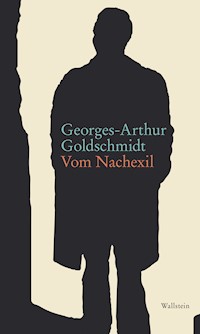
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Wallstein Verlag
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Die Grunderfahrung des geflüchteten Menschen bedeutet immer den Verlust von Heimat, Sprache und Zugehörigkeit. Georges-Arthur Goldschmidt ist einer der zentralen Autoren der Holocaustliteratur. Er berichtet mit expressiver Kraft von den Erfahrungen eines Kindes, das zum Opfer der Willkürmaßnahmen und der antisemitischen Verfolgung durch die NS-Diktatur geworden ist. Als Sohn einer schon im 19. Jahrhundert zum Protestantismus konvertierten jüdischen Familie war er in Deutschland in größter Gefahr. Deshalb schickten seine Eltern den zehnjährigen Georges-Arthur und seinen älteren Bruder Erich 1938 zuerst nach Italien. Im folgenden Jahr flüchteten sie weiter nach Frankreich. Im Internat in Annecy war Goldschmidt ebenfalls traumatisierender Gewalt ausgesetzt. Schließlich versteckten ihn Bergbauern in Savoyen bis zum Kriegsende und retteten dadurch sein Leben. Goldschmidts Werk ist zutiefst geprägt vom Gefühl existentieller Ortlosigkeit zwischen den Sprachen und zwischen den Ländern. Er hat dem Leid der Verfolgung in seinen Werken einen unvergesslichen Ausdruck verliehen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 96
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Georges-Arthur Goldschmidt
Vom Nachexil
Inhalt
Vom Nachexil
Impressum
Wer einmal ins Exil getrieben wurde, kommt lebenslang nicht mehr davon ab. Das Exil besteht auch aus einigen ganz kurzen, unmerklichen, gewöhnlichen Augenblicken. Man macht zum Beispiel eine Tür zu, steigt in einen Wagen; es ist von außen gesehen eine unscheinbare, winzige Begebenheit, nach der aber alles unwiederbringlich vorbei ist. In einem selbst ist es wie immer, nur daß man schlagartig feststellt, daß man seine Sprache mitnimmt, daß man sie nun in sich und hinter sich hat, aber weder um noch vor sich. Das Exil teilt das Leben in zwei von nun an unvereinbare Hälften: das Vorher und das Nachher; eine sehr banale Feststellung, kann man erwidern, die aber das Wesen des Exilierten als Doppelboden fundiert, untergräbt und zugleich aufspaltet.
Nicht, daß ein Exilierter irgendwie ein Doppelgänger geworden wäre, ganz und gar nicht, er ist nämlich vor der Schizophrenie geschützt, die ein Luxus wäre, den er sich nicht erlauben kann, er hat schon zu viel zu tun, denn vom ersten Augenblick des Exils beginnt eine lebenslange Arbeit, zugleich, vor allem, wenn er noch ein kleiner Junge ist, muß man alles, was man verläßt, für immer fixieren auf Nimmerwiedersehen und sich dem absolut Neuen stellen.
Schlagartig wird man anders sprachbewußt als bis dahin, man wird doppelsprachig. Die Zweisprachigkeit ist irgendwie eine glückliche Erscheinung, während Doppelsprachigkeit mit dem Existenzverbot zusammenfällt: Man spricht eine verbotene Sprache, die man, wie es damals doch hieß, nur beschmutzen konnte, einfach schon, wenn man sie in den Mund nahm. So wurde die Muttersprache zu einer Geheimsprache, die man für sich behielt, ohne sie im fremden Land vorzeigen zu dürfen, solange der Krieg und das Dahinmorden der Hitlerei noch andauerte.
Es lagern sich zwei verschiedene Raumempfindungen übereinander: die erste Räumlichkeit, die der ersten Eindrücke der Kindheit, mit welcher das Welterfassen überhaupt einsetzt, mit welcher auch die Formen und Farben, die Geräusche und Stimmen für immer begründet sind, ist von nun an die verbotene Welt, aus der man als geburtsschuldig verstoßen worden ist. Die zweite Raumaufnahme ist die, in welcher die alltäglichsten Gegenstände nun auch etwas Vertrautes bekommen und sich über die ersten Empfindungen lagern werden.
Es galt jede Einzelheit der Heimat mitzunehmen, das kleinste Detail zu registrieren. Es galt, die Heimat in einigen Momenten so scharf zu photographieren, daß deren Grundzüge als Raster des Empfindens in einem bleiben konnten. Es ist erstaunlich, was das Gehirn bei solcher Gelegenheit alles leisten kann; es arbeitet derart perfekt, daß nach achtzig Jahren alles noch an Ort und Stelle ist, so sehr, daß unter jedem Wahrnehmungsbild der Gegenwart ein anderes, ein Phantombild aus der Vergangenheit hochkommt, nicht aus einer beliebigen Vergangenheit, sondern aus einer verbotenen Vergangenheit, aus der man ausgeschlossen wurde.
Das Sonderbare am Exil ist die objektive Intensität der Trennung; obgleich das Kind nicht genau das Ausmaß des Geschehens versteht, registriert das Auge die winzigste, unbedeutendste Einzelheit, jede Holzfaser, jeden Grashalm, den Klang jeder Stimme oder wie die Türen der Abteile des Vorortszuges nacheinander zugeschlagen werden. Als Leitbild bleibt die kurze Reise von Reinbek zum Hamburger Hauptbahnhof, mit ihrer genauen Dauer, ungefähr 27 Minuten, von wo es ohne die Eltern nach Florenz ging und von da nach Frankreich; sie bleibt von nun an eine für immer festgesetzte Drehscheibe, um welche alle sonstigen Landschaftsbilder kreisen, als orientiere eine solche kurze Zwischenreise die ganze innere Geographie.
Als Zehnjähriger wurde man ins Exil geschickt, man wußte bereits seit Wochen davon, daher wurde die Wahrnehmung immer genauer, immer schärfer; es war, als ob man jede Einzelheit in sich eingravierte und fixierte, weil man wußte: nie wieder. Es war, als wüßte man im voraus, daß man sich mit Sehbildern verproviantieren müsse, weil sie unwiederbringlich sind. Man lernt ein anderes Sehen, man zielt mit dem Blick genau auf das, was man anschaut, man lernt es sich genau an: die Schönningstedter Mühle, die Billebrücke, den Saum des Vorwerksbusches – die dann der späteren Orientierung in Abwesenheit zu Hilfe kommen werden. Die Augen wurden wie aufs schärfste eingestellt, das Bild möglichst genau, damit es unvergänglich werde, und tatsächlich sind diese Innenbilder noch genau so scharf wie vor achtzig Jahren.
Die Bilder aus der Vergangenheit oder eher ihre Materialität, ihre Farben, Gerüche, Geräusche oder Formen begleiten merkwürdigerweise immer die aktuelle Wahrnehmung als deren Grundraster, um so mehr, als fast immer Doppelsprachigkeit das Exil begleitet. Doppelsprachigkeit ist vielleicht etwas anderes als Zweisprachigkeit, diese ist ein einfaches Sprache-Können, eine Technizität, jemand, der zweisprachig ist, spricht die eine so gut wie die andere Sprache, vielleicht mit einer gewissen Hintergrundlosigkeit oder besser gesagt mit einem zusätzlichen Hintergrund, den man sich durch das Erlernen der Sprache angeeignet hat. Der Doppelsprachige schleppt aber immer die eine Sprache unter der anderen mit, ob er es will oder nicht. Die Zweitsprache hat er nicht erlernt, sie begründete sein Überleben.
Das Exil besteht auch aus einigen ganz kurzen, unbemerkbaren, gewöhnlichen Augenblicken, man macht eine Tür zu, steigt zum Beispiel in einen Wagen. Von außen gesehen ist es eine unscheinbare, winzige Begebenheit, nach welcher aber alles unwiederbringlich vorbei ist. In einem selbst ist es wie immer, nur daß man schlagartig feststellt, daß man seine Sprache mitnimmt, daß man sie nun in sich und hinter sich hat, aber weder um noch vor sich. Schlagartig wird man anders sprachbewußt als bis dahin, man wird doppelsprachig. Ein exiliertes Kind verliert den geschichtlichen Lauf seiner Heimatsprache, die sich ohne das Kind weiterentwickelt. Im späteren Zurückfinden zur Muttersprache fehlt dann eine ganze Spanne der sprachlichen Entdeckungsreise.
Der Exilant zieht immer seine »Heimat« hinter sich her, seine Lebensstätte im Rücken, die Stelle, wo das erste Erkennen stattfand, ganz bedingt von der Empfindungshülse, die überhaupt die Selbsterfassung bestimmt hat, sowie sie auf den ersten Raumempfindungen beruht. Die körperliche Charakteristik des Exils ist, daß man hinter sich hat, was man um sich herum haben sollte. Die Weltumgebung ist nicht mehr mit der Muttersprache verbunden. Das Exil ist der Augenblick, in dem Anwesenheit in Abwesenheit kippt in einem zeitlosen Moment, es ist eine scharf gezeichnete unüberschreitbare Grenze, die nicht nur das Einst vom Heute, die Gegenwart vom Vergangenen trennt, sondern auch zwei verschiedene Selbstsichten, zwei verschiedene Selbsthorizonte, die jedoch eine geschlossene Einheit bilden. Der Umwurf erfolgt nicht zufällig, von ungefähr, sondern als unausweichlicher Zwang.
Das Exil, wie die Angst, »fressen Seele auf«, es zehrt am innersten Ansatz der Seele, da, wo sie anfängt. Es löscht alle Bilder, Stimmen, Gerüche und Geräusche aus, es zwingt zur Selbstumstülpung. Das Exil stülpt einen um, wie einen Sack. Das Exil läßt einen nie los, es sitzt einem in der Brust. Das Sonderbare am Exil ist die Schärfe dieser Grenze, die zwei geographische unvereinbare und doch ineinander verwobene Beschaffenheiten voneinander trennt.
Das Exil liegt dem Exilierten im Maul wie die Kandare dem Pferd, er hat es immer quer durch sich, nicht immer fühlbar, aber stets gegenwärtig; das Exil wird zu einer körperlichen Beschaffenheit, zu einer Färbung, die alles überdeckt und dem Exilierten eine besondere Unheimlichkeit verleiht. Eigentlich dürfte er niemandem und nichts Glauben schenken, da jeder Glaube doch eine Drohung bedeutet. Der Exilierte weiß, daß man ihm früher oder später einmal vorwerfen könnte, er gehöre nicht dazu. So sicher er auch sei, ein für allemal aufgenommen, besteht doch die Möglichkeit, ihm seine Zugehörigkeit abzustreiten, und als Exilierter bleibt ihm jegliche endgültige Rückkehr verschlossen. Von nun an gilt es für den Exilierten, das Heimweh nicht heranzulassen, es unbedingt von sich abzustoßen.
Das Exil scheint von außen gesehen eine unscheinbare, winzige Begebenheit, nach welcher aber alles unwiederbringlich vorbei ist. In einem selbst ist es wie immer, nur daß man schlagartig feststellt, daß man seine Sprache mitnimmt, daß man sie nun in sich und hinter sich herzieht. Ins Exil nimmt man die Heimwehsprache mit, keiner aber durfte davon wissen, sie war eine Kriegs-, eine Verbotssprache geworden, eine Sprache, die einem mit dem Tod drohte. Es ist aber auch ein gerader und bequemer Weg zur Selbstfindung und Selbsterkenntnis, da man sich doch immer irgendwie »abseits« fühlt. Man redet gerade mit jemandem, man sitzt irgendwo oder geht zwischen Bäumen entlang oder steht am Bahnsteig, und auf einmal erwischt es einen, unerwartet friert es in einem zu, wie eine innere Lähmung, durch die hindurch man seinen inneren Gefühlspegel aufsteigen und bald platzen spürt, bis einem vor Scham der Schweiß ausbricht.
Das Exil ist alles andere als etwas Verdienstvolles, alles andere als eine Leistung; es bringt die Sicherheit mit sich, nicht verwechselt zu werden: »Das ist einer von denen«, es bringt aber vor allem Sicherheit mit sich, wenn man, wie es hier der Fall ist, das Aufnahmeland völlig in sich aufgenommen hat und sich ihm zugehörig fühlt. In Frankreich, trotz des gegenwärtigen Anscheins, ist die Aufnahme um so leichter, als von einem nichts verlangt wird. Man hat sich keinem Glauben zu fügen, es wird keine religiöse oder gar politische Untertänigkeit vom Staat verlangt; Steuern zu bezahlen und sich anständig zu benehmen sind die Grundregeln der französischen République laïque. Leider wird der neutrale Staat immer mehr von den neuen Exilierten, vor allem von den Emigranten, abgelehnt.
Im Exil gibt es eine Grenze, an welcher es sich selbst aufhebt und nur noch als Hintergrund weiterwirkt oder eher als Grundriß, von dem die Empfindungs- und Denkwelt nicht abkommt. Irgendwo lagert grottentief die zur Todessprache gewordene Muttersprache, die man noch 1944 auf den Straßenschildern vor den Pariser Denkmälern in Frakturschrift sehen konnte und die den Knaben Arthur derart beschämte, daß er sich jedesmal aufs Klo flüchtete. Er gehörte zum deutschen Mördervolk, aus dem er verstoßen wurde, und doch hatte man ihn geschützt und sich für ihn der Gefahr ausgesetzt.
So gibt es für den Exilierten in der gewesenen Muttersprache kaum Wörter, die von alleine alles Mögliche ergeben, denen man sich so ohne weiteres anvertrauen könnte. Die Sprache wurde einem verboten. Man trachtete nach des Knaben Leben, er war nur noch »lebensunwürdiges Lebensmaterial« oder so etwas ähnliches. Die Abstammung machte ihn zum Abschaum, der unbedingt beseitigt werden mußte. In »der Sprache« wurde aufs natürlichste, wie es mit der Sprache so ist, ganz sachlich das Ungeheuerste überhaupt formuliert. Die Wörter sind doch vom Hinmorden immer bedroht, die schönsten und vertrautesten können so leicht Instrumente der Hinrichtung und des Abtötens werden.
Die verstockten Kriminellen des IS scheinen heute sogar die Sprache überwunden zu haben, ihre Bestialität braucht nicht einmal Sprache. Töten geht auch ohne, sogar besser. Die Nazis haben die Sprache noch gebraucht, um sie von Grund auf unkenntlich zu machen, es galt alles Persönliche, nicht politisch Verwertbare endgültig auszumerzen, es ging darum, die Sprache mit dem Massenmorden in Einklang zu bringen, ohne je das Dahinmorden zu benennen. Die Nazis haben die deutsche Sprache für immer korrumpiert, geschändet. Der NS hat das »Poetische«, den seelischen Klang, den inneren Elan, den »romantischen« Pep der Sprache für immer unmöglich gemacht.
Dennoch gibt es auch die erlösenden Wörter, die aber wurden meistens in der Sprache des Aufnahmelandes gefunden. Aus dem Deutschen war man verstoßen worden. Mittels der deutschen Sprache hatte man Millionen Menschen auf ganz besondere Weise abgeschlachtet, es war eine Mördersprache geworden, der man sich nicht ausliefern konnte, am Worthorizont stand immer eine Drohung, eine Gefahr; man versuchte, sie von sich abzuschütteln, und doch kam sie ihm immer wieder, aus dem Tiefsten seiner selbst. Wie der Schriftsteller Joachim Helfer es so schön schreibt: »Daß es unsere wunderbare Baukastensprache dem Sprecher so verteufelt leicht macht, sich einzubilden, er denke, denke gar Neues, wo er bloß unbegriffene und vielleicht begriffslose Wortteile aneinanderklebt.« Und genau dazu verführt die Fichtesche Durchsichtigkeit des Deutschen: Wer seine Muttersprache wie ein Schüler Vokabel für Vokabel lernen muß, der muß sich auch bei jedem neuen Wort fragen, was es bedeutet.