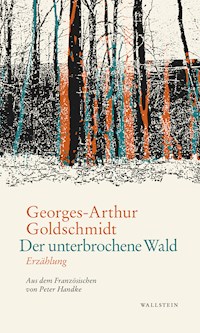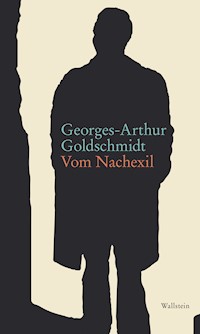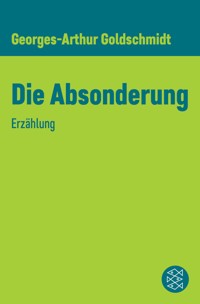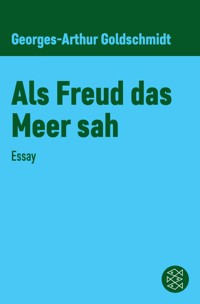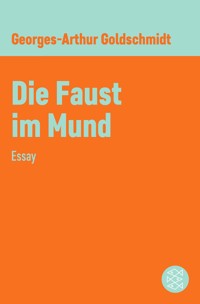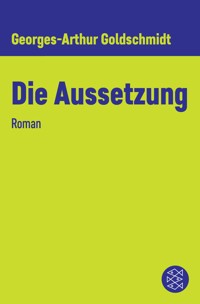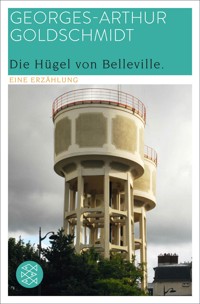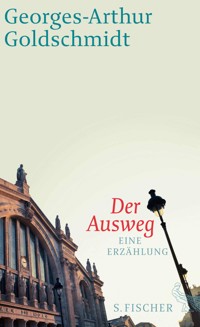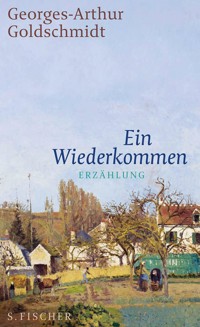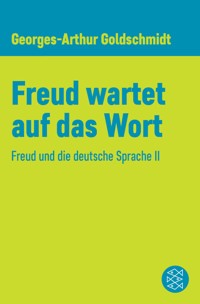
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Als Fortsetzung seiner berühmt gewordenen Studie »Als Freud das Meer sah«, die mehrere Auflagen erlebt und dem Autor zahlreiche renommierte Preise eingetragen hat (zuletzt: Joseph-Breitbach Preis 2005), setzt Goldschmidt seine Analyse der deutschen Sprache vor dem Hintergrund der Psychoanalyse fort. Orientierte sich Freud an der grammatikalischen Struktur der deutschen Sprache, die die eigentliche Information immer an den Schluss der Sätze stellt, ganz im Gegensatz zum Französischen, wo Subjekt und Verb am Anfang eines Satzes die Aussage bestimmen? Eine Sprache entfernt sich nicht von ihrem Gebrauch. Freud hat seine Methode am Vorabend der aufziehenden Nazi-Barbarei entwickelt, eine Barbarei, die alles daran gesetzt hat, wie die Geschichte zeigt, zuallererst die Sprache zu beschmutzen und zu zerstören. Goldschmidt geht diesem Phänomen nach und analysiert das Einhergehen von Sprachreinigung und Sprachzerstörung. Er sieht in der deutschen Sprache die 'Grundsprache', die von keiner anderen Sprache massgeblich beeinflusst worden ist, die durchsichtig davon spricht, was dem Benutzer in dringlicher Wirklichkeit vor Augen steht. Die beiden Sprachen, Französisch und Deutsch, werden per definitionem einander so gegenüber gestellt: das Deutsche ist urwüchsig, dinghaft, kindlich-obszön, das Französische durch luzide Rationalität geprägt, theoriegeeignet, geschmeidig, erwachsen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 274
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Georges-Arthur Goldschmidt
Freud wartet auf das Wort
Freud und die deutsche Sprache II
Über dieses Buch
Im Anschluss an seine berühmt gewordene Studie »Als Freud das Meer sah«, setzt Goldschmidt seine Analyse der deutschen Sprache vor dem Hintergrund der Psychoanalyse fort. Orientierte sich Freud an der grammatikalischen Struktur der deutschen Sprache, die die eigentliche Information immer an den Schluss der Sätze stellt – ganz im Gegensatz zum Französischen, wo Subjekt und Verb am Anfang eines Satzes die Aussage bestimmen?
Eine Sprache entfernt sich nicht von ihrem Gebrauch. Freud hat seine Methode am Vorabend der aufziehenden Nazi-Barbarei entwickelt, eine Barbarei, die alles daran gesetzt hat, die Sprache zu beschmutzen und zu zerstören. Goldschmidt geht diesem Phänomen nach und analysiert das Einhergehen von Sprachreinigung und Sprachzerstörung. Er sieht in der deutschen Sprache die ‚Grundsprache’, die von keiner anderen Sprache maßgeblich beeinflusst worden ist, die durchsichtig davon spricht, was dem Benutzer in dringlicher Wirklichkeit vor Augen steht. Die beiden Sprachen, Französisch und Deutsch, werden einander so gegenüber gestellt: das Deutsche ist urwüchsig, dinghaft, kindlich-obszön, das Französische durch luzide Rationalität geprägt, theoriegeeignet, geschmeidig, erwachsen.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Georges-Arthur Goldschmidt, 1928 in Reinbek bei Hamburg geboren, musste als Zehnjähriger in die Emigration nach Frankreich gehen. Er lebt heute in Paris. Für sein umfangreiches Werk wurde er u.a. mit dem Bremer Literatur-Preis, dem Nelly-Sachs-Preis und dem Joseph-Breitbach-Preis ausgezeichnet. Im November 2013 erhielt er den Prix de L’Académie de Berlin. Zuletzt erschien seine Erzählung ›Der Ausweg‹.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
Die Originalausgabe »Quand Freud attend la verbe. Freud et la langue allemande II« erschien bei Éditions Buchet/Chastel in Paris
© 1996 by Buchet/Chastel, Paris
© 2008 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Die erste Ausgabe dieses Bandes erschien 2006 im Ammann Verlag & Co., Zürich
Covergestaltung: Nicole Lange, Darmstadt
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-490842-7
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Widmung
Motto
Vorbemerkung zur deutschen Ausgabe
I Ohne das Wissen von Babel
II Am Waldrand oder Soll man Freud übersetzen?
III Drunter und drüber
IV Freud wartet auf das Wort oder Der Verzögerungseffekt
V Eine Sprache in Zeitlupe
VI Aus-Sichten einer Sprache
VII Ein Sprachzwang
VIII Das Feld der Wörter
IX Der Klang der Wörter
X Apocalypse now
Anhang
Am Waldrand
Literatur
Für Nicole und Patrice Loraux, in tiefer Freundschaft
»Der gleiche Sinn verändert sich mit den Worten, die ihn ausdrücken.«
Blaise Pascal[1]
»Ich beschreibe nur die Sprache und erkläre nichts.«
Ludwig Wittgenstein[2]
Fußnoten
[1]
Blaise Pascal, Gedanken, übersetzt von Wolfgang Rüttenauer, Bremen 1955
[2]
Ludwig Wittgenstein, Philosophische Grammatik, Schriften, Bd. 4, hg. von Rush Rhees, Frankfurt/M. 1969
Vorbemerkung zur deutschen Ausgabe
Dieses Buch, genau vor zehn Jahren in seiner französischen Niederschrift erschienen, war ein Versuch, Freud durch seinen Gebrauch der deutschen Sprache zu verstehen, einer Sprache, wie sie in Frankreich doch kaum gelesen werden kann. Durch die Übertragung wird der Text ein vollkommen anderer, wobei der Inhalt derselbe bleibt, er aber die Farbe gewechselt hat, ein rot angestrichenes Gebäude wird auf einmal hellblau. Es ist sozusagen derselbe Mensch mit einem anderen Gesicht. Was haben uns die Sprachen zu sagen, da, wo die Übersetzung nicht ganz ankommt und von der Ausgangssprache nichts wiedergibt? Vielleicht drücken die Sprachen das Wesentliche gerade dort aus, wo sie der anderen Sprache nur ihre Stummheit entgegenzuhalten haben, denn die Sprachfelder decken sich nur teilweise, und das Aufregende und Deutlichste geschieht fast immer dort, wo die Zielsprache leer ausgeht. Allein der Sinn bleibt erhalten, man versteht, sieht aber nicht, es ist, als sollte Glasgow für Lissabon gehalten werden.
Freud schrieb deutsch, und zwar ein besonders klares, schönes Deutsch. Übersetzt wirkt er meist gestelzt und kompliziert, aber trotz der manchmal auffallenden Verschiebungen versteht man ihn durch das Französische genau wie im Deutschen. Die Übersetzung hat in nichts den Sinn der Psychoanalyse entstellt, und doch sieht der Text vollkommen anders aus, klingt anders, wird in einem anderen Kontext anders aufgenommen. Deshalb stellt sich die Frage: Wie ist dasselbe anders, wie funktioniert es in seiner Andersartigkeit? Und so galt es, dem französischen Leser zu zeigen, wie das Deutsche überhaupt, jedenfalls das Deutsche, wie es zur Zeit Freuds von »Akademikern« geschrieben wurde, funktioniert, vor allem im Hinblick darauf, daß Freuds Denken parallel zum Aufkommen des Nazismus verlief und sich entwickelte. Freud hat, ohne es entsprechend zu formulieren, wie ein Jahrhundert zuvor Heinrich Heine, die Katastrophe des 20. Jahrhunderts herannahen sehen. Sein ganzes Werk war vielleicht eine Warnung, die zu spät kam, angesichts der nicht wiedergutzumachenden Zerstörung Europas durch den Nazismus.
Die eigentliche Frage in diesem Buch lautet: Wie sieht das Deutsche auf französisch aus? Eine Frage, die in weiteren Arbeiten, z.B. für die inzwischen eingestellte Zeitschrift Nouvelle Revue de psychanalyse oder in l’Inactuel und anderen ähnlichen Veröffentlichungen, noch näher untersucht worden ist. An ein paar wenigen Stellen wurde der Text vom Verfasser für die deutsche Erstausgabe leicht abgeändert. Sein besonderer Dank gilt der Übersetzerin Brigitte Große.
Georges-Arthur Goldschmidt
Fußnoten
[1]
Wilhelm von Humboldt, »Ueber die Verschiedenheiten des menschlichen Sprachbaues«, in: Schriften zur Sprachphilosophie, Stuttgart 1965
[2]
Im Deutschen bedeutet Parole Losungswort (mot de passe), Kennwort, Slogan, und das ist auch schon alles (s. Max Picard, Die Welt des Schweigens, Erlenbach 1950)
[1]
Georges-Arthur Goldschmidt, Molière ou la Liberté mise à nu, Paris 1973
[1]
Max Picard, Hitler in uns selbst, Erlenbach 1969
[1]
Humboldt, a.a.O.
[1]
Martin Seel, »Sprache bei Benjamin und Heidegger«, in: Merkur, Nr. 517, April 1992
[1]
Henri Bergson, La pensée et le Mouvant (dt. Denken und schöpferisches Werden. Aufsätze und Materialien, aus dem Französischen übersetzt von Leonore Kottje, Stuttgart 1993)
[1]
S. Sigmund Freud, »Psychoanalytische Bemerkungen über einen autobiographisch beschriebenen Fall von Paranoia« (»Der Fall Schreber«), StA, Bd. VII, S. 133ff.
[1]
Sandor Ferenczi, »Über obszöne Worte«, in: Bausteine zur Analyse, Leipzig-Wien-Zürich 1927
[1]
Henri Bergson, Les données immédiates de la conscience (dt. Zeit und Freiheit, Hamburg 1994)
IIAm Waldrand oder Soll man Freud übersetzen?
Das ist es nicht, oder so geht das nicht.
Es gibt nichts Eigenartigeres als den Wechsel ein und desselben Objekts aus einer in eine andere Sprache. Dieser Wechsel ist um so verblüffender, als ein solches Sprachobjekt werden muß, was es nicht ist und nicht sein kann.
Jede Übersetzung hat von Anfang an schwer an ihrer Unmöglichkeit zu tragen – als könnte man einen Körper seines Körpers entkleiden. Alles, was in einer Sprache gesagt oder geschrieben wird, ist diese Sprache. Die Übersetzung macht aus demselben ein anderes; ein deutscher Text kann nicht zu einem französischen werden. Und gerade weil Übersetzung unmöglich ist, ist sie unumgänglich.