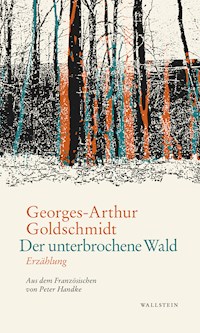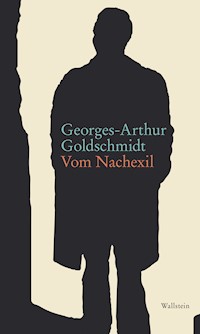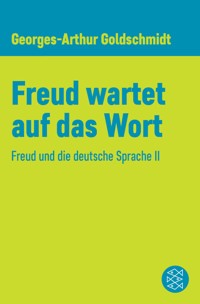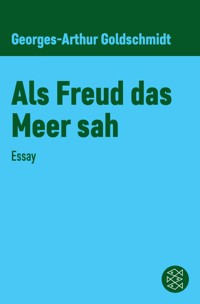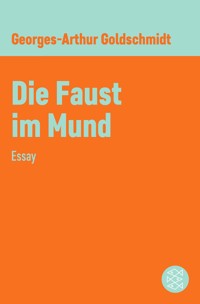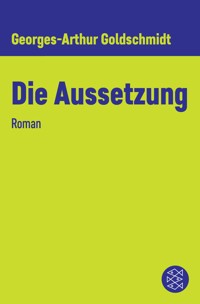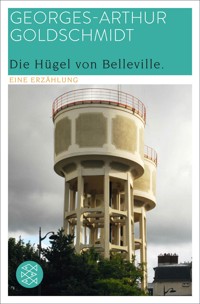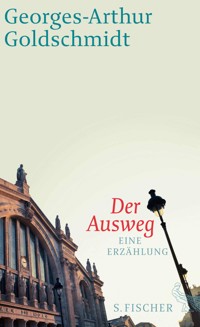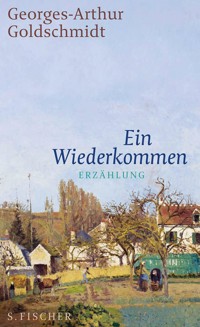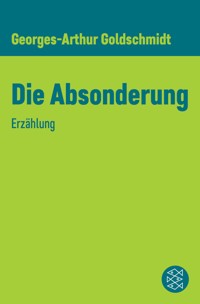
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Georges-Arthur Goldschmidt wurde 1938 als Zehnjähriger in Hamburg von seinen jüdischen Eltern in den Zug nach Florenz gesetzt. Von dort gelangt er in ein französisches Kinderheim in den Savoyer Alpen. Das Leben dort, den Kampf gegen das Heimweh, die zahlreichen Prügelstrafen und die heimliche Lust daran, die ständige Bedrohung durch die deutschen Besatzer beschreibt Goldschmidt in seiner Erzählung ›Die Absonderung‹. Im Vorwort von Peter Handke heißt es dazu: »Goldschmidt hat so etwas wie ein Traumbuch geschrieben: in dem Sinn, daß er für Situationen und Ereignisse, für die es bis dahin noch keine Sprache gab, wie somnambul, planlos, vorsatzlos, dafür um so klarer und unmittelbarer eine solche - nicht findet, sondern einfach hinsetzt. Ja, vergleichbare Bücher schreibt manchmal ein Träumer - nur ist hier beim Erwachen das Buch da, vorhanden, zur Hand: eher als ein ›Traumbuch‹ vielleicht also das Zeugnis eines so ausgedehnten wie beengten Traumwandelns, eines jahrelangen, voll des Schreckens und des Staunens, der Raum- und Zeitsprünge, der fahlen Labyrinthwelt des ewigen Kriegs und der weiträumigen Farbenwinkel eines episodischen Friedens. Traumbuch; Zeugnis eines Traumwandelns; oder: das Buch als Findling.«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 141
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Georges-Arthur Goldschmidt
Die Absonderung
Erzählung
Über dieses Buch
Georges-Arthur Goldschmidt wurde 1938 als Zehnjähriger in Hamburg von seinen jüdischen Eltern in den Zug nach Florenz gesetzt. Von dort gelangt er in ein französisches Kinderheim in den Savoyer Alpen. Das Leben dort, den Kampf gegen das Heimweh, die zahlreichen Prügelstrafen und die heimliche Lust daran, die ständige Bedrohung durch die deutschen Besatzer beschreibt Goldschmidt – und findet so eine Sprache für Situationen und Ereignisse, die vorher unbeschreibbar waren.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
© 2018 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Die erste Ausgabe dieses Bandes erschien 1991 im Ammann Verlag & Co., Zürich
Covergestaltung: Nicole Lange, Darmstadt
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-490837-3
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Widmung
Vorwort
Die Absonderung
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
Für Wolfgang Wirsig
Vorwort
Unvergleichlich«: ein oft gebrauchtes und fast genauso oft mißbrauchtes Wort für ein Menschenwerk – aber in dem Fall dieses Buches, »Die Absonderung«, scheint es einmal am Platz. Es gibt kein vergleichbares Buch in der wunderbar langen Geschichte der Bücher, nicht einmal Karl Philipp Moritz’ »Anton Reiser«, der zwar mit dem namenlosen Helden Goldschmidts, neben der Grundsituation der Ausgesetztheit und der Heimatvertriebenheit und dem Lebensalter, viele Handlungs- und Leidensmomente gemeinsam hat, nicht aber das Zentrum, welches in der »Absonderung« der Körper ist, der eines Heranwachsenden – der eigene Körper, nicht nur als Zuflucht, sondern als, gerade in den ärgsten Züchtigungen, ununterwerfbare, unzerstörbare Bastion – anderes noch als Heimat: Reich, geheimnisvolles. Einmalig wirkt auf mich diese Erzählung freilich mehr noch durch ihr stetiges Umspringen; entsprechend jenen Umspringbildern, die mit jedem neuen Blick eine andere Möglichkeit zeigen, wird »Die Absonderung« mir Leser von Anfang bis Ende zum Umspring-Buch. Noch nie habe ich solch jähes Wechseln von Ferne und Nähe gelesen, von den luftigen Horizontfarben zu den schweren Fleischfarben, von den Landschaftsformen, gestaffelt mit ihrer Hilfe die Erde als äußerstweite Himmelsgegend, zu den handnahen Rundungen, Schründen, Striemungen des Menschenleibs, konvulsivisch, chaotisch, durcheinander, verzerrt, wie sozusagen am ersten Weltentag, und wieder zurück zum Blau der Ferne, den Durchlässen, Paßhöhen und Furten im Mittelbereich, dem (trügerischen?) Grünen und Blauen von Erde und Äther, denen wiederum regelmäßig das Zusammenzucken folgt, im Innersten des Körpers, in der Todesangst, der Bestrafung, der Flucht, des Sich-beiseite-Schlagens – eben der »Absonderung«. Einmalig dabei auch die Sprache der Erzählung: Bei allem Umspringen, Zusammenzucken, Umfärben, Verformen der Bilder ein merkwürdiges Gleichmaß der Sätze und Absätze, ein stetiger Sprachfall, bei all der Abruptheit der Erscheinungen und deren plötzlicher Verflüchtigung. Goldschmidt hat so etwas wie ein Traumbuch geschrieben: in dem Sinn, daß er für Situationen und Ereignisse, für die es bis dahin noch keine Sprache gab, wie somnambul, planlos, vorsatzlos, dafür um so klarer und unmittelbarer eine solche – nicht findet, sondern einfach hinsetzt. Ja, vergleichbare Bücher schreibt manchmal der Träumer – nur ist hier beim Erwachen das Buch da, vorhanden, zur Hand: eher als ein »Traumbuch« vielleicht also das Zeugnis eines so ausgedehnten wie beengten Traumwandelns, eines jahrelangen, voll des Schreckens und des Staunens, der Raum- und Zeit-Sprünge, der fahlen Labyrinthwelt des ewigen Kriegs und der weiträumigen Farbenwinkel eines episodischen Friedens. Traumbuch; Zeugnis eines Traumwandelns; oder: das Buch als Findling.
Peter Handke
Die Absonderung
Und wie plötzlich, unvermittelt, das Gleiten begann und das Rollen der Räder und die Entfernung sich zeigte und wuchs. – Und wie dann der Schmerz über mich gekommen war, wie er angefangen hatte beim Handgelenk, den Arm entlang gekrochen war wie eine Lähmung, in den Körper wie Gift, in die Augen, in die Beine –
Lore Berger Der barmherzige Hügel
I
Unter dem weitgoldenen Abendhimmel schwappen windgekräuselte Wellen daher; in halber Ferne läuft der langsame Bogen des Fußgängerstegs über den Canal de la Villette. Ruckartig flackern die Stadtlichter auf.
Zwischen den ungleich hohen Häuserrücken öffnen sich helle Straßenschächte, wie aus der dunklen Stadtmasse ausgespart, als zögen die Straßen weit hinaus, in ihre eigene Richtung, immer weiter. Die Dunkelheit ist schon so tief, daß alle Helligkeit nur noch von den Lichtern, den Ampeln, den Leuchtschriften kommt. Allein auf der hoch gelegenen Place des Fêtes reicht der Himmel tief herunter, als braun-gelber Sonnenschatten, bis unter den Häuserhorizont, als könnte man in Brusthöhe mit ausgestreckter Hand hingreifen.
Es ist, als ob die Straße bis in die damalige Abenddämmerung hineinstöße, als man auf dem Balkon des Kinderheims stand und die blau-schwarzen Berge sich vor dem gelben Himmel abheben sah, damals 1944, in Hoch-Savoyen, als man wieder tief und ruhig atmen konnte. Immer richtete sich dann, in der Deutlichkeit des Abends, der Blick in die Richtung der Heimat. Denn es wurde eine ganze Kindheit damit verbracht, sich die Heimat zu vergegenwärtigen.
Überall, wo er stand, konnte er nach Hause zeigen. Zehnjährig war er von Hamburg aus nach Süden gefahren worden, und seitdem kam das Heimweh in ihm wie ein Ersticken wieder auf. Zu Hause, es war 1938 gewesen, hatte er nicht bleiben dürfen: er war schuldig, von ihm hatte man etwas gewußt, was er selber noch nicht wußte: eine Lähmung von innen her, alle Bewegungen wie in Gips gegossen; von nun an hatte er sich immer wieder beim Er-selbst-Sein überrascht. Schuldig war er, erwiesen schuldig. Er gehörte weggeschafft, das hatte er immer schon gewußt. Die Eltern schwiegen, wenn er eintrat, saßen steif da, als wollten sie zeigen, daß sie gar nicht von ihm redeten. Um sie herum war das grün tapezierte Wohnzimmer viel zu groß, und die Möbel darin kantig, als wollten sie die Eltern Lügen strafen. Diese waren zerstreut, schauten geradeaus, vor sich hin, gingen von einem Zimmer ins andere und wußten nicht mehr, wo sie waren, stießen gegeneinander an, weil beide vergessen hatten, wo der andere war. Sie flüsterten sich ununterbrochen zu, als hätten sie die im Nebenzimmer begonnene Unterhaltung gar nicht abgebrochen. Das Wort »Jude« kam immer wieder vor, ein Wort aus der Bibel, er hatte nicht verstanden, warum sie so unruhig waren, wo sie doch von der Bibel sprachen. Aber dann war ihm plötzlich eingefallen, daß in der Sonntagsschule, wenn das Wort Jude fiel, der Pastor ihn immer angeschaut hatte, und das Wort hatte ihm angst gemacht.
Juden kannte er keine, das Wort aber gehörte mit Totschlag zusammen, man holte mit dem Arm aus und konnte zuschlagen: etwas Unheimliches gehörte dazu, eine Schuld, er fürchtete sich davor, als könnte man wissen, daß es seine eigene war.
Als Zehnjährigen hatte man ihn von Hamburg nach Florenz über München gefahren. Die hochhelle Bahnhofshalle war ihm für immer in Erinnerung geblieben; kein Tag, wo ihr Raunen, ihr riesiger Glasschwung ihm nicht ins Gedächtnis gekommen wäre. Nach der weiten Fernen über Fernen aufdeckenden Norddeutschen Ebene fingen Berge an vorbeizuziehen, kleine spitze Berge, die ersten, die er gesehen hatte, als hätten Himmelsfinger die Erdenhaut stellenweise nach oben gezogen. Mehrmals das hohle Brückengeräusch mit flüchtig erblicktem grau-grünem Wasser: er war stolz gewesen, ein Deutscher zu sein, stolz, daß Deutsche solche Brücken gebaut hatten, zum metallenen, dröhnenden Darüberfahren.
Auf den die Bahngeleise überquerenden Wegen, wo es bei herabgelassenen Schranken jedesmal klingelte, hätte genausogut er dort stehen können. Jemand ging da, oder es fuhren Kinder Rad – wie immer zu klein auf zu großen Rädern –, auch da hätte man wohnen können. Wäre man einer unter ihnen gewesen, hätte man vielleicht nicht wegfahren müssen. Die Menschen, die er durch das Fenster sah, waren nicht wie er, sie konnten bleiben, sie waren nicht schuldig.
Im Zug, seltsamem viereckigem Kasten, in dem er saß, während die Landschaft draußen an ihm vorbeizog, hatte er auf einmal gewußt: wäre er wirklich ein Jude gewesen, er hätte es nie sagen dürfen, wie er auch das andere nie sagen durfte.
In München war der Bahnhof ein Kopfbahnhof wie in Altona, und die mochte er nicht. Auf dem Bahnsteig war man schon auf Straßenhöhe: mit dem Auto hätte man direkt hineinfahren können, er hatte nicht gewußt, daß es so etwas gab. Vierzig Jahre später setzt die Erinnerung daran plötzlich in der Morgenhelle wieder ein. Vor den Backsteinhäusern einer Straße zieht ein Güterzug langsam vorbei, davor geht ein Eisenbahner: die Häuserfronten stehen senkrecht nebeneinander, eine einzige durchfensterte Stadtwand, und obgleich es doch Straße ist, fährt darauf eine Eisenbahn.
Bei der Ankunft in München waren die Türme der Marienkirche auch so überraschend nebeneinander gestanden. Der gleiche Turm zweimal. Die dunkelroten, vom Alter angeschwärzten, viereckigen Türme mit den hellgrünen, runden Hauben, die er so oft auf dem Bild zu Hause angeschaut hatte, sie gab es nun wirklich, die unter leicht bewölktem Himmel dahinzuziehen schienen. In Hamburg hatten die Türme auch auf Backsteinstümpfen gestanden: jede noch so dünne Backsteinriege war selber Turm gewesen, bis in schwindelerregende Höhe hinaufragend, seit Hunderten von Jahren schon. Manchmal sah man, winzig, Menschen ganz oben stehen, die sich vor lauter Höhe ganz langsam zu bewegen schienen. Es war, als fühle man unter der eigenen Hand die rauhe Fläche der aufgeschichteten Backsteinmassen.
In der Kirche selbst war im fahlgelben Gefliese der Teufelsschritt zu sehen gewesen: schwarz ausgespart, als habe der Fuß den Stein angesengt.
So viele Bilder hatte man ihm von Florenz gezeigt, damit in ihm kein Heimweh entstehe, daß er die so oft abgebildete Loggia dei Lanzi im voraus erkannte, wie man Weihnachtsgeschenke vorzeitig zu sehen bekommt: die der Loggia nachgebaute Feldherrenhalle war es gewesen.
Auf dem grell beleuchteten, steifen, wie präparierten Platz stand das, dreifach, ein leerstehendes Gezimmer, nur sich selbst enthaltend: zwei Soldaten im Stahlhelm gingen im Stechschritt davor auf und ab: Drei zu lange Banner hingen vor der Halle mit übergroßen Hakenkreuzen: es war eine glatte Fläche, ein ausstaffierter Raum: Angst überkam ihn. Man würde ihn erkennen, in die Fliesen eindrücken, totwalzen. Er war schuldig, man hatte ihn dabei gesehen und es der Mutter erzählt.
An jenem Maitag 1938, im Deutschen Museum hatte er es geahnt, wie durch eine unermeßlich weite Zukunft hindurch: In der Dunkelheit, an einem schmalen Tisch wurde das erste Fernsehen den Schaulustigen vorgeführt: Männer in Kittel hantierten an metallenen, knisternden Käfigen. Angesichts der übrigen Zuschauer wurde man in einen Kasten geschoben. Man stand im Gestänge eingeengt im heiseren Elektrizitätsgeruch. An einer Mattscheibe leuchtete es grau-weiß stockend auf, bis auf einmal ein Frauengesicht erschien und sagte, wie um sich selber auszuweisen und zu zeigen, daß es kein Schwindel war: »Du bist ein wonniger Junge mit blonden Locken, ein richtiger kleiner Deutscher.« In ihm schrie es aber überdeutlich mit dem Klang der eigenen Stimme so laut, daß ihm der Schweiß kam im engen Gehäuse: »Ich bin …«, und abscheulich deutlicher noch: »Ich habe an mir selber herumgefummelt. «
Aber er war keiner von denen, es gab sie doch nur in der Bibel. Die Josefsgeschichte hatte man ihm mehrmals vorgelesen, und trotzdem wußte er es, es hatte mit ihm zu tun: ein Bestraftwerden, das ihm noch bevorstand, in einer Zukunft, die in der Ferne lag und doch schon greifbar war, die einem vor Erwartung den Atem raubte. Man würde ihn ausziehen und mit Ruten züchtigen.
Dann waren Berge gekommen, so hoch, daß man die Gipfel vom Abteilfenster aus nicht sehen konnte, und Tunnels so lang, daß man bis über tausend zählen konnte. Es war lächerlich gewesen, so winzig unter der Bergmasse durchgefahren zu werden, im tosenden Gerassel des Zuges: man saß dabei einander gegenüber, eingeschachtelt, im Getäfel, in einem länglichen Kubus. Man war im Berg und saß dabei im Abteil, so grotesk war das, daß man sich am liebsten selber durchs Fenster geschossen hätte. Im Tunnel, kilometerlang, hatte er sich zum ersten Mal von sich selber abstehen gefühlt. Er hatte sich selber gesehen – als gehöre er nicht dazu; man saß im Gedröhne mit angewinkelten Armen zu beiden Seiten und Schenkeln unter sich selber –, wie er im Sitzkasten mit anderen zusammen durch den Berg gefahren wurde.
Später war der Zug am Meer entlang gefahren, in schwindliger Höhe, wieder durch kurze Tunnel, auf die plötzliche Stadtausbuchtungen folgten, mit rotdächernen Häuserhaufen übereinander. Der Ankunftsbahnhof war aus hellgelbem Marmor gewesen, und davor stand eine weiß-schwarze Kirche mit schneckenförmigen Verzierungen zu beiden Seiten: Santa Maria Novella. Noch am selben Abend hatte er mit offenem Mund den Duòmo in der Ferne gesehen, genau wie er abgebildet gewesen war; und er hatte sich gewundert, so etwas sehen zu können, daß er es sehen konnte und daß es das gab.
Einige Tage später hatte er dann die ungeheure Kuppel wie ein riesiges Gebirge aus der Nähe emporragen gesehen, den viereckigen Campanile, von dem er nachts geträumt hatte, der sich mit allen Einzelheiten, an denen nichts fehlte, auf einmal samt allem emporfensterte, bis zum obersten Gesimse.
Ockerfarbige Straßenfluchten führten bis zu ihm hin, wo an winzigen Ladentüren manchmal an Bindfäden Vögel übereinander hingen.
Auf einer Anhöhe über der Stadt war er untergebracht worden, herzlich begrüßt von Leuten, die er nicht kannte: im runden Garten hoch über der Stadt in der durchsichtig präzisen Landschaft hatte er ein Jahr lang gelebt, dann waren auch diese Beschützer weggezogen – nach Neuseeland –, sie hatten ihn am entgegengesetzten Stadtrand abgegeben, unter indigoblauem Himmel hatte sich der Campanile rechteckig, weißgrell abgehoben, zur rechten Seite die rote, weißgesträhnte Kuppel des Duòmo, die er das ganze Jahr lang immer links davon gesehen hatte: bis dahin hatte er kaum an die Eltern gedacht und das Heimweh überspielt, als ließe es sich mit der ausgestreckten Hand wie ein Möbelstück wegschieben.
Nach Florenz war er noch mit einem ganz gewöhnlichen Reisepaß des Deutschen Reichs gekommen, ohne aufgestempeltem »J«. Auf gewissen Pässen hätte es gestanden, hatte er sagen hören; ältere Leute hätten es gehabt, obgleich »J« doch Jugendlicher bedeutete.
Aber auf einmal, ganz unerwartet, war es ihm gekommen: es konnte auch »Jude« heißen, und die Angst hatte ihm den Magen zugeschnürt. Auch in Italien durfte man nicht bleiben: die Landschaft zog sich zusammen, sie war nur noch wie aus einem Zugfenster zu sehen, als stünde man schamlos nackt in einem goldgeschmückten, getäfelten Salon.
Dann hatte es Wohnungen gegeben, am andren Ende der Stadt, in denen man abgestellt wurde, ohne daß der Blick stillhalten konnte; mitten in einem Etagenhaus war man wie aufgehangen, ein Kleiderbügel in einem riesigen Schrank.
In der sonst immer trockenen, sommerfarbenen Stadt hatten sich spiegelnasse Bürgersteige ausgestreckt mit dunklen Feuchtigkeitszungen an den ocker beworfenen Häusermauern, unter wasserglänzendem Licht.
Eines Tages war vor dem hohen Himmel am Campanile ein weiß-gelbes Banner im Winde auf Halbmast hin und her geschweift, wie verlangsamt von der Turmhöhe. Der Papst Pius XI. war tot. Vielleicht hätte er einen geschützt.
Der Zug nach Frankreich fuhr wieder an den plötzlichen Ausbuchtungen am Meer entlang. Sie saßen nebeneinander, der größere Bruder und er; seinetwegen schämte sich der Große: man sah ihm zu sehr die Angst an vor der Fahrt in unbekanntes Land. Man hatte ihnen gesagt, daß sie nach der Durchfahrt einer weiten Ebene die Alpen sehen würden, vielleicht hatte man es ihnen gesagt, damit sie sich keine Sorgen machten.
Schon fuhr man durch Berge hindurch; das Tal war eng geworden, manchmal reichten felsige, schütter bewachsene Abhänge bis dicht an die Bahn heran. Der Gang war jetzt immer im Schatten, die Sonne schien, nur noch längliche Lichtbahnen zeichnend, ab und zu in das Abteil hinein.
Die Vorfreude auf die rechteckige, zugeklebte Eßtüte, die man ihnen mitgegeben hatte, war schon längst verflogen und konnte nicht mehr gegen die Angst ankommen; tagelang hatte man daran gedacht, an das »chestino di viaggio«. Beim Öffnen, hatte man sich vorgestellt, würde man kleine, braune Henkeltöpfe aus Ton vorfinden, mit allen den Speisen darin, die er mochte, Pasta sciutta, Bratkartoffeln, und wie in »Tischlein, deck dich« wäre es ein ununterbrochenes Mampfen, ein Sattessen gewesen, während der Zug einen davongetragen hätte. Aber es waren dann bloß Hühnergerippe gewesen mit ein wenig vertrocknetem Brot.