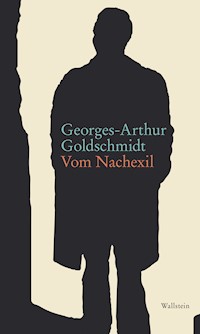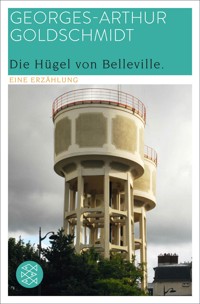9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Georges-Arthur Goldschmidt ist eine einzigartige Erscheinung im deutsch-französischen literarischen Grenzverkehr. Sowohl in Frankreich als auch in Deutschland ein Autor von Rang, betrachtet Goldschmidt Probleme und Worte »mal von unten, mal von oben«. Er entführt uns in literarische Abenteuer, mitten hinein in die Grimmschen Märchen, zum Struwwelpeter, von Pascal und La Bruyère bis hin zu Eichendorff und vor allem: zu Franz Kafka. Die Faust im Mund ist ein Sinnieren mit Geist, Körper und Seele über Sehnsucht, Gewalt, lustvolle Bestrafung und Scham und eine Wiederentdeckung der Liebe zur Muttersprache durch die Welt der Literatur.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 148
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Georges-Arthur Goldschmidt
Die Faust im Mund
Essay
Über dieses Buch
Georges-Arthur Goldschmidt ist eine einzigartige Erscheinung im deutsch-französischen literarischen Grenzverkehr. Sowohl in Frankreich als auch in Deutschland ein Autor von Rang, betrachtet Goldschmidt Probleme und Worte »mal von unten, mal von oben«. Er entführt uns in literarische Abenteuer, mitten hinein in die Grimmschen Märchen, zum Struwwelpeter, von Pascal und La Bruyère bis hin zu Eichendorff und vor allem: zu Franz Kafka. Die Faust im Mund ist ein Sinnieren mit Geist, Körper und Seele über Sehnsucht, Gewalt, lustvolle Bestrafung und Scham und eine Wiederentdeckung der Liebe zur Muttersprache durch die Welt der Literatur.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Georges-Arthur Goldschmidt, 1928 in Reinbek bei Hamburg geboren, musste als Zehnjähriger in die Emigration nach Frankreich gehen. Er lebt heute in Paris. Für sein umfangreiches Werk wurde er u.a. mit dem Bremer Literatur-Preis, dem Nelly-Sachs-Preis und dem Joseph-Breitbach-Preis ausgezeichnet. Im November 2013 erhielt er den Prix de L’Académie de Berlin. Zuletzt erschien seine Erzählung ›Der Ausweg‹.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
Die Übersetzung wurde gefördert durch das französische Kulturministerium, Centre National du Livre.
Die Originalausgabe »Le poing dans la bouche« erschien 2004 bei Éditions Verdier in Lagrasse.
© 2004 by Éditions Verdier, Lagrasse
Die deutsche Erstausgabe erschien 2008 im Ammann Verlag & Co., Zürich.
© 2018 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung: Nicole Lange, Darmstadt
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-490845-8
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Hinweis
Widmung
Motto
Vorrede
I Das erste Auflodern
II Die Sprache der Entdeckung
III Offenbarungen
IV Begegnungen
V Die Faust im Mund
VI Kafka
Nachbemerkung
Die Originalausgabe
»Le poing dans la bouche«
erschien 2004 bei Éditions Verdier
in Lagrasse.
Die Übersetzung wurde gefördert
durch das Französische Kulturministerium,
Centre National du Livre.
Für Patrice Loraux,
in Erinnerung an Nicole
… aber das Zimmer ist leer, niemand kümmert sich um mich, es ist als sagte man: Laßt ihn, seht ihr nicht wie ihn seine Sache erfüllt, es ist als hätte er eine Faust im Mund.
Franz Kafka, Brief an Milena
Wenn das stolze, schelmische Gesicht auftaucht, vom jungen Leuchten seines Lachens überstrahlt – Schmerz, der das Blut stocken läßt und das Herz grausam plagt in seiner Schuld, Schmerz wie Salz in der Wunde. Gerechte Prüfung, unendliche Buße, gelebt in der Verjährung des Überlebens.
Louis-René des Forêts, Ostinato
Manche Bücher können einen ein ganzes Leben lang bestimmen und leiten, und wenn man das Glück hatte, sie zu finden und sie sogar zu übersetzen (Der Prozeß 1974, Das Schloß 1976), entsteht das Bedürfnis, von dieser Entdeckung zu erzählen. Davor aber liegt ein langer Weg von einer Sprache in die andere, ein Weg, der erst zu dieser Entdeckung hinführt und es ermöglicht, die Annäherung in aufwühlender oder heiter gelassener Vertrautheit zu durchleben.
Von Buch zu Buch und von Sprache zu Sprache zeichnet sich deutlicher ab, was man sucht, ohne es je wirklich zu finden, bis zu der entscheidenden Begegnung, die alles bisher Gelesene ordnet. Diese fand 1950 statt, und zwar an demselben Punkt, an dem die Suche 1943 ihren Ausgang genommen hatte.
Die folgenden Seiten wollen den Weg nachzeichnen, auf dem der Leser bestimmte Bücher findet, die ihm zum Stoff seines restlichen Lebens werden.
IDas erste Auflodern
Alles beginnt an einem Oktobertag des Jahres 1943, in der Angst, Einsamkeit und Schande der Besetzung Frankreichs durch die Nazis. Mit einemmal fühlt man sich ausgerichtet an einer merkwürdig vertikalen Feststellung ohne Inhalt und Ausdehnung, die einen stets begleitet hat und sich plötzlich mit besonderer Deutlichkeit und Intensität abzeichnet. Spürt eine simple Gewißheit zu leben, ein ungekanntes Auflodern, das einen buchstäblich in sich selbst hineinfallen läßt. Eine Erschütterung, eine Grundlegung, einen Blitzschlag, aus dem ein unverrückbares Fundament für den Rest des Lebens entsteht. Gleichzeitig hört man das Lied des Föhns, jenes Südwinds, der über die Berge kommt und das Haus anzuheben scheint, daß es höher wird und sich aufrichtet, wie bedrängt von der Unermeßlichkeit ringsum.
Es war ein kurzer Rausch – ein Emporgerissenwerden, ein unsagbares Entzücken, eine leidenschaftliche Erregung, die mir die Tränen in die Augen trieb, das Gefühl, daß dieser zentrale Punkt außerhalb der Worte und ohne Halt eben das ist, worum die Sprache kreist, ohne es zu erreichen, ein leerer Punkt, der den Worten Raum gibt.
Diese Entdeckung, dieses »Ich bin, ich existiere«, wurde zum Orientierungspunkt des hilflosen, verlorenen, vertriebenen und mit dem Tod bedrohten Kindes, das als »minderwertiger« Christ zur Welt gekommen war.
Das Erlebnis war um so tiefgreifender, wesentlicher, je bedrohter ich – aufgrund meiner Herkunft – in meinem schlichten Überleben war, so daß jeder zufällig in einem Buch gelesene Satz Zuflucht und Zeichen wurde.
In dem strengen Internat in den Alpen Hochsavoyens, wo ich zu der Zeit lebte, gab es außer Lateinlehrbüchern und einem vom Verlag J. de Gigord eigens für katholische Lehranstalten herausgegebenen Handbuch mit Ausgewählten Stücken nur wenige Bücher. In der Jugend überfliegt man mehr, als man liest.
Es gab ein Exemplar von Pascals Gedanken, die in ihrer Knappheit Schauer hervorrufen können, dank derer man über das Lesen das ursprüngliche Staunen wiederfindet. Der Blick stockte bei der »unendlichen Bewegung: der Punkt, der alles erfüllt, der Augenblick der Ruhe. Unendlich ohne meßbare Größe, unteilbar und unendlich«. Das war kein Begreifen, sondern ein Ergriffenwerden. »Das ewige Schweigen dieser unendlichen Räume erschreckt mich.« Es war das gleiche, was mir eben passiert war, allein, im Schlafsaal ganz oben im Haus, ein plötzliches Gepacktsein, das einem den Atem verschlägt.
Der Körper war also so nah an den Worten, daß »Gedanken« erbeben lassen und den Atem nehmen konnten. Unter den Ausgewählten Stücken waren auch die Maximen von La Rochefoucauld, dessen heller Zynismus, wohltuende Bosheiten und Bedeutungsumkehrungen den Stoff des Denkens prägten. Es zog einem den Magen zusammen bei diesen schnellen, zugespitzten Maximen, durch sie erwies sich die französische Sprache als lebhaft, flink und präzise. Im Körper hinterließ dieses schlanke Französisch, das stracks auf sein Ziel losging, einen sonderbar schneidenden, fast heiteren Eindruck.
Bis 1943 hatte ich in ständiger Aufregung gelebt, von einer Züchtigung zur nächsten, kopflos vor Schimpf und Schande, daher war mir gar nicht bewußt geworden, daß ich kleiner deutscher Flüchtling längst Französisch sprach, als ob ich das seit jeher getan hätte, als ob es meine zweite Muttersprache wäre.
An jenem Oktobertag 1943 kam alles auf einmal, auch der zweifache Zugang zum Schreiben. Statt mich wie gewöhnlich zum zweihundertmaligen Abschreiben des Satzes »Ich darf im Unterricht nicht schwätzen« oder »Ich werde Schläge bekommen, weil ich faul bin« zu verdonnern, hatte man sich diesmal in den Kopf gesetzt, mich die »Abenteuer eines Zerstreuten« aus den Charakteren von La Bruyère abschreiben zu lassen. Noch nie hatte ich so Französisch geschrieben. Es war, als ob ich über dem Text schwebte, nie zuvor war mir die absonderliche Anordnung all dieser Buchstaben aufgefallen, die die Seiten schmückten, aber beim Vorlesen meist nicht zu hören waren; das verlieh dem ganzen ein elegant pittoreskes Flattern, das mich staunen machte. So wurde die Sprache, die ich abschrieb, zu einer überraschenden, wunderbaren Zuflucht in der alltäglichen Not.
Alles war anders als in meiner deutschen Muttersprache. Alles lief anders. Hinter den vollkommenen Sätzen La Bruyères zeichnete sich gegen meinen Willen das Deutsche ab, ein Block aus Angst und Grauen, daß man am liebsten die Bäume angefleht hätte, den eigenen Platz einzunehmen, oder sich an die Stelle der Gartenzäune wünschte; die braunen Uniformen der Nazipartei NSDAP mit der Koppel am Schulterriemen, all die Leute, die man kannte und fürchtete – der Krämer, der Kohlenhändler, der Lehrer –, die stocksteif und gestiefelt in Reihen durch die Dorfstraßen marschierten und die Hakenkreuzfahne schwenkten.
Seit 1937 schon das plötzliche Verstummen der Eltern, wenn die Kinder nach Hause kamen, als hätten sie sich in ihren unterbrochenen Gesten verheddert, als hätten sich die zuletzt ausgesprochenen Wörter auf ihren Lippen festgesetzt, und welche das waren, wußten wir nur zu gut: »Hitler«, »Juden«, »dort«, vielleicht auch »KZ«, ein Wort, das damals in aller Munde war.
Niemand sprach darüber, aber alle wußten es, selbst ich, ich spürte genau, daß die Landschaft, die ich sah, einen doppelten Boden hatte. Da war das ruhige, alltägliche Oben mit den Fichten und ihren grün schimmernden Stämmen und darunter der bodenlose Terror, der an die Oberfläche drang und alles verdunkelte. Plötzlich traten die behäbigen, dicken Männer, die sonst friedlich Drehständer mit Ansichtskarten auf dem Bürgersteig aufbauten oder Schaufenster mit Shampoo-Gebinden dekorierten, mit haßverzerrtem Mund in gänsekackbraunen Uniformen auf, im Gleichschritt, marsch. Alles war grau und trüb geworden. Es gab vertraute Orte, an die man nicht mehr ging. Der innere Horizont war umstellt von großen Zusammenbrüchen. Man wurde von einer senkrechten Platte entzweigeschnitten, man war wie unter sich selbst verkrochen, als ob man sich in seinen Keller flüchten und dort zum Flaschengestell werden wollte.
Die großen Eichen, vom Wind gezaust, der über die Ebene strich, die in weiter Ferne von den Bäumen und niedrigen Häusern an einer noch unbekannten Straße gesäumt war, der Himmel, an dem sich die vom Meer her kommenden Wolken jagten, die Windmühle, deren Flügel immer hinter einer kleinen Anhöhe verschwanden und wieder auftauchten, all das war nach 1937 verboten, abgeschnitten, außer Betrieb. Deutschland verfiel in Angst, erstarrte unter der allgegenwärtigen Bedrohung, die uns die Beine steif machte, uns Kindern, die ahnten, daß sie Geächtete waren, ohne zu wissen, warum.
Das ganze Land wirkte verkehrt, wie verwandelt von der zu verlogener Begeisterung mutierten Angst, die Leute hatten sich den Dingen, den Befehlen gebeugt, und immer krümmte Furcht ihnen den Rücken. Das Deutsch meiner Kindheit klang plötzlich abgehackt, grob und hart, es traf dich in die Seiten, rauh, aus tiefer Kehle gebrüllt, und wenn Tralau, der stiernackige Nazi-Schuldirektor, gegen Minderwertige[*] und Volksverräter hetzte, war es schon von weitem zu hören.
Von diesem kalten, trockenen, granitenen Deutsch wurde alles abgeschnitten, geköpft, versteinert, vereist, als ob das Naziregime die Sprache verschluckt und aufgefressen hätte, um den Geist zu zementieren. Wenn du so vor dich hin gingst, als ob sich nichts verändert hätte, und den Blick zum Horizont hobst, versetzte es dir gleich einen Schlag: Immer konnte von irgendwoher ein SA-Mann in brauner Uniform kommen und dich mitnehmen.
Ständig spürte man diese Präsenz im Rücken, das fiel mir wieder ein, als ich abschrieb: »Ménalque steigt die Treppe hinab, öffnet seine Haustür, um auszugehen, und schließt sie wieder hinter sich zu: da wird er gewahr, daß er die Nachtmütze noch aufhat; er mustert sich genauer, merkt, daß er nur halb rasiert ist, daß er seinen Degen an die rechte Seite geschnallt hat, daß seine Strümpfe ihm bis auf die Fersen herabhängen und sein Hemd nicht in den Hosen steckt.«
Unter dem Text von La Bruyère blieb die Muttersprache wie eine schweigende Masse. »Geht er über einen Platz, so spürt er plötzlich einen kräftigen Schlag gegen den Magen oder ins Gesicht; er begreift gar nicht, was das sein könne, bis er sich ermuntert, die Augen aufschlägt und dicht vor sich eine Wagendeichsel oder eine lange Bohle entdeckt, die ein Handwerker auf den Schultern trägt.«
In den neckischen Girlanden all dieser Buchstaben, die nicht ausgesprochen wurden, lag etwas Heiteres. Obwohl es eine Strafe war, bereitete mir das Abschreiben dieser Sprache, bei der man so gut verstand, was man nicht hörte, dieses ständige -oing, -ant, -ait, -ier, großes Vergnügen. Die berühmte Orthographie, von der jeder sprach, begann mich zu faszinieren.
Das Französische hatte etwas Mondänes, Möbliertes, es war eine Sprache der Tapisserien, Medaillons und Fauteuils. Eine Sprache, die in den Mund flitzte, wenn man sie nur in den Mundwinkel nahm, und ganz von alleine lief. Sie hatte nicht solche Rundungen und Hebungen wie das Deutsche, nicht deren Weiches noch deren Hartes. Das Deutsche, meine Muttersprache, erfaßte den Körper anders als das Französische, das darüberlag, gestützt vom Fundament des Deutschen, das ich, aus Scham über meine Herkunft, vergessen zu können glaubte. Wie jedes deutsche Kind beherrschte ich mit zehn die gesamte Sprache, weil sie sich nur aus sich selbst zusammensetzt. Man wird von ihr durchdrungen bis ins Mark. Geräusche, Farben, Beschaffenheiten – all das lernt man voller Entzücken an der Muttersprache, das Haus, der Garten, die Schule bilden die Sedimente des Selbst. Die Sprache ist der hochrädrige Zug, der weit entfernt vorbeifährt, die Spiegelungen im Wasser unter der Brückenwölbung, rufende Stimmen, das Rascheln des toten Laubes, wenn der Fuß es durchpflügt.
Doch im Hintergrund mischte sich auch Angst hinein, eine physische Furcht, wie man sie oft empfand zwischen 1936 und 1938, am Saum des Sachsenwaldes, wo das helle Buchenlaub überall auf den dunklen Grund der Tannen stieß. Wir fuhren mit dem Fahrrad durch den Wald, um das Bismarck-Grab zu besichtigen, ein kurzes, rundliches Bauwerk mit gelben Fensterscheiben, nur einen Katzensprung vom Bahnhof Friedrichsruh entfernt. Im Dorf gingen die Menschen erhobenen Hauptes durch die Straßen und hielten die Arme, als ob sie Waffen trügen. Sie hatten fanatische Gesichter und waren bereit, kurzen Prozeß zu machen.
Das Gewicht, die Konsistenz der Sprache steckten mir noch im Leib. Schwarze Bäume, die in der Dämmerung aus dem satten Gelb des Laubes ragten, ehe sie sich im Dunkel der Nacht auflösten; die Angst, das nahe Haus nicht wiederzufinden; die lauten Stimmen, die vollen, breiten Silben, die aus tiefer Kehle gepreßten Konsonanten, die die Luft unter der Zungenspitze passieren lassen, dies ach, dies krächzen, kratzen, machen.
Die klingenden Vokale dazwischen füllten den Brustkorb, nun aber hörte man überall Gebrüll, Geschrei, Gejohle, Gebelfer, in der Schule und auf der Straße; bei jeder sich bietenden Gelegenheit wurde die Sprache im Befehlston durch das kleine, ansteigende Sträßchen namens Schmiedesberg geplärrt; dem Friseur und dem Kohlenhändler entbot man im Vorbeigehen den deutschen Gruß, den Hitlergruß, den der Führer als unfehlbares Werkzeug der Unterwerfung eingeführt hatte. Dazu mußte man den Arm heben und Heil Hitlaaa! brüllen, das spaltete den Körper, zerriß ihn innerlich, es war ein Todesschrei.
Ich erkannte meine Muttersprache nicht wieder, die so melodiös und geheimnisvoll klang, wenn meine Mutter sang oder mir abends ein Märchen von den Brüdern Grimm oder von Corlshorn vorlas. Aber auch in den Märchen wohnte das Grauen, gleich neben dem Raum der Träume: Da gab es unterirdische Welten voll frischer Luft und Sonnenschein, aus denen man über Treppen in die wirkliche Welt hinaufstieg, Hügel, die ihre Hand ausstreckten, gedeckte Tische aus dem Nirgendwo, aber auch zahllose in den Wäldern ausgesetzte Kinder. Da lernte man das Gruseln, diesen besonderen, köstlichen Schrecken, der einem eiskalt den Rücken hinunterläuft. Einmal las mir meine Mutter eine Geschichte vor, die mir im Gedächtnis blieb, aber erst Jahre später, angesichts einer Passage in einem Buch von Henry Miller, verstand ich, warum:
»In einer Stadt, Franecker genannt, gelegen in Westfriesland, da ist es geschehen, daß junge Kinder, fünf- und sechsjährige, Mägdlein und Knaben, miteinander spielten. Und sie ordneten ein Büblein an, das solle der Metzger sein, ein anderes Büblein, das solle Koch sein, und ein drittes Büblein, das solle eine Sau sein. Ein Mägdlein (…) solle Köchin sein, wieder ein anderes, das solle Unterköchin sein, und die Unterköchin solle in einem Geschirrlein das Blut von der Sau empfahen, daß man Würste könne machen.
Der Metzger geriet nun verabredetermaßen an das Büblein, das die Sau sollte sein, riß es nieder und schnitt ihm mit einem Messerlein die Gurgel auf, und die Unterköchin empfing das Blut in ihrem Geschirrlein. Ein Ratsherr, der von ungefähr vorübergeht, sieht dies Elend: er nimmt von Stund an den Metzger mit sich und führt ihn in des Obersten Haus, welcher sogleich den ganzen Rat versammeln ließ. Sie saßen all über diesen Handel und wußten nicht, wie sie ihm tun sollten, denn sie sahen wohl, daß es kindlicherweise geschehen war.
Einer unter ihnen, ein alter weiser Mann, gab den Rat, der oberste Richter solle einen schönen roten Apfel in eine Hand nehmen, in die andere einen rheinischen Gulden, solle das Kind zu sich rufen und beide Hände gleich gegen dasselbe ausstrecken: nehme es den Apfel, so soll’ es ledig erkannt werden, nehme es aber den Gulden, so solle man es töten. Dem wird gefolgt, das Kind aber ergreift den Apfel lachend, wird also aller Strafe ledig erkannt.«
Vielleicht ahnte das Kind etwas vom herrlichen Gebrauch eines ausgehöhlten Apfels.
Die meisten Märchen enthielten eine Drohung, etwas Dunkles, Unheimliches, sie waren in einem robusten, treffenden Deutsch geschrieben, von den Rändern des Textes ging etwas Gewaltsames aus, von dem man nicht loskam.
Aber es gab auch die Weihnachtslieder, Stille Nacht, heilige Nacht, die Teller mit dem Naschwerk, die Zuckerkringel an den Tannenzweigen und die heimlichen, unsagbaren Enttäuschungen, als könnte man der Sprache nicht mehr alles anvertrauen.