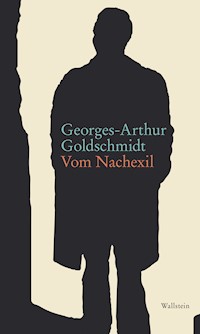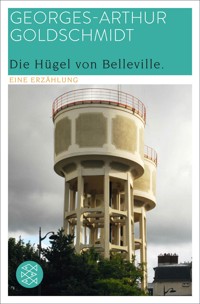9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Warum ausgerechnet Kafka? Weil Kafka von großer Klarheit ist, egal wie unwahrscheinlich seine Geschichten sind. Ein Mann verwandelt sich in ein Ungeziefer? Unmöglich, und doch gibt es nichts Gewisseres, nichts Packenderes. Was Kafka schreibt, ist, was es ist – es gibt kein Jenseits der Sprache, keine Bedeutung, die außerhalb des Gesagten liegt. Georges-Arthur Goldschmidt nimmt Kafka beim Wort. Aus diesem Wörtlichnehmen ist eine erstaunliche Lektüre Kafkas entstanden, die einem die Sprache verschlägt. Goldschmidt denkt scharf wie ein Messer und schreibt leidenschaftlich wie ein Liebhaber. ›Kafka lesen‹ ist ein mitreißendes Plädoyer für einen der größten Schriftsteller des 20. Jahrhunderts. Eine kleines Juwel am literarischen Himmel. Als würde man Kafka zum ersten Mal lesen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 175
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Georges-Arthur Goldschmidt
Meistens wohnt der den man sucht nebenan
Kafka lesen
Über dieses Buch
Wer, wenn nicht Georges-Arthur Goldschmidt, weiß, uns Franz Kafka zu erklären. Als sein Übersetzer kennt er in Kafkas Werk jedes Wort und dessen Bedeutung. Er nimmt Kafka beim Wort, und dieses Wörtlichnehmen macht klar, dass es keine Trennlinie zwischen Text und Kommentar gibt: Kafka lesen bedeutet, dass wir immer bei dem landen, was dort steht. Denn für Kafka ist die Sprache kein Instrument zum Weltgebrauch, sie ist Welt. Nur geht diese Welt nicht auf, weshalb man mit dem Sprechen über Kafka immer wieder von vorne anfangen muss.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
Die Originalausgabe erschien 2007 unter dem Titel »Celui qu'on cherche habite juste à côte. Lecture de Kafka« bei Éditions Verdier, Paris
© 2007 Éditions Verdier, Paris
© 2010 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung: Nicole Lange, Darmstadt
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-490838-0
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Widmung
Motto
Kafkalektüre
I Das Initialereignis
II Eine Mahnung
III Ein unsinniges Hoffen
IV Reise ohne Wiederkehr
V Im Stillstand
VI Ein Weg und kein Ausweg
VII Verweis und Verstoß
VIII Ein deutsches Nachwort vom Verfasser, der gerne wieder von vorne anfangen möchte
Für die so sehr geliebte Schwalbe
Man sollte Unbekanntem gleichen.
Alberto Giacometti
Kafkalektüre
Was Kafka schreibt, ist so klar, von so verblüffender Klarheit, daß es einem buchstäblich die Sprache verschlägt, man ist gefesselt, ratlos, bestenfalls begierig, den Text noch einmal zu lesen.
Kafka erzählt auf den ersten Blick unwahrscheinliche Geschichten – wie kann eine Brücke sich mit Händen und Füßen über einem Abgrund an den Wänden festhalten und sich umdrehen, um zu sehen, wer kommt; wie kann sich ein Mann in ein Ungeziefer verwandeln? Und doch gibt es nichts Gewisseres als diese Unwahrscheinlichkeiten, nichts Packenderes als diese Geschichten.
Kafka trifft tatsächlich jedes Mal mitten ins Zentrum, alles, was er schreibt, erreicht den Leser genau da, wo nichts mehr zu sagen ist. Man ist betroffen von Kafka, weil er dort ankommt, wo jeder anfängt, an dem stummen Punkt, mit dem das Sprechen des Lesers anhebt.
Was Kafka erzählt, führt zu diesem Ursprungsort, zu dieser unformulierbaren Sprache, hinter die man nicht zurückkann.
Was er schreibt, ist so einzigartig, daß es auf Anhieb erkennbar ist, ohne Bezug auf etwas anderes und deshalb absolut universell.
Dieser Essay ist das Ergebnis einer ständigen Präsenz Kafkas seit der Entdeckung seines Romans Der Proceß; in einem Garten in Kitzeberg bei Kiel im August 1950. Das war ein denkbar unangemessener und unerwarteter Ort für eine Kafka-Lektüre – mitten in Norddeutschland, in einer der damals uneinnehmbarsten Bastionen der Nazinostalgie. Wäre Kafka dort zwischen 1933 und 1941 spazierengegangen – also noch vor der Wannsee-Konferenz, in der die endgültige Vernichtung von seinesgleichen beschlossen wurde –, hätte er das nicht überlebt.
Natürlich kann man zu Recht in Kafka jemanden sehen, der das kommen sah. Mit dem, was sich damals ankündigte, ist man jedenfalls noch nicht fertig. Doch Kafka ist anderswo, nämlich in jedem Leser, er gehört dem, der ihn liest, und man kann Kafka nur lesen lernen, indem man ihn liest.
Es geht hier nicht um eine erschöpfende Lektüre Kafkas. Amerika etwa, Kafkas letztes Werk, wurde nur gestreift, um den vorliegenden Text, der kurz bleiben sollte, nicht unnötig zu verlängern. Außerdem hat die Lektüre von Amerika ihn bloß bestätigt. Heute werden durch neue Ausgaben, durch Erforschung und Entzifferung der Manuskripte Varianten und Abweichungen sichtbar, die aber im Grunde nichts ändern.
Das Wort »sein« bedeutet im Deutschen beides: Dasein und Ihm-gehören.[1]
IDas Initialereignis
Jemand mußte Josef K. verleumdet haben, denn ohne daß er etwas Böses getan hätte, wurde er eines Morgens verhaftet.[2]
Mit diesen ersten Worten im Proceß ist alles verwandelt, alles steht von da an unter dem Zeichen des Unabwendbaren: Es gab ein Davor, nach der Verhaftung ist alles danach. Praktisch findet sie kaum statt. Doch von da an ist alles, was danach kommt, radikal von dem Vorherigen getrennt. Was im Augenblick davor noch möglich war, wird nie geschehen, durch die Verhaftung ist der Faden gerissen. Das Wirkliche ist bloß ein unwiderruflicher Zustand des auf ewig erstarrten Möglichen.
Alles erhält durch diese Verhaftung, die Josef K., indem er sie auf seine Weise »beim Wort nimmt«, selbst Schritt für Schritt gestaltet, eine neue Wendung. K. ist gleichzeitig deren Objekt und Subjekt. Die Verhaftung läßt ihm in seinem Tun und Handeln völlig freie Hand. Alles ergibt sich aus dem, was er tut und wie er es tut, sein Schicksal erwächst aus seinem Tun und Handeln. Einmal getan, ist die Handlung unwiderruflich.
Alles ist da, und alles geschieht, als ob Josef K. von einem ersten Auslöser an seine Verhaftung selbst betriebe. Er läutet, man kommt. Aber es ist nicht Anna, die Köchin seiner Zimmervermieterin Frau Grubach, die ihm wie üblich sein Frühstück bringt, sondern der Wächter, der ihn verhaften will, aber erst eintritt, als K. geläutet hat. Man weiß nicht, ob er kommt, weil Josef K. geläutet hat, oder später von selbst hereingekommen wäre, nur: Er tritt ein, als K. läutet, nichts weiter. Es wird nicht gesagt, daß er eintritt, weil Josef K. geläutet hat, sondern nachdem Josef K. geläutet hat. K. läutet, er kommt herein, beides trifft zusammen, das ist alles.
Sie haben geläutet? fragt der Wächter.
Der Mann, der Josef K. verhaften kommt, ist verwirrend gekleidet, er trägt ein anliegendes schwarzes Kleid, das ähnlich den Reiseanzügen mit verschiedenen Falten, Taschen, Schnallen, Knöpfen und einem Gürtel versehen war und infolgedessen, ohne daß man sich darüber klar wurde, wozu es dienen sollte, besonders praktisch erschien.
Josef K. verlangt sein Frühstück, was ein kleines Gelächter im Nebenzimmer auslöst, das des anderen Wächters, denn es sind zwei, Franz und Willem. Josef K. springt aus dem Bett und zieht seine Hose an, und Kafka läßt ihn sagen: »Ich will doch sehn, was für Leute im Nebenzimmer sind und wie Frau Grubach diese Störung mir gegenüber verantworten wird.« Sofort fällt ihm auf, daß er dadurch gewissermaßen ein Beaufsichtigungsrecht des Fremden anerkannte.
Er macht sich also selbst zum Verhafteten, er stellt sich von Anfang an in den Kreis, dessen Mittelpunkt und Rand er ist. Er etabliert seine Verhaftung, noch bevor sie ausgesprochen ist.
Langsamer, als er vorhatte, geht er ins Nebenzimmer. Niemand zwingt ihn, schneller oder weniger schnell zu gehen. Dann macht Josef K. eine Bewegung, als reiße er sich von den zwei Männern los, die aber weit von ihm entfernt standen.
Man weiß nicht, was passiert wäre, wenn Josef K. sich anders verhalten hätte, weil er sich so verhalten hat, wie er sich verhalten hat, man weiß nicht, wie sich die Verhaftung entwickelt hätte, weil sie sich so entwickelt hat, wie sie sich entwickelt hat.
Deshalb eröffnet der Anfang endgültig eine wie auch immer geartete Folge. Mit dem Initialereignis – und nur mit diesem – beginnt, was nicht war. Die Verhaftung hat stattgefunden, wenn auch kaum wahrnehmbar, und das kann durch nichts mehr rückgängig gemacht werden. Jeder Beginn wird dem Beginnenden zugewiesen. Eine Richtung, das Warten auf einen Ausweg aus dem Prozeß – welchem Prozeß? – ist nun festgelegt. Der Prozeß aber ist das Unwissen darüber, was ihn ausmacht.
»Das Verfahren ist nun einmal eingeleitet und Sie werden alles zur richtigen Zeit erfahren«, antwortet der Wächter Willem Josef K., als dieser wissen will, warum er verhaftet sei. Das Verfahren ist ohne Grund eingeleitet, es gehört nicht zum möglicherweise Vertretbaren, sondern zu Josef K. Er ist sein Prozeß. Der Wächter beschreibt die Begleitumstände des Verfahrens, das er auch nur soweit kennt, wie es ihn, den Wächter, angeht: den Verkauf der Kleider des Angeklagten, dessen Erlös ihm und seinen Kollegen zusteht. Unbewußt präzisiert und vervollständigt K. Schritt für Schritt seine Verhaftung und gibt seinen Mutmaßungen mit deren Formulierung eine neue Wendung. Ihm wird nur gesagt: Sie sind doch verhaftet. Mehr passiert nicht, außer daß er sein Frühstück nicht bekommt, weil die Wächter es essen, und ihm seine Verhaftung angezeigt wird, ohne daß sie mit einem konkreten Zeichen einherginge.
K. kann sich weiter frei bewegen und geht von einem Zimmer ins andere. »Sie hätten in Ihrem Zimmer bleiben sollen!«, sagt Willem, einer der Wächter, zu ihm, ohne ihn aber an dessen Verlassen zu hindern. Sie, die Wächter, wissen, daß es ein großer, verfluchter Proceß ist, sie wissen das, weil es seiner ist, man hat sie geschickt, ihm das mitzuteilen. Sie sind auf der anderen Seite des Spiegels, an dem das Ereignis stattgefunden hat.
Josef K. verlangt Erklärungen zu äußerlichen Einzelheiten, die er für wesentlich hält, die jedoch nicht wesentlich zum Prozeß gehören. Dieser Prozeß ist nur dadurch Prozeß, daß er nicht verstanden wird. Josef K. kann ihn nicht verstehen, weil es seiner ist. Er selbst ist der Prozeß. Ihm ist es viel wichtiger, Klarheit über seine Lage zu bekommen; in Gegenwart dieser Leute konnte er aber nicht einmal nachdenken.
Mit jedem seiner Einfälle trägt er zu seiner Verhaftung bei. Nachdem er sich fertig angezogen hat, glaubt er im Geheimen, eine Beschleunigung des Ganzen damit erreicht zu haben, daß die Wächter vergessen hatten, ihn zum Bad zu zwingen.
Alles hängt von Josef K. ab, alles geht von ihm aus, seine Verhaftung verläuft ihm gemäß und besteht in einer fortschreitenden Anpassung. K. konstruiert seinen Prozeß unbewußt Punkt für Punkt, durch eine Projektion, in der er sich ständig voraus ist: Der Fall ist das Noch-nicht. Das Verfahren ist nun einmal eingeleitet und Sie werden alles zur richtigen Zeit erfahren. Der Wächter Willem weiß nichts, weiß aber, was K. nicht weiß.
Sämtliche realen oder juristischen Einzelheiten, die Josef K. anspricht, jeder Bezug zum Alltagsleben, alle Fragen, die er ganz normal stellen kann, heben sich im Lauf der Geschichte nach und nach auf, als entzöge K. sich selbst die Grundlagen seiner Verteidigung, als lieferte er sich selbst die Gründe für seine Verhaftung. All diese Einzelheiten und Bezüge zur äußeren, alltäglichen Welt – Ausweise und verschiedene Zertifikate, Anwälte und andere Anhaltspunkte – zielen am Kern vorbei.
Bekanntlich wird Josef K. an seinem dreißigsten Geburtstag überfallen, und das mitten im Frieden, in einem Rechtsstaat, in dem die Gesetze aufrecht bestanden. Diesen Gesetzen entsprechend will K. sich »legitimieren«: »Hier sind meine Legitimationspapiere.« »Was kümmern uns denn die?« rief nun schon der große Wächter, »Sie führen sich ärger auf als ein Kind. Was wollen Sie denn? Wollen Sie Ihren großen verfluchten Proceß dadurch zu einem raschen Ende bringen, daß Sie mit uns den Wächtern über Legitimation und Verhaftbefehl diskutieren?«
Josef K.s Prozeß kann nicht anhand »normaler« Bezugselemente eingeordnet werden, er kommt nicht von außen, weil es sein eigener ist.
Geltenden Gesetzen gemäß will K. am gewohnten Horizont der Tatsachen festhalten, doch die Ordnung, nach der er verhaftet wird, ist nicht von hüben oder drüben, sie offenbart sich einfach: Man erlebt, wie die Tatsache ausgelöst wird. Diese Verhaftung hat nichts »Kafkaeskes«. Das Initialereignis, das ein für allemal alles auslöst, eröffnet das Von-nun-an: Das Davor ist vergangen, das noch nicht Geschehene ist lastend gegenwärtig, es führt nur zu K. als dem, der er ist.
Die Wächter, wiewohl ganz unten in der Hierarchie, wissen genau, daß die Papiere nichts mit dem Prozeß zu tun haben und daß »die hohen Behörden, in deren Dienst wir stehn, ehe sie eine solche Verhaftung verfügen, sich sehr genau über die Gründe der Verhaftung und die Person des Verhafteten unterrichten. […] Unsere Behörde […] sucht doch nicht etwa die Schuld in der Bevölkerung, sondern wird wie es im Gesetz heißt von der Schuld angezogen und muß uns Wächter ausschicken. Das ist Gesetz. Wo gäbe es da einen Irrtum?« »Dieses Gesetz kenne ich nicht«, sagte K.
Und das ist seine Schuld: nicht das Gesetz nicht zu kennen, sondern nicht zu erkennen, daß es auf ihn angewandt wird, seine Schuld besteht darin, er zu sein. K. kann das Gesetz nicht kennen, weil er sich im Innern befindet. Das Gesetz ist, was er nicht kennt.
»Sieh Willem«, sagt Frank, der andere Wächter, »er gibt zu, er kenne das Gesetz nicht und behauptet gleichzeitig schuldlos zu sein.«
Josef K. ist seine Schuld, sein Fehler ist, daß er er ist. Worin fällt das Gesetz mit ihm zusammen? Das Gesetz ist nicht er, aber er ist in dem Gesetz.
K. selbst sucht im Kleiderkasten nach seinem guten Anzug, um vor den Aufseher im Zimmer nebenan zu treten. Dieser wird zu ihm sagen: »Ich kann Ihnen auch durchaus nicht sagen, daß Sie angeklagt sind oder vielmehr ich weiß nicht, ob Sie es sind. Sie sind verhaftet, das ist richtig, mehr weiß ich nicht.«
Es hat die Verhaftung gegeben, das ist alles, und von da an, nach diesem Donnerschlag der Verhaftung, begründet alles das Gesetz, künftig ist das Gesetz das, was eintritt. Deshalb sagt der Aufseher zu K.: »Denken Sie weniger an uns und an das, was mit Ihnen geschehen wird, denken Sie lieber mehr an sich. Und machen Sie keinen solchen Lärm mit dem Gefühl Ihrer Unschuld, es stört den nicht gerade schlechten Eindruck, den Sie im übrigen machen.«
K. kann an nichts anderes denken als an das, was ihm geschieht, und sich zugleich unschuldig fühlen, und eben das ist seine Verhaftung: »Wir raten Ihnen, zerstreuen Sie sich nicht durch nutzlose Gedanken, sondern sammeln Sie sich, es werden große Anforderungen an Sie gestellt werden«, sagt Willem, der Wächter, zu ihm. K. wird geladen, nicht zu dem, was er von sich weiß, seiner bürgerlichen Person im Zuständigkeitsbereich seiner Papiere, seiner Kollegen und seiner Umgebung, sondern zu jenem »Von-nun-an«, ohne Plan noch Ziel oder Ende. K. wird gemahnt – »mis en demeure«, wie das Französische so schön sagt. Es ist ihm auferlegt, doch nichts ist ihm zugeteilt: Es gibt weder Inhalt noch Botschaft (die Botschaft des kaiserlichen Boten ist eben die, daß er nicht ankommt). Was nach der Verhaftung passieren wird, passiert noch nicht, und was passiert, ist so, daß nichts anderes passiert als das, was passiert. Alles, was geschieht, hindert alles andere daran, an seiner Statt zu geschehen. Es gibt das Es-gibt.
Der geschriebene Satz schließt jeden anderen Satz aus, der geschrieben hätte werden können. Das Eigentümliche jedes Ereignisses ist der Ausschluß jedes anderen Ereignisses, das es hätte sein können. Das also macht den Prozeß aus: daß er so verläuft, wie er verläuft. Es gibt keinen anderen Prozeß als diesen. Wenn es einen Anfang gibt, dann danach.
Die Erzählung ›Ein Landarzt‹ ist wie eine andere Darstellung des Processes und dessen, was ihn nachträglich eröffnet. Der Arzt wird im Schneesturm zu einem Kranken gerufen, doch sein Pferd ist gestorben, und, siehe, da nimmt alles seinen Lauf. In dem seit Jahren ungenutzten Schweinestall stehen plötzlich zwei prächtige Pferde, er läßt sie anschirren und trifft gleich darauf bei seinem jungen Patienten ein: Der Junge ist krank. In seiner rechten Seite, in der Hüftengegend hat sich eine handtellergroße Wunde aufgetan. Rosa, in vielen Schattierungen, dunkel in der Tiefe, hellwerdend zu den Rändern, zartkörnig, mit ungleichmäßig sich aufsammelndem Blut … Würmer, an Stärke und Länge meinem kleinen Finger gleich, rosig aus eigenem und außerdem blutbespritzt, winden sich, im Innern der Wunde festgehalten, mit weißen Köpfchen, mit vielen Beinchen ans Licht …
Der Arzt hat seine Magd Rosa umsonst verlassen, er wird entkleidet und nackt in das Bett des Jungen gelegt. Nackt will er nach Hause fahren, zu Rosa, die dem Pferdeknecht ausgeliefert ist, dem Froste dieses unglückseligsten Zeitalters ausgesetzt, mit irdischem Wagen, unirdischen Pferden, treibe ich mich alter Mann umher. Mein Pelz hängt hinten am Wagen, ich kann ihn aber nicht erreichen, und keiner aus dem beweglichen Gesindel der Patienten rührt den Finger. Betrogen! Betrogen! Einmal dem Fehlläuten der Nachtglocke gefolgt – es ist niemals gutzumachen.
Das Initialereignis mündet hier, in diesem Augenblick, in seinen Ursprung: Schuldgefühl, Nacktheit, das rosa Geschlecht. Die Wunde und die Magd-Geliebte werden mit demselben Wort bezeichnet: rosa[3]. Rosa: Ist das die Schuld des Arztes? Wie auch immer, das Initialereignis betrifft wesentlich den Körper.[4] Ein schuldhaftes erotisches Entgegenkommen verknüpft sich mit der Lähmung des gebrandmarkten Körpers ›In der Strafkolonie‹.
Das Gesetz trifft nämlich nicht irgendwen, sondern nur den, den es betrifft, in den es sich einschreibt wie ›In der Strafkolonie‹.
Das Initialereignis zeitigt eine ebenso zufällige wie unvermeidliche, selbstverständliche wie unvorhersehbare Folge von Ereignissen. Josef K. kann sich trotz seiner Verhaftung frei bewegen, er kann hingehen, wohin er will, und tun, was er möchte. »Sie sind verhaftet, gewiß«, erklärt der Aufseher, »aber das soll Sie nicht hindern Ihren Beruf zu erfüllen. Sie sollen auch in Ihrer gewöhnlichen Lebensweise nicht gehindert sein.« »Dann ist das Verhaftetsein nicht sehr schlimm«, sagte K. und gieng nahe an den Aufseher heran. »Ich meinte es niemals anders«, sagte dieser.
Die Verhaftung ist nur ein Zeichen, eine Schwelle, wie Peter Handke sagen würde, eine plötzliche Verblüffung, nach der alles gleich bleibt und alles sich verändert hat. Das Initialereignis bringt zum Vorschein, was nicht war. Es ist Nichtmehr und Nochnicht zugleich. Nichts gibt es mehr von dem, was war, die Brücken zum Vorangegangenen sind von Anfang an radikal abgebrochen, es gibt ab da keinen Bezug mehr. Was bis dahin war, gibt es nicht mehr, und das, was unvermeidlich sein wird und doch jederzeit nicht sein hätte können, gibt es noch nicht. Der Anfang der Verhaftung ist von dem bestimmt, was geschehen wird und nirgends, in keiner Zukunft, existiert, aber in dem Maße existiert wie K. selbst. In Erinnerung an die Zukunft, die kam –; das Unvermeidliche offenbart sich erst danach.
Das Initialereignis ist fast keins, zu Beginn des Romans Das Schloß begibt sich der Landvermesser bloß dahin, wohin er bestellt worden ist (er hätte die Einladung auch ablehnen können). Dazu kommt, daß das Initialereignis sich ihm verweigert, als ob die Ankunft ihn nicht wollte: Es war spät abend als K. ankam. Das Dorf lag in tiefem Schnee. Vom Schloßberg war nichts zu sehn, Nebel und Finsternis umgaben ihn, auch nicht der schwächste Lichtschein deutete das große Schloß an. Lange stand K. auf der Holzbrücke die von der Landstraße zum Dorf führt und blickte in die scheinbare Leere empor.
Alles – und das ist das eigentliche Thema des Romans – scheint sich K. zu entziehen, sich ihm und seiner Beharrlichkeit zu verweigern, als ob die Ereignisse nicht stattfinden sollten, als ob der Auslöser vermieden werden müßte, als ob dem Auslösen der Ereignisse ein Widerstand entgegenstünde, als ob sie nicht passieren dürften. Was geschieht, geschieht nur aufgrund des Tuns desjenigen, dem es geschieht.
Tun und Personen sind so eng verbunden, daß man vom Einen nur durch das Andere erfährt. Das Initialereignis – die Ankunft – ist das, von dem an alles geschieht. Doch Kafkas Personen sind unaufhörlich wie unbewußt damit beschäftigt, dieses Ereignis aufzuheben, bis sie gewissermaßen von ihm absorbiert sind, es schließlich eingeholt und quasi gerechtfertigt haben (daher die Hinrichtung K.s am Ende des Processes). Alles läuft auf die Aufhebung des ersten Moments hinaus, als ob es darum ginge, zu erreichen, daß, was geschehen ist, nicht geschehen sei – ein verzweifelter Versuch, das Unumkehrbare umzukehren.
Das Initialereignis begründet jenes Streben, das nicht nachläßt, bis es nichts anderes mehr gibt als das, was die Personen betrifft. Dieses Streben zeigt sich erst, wenn es zu spät ist, es tritt erst nach seinem Objekt auf. Nichts ist dem Prozeß mehr äußerlich: K. kann nirgendwo anders sein, als er ist, und dort, wo er ist, ist der Prozeß.
Vom ersten auslösenden Moment an kann es nichts anderes mehr geben als weitermachen und streben ohne Ergebnis. Alles ist Weg, wie in der Erzählung ›Eine kaiserliche Botschaft‹: Der Kaiser – so heißt es – hat Dir, dem Einzelnen, dem jämmerlichen Untertanen, dem winzig vor der kaiserlichen Sonne in die fernste Ferne geflüchteten Schatten, gerade Dir hat der Kaiser von seinem Sterbebett aus eine Botschaft gesendet.
Doch diese Botschaft besteht darin, nicht überbracht zu werden: Obwohl alle Hindernisse vor dem Boten zurückweichen, ist er unaufhörlich unterwegs. Der Inhalt der Botschaft vermischt sich mit ihrer Sendung – Du aber sitzt an Deinem Fenster und erträumst sie Dir, wenn der Abend kommt –, ganz als wäre es das Wesen des Raums, daß er nicht zu durchmessen ist. Die Botschaft schicken und nicht erhalten ist ein und dasselbe. Man kann sie sich vorstellen, nicht in ihrem Inhalt, aber in ihrer Bestimmung.
Das Initialereignis ist der Schlag ans Hoftor[5]