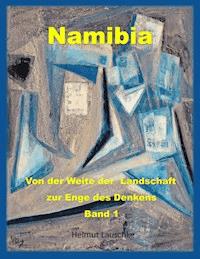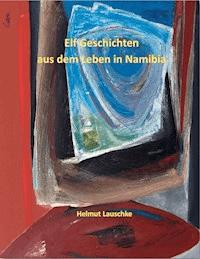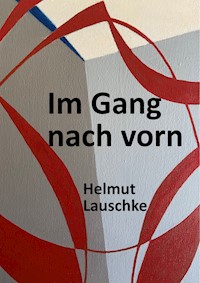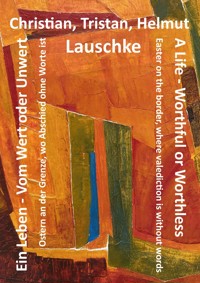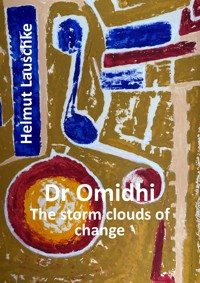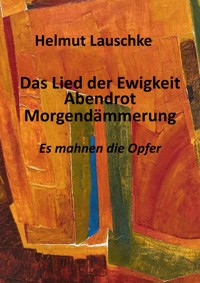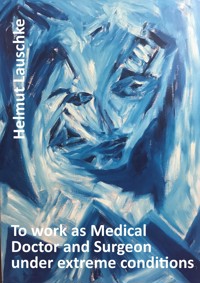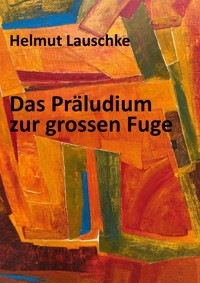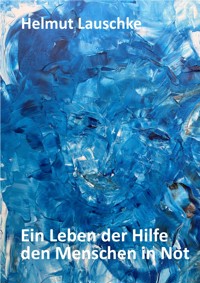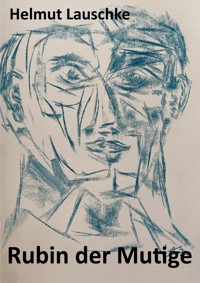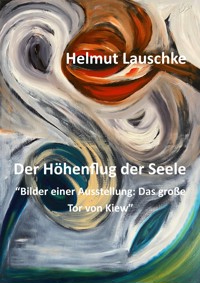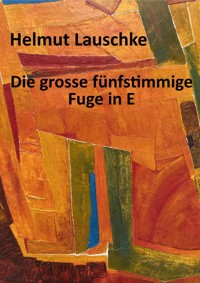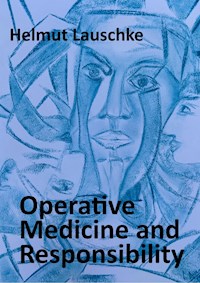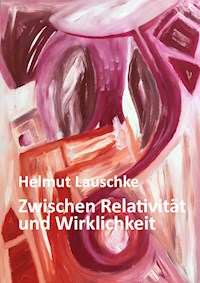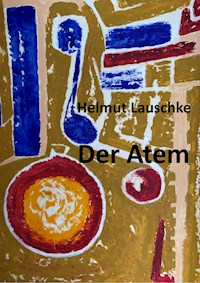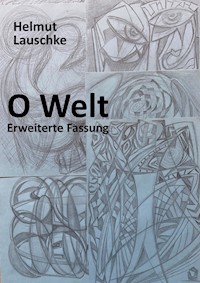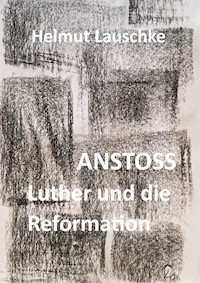
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
In Luthers Schrift 'Von der Freiheit eines Christenmenschen' (1520) schränkte er die Freiheit auf die Beziehung des Individuums zu Gott ein. Im irdischen Leben habe dagegen jedermann, ohne aufzubegehren, an seinem Platz in der ständischen Ordnung zu verharren. Für Luther gab es prinzipiell zwei von Gott geführte, gottgewollte Regimente: Das weltliche Regiment (civitas terrena) wurde durch die Agenturen und Administrationen ausgeführt; ihre Zuständigkeit war die Einhaltung von Recht und Ordnung. Das geistliche Regiment (civitas dei) wurde durch das Wort Gottes geführt. Luthers Auffassung fand ihren Ursprung in der Theologie des Augustinus, er sah die Machtstellung Gottes geteilt, so trennte Augustinus diese in eben die "civitas dei", das Reich Gottes und "civitas terrena", das weltliche Reich. Die Schrift 'Von der babylonischen Gefangenschaft der Kirche' (1520) reduziert die sieben katholischen Sakramente auf jene drei, die Jesus im NT selbst eingesetzt habe: Taufe, Abendmahl und Buße (Beichte). Er betonte in der Schrift die fundamentalen Bestandteile des Sakraments: 1) Das Zeichen, 2) die Bedeutung und 3) den Glauben. Gerade dem Glauben maß Luther die größte Bedeutung zu, womit er dem katholischen Konzept des ex opere operato die Signifikanz absprach. Er hingegen betonte die Wichtigkeit des Glaubenden als des Subjekts und somit das Konzept des opus operantis. Bahnbrechend war vor allem die theologische Begründung: Jesu eigenes, gepredigtes Wort vermittle das Heil. Die Sakramente veranschaulichten seine Zusage und dienten ihrer Vergewisserung, fügten ihr aber nichts hinzu. Indem Luther die menschliche Antwort auf Gottes Wort radikalisierte, wurde ihm Gottes Gerechtigkeit selbst zum Problem. Obwohl er alle damaligen theologischen Denkschulen genau kannte, legte er die Bibel in seiner ersten Psalmenvorlesung (1512/13) fast ohne scholastische Begriffe aus und fasste den Literalsinn des Bibeltextes, der sich als Geist selbst mitteilt, als Hinweis auf Christus auf.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 150
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Helmut Lauschke
ANSTOSS
Luther und die Reformation - Von der Ebenbildlichkeit - "O meine Sünde!"
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Ps. 1: Die Entscheidung ist fällig
Ps. 2: Sieg über den Frevler
Ps. 8: Seine Größe (ein Psalm Davids)
Ebenso finden sich anthropologische Aussagen über den christlichen Menschen als Ebenbild Gottes oder Christi, nämlich an den folgenden Stellen:
Ps. 4: Gespräch am Abend (ein Psalm Davids)
Ps. 9: Dank (ein Psalm Davids)
Wirkungsgeschichte im Christentum
Betrachtung Gottes durch die Spuren in der Schöpfung
Ps. 10: Wo bleibt die Hilfe
Ursprung des freien Willens
Reformation
Ps. 12: Klage über die Macht des Bösen (ein Psalm Davids)
Das Zweite Vatikanische Konzil
Kritik und Kontroversen
Ps. 11: Vertrauen (ein Psalm Davids)
Grundlage der Menschenwürde
Von der Freiheit eines Christenmenschen (Luther, Wittenberg 1520)
Ps. 15: Das, was gilt (ein Psalm Davids)
Der Mönch als Anwalt der Betrogenen
Ps. 17: Gebet Davids
Reformatorische Wende
Ablass, 95 Thesen (1517) und Heidelberger Disputation (1518)
Ps. 20: Fürbitte in Kriegsnot (ein Psalm Davids)
Romreise
Aufgaben in Wittenberg
Ps. 21: Danklied (ein Psalm Davids)
Römischer Prozess, Augsburger Reichstag und Leipziger Disputation (1518/19)
Ps. 22: Leidenspsalm (von David)
Reichstag zu Worms, Reichsacht und vorgetäuschte Gefangennahme (1521)
Wartburgzeit (1521-22)
Ps. 25: Gebet um Vergebung (ein Psalm Davids)
Luthers Position im Bauernkrieg (1524-25)
Heirat mit Katharina von Bora (1525)
Auseinandersetzung mit Erasmus von Rotterdam (1524-25)
Konsolidierung der Reformation
Abendmahlsstreit und das Marburger Religionsgespräch (1529)
Reichstag zu Augsburg (1530)
Wittenberger Konkordie (1536)
Schmalkaldener Bundestag (1537)
Ps. 27: Befestigung im Gottvertrauen (ein Psalm Davids)
Luthers Tod
Theologie
Ps. 51: Bußgebet (ein Psalm Davids, als der Prophet Nathan zu ihm kam)
Verhältnis zur Täuferbewegung
Luthers sprachprägende Bedeutung
Aus der Lutherforschung
Epilog
Gott- bzw. Christusebenbildlichkeit des Menschen
Impressum neobooks
Ps. 1: Die Entscheidung ist fällig
Luther und die Reformation
Zur Ebenbildlichkeit – “O meine Sünde!”
Dem sei Glück, der treu in seiner Wahrheit steht mit dem Herzen und den Sinnen die Schöpfung achtet, der sich kritisch für den Weg entscheidet, ihn mutig zwischen links und rechts durchschreitet.
Es bleibt der Mensch, der es nicht bereut, wenn er der Verführung anderer Menschen widersteht, der es mit dem Schmerze lernt, den Spott zu ertragen, denn der Frevler wirft selbst Gott auf alte Wagen.
Steht auf!, Leute, habt Mut und Stärke, setzt die Füße zusammen und stemmt hoch die Werke. Wenn ihr in die Zerrissenheit der Völker seht, dann hört ihr das Stöhnen nach dem Frevel ihrer Taten.
Fangt an und nehmt euch der Freude seiner Kinder an, dann empfangt auch ihr das Wort seiner Weisung. Wahrlich, die Raumtiefe seiner Rede ist unergründlich, doch auf ihr sollt ihr euer Leben gründen.
Seine Quellen des Wassers werden nicht enden, eure Wurzeln reichen tief in die Erde hinein. Stärker werden eure Körper wachsen, sie werden fruchtbar sein zu eurer Zeit.
Was dem Schöpfer da gelingt, wenn er die großen und kleinen Dinge gestaltet, eure Augen werden es sehen und sich wundern, wenn die Ströme fließen und Meere füllen.
Sehen werdet ihr, wie sich die Frevler verheben, die blind und taub für seine Botschaft sind, die mit Arroganz und faulen Lügen kommen, sich dann selbst in die Vergessenheit zerstäuben.
Scheinblüten bleiben fruchtlos, sind bedeutungslos, denn den Kelchen dieser Blüten bleibt das Glück versagt. Wenn nichts gerade ist, brechen schnell die Beine, der Faulgeruch umweht sie schon zu Lebenszeit.
Alles ist geschieden, wie es die Wahrheit will. Da fällt vom Beständigen das Unbeständige ab, der Windstoß trennt schnell den Spreu vom Weizen; schnell trennt sich der Redliche vom Schwätzer.
Im Sturz der Blutbäche haben sich Völker geirrt, wenn sich die Meere mit Leidenstränen füllen. Bitter schmeckt das Tränensalz bis in unsere Tage, wenn mit dem ersten Licht der neue Tag beginnt.
Das alles ist dem Schöpfer längst bekannt, wie sich Menschen in der Schöpfung benehmen. Darum ist’s gut, sich für den geraden Weg zu entscheiden und ihn mutig zwischen links und rechts zu durchschreiten.
Im 2. Korintherbrief (2 Kor 4,4): Den Ungläubigen, denen der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat, dass sie nicht sehen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi, welcher ist das Ebenbild Gottes.
Im Verlauf der Wirkungsgeschichte entwickelten sich viele Deutungsansätze. Eine Schwierigkeitchristlicher Theologie lag darin, die Lehre der Gottebenbildlichkeit mit der des menschlichen Sündenfalls zu verbinden. So wurde in der theologischen Tradition seit der Patristik von einer verlorengegangenen Ähnlichkeit mit Gott, zugleich aber vorhandenen, innerseelischen Gottebenbildlichkeit ausgegangen. In der Reformation hingegen wurde die Gottebenbildlichkeit als infolge des Sündenfalls „korrumpiert“ betrachtet. Seit dem Renaissance-Humanismus wird bis heute die Gottebenbildlichkeit häufig als theologische Begründung der Menschenwürde betrachtet. In der Moderne kam es infolge der Säkularisierung zu einem „Abstieg“ der Vorstellung der Gottebenbildlichkeit.
Die moderne Theologie geht aufgrund der Verwandtschaft der göttlichen Ebenbildlichkeit im Menschen mit dem „elterlichen“ Gott von einer Wesensaussage aus. Die Gottebenbildlichkeit befähige den Menschen, über die Natur zu herrschen, siehe Dominium terrae.
Heftige Kritik erfuhr, in Auflehnung gegen die kirchlichen Erklärungsmodelle, die Gottebenbildlichkeit als erstes durch Ludwig Feuerbach. Er vertrat im Rahmen seiner Projektionstheoriedie Ansicht, der Mensch schaffe sich einen Gottnach seinemEbenbild. Im 20. Jahrhundert wurde von einigenNaturalistendie Ursache für die Naturausbeutung in dem eng mit der Gottebenbildlichkeit verbundenen Herrschaftsauftrag gesehen. Demgegenüber steht eine Aussage der Theologie, wonach sich der Mensch überhaupt keine Fantasie von einem Gott schaffen könne, ohne selbst, durch seine innere Gottebenbildlichkeit, Anteil am „elterlichen“ Gott zu haben.
In Mesopotamien :In akkadischen Texten ist die Vorstellung einer Gottebenbildlichkeit des Königs mehrfach belegt. Der älteste Beleg dafür findet sich in der mittelassyrischen Siegeshymne auf Tukulti-Ninurta I. (1244–1208 v. Chr.). Diese bezeichnet den König als „bleibendes Abbild des Gottes Enlils“. Die meisten Belege aber stammen aus der neuassyrischen Zeit, aus dem 7. Jahrhundert v. Chr.
Im Gilgamesch-Eposvollzieht sich die Erschaffung des Menschen Enkidu folgendermaßen: Die Muttergöttin Aruru bildet in ihrem Herzen ein Ebenbild des Gottes Anu und zeichnet dieses dann in Lehm. Es ist das Geschöpf also das Ebenbild einer Gottheit, nach welcher er geschaffen wurde.
In Ägypten: Im Alten Ägypten wird besonders der König sowohl als Gottes Sohnals auch als Gottes Abbild bezeichnet. Die vielen verschiedenen Begriffe, die sich dabei für „Abbildung“ finden lassen, können in zwei Hauptgruppen eingeteilt werden.
Der König als konkretes Abbild Gottes: Zum einen wird der König als konkretes Bild Gottes, sein passiver Repräsentant und Herrschaftsausüber bezeichnet. Für dieses konkrete Abbild stehen die Worte twt.w,ḥntj und šzp. Dabei bezeichnen die Wörter in ihrem Kontext jeweils ähnliche Sachverhalte. Diese Wörter können einerseits Königsstatuen in Tempeln, Statuen, die bei Prozessionen getragen und verehrt wurden, Statuen von Privatpersonen im Tempel sowie Grabstatuen von Privatpersonen darstellen. Die durch die Statue dargestellte Person wird am Ort der Statue gegenwärtig.So heißt es auf einer in Nubien aufgestellten Statue Ramses II.:
Andererseits wird auch der König selbst als „Abbildung Gottes“ bezeichnet. Der früheste Beleg hierfür findet sich in der Zweiten Zwischenzeit, ca. 1648–1550 v. Chr. Dabei wird der König als Abbild der Götter Re, Aton, Amun und Chepre bezeichnet. Alle diese Götter sind eine Form des höchsten Sonnengottes. Auch der erste Bestandteil des Königsnamens Tutanchamun, twt, kann vontwt.t abgeleitet werden, was für die Gottebenbildlichkeit des Königs steht.
Das genannte Verhältnis einer Statue zu dem Abgebildeten wird auf das Verhältnis des Königs zum Gott übertragen: Obwohl der Gott „fleischlich“ nicht anwesend ist, ist er durch die Abbildung gegenwärtig: Es ist also der Gott im König auf Erden gegenwärtig.
Die Funktion dieser Gottebenbildlichkeit besteht in der Herrschaftsausübung des Königs auf Erden. Dieser göttliche Auftrag zur Herrschaftsausübung kommt beispielsweise an einer Stelle Amenophis' III. zum Ausdruck. Dort spricht der Gott Amun-Re-Kamutef zum König:
„… Du bewirtschaftest es [das Land] für mich aus liebendem Herzen. Denn du bist mein geliebter Sohn, der aus meinem Leibe hervorgegangen ist, Mein Abbild, das ich auf Erden gestellt habe.“
Ein weiterer Begriff für Bild, sšm.v betont die Verborgenheit Gottes. Dabei wird wiederum der König als „lebendes sšm.w-Bild des Herrn der Götter“ bezeichnet. Der König vollzieht seine Regierungsgeschäfte in der Abgeschiedenheit des Palastes. Gleichzeitig erteilt der König als sšm.w-Bild Orakel, wie es in der Lobrede eines Königs heißt:
„Ich bin der Herold deines Wortes, das sšm.w-Bild deines Orakels, das aus dem Munde deiner Majestät hervorkommt.“
Als Gott ähnlich: Weiterhin wird der Mensch und besonders der König als Gott in seinem Handeln ähnlich betrachtet. So bezeichnet eine weitere Reihe von Wörtern, znn, mi.ti, mi.tt und ti.t den König weniger als konkretes Bild des Gottes, sondern mehr als dem Gott in seinem Wesen und Handeln ähnlich. Als Gottähnlicher besitzt er die nötige Voraussetzung dafür, ein Abbild Gottes zu sein. Dabei kann auch ein Privatmann als Gottähnlicher bezeichnet werden. Allerdings besteht ein graduell sehr starker Unterschied zwischen König und Privatmann: Der König ragt als dem Sonnengott Wesensähnlicher unter allen Menschen hervor.
Ps. 2: Sieg über den Frevler
Unvermindert toben sie, die Feinde auf dem Felde der Falschheit und des Tötens. Unstillbar ist ihre Gier nach großer Beute, da überziehen sie das Land mit Leid und Not.
Frevelzungen sprechen viele Sprachen, doch ihre Worte haben die Falschheit eingehüllt. Ihr merkt’s, wenn die Silbe stürzt, am Boden klebt, weil sich der irrige Gigant im Hochmut verhebt.
Wenn Menschenhand alte Bande zerreißt, sind Urteile wertlos, so lange Richter bestechlich sind. Denn Menschen bedienen sich des Unrechts und der Gewalt, sie quälen Völker, stürzen sie in Hunger und Elend.
Da geht der Schmerz der Völker ins Morgenrot, schwer wird es dem Tag, die Hürden der Willkür zu brechen. Ihr werdet auf die Mauern steigen und sie niederreißen, dann mit ausgeworfenen Seilen die Gefangenen befrein.
Die Falschen und ihre Verräter sollen den Zorn spüren, der mit der Gerechtigkeit über sie kommt. Sie werden zittern und vergehn, wie alles Aufgezwungene vergeht, wenn Völker ihre Freiheitshelden auf den Schultern tragen.
Denn das Wort des Herrn gilt für alle, die Macht seiner Sprache fährt allen durch Mark und Bein. In ihre Schwächen werden sie versinken, die da trotzen, da ist der Trennstrich zwischen Gut und Böse dick gezogen.
Es bleibt: der Sieg des Herrn kommt über die Frevler gegen ihre Besserwisserei und all das kluge Geschwätz. Reihenweise werden sie in Ohnmacht fallen, wenn er mit seinem Zepter durch die Völker fährt.
Jeder mit Fleiß und seiner Geschichte ist ihm unterworfen, denn er wird fragen und richten, zu verbergen gibt es nichts. Die Treuen werden es sein, zu denen er sprechen wird: Du bist mein Sohn, selber habe ich dich gezeugt.
So kehren in die Welt des Hohns Trost und Liebe ein, wenn die Gesichter vors Gericht treten, und der Weltenrichter spricht: Bitte mich, so gebe ich dir die Völker und die Ränder der Erde dir als Hufe.
Als Menschenhände zitterten, griff ich fest den Stock, ich sagte: zerschelle die Frevler mit dem eisernen Stab. Zerscherbe die Völker des Frevels wie ein Töpfernis! Da sperrten sie ihre Mäuler auf und verstummten.
So fangt an und übt die Vernunft bei Tageslicht. Beginnt jetzt, die ihr die Macht über die Völker habt und sie richtet, denn ihre Opfer waren viel zu groß. Bedenkt: Auch ihr mit dem Sagen werdet gerichtet werden.
In der hebräischen Bibel finden sich Aussagen zur Gottebenbildlichkeit an zentraler Stelle, nämlich in der priesterschriftlichen Schöpfungserzählung an den Stellen
Gen 1,26f EU: Dann sprach Gott: Lasst uns Menschen machen als unser Bild, uns ähnlich! Sie sollen walten über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels, über das Vieh, über die ganze Erde und über alle Kriechtiere, die auf der Erde kriechen. Gott erschuf den Menschen als sein Bild, als Bild Gottes erschuf er ihn. Männlich und weiblich erschuf er sie.
Gen 5,1 EU: Dies ist das Buch der Geschlechterfolge Adams: Am Tag, da Gott den Menschen erschuf, machte er ihn Gott ähnlich.
Gen 9,6 EU: Wer Blut eines Menschen vergießt, um dieses Menschen willen wird auch sein Blut vergossen. Denn als Bild Gottes hat er den Menschen gemacht.
Hinzu kommt nochder 8. Psalm (Ps 8,6 EU):
Du hast ihn nur wenig geringer gemacht als Gott, du hast ihn gekrönt mit Pracht und Herrlichkeit.
Ps. 8: Seine Größe (ein Psalm Davids)
Herr, hoch stehst du über den irdischen Herrschern, du bringst den Tag und nimmst ihn wieder weg. Du webst die Dinge zu- und ineinander, groß steht dein Name über allem Erdenreich.
Deinem Namen gilt die Ehre im großen Wettgesang aus den Mündern der Kinder und Neugeborenen. Herrlich hast du die Schutzmacht gegründet mit kraftvollen Schwingen hebt der Adler zu den Höhen ab.
Du hast den Menschen wenig niedriger gemacht denn Gott, und mit Ehre und Schmuck hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrn gemacht über deiner Hände Werk: alles hast du unter seine Füße getan.
Wie klein fühl ich mich unter diesen Himmeln. Was ist am Menschen, dass du seines gedenkst? Was ist der Adamssohn, dass du ihm zuordnest in der unfassbaren Größe deines Universums?
Eines gabst du dem Menschen nicht, auch wenn du ihn zum Ebenbild geschaffen hast, dass er auf Erden göttlich ist, sich auf Erden für einen Gott halten lässt.
Du hast ihm zwar aufgegeben, deine Werke mit Weisheit zu verwalten, damit hast du den Menschen mit Ehre gekrönt. Aber den Personenkult hast du ihm untersagt.
Dem Menschen hast du die Werke gegeben. er soll sie achten und pflegen, dass dein Name unsterblich bleibt. Groß stehst du über den Himmeln dieser Welt.
Literarischer Kontext: Gen 1 EU: Erschaffung des Menschen und Herrschaft des Menschen über die Tiere
Gen 5 EU: Erinnerung an den Tag, als Gott den Menschen schuf
Gen 9 EU: Erschaffung des Menschen durch Gott als Begründung für das Mordverbot
Besonders die Stelle Gen 1,26f EU stellt vor das lexikalische Problem der Bedeutung der Substantive ṣäläm und demût. Während ṣäläm eine konkrete plastische Nachbildung – ein Porträt, ein Standbild oder eine Statue – meint (z. B. 2 Kön 11,18 EU), bedeutet demût eher „Gleichheit“, auch wenn es als Ausdruck für Form und Äußeres verwendet werden kann (z. B. 2 Chr 4,3 EU). Letztlich sind beide Wörter fast bedeutungsgleich. Dabei sind beide Begriffe mit Präpositionen versehen, nämlich austauschbar mit be oder mit ke (Gen 1,26 OT und 5,1-3 OT). Beide zielen auf einen Vergleich. Die vorfindliche Lehre ist deshalb sprachlich kaum systematisierbar.
Auffällig ist weiterhin die Verwendung des Plurals „Lasset uns …“ (נעשה אדם). Die heutige Exegese sieht hier drei Möglichkeiten:
Die „himmlischen Wesen JHWHs Hofstaat“ werden mit einbezogen.
Es handelt sich um einen Hoheitsplural – denPluralis Majestatis.
Ein Pluralis Deliberationis ist gemeint, also ein Plural der Absichtsbekundung in der„Art der Selbstaufforderung“.
Im Neuen Testament: Neben den Schriftbelegen im Alten Testament finden sich für das Christentum relevante Aussagen im Neuen Testament. Dieses bezieht Aussagen über die Gottebenbildlichkeit – hierfür wird der Begriff εἰκών (eikōn, Abbild) verwendet – besonders auf Jesus Christus, außerdem wird der Begriff auf die Eschatologie ausgedehnt.
Die Textbelege lassen sich dabei in drei Typen einteilen.]
Christus als Ebenbild Gottes : Solche christologischen Aussagen über Christus als das Bild Gottes finden sich an den folgenden Stellen:
Im 2. Korintherbrief (2 Kor 4,4 EU): Den Ungläubigen, denen der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat, dass sie nicht sehen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi, welcher ist das Ebenbild Gottes.
2 Kor 4,5-6: Denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Jesus Christus, dass er sei der Herr, wir aber eure Knechte um Jesu willen. (6) Denn Gott, der da hieß das Licht aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass durch uns entstünde die Erleuchtung zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christri.
Im Kolosserbrief (Kol 1,15 EU): Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung (vor allen Kreaturen).
Kol 1, 16-20: Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und Unsichtbare, es eien Throne oder Herrschaften oder Reiche oder Gewalten: es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. (17) Und er ist vor allem, und es besteht alles in ihm. (18) Und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde: er, der der Anfang ist, der Erstgeborene von den Toten, auf dass er in allen Dingen der Erste sein. (19) Denn es ist Gottes Wohlgefallen gewesen, dass in ihm alle Fülle wohnen sollte (20) und alles durch ihn versöhnt würde mit Gott, es sei auf Erden oder im Himmel, dadurch das ser Frieden machte durch das Blut an seinem Kreuz.
Im Hebräerbrief (Hebr 1,2-3 EU): (2) … hat er (Gott) in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn, Ihn hat Gott gesetzt zum Erben über alles; durch ihn hat er auch die Welt gemacht. (3) Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens und trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort und hat vollbracht die Reinigung von (unseren) den Sünden und hat sich gesetzt zur (zu der) Rechten der Majestät in der Höhe.
Hebr 1,4-6:(4) … und ist so viel höher geworden als die Engel, so viel erhabener der Name ist, den er vor ihnen ererbt hat. (5) Denn zu welchem Engel hat Gott jemals gesagt (Ps. 2.7): “Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt”; und abermals (2. Sam. 7.14): “Ich werde sein Vater sein, und er wird mein Sohn sein”. (6) Und wiederum, da er den Erstgeborenen in die Welt einführt, spricht er (Ps. 97.7): “Und es sollen ihn alle Engel Gottes anbeten.”
Ebenso finden sich anthropologische Aussagen über den christlichen Menschen als Ebenbild Gottes oder Christi, nämlich an den folgenden Stellen:
Im Ersten Korintherbrief (1 Kor 15,49 EU): Wie wir nach dem Bild des Irdischen gestaltet wurden, so werden wir auch nach dem Bild des Himmlischen gestaltet werden.
Im Zweiten Korintherbrief (2 Kor 3,18 EU): Wir alle spiegeln mit enthülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wider und werden so in sein eigenes Bild verwandelt, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, durch den Geist des Herrn.
Im Kolosserbrief (Kol 3,10 EU