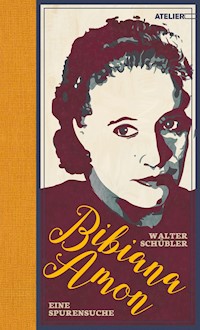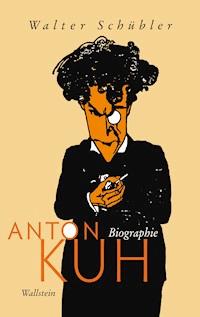
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Wallstein Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Ein mitreißendes Porträt des bissigen Journalisten und launigen Bohemiens Anton Kuh. Walter Schüblers Biographie porträtiert den extravaganten Lebenskünstler Anton Kuh in all seinen Facetten: den streitbaren Publizisten, der die laufenden Wiener und Berliner Ereignisse mit polemischer Verve glossierte; den hellwachen Chronisten der 1910er, 1920er und 1930er Jahre; den bekennenden »Linksler«, der in der Auseinandersetzung mit den Nazis Kopf und Kragen riskierte; den »Gegenteils-Fex«, der sich einen Spaß daraus machte, Karl Kraus über Jahre zu frotzeln; den Bohemien, der - programmatisch taktlos - keine Gelegenheit ausließ zu provozieren; den aufgekratzten Neurastheniker, der geradezu selbstmörderisch lebte; den fulminanten Stegreif-Redner, der seine Gedankengänge heißlaufen ließ und damit sein Publikum zu Beifallsstürmen hinriss. Diese erste Biographie des »Sprechstellers« rekonstruiert auch dessen Hauptwerk - die Stegreif-Reden - und wirft alles über den Haufen, was an Gerüchten über die vermeintliche Wiener »Lokalgröße« immer noch kursiert.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 970
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Walter Schübler
Anton Kuh
Biographie
Veröffentlicht mit Unterstützung
des Austrian Science Fund (FWF),
Einzelprojektförderung P26346-G23
und Publikationsförderung PUB 540-G24
»Zu der unvergeßlich bunten, zum Teil leider schon verblichenen Menschenlandschaft, die der Sonnenuntergang der europäischen Kultur gerade noch bestrahlte, gehör[t] u. a. […] Anton Kuh –«[1]
Max Reinhardt
»Ulrich erinnerte sich einer ähnlichen Erfahrung aus seiner Militärzeit: Die Eskadron reitet in Zweierreihen, und man läßt ›Befehl weitersagen‹ üben, wobei ein leise gesprochener Befehl von Mann zu Mann weitergegeben wird; befiehlt man nun vorne ›Der Wachtmeister soll vorreiten‹, so kommt hinten heraus: ›Acht Reiter sollen sofort erschossen werden‹ oder so ähnlich. Auf die gleiche Weise entsteht auch Weltgeschichte.«[2]
Robert Musil
– Auf die gleiche Weise entstand auch das »Nachleben« Anton Kuhs.
Inhalt
Vorbemerkung
Personsbeschreibung
»Eine wahre Wedekind-Tragödie« – Wie er wurde
1909 – 1917
»Sodbrennen im Artisten-Café« – Der Sprechsteller
1917 – 1919
»Polemische Lassos« – Der »apostolische Denunzius« K. Kraus
1919 – 1920
Reinstes Deutsch vs. beste Mehlspeis – Anton Kuhs »Prager Herkunft«
»Mit den Waffen von Otto Gross und Sigmund Freud ins jüdische Schlafzimmer« – »Juden und Deutsche«
Wie der Herr, so ’s G’scher – »Kraushysterische Peter Zapfels«
1921
Beim »Personal der Welt« – Etabliert
1921 – 1922
»Akustischer Kehraus einiger Nachmittage« – »Von Goethe abwärts«
»Die Druckerschwärze ist noch frisch« – »Börne, der Zeitgenosse«
1923 – 1924
»Der Rest ist Speiben« – Theater-Kritiker
1924 – 1925
»Eine Unternehmung wie jede andere« – »Die Stunde«
»An seinen Früchteln sollt ihr ihn erkennen« – »Der Affe Zarathustras«
1925 – 1926
»Wehe dem, der das letzte Wort hat« oder: Außer Spesen nichts gewesen – Prozeß K. Kraus vs. Anton Kuh
1926
»In jeder Beziehung die freieste Stadt der Welt« – Berlin
Eleve am Theater in der Josefstadt – Als Kritiker Gunn in »Fannys erstes Stück«
»Herzlich grüßt Anton Kuh!« – Trittbrettfahrer einer aktennotorischen Fehde
1926
Ethos und »Ethospetetos« – Anton Kuh vs. Karl Kraus
1926
In einem Gefühl »unterirdischen Corpsgeistes« – Bewerbung bei Maximilian Harden
1927
»Verpatzter Äther« – Im Radio
Tonfilmdrama »A conto« – Drehbuchautor
1928 – 1930
A. E. I. O. U.? – L. M. I. A.! – »Der unsterbliche Österreicher«
1930
»Wenn der Literat den Raufbold spielt …« – Anton Kuh vs. Arnolt Bronnen
Nestroy, verpreußt – Anton Kuhs »Lumpacivagabundus«-Bearbeitung
1931
Abbildungen
»Kuhrioses« – In der Anekdote
1931 – 1932
»Bis aufs psychologische Beuschel« – »Physiognomik« und Physiognomik
»Einen Knobel-Penez …« oder »Ein Bier für Herrn Kraus!«? – Das Geheimnis hinter dem roten Vorhang
1932 – 1933
»Weit? … Von wo?« – Der »Emigrant in Permanenz« im Exil
1933 – 1936
»Ein Klavier auf dem Wintergletscher?!« – »The Robber Symphony«
1936 – 1938
»Undesired expert« in den USA – New York, in Etappen
1938 – 1941
Anhang
Anmerkungen
Chronologie
Dank
Siglen und Abkürzungen
Quellen und Literatur
Bildnachweise
Personen- und Werkregister
Vorbemerkung
Dies Buch schmeckt, wo möglich, »nach den Quellen«.[1] Sie geben »den Augen und Sinnen sozusagen den Kammerton A«.[2] Der sprachliche Eigenwert des Quellenmaterials vermittelt eine Ahnung von der Zeit, aus der es stammt, von der »akustischen Atmosphäre«, in der Anton Kuh sich bewegte.
Auf den »O-Ton« zu setzen, wenn Kuh am Wort ist, lag umso näher: Ihn zu referieren ist nicht annähernd so unterhaltsam wie ihn zu zitieren.[a]
Die Exkurse sind Umwege, die die Ortskenntnis erhöhen.
Zur Methodik nur so viel: Die Kapitel »›Kuhrioses‹ – In der Anekdote« und »›Einen Knobel-Penez …‹ oder ›Ein Bier für Herrn Kraus!‹?« sind hier auch programmatisch. Gelegentlich lasse ich ohnehin ins Getriebe blicken – hoffend, daß dabei keine Verstimmung aufkommt.[3]
Dies Buch leistet auch die Rekonstruktion von Kuhs Hauptwerk: seiner Stegreif-Reden. Sie sind die Wegmarken.
________
a Den Nachweisen von Texten Anton Kuhs wird in eckigen Klammern die in den »Werken« (Göttingen 2016) dafür jeweils vergebene Nummer beigefügt; sie sind dort leichter zu finden als an den Erstdruckorten. Innerhalb von Zitaten aufgehobene Absätze werden mit einem Schrägstrich markiert.
Personsbeschreibung
Größe: 1.74. Statur: »gracil«[1]. Gesicht: länglich. Haare: schwarz. Augen: braun. Mund: »normal«. Nase: »normal«. Besondere Kennzeichen: keine.[2]
Hat einen »leicht trippelnden, zwar etwas hüftweichen und gezierten, aber durchaus flotten Gang«.[3]
Trägt seit seinem 19. Lebensjahr im linken Auge ein Monokel – Durchmesser: 42 Millimeter, minus 3,5 Dioptrien –, das sich nicht »preziösem Geckentum«[4] oder schmissigem Kommißgeist verdankt, sondern – ganz konkret – Alleinstellungsmerkmal ist und das nervöse Zwinkern des Auges nicht gänzlich verbergen kann.
Mauschelt klangreich exzessiv, um »das latente Jüdeln um [ihn] herum in ein eklatantes zu verwandeln«.[5] Gegen jede Konjunktur und inmitten eines virulenten Antisemitismus trägt er sein Judentum auch sprachlich zur Schau: Er mauschelt – Punktum! Spricht also ungeniert – ungeniert von der Diffamierungsabsicht, die mit diesem antisemitischen Kampfwort verbunden ist – und ohne distanzierende Anführungszeichen ein Deutsch mit stark jiddischem Akzent. Jede sprachliche Parodie hebt darauf ab: »Die Rolle des katholischen Priesters in ›Maria Stuart‹ spielt Anton Kuh. Do hätt’ sich kaum e Geeigneterer finden lossn!«[6] – »In dieser total verbocheten Welt, die das Strahlende in adäquat benebbichter Art in den Staub zu ziehen wie das Erhabene zu schwärzen liebt, sehne ich den Augenblick herbei, wo, von der Parteien Haß und Gunst verwirrt, das Bild meines, und wenn Sie zerspringen, Charakters schon endlich in der von Trotteln über dieselben und für dieselben gemachten Literaturgeschichte schwankte.«[7]
Trägt bestes englisches Tuch, auf Maß gearbeitet vom Nobelschneider Kniže.
Starker Raucher.
Bekennender Neurastheniker, einer jener Nervösen mithin, die als Phänomen der modernen, »beschleunigten«, überreizten Jahrhundertwende-Großstadtkultur beschrieben wurden.[8] Hält sich auf »die Nervosität als Witterungssprache zwischen den Menschen« durchaus etwas zugute, wenn er sie mit der »robuste[n] Geschlossenheit unnervöser Menschen« vergleicht.[9] Die Kehrseite dieses »unglückseligen Danaergeschenks« eines übersensiblen Temperaments: Die auf Permanenz gestellte Aufgekratztheit nagt an der Substanz. Kuraufenthalte schon in jungen Jahren können das Tempo, in dem die Kerze von beiden Enden abbrennt, nicht mindern.
Hegt seine Idiosynkrasien, namentlich jene gegen die »Feschität« in all ihren Erscheinungen:[10] gegen die schmissige Offiziersschneid; die Kreuzfidelität der Operette; die kecke, sich kühn wähnende Andersmeinung, die sich, genau besehen, nur triumphanter Unbildung schuldet; die fixfingerig »flotte« Schreibe, die schlicht oberflächlich ist; die glatte, ganz auf up-to-date gebürstete Versiertheit; die blickheischende Pose der Ungezwungenheit; den »Feschak«, der mit neckischen Accessoires »Charakter« und »Persönlichkeit« markiert und doch nicht kaschieren kann, daß er seicht ist.
Hotel-Jahresmieter seit seinem 17. Lebensjahr. – Häuslichkeit, »Heim« sind ihm Vorschein des Todes. Er ist geradezu manisch auf Achse. Unterwegs – ob zu Vorträgen oder privat –, hat er das »beruhigende« Gefühl, »Durchgangspassagier der Erde zu sein«.[11]
Bohemien, ostentativ. Das ist ihm keine Attitüde, die sich darin erschöpft, später aufzustehen als andere Leute, den restlichen Tag von drei, halb vier Uhr nachmittags bis Mitternacht im Kaffeehaus, dann in Bars zu verbringen, dem Alkoholgenuß zuzuneigen, seine Zechen aufschreiben zu lassen, seine Papiere in Unordnung zu haben, seine Haare unfrisiert zu tragen, Artikel nicht zu liefern, für die er schon Vorschuß kassiert hat, seine Liebschaften öffentlich zu erledigen.[12] Vielmehr besteht er darauf, über jene Fasson, die vom bürgerlich-behördlichen Gesetzbuch zugeschnitten wird, hinaus selig zu werden.[13] Nimmt sich die Freiheit, nach dem Wahlspruch »Quod licet bovi, non licet Jovi!«[14] zu leben, oder: Alles, was Gott verboten hat. Nachtschwärmer, dem der Morgen »kein Anfang ist, sondern ein Ausklang«, zu dem Begriffe wie Décadence, Eros, Geliebte, Aroma, Freude, Anarchismus gehören,[15] der »im Achtstundentag der Arbeit eine geringere Dotation des Erdenglücks und der Freiheit erblickt als in der Vierundzwanzigstundennacht der Liebe«.[16] Läßt keine Gelegenheit aus, das »Épater le bourgeois« geistlaunisch zu exerzieren. Immer wieder gelüstet’s ihn, »aus bösem proletarisch-ruppigem Trieb« die Auslagenfenster einzuschlagen, hinter denen sich wer oder was auch immer dem gutbürgerlichen Idyllenbedürfnis darbietet.
»Schmutzfink der Aufrichtigkeit«, ist er ein »geborene[r] Spielverderber«.[17] Bildung ist ihm kein zeitfernes Ornament, sondern »Instrument eines zeithellen Verstandes«.[18] Dem Zeremoniellen, dem Würde-Getue, der Attitüde der Wohlanständigkeit, dem Neid, der sich als Sittlichkeit drapiert[19], begegnet er in antibürgerlichem Affekt mit dem Götz-Zitat.
Als »physiologisch linksstehende[r] Mensch« ist er zwar gegen die Unfreiheit, aber für den Adel, soll heißen: »gegen das Privileg auf die reinen Hemden […], aber nicht gegen die reinen Hemden selbst«.[20] Und wenn er auch »ein Gymnasialbolschewik« war – »in der Religionsstunde Spartakussist« –, vor die Wahl gestellt »zwischen dem schlimmsten Seelenquäler, der den Katalog als Bakel schwingend wie ein Caracalla dastand, und [s]einem Nebenmann, der [ihm] mit zuckendem Kretinslächeln zuraunte: ›Uj jessas, der Profax!‹ – [er] lief zur Monarchie.«[21]
»Hamsunist«: Läßt sich vom Lebenswind treiben, »ohne nach moralischen Wertungen und Handlungen zu lechzen, aber doch immer mit der tiefen Freude am Wunder des Daseins«; genießt das Leben »wie eine paradiesische Wildnis […], voll Voraussetzungslosigkeit, aber nicht mit der Koketterie des Nichtstuers, mit ein bißchen Melancholie, aber ohne Pose«: ein »aristokratischer Landstreicher«.[22]
»Zeitlebens ein Besitzloser«, und das »aus Überzeugung fast mehr als aus Zwang«[23], hat er, der gut verdient, ständig Schulden. Er schnorrt, hat aber mit der Zunft der kleinen Schnorrer nichts am Hut – er schnorrt stilvoll und in großem Stil, ist darin »Weltklasse«[24]. Er kennt eine Unmenge Leute aus den besten Kreisen, die er anpumpen kann – Rudolf Kommer, der Galerist und Kunsthändler Fritz Mondschein (nachmals Frederick Mont) und später dann Alexander Korda zählen zu seinen Mäzenen –, zudem besteuert er zahlungskräftige Zeitgenossen. Leo Perutz, den er in Salzburg einmal als »Geschäftsträger« zu Erich Maria Remarque schickt, um diesen um 400 Schilling anzupumpen, spielt Kuh den bösen Streich, nur 4 Schilling 20 zu fordern, was dessen Pläne dann gehörig über den Haufen wirft: eine Gemeinheit, die Kuh Perutz lange nachträgt.[25]
Ob im Kaffeehaus oder in teuren Restaurants: Er zahlt nie selbst, immer begleicht einer aus der Runde die Rechnung für ihn. Schließlich beschenkt er die Runde in verschwenderischem Maß durch seine Anwesenheit, »mit geistreichem Klatsch, mit Quintessenzen neuester Philosophien«.[26]
Exzedent. Das Ungestüme, Lodernde, Sichselbstverzehrende zeichnet nicht allein den Stegreif-Redner aus, Kuh lebt nach dem Wahlspruch, mit dem Walter Pater das Wesen des Künstlers beschreibt: »in die Minute des Daseins möglichst viel Pulsschläge zusammendrängen«[27] – exzessiv. Er würde die »Rolle des Exzedenten«, dem nichts Menschliches fremd ist, gegen keine andere tauschen wollen.[28] Wenn dabei auch nichts andres als Störung der Ruhe herauskäme, insistiert er: »Vive l’excès!«[29]
»Vor das Glück haben die Götter nicht den Schweiß gesetzt«, setzt er seiner Aperçu-Sammlung »Von Goethe abwärts« als Motto voran.[30] Hegt seine Abneigung gegen das »Problemateln«, gegen »Tanzproduktionen mit Weltanschauung«[31], gegen die »tiefbohrend-deutsche Ekstase, die sich mit dem Tatbestand der gottgefälligen Heiterkeit nicht zufriedengeben kann«[32].
Hat als Individualist eine »Scheu vor der Massenakustik, vor Aufzügen, Emblemen, Redensarten, vor allem aber vor dem donquichotisch-pathetischen ›Wir‹«[33].
Bekennender »Gegenteils-Fex«[a][34], ist er »ein Ausnahmsfall von renitentem Geist«[35], für den es »ein einziges argumentum ad rem« gibt: »das argumentum ad hominem«[36] – ganz nach dem Motto: »Nur nicht gleich sachlich werden! Es geht ja auch persönlich.«[37]
Provoziert gern, legt den Finger auf den wunden Punkt, ist goschert und »geschmacklos« und bis zuletzt programmatisch »taktlos«: »Wo das Wort ›taktlos‹ fällt, ist man bald im Bilde! Die den gelben Fleck noch innerlich, in ihrem subalternen, kulturübertünchten Herzen tragen, sind stets die geborenen Flüsterer und ›Pst!‹-Macher. Bekleiden sie aber gar den Hofratsrang, jene Würde also, wo das Buckerlmachen und Leisetreten nach oben sich mit dem Profoßenton nach unten verbinden darf, dann bekommt der ›Takt‹ einen Polizeicharakter.«[38]
Mit sich selbst verfährt er ebenfalls keineswegs zimperlich. Selbstironisch, macht er kein Gewese um sich. Daß er als Stegreif-Sprecher und damit Artist vom Zimmermädel seines Wiener Hotels auf eine Stufe mit deren Tante, der »Tätowierte[n] aus’n Wurstelprater«, gestellt wird, jener Riesendame, »deren ganzer Leib mit pikanten Bildern bemalt ist (›Konswärkä … lauter Konswärkä … Konswärkä an den Armen, Konswärkä an den Beinen, ja Konswärkä sogar auf dem Steiß …!‹ verhieß der Ausrufer)«[39], amüsiert ihn. Daß er immer und überall allesamt in Grund und Boden sprudelt, seinem Laster des Nicht-zu-Wort-kommen-Lassens, schreibt er’s schmunzelnd zu, daß er nach Jahren in
Paris noch kein einigermaßen akzeptables Französisch spricht. Und den billigen Scherz mit seinem Namen, »daß es für einen distinguierten Ausländer [in Paris] kein größeres Malheur gibt, als ›Kuh‹ zu heißen«, versagt er sich auch nicht.[40][b] Und wenn ihm der Ober des Café Central mitteilt, daß sein Hund während des Kuraufenthalts seines Herrchens täglich dessen Kaffeehausstunden gehalten habe, und auf die verdutzte Nachfrage »Und was tut er hier?« die Antwort erhält: »Na nix. Er bettelt die Leut’ an, setzt sich zu dem und zu dem«, schießt ihm durch den Kopf: »Meine Lebensweise!«[41] Und wenn er darüber schreibt, daß Peter Altenberg seine Unabhängigkeit an Nachtlokalmäzene verkaufte, kann er sich die nachdrückliche Nebenbemerkung »ein leiser Merks für den Schreiber dieser Zeilen!« nicht verkneifen.[42]
Eindrücke
»Fahrig und haltlos, sozusagen aus Grundsatz, sprudelte er grossartige Spracheinfaelle von sich, er wiederum kein beschaulicher Zecher, sondern ein passionierter Sich-Betaeuber, achtlos seiner Gesundheit wie der buergerlichen Sittsamkeit gegenueber. Er hatte etwas Meteorhaftes, jaeh Aufblitzendes und Verhuschendes, […] er loderte und verlosch in einem Rausch von Sprachironie, Schlagfertigkeit und Verstandesueberschaerfe.«[43]
»[D]ieses von Leidenschaften fast zerrissene Antlitz, von schwarzem lockigem Haar gleichsam überflammt […]; die Gestalt […] eines Tänzers: eine sprudelnde Beweglichkeit, Lebhaftigkeit, ein […] Sichausschleudern von Gestikulationen. […] Gesten […], wie wir sie von Bacchanten annehmen.«[44]
»Mittelgroß, schlank, beweglich, fahrig mit einem immer bleichen Gesicht, zwischen dessen riesenhaften Poren sich stets ein nervöses Zucken bewegte, mit auf und ab wippenden schweren Augensäcken, schnell auf- und zuklappenden Augenlidern, einem Mund mit gewaltigen Lippen, einer dunklen wilden Zigeunermähne, deren Locken er unablässig mit kurzen schnellen Bewegungen zurückwarf, einem zerklüfteten Gesicht voll Klugheit und Hinterhältigkeit, in dem ein übergroßes Einglas festgerammt klebte.«[45]
________
a Franz Jung sieht 1930 Anton Kuh, neben Franz Blei, unter den prospektiven Mitarbeitern seiner in Gründung befindlichen Monatsschrift »Gegner«, die »gegen die herrschende Ansicht in ihrem Stoffgebiet Prinzipielles zu sagen haben«, als Garanten für den programmatischen »geistigen Außenseiter-Standpunkt« des Periodikums (Franz Jung: Prospekt für den Inhalt der Zeitschrift. In: Briefe und Prospekte. Dokumente eines Lebenskonzeptes. Zusammengestellt und kommentiert von Sieglinde und Fritz Mierau. Herausgegeben von Lutz Schulenburg. Hamburg 1988 [= Franz Jung: Werke in Einzelausgaben, Bd. 11], S. 170-171).
b Französisch und also »Küh« ausgesprochen, ist Kuh appositionslos schlicht der Arsch (»cul«) oder als »Cul de Paris« eine Modeschöpfung des Fin de siècle, »dazu bestimmt, dem Hinterteil der Damen […] graziös hervorgehobene Geltung zu verschaffen« (Friedrich Torberg: Die Tante Jolesch oder Der Untergang des Abendlandes in Anekdoten. München 1975 [= Gesammelte Werke in Einzelausgaben, Bd. VIII], S. 252).
»Eine wahre Wedekind-Tragödie« –Wie er wurde
»Ein reines Wedekind-Drama« sei ihre Familie, klagt Auguste Kuh Ende 1919 Hermann Bahr ihr Leid.[1] – Welche Rolle verkörpert darin ihr Sohn Anton? Und wer sind die Dramatis personae?
Auguste Kuh, am 22. Januar 1855 in Prag als Tochter des Lederhändlers Baruch Perlsee und dessen Gattin Franziska geboren und seit 24. Dezember 1882 mit Emil Kuh verheiratet, 1885 Umzug nach Wien.
Georg Kuh, ältester (überlebender[2]) Sohn, Jahrgang 1888, studierter Jurist, geht als Bankbeamter Anfang 1914 in die USA, kann dort nicht Fuß fassen und kehrt Mitte 1917 nach Wien zurück.
Anton Kuh, am 12. Juli 1890 geboren, »über dessen ›geistige Manieren‹ man sich [zwar] hie und da in Wien beklagt hat«, aber in den späten 1910er Jahren die »einzige junge Elementarkraft unseres Journalismus«[3].
Margarethe »Grete« Kuh, am 1. September 1891 geboren, im Ersten Weltkrieg freiwillige Krankenpflegerin und ab 1917 »Private«[4].
Marianne »Mizzi« Kuh, geboren am 30. Januar 1894, Krankenschwester, laut Meldezettel: »Private«.[5]
Anna »Nina« Kuh, am 15. Oktober 1897 geboren, die am 20. Juni 1918 bei einer Vernehmung zu Protokoll gibt: »Schulbildung: Volks-, Bürger- u. Handelsschule«, »Beruf und Stellung im Berufe: Keinen«.[6]
Johann »Hans« Kuh, Jahrgang 1895, hat die Szene bereits verlassen, ist als Handelsschulabsolvent und nunmehriger »Kontorist« Anfang 1914 in die USA ausgewandert.
Auch nicht mehr im Spiel: der Vater, Emil Kuh, hinreißender Redner, schlagfertiger, geistreicher Causeur, begnadeter Parodist und Stimmenimitator, an dessen sprudelndem, kaustischem Witz man nur manchesmal »jenen Geist der Suite, den methodische Menschen mehr vorziehen als eine gewisse, an feste Ordnung nicht gebundene Genialität«, vermißt.[7] Ein Jugendfreund attestiert seinen Leitartikeln schmunzelnd den »romantische[n] Idealismus des väterlichen Achtundvierzigertums, [a] durch keine Zahlen- und Sachkenntnis gehemmt«.[8]
Nach dem frühen Tod des Familienerhalters, der am Pfingstsonntag 1912 im 57. Lebensjahr an »Schlagadernverkalkung«[9] verstirbt, scheinen die ohnehin permanent prekären Verhältnisse chronisch desolat geworden zu sein. Mögen die zahlreichen Prager und Wiener Honoratioren, Kollegen und Freunde, die dem langjährigen Redakteur des »Neuen Wiener Tagblatts« am 29. Mai 1912 in der israelitischen Abteilung des Wiener Zentralfriedhofs die letzte Ehre erweisen, für dessen Beliebtheit und Ansehen zeugen – Zählbares hinterläßt er, zeitlebens sorglos im Umgang mit Geld und Gesundheit, seiner Familie nicht.
Das familiale Wedekind-Drama, in dem – das nur nebenbei, aber nicht zu vergessen – Kinder mit ihren Eltern selbstverständlich per Sie verkehren, spielt in den Kulissen der Boheme. Auguste Kuh, von ihrer Tochter Grete als »unbürgerlich« und »alles eher, als was man Hausfrau nannte«, beschrieben, hat zwar keinen Beruf erlernt, ist aber hoch gebildet und verdient sich, »weil sie u. wir nie Geld hatten«, mit Latein-, Griechisch- und Französisch-Nachhilfeunterricht sowie Klavierstunden »manchmal [ein] paar Gulden«.[10] Sie bringt auch vereinzelt Artikel sowie Übersetzungen literarischer Texte aus dem Französischen in der »Prager Presse« und im »Prager Tagblatt« unter und gibt den zuständigen Redakteuren unverhohlen zu verstehen, daß ihr schon klar ist, daß die Bekanntheit ihres Sohnes Anton ihr dabei keineswegs Türen öffnet, sondern im Gegenteil beim Akquirieren von Aufträgen nur schadet, weil er mit allen anbindet.[11] Nicht bloß für Anton Kuh, auch für seine Schwestern und seine Mutter ist das Kaffeehaus »dauernder, selten verlassener Aufenthaltsort«.[12]
Klagen über »Existenzschwierigkeiten«, über »erfolgloses ›Schnorren‹«[13] – einige Schnorrbriefe sind überliefert[14] –, aktennotorische Zechprellerei, in der Sprache des »Zentralpolizeiblatts«: »betrügerische Kost- u. Quartierschulden«[15], Beschwerden über die wenig verläßliche Unterstützung seitens ihres Sohnes[16] und Mahnungen Dritter an die Adresse Anton Kuhs[17] konturieren den materiellen Hintergrund der konfliktträchtigen Konstellation.
Nach dem »Hingang« ihres »Herzenskindes« – Georg stirbt am 27. November 1919 an Blutvergiftung –, das nach der Rückkehr aus den USA in seiner neuen Karriere als Journalist – er publiziert unter dem anglisierten Vornamen »George« unter anderem im »Neuen Wiener Journal« – keinen Boden unter die Füße bekommt, obwohl Auguste Kuh sich für ihren von ihr verzärtelten, unleidlichen Ältesten bei Arthur Schnitzler und Hermann Bahr verwendet, klagt sie letzterem gegenüber: »Neid und Scheelsucht eines nur auf seine Geltung bedachten jüngeren Bruders« hätten Georg »von jedem Unternehmen ferngehalten«. Er sei in der Verbitterung gestorben, »von seinem Bruder, dem er echte Liebe und neidlosen Beifall gezollt, verächtlich beiseite geschoben worden zu sein.«[18] Ähnlich in einem Brief an Arthur Schnitzler: Georg sei von seinem Bruder »in seinem ganzen schriftstellerischen Bestreben fürchterlich unterdrückt« worden.[19]
Nicht als küchenpsychologische Erklärung von Anton Kuhs behaupteter »Scheelsucht«, sondern als einziges weiteres Zeugnis, das etwas Licht auf die Stellung der zwei Kuh-Brüder innerhalb der Familie wirft, hier die »Aussage« von deren ältester Schwester: Auguste Kuh habe Anton, mit seinem gewinnenden Charme von Kindesbeinen an Everybody’s Darling, dem älteren Bruder gegenüber von klein auf geradezu stiefmütterlich zurückgesetzt, weil sie ihn als Konkurrenz für den von ihr vergötterten »Erstgeborenen« betrachtete.[20]
Näher dran an Wedekind, aber auch kaum besser ausgeleuchtet ist die Rivalität der Kuh-Schwestern um Otto Gross, den charismatischen Verfechter umfassender Libertinage, dem »sexuelle Revolution, Hetärentum, Matriarchat, Polygamie, Orgie […] keine Gedankenspiele und keine spekulativen Felder [waren], sondern ein geistig-körperlicher Aktionsraum, in den er andere einbezog und den er mit anderen besiedelte«.[21] Stets mit von der Partie: Opium, Morphium, Kokain.
Mizzi lernt Gross vermutlich im Sommer 1914 kennen, als dieser sich nach seiner Entlassung aus der Landesirrenanstalt Troppau zur Nachbehandlung bei Wilhelm Stekel im Bad Ischler Sanatorium Wiener aufhält. Sie ist längerfristig mit ihm liiert, von 1914 bis zu seinem frühen Tod 1920, hat mit ihm eine Tochter, die am 23. November 1916 geborene Sophie.
Grete ist als Krankenpflegerin zur selben Zeit in Vinkovci, Slawonien (heute Kroatien), stationiert, da Gross dort als Assistenzarzt Dienst tut und seiner Ehefrau Frieda brieflich mitteilt, daß er seine neue Freundin heiraten wolle.[22]
Nina wird im Juni 1918 nach einer heftigen Auseinandersetzung mit Mizzi um Otto Gross von der Polizei einvernommen und gibt dort zu Protokoll, daß sie seit Sommer 1914, »von kurzen Unterbrechungen abgesehen«, mit Gross verkehre und zwischen ihnen ein »Liebesverhältnis« bestehe.[23]
Wiederum unter dem ausdrücklichen Vorbehalt, daß es nicht darum zu tun ist, »allen Findlingen in [m]einer Obhut ihre Väter nachzuweisen« – Siegfried Kracauer über die Neigung des Trivialbiographen, alle frühen Lebensabschnitte wenn schon nicht als Vorzeichen, so doch als »logische« Vorgeschichte zu sehen[24] –, im folgenden kursorisch die schulischen Beurteilungen Anton Kuhs, deren Gesamtqualifikation in etwa unter den Begriff »verhaltensoriginell« zu fassen wäre und damit auf den »Neurastheniker« vorauszuweisen scheint: Über die Volksschulzeit ist nicht mehr bekannt, als daß der Sechsjährige 1896/1897 eingeschult wurde: Alle Unterlagen vor 1900 wurden skartiert.[25] Der »Haupt-Katalog der Ia Classe vom Schuljahre 1900/01« des »k. k. Staatsgymnasiums im III. Bezirke Wiens« vermerkt zwar nicht eben berauschende »Leistungen in den einzelnen Unterrichtsgegenständen«: »Religionslehre: genügend / Lateinische Sprache: nicht genügend / Deutsche Sprache (als Unterrichtssprache): genügend / Geographie und Geschichte: genügend / Mathematik: genügend / Naturgeschichte: nicht genügend / Zeichnen: nicht genügend / Turnen: genügend / Kalligraphie: genügend« und unter »Äußere Form der schriftlichen Arbeiten«: »nicht empfehlend« – eine Beurteilung, die sich durch die ganze Gymnasialzeit hindurchzieht, nur fallweise gibt’s hier ein »minder empfehlend« –, aber immerhin unter »Sittliches Betragen« noch »befriedigend« und unter »Fleiß«: »ungleichmäßig«. Während sich unter den Benotungen der einzelnen Unterrichtsgegenstände in den Folgejahren kaum einmal ein »befriedigend« findet, geht’s mit der Beurteilung des Betragens ab dem zweiten Semester des Schuljahres 1903/1904 rapide bergab: Der »Haupt-Katalog der IV a Classe vom Schuljahre 1903/04«: »Sittliches Betragen: minder entsprechend wegen seines Benehmens beim Unterrichte u. seinen Mitschülern gegenüber«; »Haupt-Katalog der V. Classe vom Schuljahre 1904/05«: im ersten Semester »minder entsprechend wegen Unordnung und Unterrichtstörung«, im zweiten »entsprechend«; »Haupt-Katalog der VI. Classe vom Schuljahre 1905/06«: »Sittliches Betragen: minder entsprechend wegen fortgesetzter Störung des Unterrichts«. Auch die »Leistungen in den einzelnen Unterrichtsgegenständen« – »Religionslehre: nicht genügend / Lateinische Sprache: genügend / Griechische Sprache: nicht genügend / Deutsche Sprache (als Unterrichtssprache): nicht genügend / Geographie und Geschichte: nicht genügend / Mathematik: nicht genügend / Naturgeschichte: genügend / Turnen: nicht genügend / Stenographie: genügend« – dürften dazu beigetragen haben, daß Anton Kuh am 31. Mai von der Schule abgemeldet wird. Am »k. k. Erzherzog Rainer-Realgymnasium im II. Gemeindebezirke in Wien«, wo er im Schuljahr 1906/1907 in die fünfte Klasse einsteigt, sind die Noten nach dem ersten Semester nicht besser: »Sittliches Betragen: minder entsprechend wegen vielfacher Störung des Unterrichtes«. Kuh wird am 2. März 1907 »ordnungsgemäß« abgemeldet. Um einiges besser dann die Noten, die der »Klassen-Katalog der 6. Klasse vom Schuljahre 1906/07« des k. k. Staats-Obergymnasiums zu Krumau ausweist. Auch wird Kuhs »Sittliches Betragen« mit »entsprechend« beurteilt.
Danach verliert sich die Spur der Gymnasialkarriere, die im Herbst 1911 mit einem mageren »mit Stimmenmehrheit zum Besuche einer Universität für reif erklärt« bei der Maturitätsprüfung am Krumauer Obergymnasium – zu der Kuh als Externer zugelassen worden ist – endet. Im »39. Jahresbericht des k. k. Staats-Obergymnasiums in Krumau«[26] wird im »Verzeichnis der approbierten Abiturienten im Schuljahre 1910/11« in der Rubrik »Gewählter Beruf« beim Externisten Anton Kuh angeführt: »Jus«. Ein reguläres Studium ist allerdings nicht nachzuweisen, weder an der Juridischen Fakultät in Wien oder Prag noch an irgendeiner anderen, auch wenn Kuh bei einer Einvernahme am 9. Januar 1926 angibt, er habe »2 Jahre Universität« absolviert,[27] und auch wenn er in Gastspiel-Verträgen als »Herr Dr. Anton Kuh« firmiert[28] und in Briefen als »Sehr verehrter Herr Dr. Kuh!« adressiert wird.[29] »Titel verleiht in Wien das Kaffeehaus«, mokiert sich Kuh, »Titel trägt man fürs Kaffeehaus. Ich erinnere mich eines der frühesten Backenstreiche, die mein Knabenantlitz für die Verhöhnung eines Mitmenschen trafen – es war ein Advokaturschreiber, der sich des Kellners und der abendlich umworbenen Dienstmädchen halber ›Doktor‹ nannte und dem ich, als er eines Tages ruhelos das große Billardbrett des Stammcafés umschritt, zugerufen hatte: ›Na, Herr Doktor – den ganzen Tag da umeinanderpromovieren?‹«[30]
Kuhs Hang zum Sarkasmus wird, einem weiteren autobiographischen Schnipsel zufolge, in der Schulzeit grundgelegt: »Das Gehör eines so unglücklichen Namensträgers [wird] frühzeitig zu jener Notwehr erzogen, die man als ›satirische Veranlagung‹ bezeichnet; denn es ist schon dem Knaben, der auf den Namen ›Kuh‹ hört, als hätte die Stupidität der ganzen Welt sein Ohr als Zielscheibe genommen. Er geht in die Schule und hört hinter seinem Rücken den Chor-Reim: / Die Kuh gibt Milch und Butta / Wir geben ihr das Futta … / Oder ein Kollege faßt ihn in plötzlicher Anwandlung von Tiefsinnigkeit beim Arm und fragt ihn: ›Kuh, warum machst du nicht Muh?‹ / Ich habe mich von Kindesbeinen an daran gewöhnt, diese Fragen ad absurdum zu führen, indem ich sie wörtlich nahm; also etwa der letzten Frage entgegnete: ›Ich weiß nicht, ich habe es schon versucht, es geht so schwer.‹ Doch man kann sich leicht vorstellen, wie einen die Gewöhnung an solche Humore frühzeitig zum Menschenkenner und -verächter erzieht.«[31]
Noch vor der Matura ein erster Stellungstermin, wie die Akten der Militäradministration festhalten, ein Bestand, mit dem sich zumindest eine der launigen Angaben des autobiographischen Texts »Wie ich wurde« fundieren läßt: »Der Krieg findet Kuh«, wie der’s dort formuliert, »in den vordersten Reihen des Hinterlandes«[32], genauer: ursprünglich »auf Kriegsdauer« als »Einjährig-Freiwilligen«[33] dem k. u. k. Infanterie-Regiment Nr. 84 zugeteilt – dem Regiment »Freiherr v. Bolfras, Wien-Umgebung. (Einer Art Provinz-Filiale der Deutschmeister.)«[34] –, und zwar der I. Ersatz-Kompanie, wo er am 21. Juni 1915 einrückt. (Im Juni 1911 und im September 1912 lautete der Befund der Stellungskommission noch: »Dzt. Unt[au]gl[ich], schwach, zu[rück]-stellen«; im April 1913: »Zum Waffendienst unt[au]glich, hochgrad[ige] allg. Körperschw[äche], waffenunfähig«.)[35] Er wird allerdings am 29. September 1915 für dienstuntauglich erklärt und am 26. Oktober 1915 für »invalid, waffenunfähig« und als »bürgerlich erwerbsfähig« per 30. September 1915 – und damit nach drei Monaten und zehn Tagen »anrechnungsfähiger Dienstzeit«, so die Superarbitrierungsliste – entlassen. Der »Konstatierungsbefund« des k. u. k. Garnisonsspitals Nr. 2 in Wien, wohin Kuh am 28. August 1915 »zur Konstat[ierung] seines Leidens« überstellt und am 4. September wieder entlassen wird, lautet auf »Ticker-Krankheit (maladie de tics)«.[36]
Auch wenn es scheint, als sei sein Berufsweg ohnehin familiär vorgezeichnet – Großvater David war Begründer und langjähriger Herausgeber des »Tagesboten aus Böhmen«, Vater Emil lange Jahre Zeitungsredakteur, zuletzt, von 1899 bis zu seinem Tod 1912, Leitartikler[37] des »Neuen Wiener Tagblatts« –, Anton Kuh empfindet die Schreiberei als mindere Art, seinen Lebensunterhalt zu verdienen: »Mein Jugendideal war: am Tag Nietzsches sämtliche Werke zu schreiben und am Abend einen Tirolerbuben aus Papiermaché auf meinen Knieen hutschen und ihn noch mal das schöne Liedchen singen zu lassen: Morgen-ro-hot, Morgen-ro-hot … Statt dessen bin ich auf der mittleren Linie geblieben und schreibe Feuilletons.«[38] – Gut, »[m]it achtzehn ist jeder von uns ein Genie, mit achtundzwanzig jeder ein Redakteur«[39] – so Anton Kuh über allzu hoch fliegende Ambitionen –, und immerhin hat er sich anfangs nicht weit von der »Hutschen« verdingt: beim Kabarett. [b]
Die »einzige junge Elementarkraft unseres Journalismus. Ein Ausnahmsfall von renitentem Geist«[40], wie Kuh Mitte 1918 von Berthold Viertel apostrophiert wird, hatte ein erkleckliches Maß an Renitenz nötig, um als solche auch anerkannt zu werden.[41] Das junge Talent wird zwar von Karl Tschuppik, 1910 bis 1917 Chefredakteur des »Prager Tagblatts«, protegiert, der stimmt allerdings dessen ätzenden Witz und hochgezwirbelte Schreibe redigierend gehörig herunter. Kuh fühlt sich zum »Schapsel« und »Tinterl« degradiert, wenn man ihm keine »Ausnahmsstellung« einräumt[42]. Er droht damit – vierfach und balkendick unterstrichen –, »keine Zeile mehr nach Prag« zu schicken, wenn man dort seine besten Sachen vermodern läßt[43], und verbittet sich’s Maximilian Schreier, dem Herausgeber des Wiener »Morgen«, gegenüber wutentbrannt, daß man ihn, der sich schließlich als Theaterreferent des »Prager Tagblatts« »hinlänglich bekannt gemacht« hat, für »Fleißaufgaben« und »Gelegenheits-Dienste« heranzieht und ihn beim »Morgen« offenbar nicht in der Rolle des »distinguierten Gastes, sondern [in der] des zur Anpassung erzogenen Tinterls« sieht und seine Texte durch redaktionelle Eingriffe platt macht.[44]
Wie andere Intellektuelle seines Jahrgangs kann auch Anton Kuh sich des prägenden Einflusses der wirkmächtigen Nietzsche-Mode um die Jahrhundertwende nicht entziehen. Wenn Friedrich Nietzsche im Vorwort zum »Zweiten Stück« der »Unzeitgemässen Betrachtungen«, zu »Vom Nutzen und Nachtheil der Historie für das Leben«, programmatisch verlautbart, er arbeite »gegen die Zeit«,[45] vermeint man in einigen Selbstaussagen Kuhs einen Nachhall davon zu vernehmen. Nicht bloß beim Trapez-Akt des Stegreif-Sprechens ist ihm befeuernder Antrieb, daß er »grundsätzlich nur gegen« spricht[46], Kuh ist generell »Gegenteils«-Fex.[47]
»Sein« Nietzsche ist der »Umwerter aller Werte«, der Umstürzler und Rebell, der militant den herrschenden kulturellen Normen opponiert, der Anarchist und Amoralist, der – »Anti-Philosoph unter den Philosophen« – nicht mit verblasener Begrifflichkeit nach dem Wesen der Wahrheit sucht, sondern ganz konkret nach dem »Wesen des Glücks«[48], der unbefangen und respektlos seine Denkbahn schreitet, der »begann, die Dinge wieder von vorne anzusehen; ohne sich vor Fiktionen und geistigen Übereinkünften der Menschheit zu verbeugen«[49], der nicht fragt »Frei wovon?«, sondern »Frei – wozu?«.
Und Kuh nimmt Friedrich Nietzsche, nach dessen »Bildungsphilister« er seinen »Intelligenzplebejer« strickt, immer wieder gegen ebendenselben in Schutz, immer wieder auch gegen die Indienstnahme durch die antiintellektuellen, völkisch-nationalen und zumal nationalsozialistischen Proponenten eines trivialisierten »Übermenschen« und »Willens zur Macht«, die »ihren« Leibphilosophen zum Apologeten säbelrasselnder deutscher Machtpolitik verfälschen; ihn zum deutschen Patrioten umbügeln[50] und als »Philosophen der Macht« in die Montur des »Potsdam-Deutschen« stecken.
Die zweite intellektuell prägende Figur ist charismatischer Akteur im Kuhschen Familiendrama: In den Boheme- und Anarchisten-Zirkeln Münchens, Berlins, Asconas und Wiens als Prophet verehrt; hochbegabter und einst hochgeschätzter Schüler Sigmund Freuds, der, als er die Psychoanalyse gesellschaftskritisch wendet und damit politisiert, verstoßen wird; der, mit unüberhörbar nietzscheanischem Anklang, durch eine »Zurück-Umwertung aller Werte«, soll heißen eine Überwindung patriarchaler Herrschaft, zu einer »goldene[n] erste[n] Zeitperiode« paradiesischer Urform, egalitärer, matriarchaler Verhältnisse (zurück)zugelangen strebt;[51] zu einer Art mutterrechtlichen Kommunismus, »rein von Pflicht und Moral und Verantwortlichkeit, von wirtschaftlichen und rechtlichen, moralischen Verbindlichkeiten, von Macht und Unterwerfung; rein von Vertrag und Autorität, rein von Ehe und Prostitution«[52]: Otto Gross.
Als die »menschlich bedeutendste Figur, der [er] je begegnete«[53], bezeichnet Anton Kuh diesen Inbegriff des Rebellen, programmatisch unangepaßt und trotz massiver Anfeindung und Ablehnung konsequent und ohne Konzessionen seinen Weg gehend. »[E]inem einzigen genialen Psychoanalytiker« sei er in seinem Leben begegnet, einem, der »sein Leben zwischen Polizeistation, Sanatorium und Irrenhaus [verbrachte]. Das spricht für ihn. Seine Art Psychoanalyse war eben keineswegs etwas so Harmloses, Obrigkeitsbeliebtes, zum ›Vater leih’ mir die Scher‹-Spiel Taugliches, wie sie seit Freud die Jünger samt und sonders betreiben.« Also nicht »eine Art psychischer Klistierverabreichung«. »Sie war für ihn eine neue, revolutionäre Methode« zur »Auskurierung der Menschheit«, die nur über die Abschaffung von »mancherlei staatsgeheiligte[n] Institutionen« zu bewerkstelligen sei, »die der Gesundheit des Menschengeschlechts abträglich sind: […] Ehe, Moral, Virginität usw.«[54]
Der Vater dieses »Revolutionär[s] a genere« mit »seinem hackigen, wüst zerschnittenen Gesicht […], seinem kinderreinen Fanatismus, seinem marterbereiten Dozententum«[55], Hans Gross, seit 1905 Inhaber des Grazer Lehrstuhls für Kriminalistik und Kriminologe von Weltruf, läßt seine Beziehungen spielen und seinen Sohn, der bis 1908 in Graz als Privatdozent für Psychopathologie gelehrt hatte, im November 1913 in Berlin verhaften, unter Polizeibegleitung an die österreichische Grenze expedieren und mit der Diagnose »unheilbarer und gefährlicher Geisteskranker« in der Privat-Irrenanstalt Tulln bei Wien und späterhin in der Landesirrenanstalt Troppau, Schlesien, zwangsinternieren. Über eine Protestkampagne, die von expressionistischen Zeitschriften initiiert wird, gelangt die Affäre auch auf die Seiten der großen liberalen Zeitungen und in Form einer Anfrage im Landtag auch aufs politische Parkett. Die Zwangsinternierung Otto Gross’ muß im Juli 1914 aufgehoben werden, er bleibt aber unter Kuratel. Kurator: sein Vater – der die Entmündigung betrieben hatte.
Otto Gross stirbt, nachdem man ihn zwei Tage davor halb verhungert und erfroren und auf Entzug mit einer Lungenentzündung auf der Straße aufgelesen hatte, am 13. Feber 1920 in einem Sanatorium in Berlin-Pankow.
Im Nachlaß Anton Kuhs in den Beständen des Österreichischen Literaturarchivs findet sich ein fragmentarischer Durchschlag von Otto Gross’ Programmschrift »Die kommunistische Grundidee in der Paradiessymbolik«. Ansonsten umfaßt dieser sogenannte Splitternachlaß ein paar Dutzend Briefe und Briefentwürfe, zumeist aus dem Zeitraum 1915 bis 1920, darunter: der Brief eines aufgebrachten Lesers an Maximilian Schreier, den Herausgeber der Wiener Montagszeitung »Der Morgen«, dem zufolge Anton Kuh in seinen frühen Erwachsenenjahren ständiger Besucher der Freudenau – Galopprennbahn im Südosten Wiens und Treffpunkt der Hautevolee – gewesen sei und als Rennplatz-Habitué auch Wettaufträge besorgt habe, wobei er des öfteren Gelder, die ihm zu diesem Zweck anvertraut worden waren, mit der fadenscheinigen Ausrede unterschlagen habe, er hätte sich an der Wettmaschine geirrt[56]; Mahnungen – im Ton schwankend – des »Prager Tagblatts«, für die Pauschale, die er bezieht, gefälligst auch Texte im vereinbarten Umfang zu liefern,[57] oder die dezidierte Drohung, die regelmäßigen Überweisungen einzustellen, bevor er nicht den Vorschuß – der sich im Juni 1919 auf immerhin 900 Kronen beläuft – abgearbeitet hat;[58] briefliche Aufforderungen, er möge geliehenes Geld zurückgeben[59]; eine gerichtliche Ladung für den 21. November 1919 zur Verhandlung »Anton Kuh gegen Österreichische Aktiengesellschaft der Hotel- und Kuranstalten Abbazia« vor dem Bezirksgericht Landstraße, »betr. Kuraufenthalt im Sanatorium Tobelbad (von 6. bis 26. Juni 1919)«, konkret: einen offenen Betrag – für »Zimmermiete, Pension, Kurtaxe, ärztliche Untersuchung, Bäder- und Heilmittel, Medikamente, aussertourlich verabfolgte Speisen, Fahrmittel, Telefongebühren, Versicherungsbeiträge« – von K 2.089.44[60]; das mit »Wien, 17. November 5h20« datierte Protokoll einer Ehrenerklärung, »aufgenommen in der Ehrenangelegenheit der Herrn Oberleutnant Hauffe contra Anton Kuh«, dem zufolge Hauffe auf Kuhs Bemerkung hin, »er suche sich Freunde in intellektuelleren Kreisen, als es das Offizierkorps darstelle – ein Offizier sei für ihn nur eine ›Simplicissimus‹-Figur« –, Genugtuung mit Waffen verlangt habe und die »Vertreter des Herrn Oberleutnant Hauffe« erst auf die Erklärung des »Vertreters des Herrn Kuh, dass Herr Kuh in keiner Weise die Absicht hatte, dem Offizierskorps in beiden Fällen nahegetreten zu sein«, und er überdies »auf dem Standpunkt der Antiduell-Liga« stehe und daher die Genugtuung mit der Waffe verweigere, die Angelegenheit »für ritterlich erledigt« erklären;[61] ein Schreiben von »Hof- und Gerichts-Advokat Dr. R. Herzer«, in dem Kuh unter dem 4. Januar 1919 »In Sachen: Amon« mitgeteilt wird, daß Herzer von »Frl. Amon« angewiesen worden sei, die »wegen Durchführung der Eheschließung eingeleiteten Schritte nicht weiter fortzusetzen«.[62] Einen Monat davor hatte Bibiana Amon ihrem Verlobten auf Briefpapier des »Grand Hôtel, Wien« die Gründe für die Auflösung des Eheversprechens mitgeteilt. »Unsicher« und »lebensunklug«, wie sie nun einmal sei, blauäugig und naiv, könne sie nichts weniger ertragen als »ewige Ungewißheit, verursacht von einem Menschen, dessen Verantwortungsgefühl einfach nicht vorhanden« sei; könne sie niemand weniger brauchen als einen Menschen, der ihr »ohnehin schwer kämpfendes Dasein noch mehr belastet durch Verworrenheit, Un[n]atürlichkeit und Haltlosigkeit«.[63] Detaillierter geben Anton Kuhs handschriftliche »Zehn Bibiana-Gebote« Aufschluß über permanente Beanstandungen seitens Bibiana Amons, der »Strahlende[n], als Gretchen von Peter Altenberg entdeckt, aber nun schon zu [Anton Kuhs] Helena erblüht«[64]:
»1.) Ich soll nicht mit anderen Leuten über die Bez[iehung] zu B[ibiana] reden.
2.) Ich soll nicht lügen.
3.) Ich soll aesthetischer werden.
4.) Ich soll mir von einem Therapeuten einen Vortrag über das Wort ›Ethik‹ anhören.
5.) Ich soll jeden Tag umherhören, ob die Mama zu essen hat.
6.) Ich soll nachdenken Tag u. Nacht[,] wie ich es ermögliche, Hemmungen zu bekommen.
7.) Ich soll nicht vergessen[,] B[ibiana] zu respektieren.
8.) Ich soll meine schmutzigen Gedanken nicht meiner schönen [1 Wort unleserlich] [c] Freundin mitteilen, sondern sie verschlucken.
9. Ich soll ernstlich nachdenken, wie ich am besten der B[ibiana] im Leben weiterhelfen kann.
10.) Ich soll eingedenk meines tiefen Schuldbewußtseins beim Aufwachen u. vor dem Zu-Bett-Gehen mir mit allem Aufwand meiner Energie und Kraft 2 Tetschn (zusammen 4) geben.«[65]
Des weiteren im Nachlaß: eine Feldpostkorrespondenzkarte aus »Castellnuovo, Süd-Dalmatien«, die an »Herrn Anton Kuh, Wien III, Café Radetzky«, adressiert und, kaum leserlich, mit »WSDambron« unterzeichnet ist, laut Paul Elbogen ein überaus bemerkenswertes Exemplar aus der »Musterkollektion von prächtigen und häßlichen Giftgewächsen«, die »damals auf dem immer mehr verfaulenden Boden« Wiens wuchs: »Wolfgang Sylvain Dambron. Das Geschöpf war angeblich Statist gewesen. Es tauchte, goldblond, götterschön und nur leicht hermaphroditisch, eines Tages auf unserem nachmittäglichen ›Korso‹ auf der Kärntner Straße auf; gekleidet – war es wirklich 1913? – in einen violettgrauen Cutaway, violettgrauen Hut und Krawatte samt violettgrauen Schuhen. Er (oder es) lebte, wie man bald erfuhr, in einer teuren Pension, mit einem bekannten Kabarettier W. als Lebensgefährten; und mit Anton Kuh […] als Hofnarren und diplomatischem Beantworter zahlloser eindeutiger ›Liebesbriefe‹ von Dambrons Anbetern aller drei Geschlechter. Wovon lebten sie? Es ist schwer, es schwarz auf weiß auszudrücken und getrost nach Hause zu tragen: Unter vielen anderen standen eine russische Gräfin und – davon unabhängig – ihr Gatte mit den beiden Pensionsbewohnern in einem Zusammenhang, den man intim nennen darf. So bedrohte eben der reizvolle Wolfgang Sylvain den Grafen, sein weniger reizvoller, aber umso muskulöserer Freund die Gräfin, mit Verrat ihrer mutuellen Beziehungen.«[66]
Weiters ergeben die spärlichen Briefschaften, zusammengelesen, daß Anton Kuh in seinen frühen Zwanzigern in einer Clique im Café Radetzky und im Café Hungaria hinter dem Haupt-Zollamt verkehrt, bevor er Mitte 1916 ins »Central« (Herrengasse 14, Ecke Strauchgasse) und dort in den Altenberg-Kreis wechselt, »wo der abtrünnige Journalismus sein Dach [hat], der Empörungswille junger Theater- und Musikrezensenten«.[67] Neben Prager Freunden und Bekannten – Franz Werfel, Egon Erwin Kisch und Otto Pick arbeiten im Wiener Kriegspressequartier, Ernst Polak und Milena Polak (geb. Jensenská) leben seit 1918 in Wien – verkehren dort Franz Blei (ewig junger »Weltmann des Geistes«[68]), Alfred Polgar (der »Marquis des Feuilletons«[69]), der »spaßhafte Kulturhistoriker« Egon Friedell (»Ein Klassenprimus, der den schlimmen Buben spielt. Mit dem respektlosen Ulk der Schülerzeitschrift frönt er den Lehrerinstinkten«[70]), Otto Soyka (»Tat-Romancier, Pokerspieler aus vitalstem Herausforderungstrieb ans Schicksal, blaß wie die schlechterfundenen Namen seiner Helden«[71]), Otfried Krzyzanowski (»der verbettelte Dichter […], schlottrig, knochig, häßlich, aber gebildet und edel«[72]), der Versicherungsmathematiker und Romancier Leo Perutz, Eugen Lazar, der Chefredakteur der »Wiener Allgemeinen Zeitung«, Adolf Josef Storfer, Journalist und Psychoanalytiker, Gründer und nachmals geschäftsführender Direktor des Internationalen Psychoanalytischen Verlags, Arne Laurin, der nachmalige Chefredakteur der »Prager Presse«, der von Otto Weininger imprägnierte Philosoph Gustav Grüner sowie sein Bruder, der Lyriker Franz Grüner, der versiffte Journalist Egon Dietrichstein, der Talkum-Industrielle, Bohemien und Dichter sowie Interpret anzüglicher Chansons Franz Elbogen.
Anton Kuh über die Atmosphäre des in einem ehemaligen Börse-Gebäude beheimateten und mit einem Arkaden- und Säulenhof ausgestatteten Lokals: »Das Allerheiligste lag rückwärts und nannte sich Kuppelsaal. Nicht deshalb allein … sondern weil Rauch und Lärm dieses Vierecks ins Grenzenlose stiegen, zu einer Höhe, wo eine Kuppel kaum mehr sichtbar war. Aber diese Kapellenhoheit, diese Unüberdachtheit des Qualms bildeten die Eigenart des Raumes. / In den anderen Trakten saß der Sozialismus, der Panslawismus, der k. k. Hochverrat; Dr. Kramař und Masaryk, slowenische Studenten, polnische und ruthenische Parlamentarier, gelehrte Arbeiterführer – der fanatische Leitartikel. Der Kaffee roch wunderbar, und auf dem großen Rundtisch schichteten sich die Zeitungen in allen Landessprachen. / Dort hinten aber residierte das Feuilleton. / Es schleppte sich um die Jahrhundertwende als Rattenschweif Peter Altenbergs ein, des ersten und eigentlichsten Kaffeehausdichters, der nebenan im alten Absteighotel ›London‹ wohnte, inmitten improvisierter Liebespaare, aber als seine Adresse in den Kürschner eintrug: ›Wien, 1. Bezirk, Café Central‹!«[73] – »Café Central« lautet auch die Adresse einer an Anton Kuh gerichteten Ansichtskarte aus dem Sommer 1917 sowie eines Telegramms vom Mai 1918.[74]
Im Windschatten des politischen Umsturzes vollzieht sich im November 1918 eine »Sezession im Wiener Geistesleben«, soll heißen: eine Kaffeehaus-Sezession. Zwei Tage nachdem vom Balkon des Landhauses schräg vis-à-vis dem »Central« aus die Republik Österreich ausgerufen worden war, »saß alles, was politisch und erotisch revolutionär gesinnt war, drüben im neuen Café [zwei Häuser weiter, W. S.] – die Mumien blieben im alten«[75] –: im neueröffneten Café Herrenhof (Herrengasse 10). Daß auch Kuh dem grabeskühlen »Asyl der Resignationen, bewohnt von Klausnern, die sich alle gern den einstigen Karl V. vom Gesicht ablesen ließen«, den Rücken kehrt, versteht sich.
Patron des »Herrenhof« ist »nicht mehr Weininger, sondern Dr. Freud; Altenberg wich Kierkegaard; statt der Zeitung nistete die Zeitschrift; statt der Psychologie die Psychoanalyse, und statt des Espritlüftchens von Wien wehte der Sturm von Prag. / Daher war die Luft zunächst antiwienerisch, europäisch. Man debattierte zwar wieder (was durch Tarock, Schach und Poker bereits aus der Mode gekommen war), aber nicht mittels Bonmots und Pointillismen, sondern mit Skalpmessern und unter gleichzeitiger Wegnahme einer Geliebten. / Das war vor allem der Fortschritt: es ging an jedem Tisch Wichtigstes, Beziehungsvollstes vor, oft unter Begleitung von Kokain – ja, und an die Stelle des Wortes ›Verhältnis‹ war jetzt überhaupt die Vokabel ›Beziehung‹ getreten. / Der Aktivismus zog ein: Werfel, Robert Müller, Jacob Moreno-Levy.«[76]
Die plüschgepolsterten Halbkreis-Logen des ausladenden, von einem Glasdach erhellten Mittelsaals des »Herrenhof« – sie bieten für fünf, sechs Personen Platz, sind bei Bedarf auch mit Stühlen zu einem Kreis erweiterbar, der acht bis zehn Personen Platz bietet – sind die Zentren des literarischen Treibens des Kaffeehauses: »Wortschlachten und Sexualgefechte«.[77]
Jede dieser Logen hat einen Vorsitzenden, nach dem sie benannt ist. So sitzt etwa in Adler-Loge der Begründer der Individualpsychologie, Alfred Adler, mit Frau und Kindern sowie mit Schülern, zu denen Gina Kaus und Manès Sperber gehören,[78] und einem dieser Stammtische präsidiert Ernst Polak, aus Prag stammender Bankbeamter – ab März 1918 Devisenhändler an der Wiener Niederlassung der Österreichischen Länderbank, ab Januar 1923 Prokurist, läßt er sich per 1. Januar 1925 pensionieren[79] –, literarisch ungemein beschlagen und geschliffen formulierend, der, mit seinem gepflegten Schnurrbärtchen an den Filmstar Adolphe Menjou erinnernd, von Kuh »Herschel Menjou« genannt wird[80] und »mit messerscharfer Nase und Rede den Dunst« zerteilt – »man orientierte sich jener und dieser entlang über die Zweckrichtung des Beisammenseins«.[81]
In einem dämmrigen Nebenraum tagt die Stammtischrunde Leo Perutz’, der streng über die handverlesene Auswahl der »zugelassenen« Tischgenossen wacht. Dazu gehören der Romancier und Lustspielautor Paul Frank, der Lyriker Josef Weinheber, der Rechtsanwalt und streitbare Publizist Walther Rode, der Verleger E. P. Tal, der Reiseschriftsteller Arnold Höllriegel, der Journalist und Publizist Karl Tschuppik. Wenn er in Wien ist, läßt sich auch Joseph Roth abends im »Herrenhof« sehen. Er sitzt mit Alfred Polgar, Franz Werfel, Anton Kuh, Karl Tschuppik und Max Prels, einem Redakteur des »Neuen 8 Uhr Blattes«, an einem Tisch.[82]
Immer wieder zäumen Perutz und Kuh, im »Central« wie auch privat, das »Dardl-Roß« auf, soll heißen, sie spielen Tartl. Daß es den Kontrahenten am Kartentisch dabei – wie in den Partien zwischen Perutz und Hugo Sperber[d] – weniger um den schnöden Gewinst geht als vielmehr darum, einen virtuosen verbalen Schlagabtausch zu zelebrieren, diese Vermutung liegt nahe. Was jedenfalls das Finanzielle betrifft, gerät meistens Perutz ins Hintertreffen.
Während Franz Blei, Robert Musil und Hermann Broch nur fallweise am Polak-Tisch gastieren, finden sich hier fast täglich zusammen: Anton Kuh – der auch nach der Sezession, die nicht so streng praktiziert wird, wie sie gern dargestellt wird, parallel zumindest fallweise immer noch auch im »Central« verkehrt –, Franz Werfel (nach seiner Verheiratung mit Alma Mahler allerdings nur noch sporadisch), Milena Polak, Gustav Grüner, der Journalist Richard Wiener, der Schriftsteller und Musiker Victor Wittner (von 1930 bis 1933 Chefredakteur des Berliner »Querschnitts«), der Architekt Hans Vetter, Adolf Josef Storfer, der Kunsthistoriker und enge Freund Karl Kraus’ Ludwig Münz, Albert Ehrenstein (»Hamlet vor der Matura«[83]), der Dramatiker, Erzähler und Lyriker Fritz Lampl, 1919 Mitbegründer des »Genossenschaftsverlags«, der Arzt und Schriftsteller Ernst Weiß, in den Jahren 1918 bis 1922 auch der aktivistische Schriftsteller Karl Otten.
In »Starbesetzung« – Polak, Werfel, Kuh, Gustav Grüner – liefert sich diese Stammtischrunde einen »pointensprühenden Wettbewerb der Einfälle und Meinungen, die wie Bälle im Ping-Pong-Spiel« hin und her geschupft werden, und das »so rasant, als ginge es um die Erringung einer Weltmeisterschaft«.[84]
Ebenfalls am Polak-Tisch: Otto Gross, der mit missionarischem Eifer die sexuelle Revolution verficht, die die Menschheit von der Unterdrückung durch patriarchalische Herrschaftsstrukturen befreien soll. »Psychoanalytiker auf Barrikadenhöhe«, springt er »alle zwei Minuten auf und [nimmt] irgendeine Frau oder einen Mann auf seine peripatetischen Hüpfgänge durchs Lokal mit – er [kann] nicht anders die letzte Konsequenz eines Gedankens entwickeln.«[85]
Nicht nur »die ganze Familie« Kuh ist dem »dämonischen Menschen« verfallen[86], auch die erweiterte Familie, der »Herrenhof«-Stammtisch, steht ganz im Bann des charismatischen Sozial- und Sexualrevolutionärs. Ernst Polak und Ernst Weiß »sind schon ganz narrisch«, teilt Bibiana Amon am 23. Juni 1919 Anton Kuh, der zur Kur in Tobelbad bei Graz ist, brieflich mit: »Ernst Weiß speziell hat schon seinen Verstand mitsamt dem Kopf verloren, vor lauter ›Analyse‹ mit Otto Gross. Er redet schon ganz irre und ist für einen gewöhnlich Sterblichen höchst selten zu sprechen. Vor lauter Komplexen, die Otto an ihm entdeckt hat. Ähnlich geht es E. Pollak, nur scheint er etwas kühler zu sein.«[87] Und nicht bloß predigt Gross uneingeschränkte sexuelle Libertinage – sein Essayband »Drei Aufsätze über den inneren Konflikt« ist Pflichtlektüre[88] –, Promiskuität wird in der Boheme-Atmosphäre des »Herrenhof« programmatisch gelebt, wobei die Frauen nicht Spielfiguren sind, wie Kuhs Bemerkung, die Frauen »kiebitzten nicht dem Spiel, sondern bildeten es«[89], einseitig mißverstanden werden könnte, sondern emanzipierte Mitspielerinnen.
Das Kaffeehaus ist nicht bloß Brutstätte[90], Umschlagplatz und Labor revolutionärer Ideen – »Hier werden die Meinungen gebildet, die Gemeinplätze und manchmal auch die Gemeinheiten«[91] –, es fungiert auch, ganz banal, als Arbeitsplatz resp. Büro. Dort schreibt man, erledigt man die Korrespondenz, dort trifft man Kollegen, Geschäftsfreunde, liest – im »Central« etwa liegen 250 Zeitungen und Zeitschriften auf –, und auch der jeweils benötigte Band des »Brockhaus«, des »Meyer« oder des Wiener Adreßbuchs wird auf Verlangen serviert. »Auch Vermittlung von Telephonnachrichten wird gratis und diskret besorgt, indem der Zahlmarkör den eintretenden Stammgast mit dem durch den ganzen Raum hallenden Ruf begrüßt: ›Herr von Pollitzer wurden von einer Dame angerufen, war aber nicht die Frau Gemahlin.‹«[92]
In Prag – ab Herbst 1916 immer wieder auf Wochen und Monate Lebensmittelpunkt – verkehrt Anton Kuh mit Karl Tschuppik, mit dem ihn eine innige Freundschaft verbindet, mit Franz Werfel und Max Brod, ist häufig bei den ausgelassenen Soireen des gastfreien Textilindustriellen und Mäzens Eugen Loewenstein[93] zu sehen sowie als »Hospitant« am Literatentisch im Café Arco, Ecke Dlážděná und Hybernská, wo die »junge«, dem Expressionismus nahestehende Generation ihr Hauptquartier hat (während die alte sich im Café Continental auf dem Graben versammelt): Franz Werfel, Max Brod, Franz Kafka (der sich selten sehen läßt), Johannes Urzidil, Hans Janowitz, Franz Janowitz, Karl Brand, Oskar Baum, Otto Pick, Otto Ro(senf)eld, Ernst Feigl, Willy Haas, Paul Leppin, Paul Kornfeld, Rudolf Fuchs. Das »Arco« ist als »Szenelokal« auch Fixpunkt auswärtiger Gäste: »Anton Kuhs Schwestern schnupften [hier] ihr Kokain und sein Schwager Dr. Groß, ewig auf der Flucht, gelangte von allen Themen zu seinem ewigen Steckenpferd, dem Mutterrecht«, weiß der »Arco«-Habitué Johannes Urzidil zu berichten.[94]
Ab Juli 1917 verkehrt Kuh regelmäßig mit Leo Perutz[95]: im »Central«, dann im »Herrenhof«, abends in der Carlton-, der Reiss- und der Renaissance-Bar wie auch privat tagsüber und abends bei Gesellschaften in Perutz’ Wohnung; oft zu Gast: Egon Erwin Kisch, Franz Elbogen, Hugo Sperber, das »letzte Original des Wiener Barreaus«, dem ein leider standeswidriges Werbeplakat mit folgendem Text vorschwebt: »Räuber, Mörder, Kindsverderber / Gehen nur zu Doktor Sperber«[96], Egon Dietrichstein, Franz Werfel, Otfried Krzyzanowski, Paul Frank, Paul Stefan, bisweilen Arnold Höllriegl und Lia Rosen. Bei den Perutzschen Abendgesellschaften gibt Kuh des öfteren eines seiner »großen Programme«[97] – deklamiert etwa am Abend des 6. Oktober 1918 »prachtvolle Shakespearesche Königsmonologe«[98] –, soll heißen eines seiner für alle Bescherten unvergeßlichen »Privatkabaretts«, oder einen »kleinen speech«. Da karikiert er innert zehn Minuten ein vollständiges Drama, etwa Franz Grillparzers »Ahnfrau« à la Burgtheater oder Gerhart Hauptmanns »Weber« à la Stadttheater Leitomischl.[99] Oder stellt eine der Dutzenden urwüchsigen Jargon-Possen, die er auswendig kann, auf die improvisierte Bühne.[100] Als Alleinunterhalter vertreibt er auch hie und da die Langeweile in den Salons betuchter Wiener Herrschaften – gegen gutes Honorar, versteht sich: »Börsen- und Rennwettenverluste schluckt die Sippschaft – ausgerechnet ihr Dabeisein bei der Literatur soll gratis sein?!«[101] Für die Kaffeehaus-Habitués und die befreundeten Drahrer sind die oft nächtelangen solokabarettistischen »Vorstellungen« gewöhnlich umsonst: ein »Katarakt von Geist und Witz, unausschöpfbar, kalt moussierend, Elektrizität erregend, jeden Einwand überdröhnend«, erinnert sich Paul Elbogen: »Wir wankten aus unzählbaren Nächten heim – mit vor Lachen erstarrten Gesichtern.«[102]
1909 – 1917
Ein Einstand mit Aplomb und damit ganz nach dem Geschmack des jugendlichen Arrogants: Gerade 19 geworden, zeichnet Anton Kuh am 13. August 1909 erstmals einen Beitrag im »Prager Tagblatt«, einer der renommiertesten Zeitungen der Monarchie, mit vollem Namen! Noch dazu das Einserfeuilleton, das in drei breiten Spalten überläuft bis auf Seite drei. Dabei ist die Prag-Flanerie »Kultur. Impressionen eines Passanten« nicht Kuhs erste Veröffentlichung. Fünf Monate zuvor finden sich zwei Piècen in der kommißhumorigen Wiener Satire-Illustrierten »Die Muskete«, die mit »Kuh« unterzeichnet sind. Und bereits ab Mai 1908 hat er im von seinem Onkel Oscar Kuh herausgegebenen »Montagsblatt aus Böhmen« wiederholt und des langen und breiten aus der Donaumetropole berichtet, etwa über den »Kaiser-Huldigungs-Festzug«, bei dem am 12. Juni 1908 von 12.000 Mitwirkenden anläßlich des Jubiläums des 60. Jahrestages der Thronbesteigung Kaiser Franz Josephs »die Geschichte Eurer Majestät ruhmvollen Hauses in lebenden Bildern« gezeigt wird und der »Eurer Majestät Vertreter der Völker Österreichs vorführt, die Eurer Majestät in Treue und Verehrung zujubeln wollen«, wie der Präsident des Festzugskomitees in seiner Meldung an den Kaiser kniefällig formuliert.[103] Aber schon der fünfzehn-, sechzehnjährige Gymnasiast hatte für seinen Vater, Redakteur des »Neuen Wiener Tagblatts«, Premierenkritiken und Rezensionen geschrieben,[104] und dem ersten namentlich gezeichneten Artikel im »Prager Tagblatt« sind Dutzende anonyme Beiträge vorangegangen. Das Privileg, seinen Namen unter oder über einen Artikel zu setzen, hing nicht an dessen Umfang, sondern an der Anciennität des Schreibers.
Kuh liefert sehr viel »unter dem Strich«: Feuilletons über Wiener Typen – etwa das forcierte »Hallodritum«, mit dem der »Winter-Ehemann« alljährlich zum »Sommer-Lebemann« mutiert, sobald er seine Familie auf Sommerfrische weiß[105] –, Gepflogenheiten wie die populäre Vergnügung des Mittagsständchens im Burghof[106], Befindlichkeiten und Aktualitäten wie etwa das Glücksspiel Bukidomino, das zwar auf der vom k. k. Justizministerium 1904 veröffentlichten »Liste verbotener Spiele« steht, aber im Wien der 1910er und 1920er Jahre grassiert,[107] Impressionen aus der hochsommerlichen Stadt[108], Nachrufe auf Prominente aus Literatur und Politik. Er entwirft ellenlange Porträts zu runden Jahrestagen etwa von Frank Wedekind[109], Shakespeare[110] und Gustav Freytag[111], trägt aber auch, wenn er sich, wie so oft, in Prag aufhält, »Entdeckungen eines Zugereisten«[112] und Prager Streiflichter bei, Skizzen eines geistesgegenwärtigen Flaneurs, Beobachtungen, die mit einer »Chronik«-Meldung ein Schlaglicht auf einen gesellschaftlichen Tatbestand werfen, etwa auf die Unterschiede im Grußverhalten zwischen der Donau- und der Moldaumetropole – hie Koketterie, wahlweise petschierlich oder streberhaft; da Zeremoniell, »ein kaufmännisches Eintragen des Nominalwertes der persönlichen Würde«[113] –, und Besprechungen von Aufführungen am Neuen deutschen Theater und am Landestheater (im Winter 1916/1917). Von Januar 1916 bis August 1917 berichtet Kuh auch regelmäßig über den Wiener Theaterbetrieb – häufig »Referate«, die gleich im Anschluß an die Premiere telephonisch an die Redaktion übermittelt werden – sowie vereinzelt (ab Juni 1917) über Parlamentsdebatten und Gerichtsprozesse. 1913 aber auch ausführlich über die Landplage der »stud. med., stud. jur. und stud. phil. mit dem souveränen Burschensignum«, als die von deutschnationalen Studenten inszenierten Krawalle – Übergriffe auf jüdische Kommilitonen und Professoren – im Frühjahr derart überhand nehmen, daß der Rektor am 21. Juni die Schließung der Universität und die Sistierung der Lehrveranstaltungen und Prüfungen verfügt.[114]
Im Vergleich zu den vor Selbstbewußtsein strotzenden, »chuzpösen« Beiträgen zum »Montagsblatt aus Böhmen« – da kanzelt der Jungspund etwa im März 1910 die gesamte Wiener Presse ab, die in ihren allzu pietät-, takt- und weihevollen Nachrufen auf den langjährigen Wiener Bürgermeister Karl Lueger einen fatalen Sachverhalt unterschlagen habe: die atmosphärischen Verwüstungen, die der Volkstribun, der den Antisemitismus zum politisch-populistischen Programm erhoben hatte, angerichtet habe, indem er die »Bierbank in den Beratungssaal« gestellt und »die Dummheit repräsentationsfähig gemacht« habe – wirken die frühen Arbeiten im »Prager Tagblatt« mit ihrer Bildungshuberei überladen und überanstrengt, sprachlich und vom Duktus her beinah betulich, »verstuckt«, weit entfernt jedenfalls von dem, was man als »typisch Kuh« bezeichnen würde, und noch die Beiträge der späten 1910er Jahre wirken »con sordino« – gedämpft von Chefredakteur Karl Tschuppik, der das junge Talent zwar protegiert, dessen Texte aber gehörig herunterstimmt.
Ab Feber 1914 liefert Anton Kuh einigermaßen regelmäßig Beiträge, in dichter Folge ab Winter 1915/1916. Da sind die Tageszeitungen voll mit lakonischen, jeweils numerierten »Verlustlisten«, die, getrennt nach Offizieren und Mannschaft, alphabetisch die Verwundeten, Toten und Kriegsgefangenen aufführen und die schon im Herbst 1914 in Fortsetzungen, die sich über mehrere Ausgaben erstrecken, Seiten um Seiten füllen; mit ellenlangen Rubriken wie »Patriotische Spenden« – etwa »Für die Familien der Reservisten und Hinterbliebenen unserer gefallenen Soldaten« –, die nicht nur das jeweilige »Gesamtergebnis« ausweisen, sondern vereinzelt namentlich die Spender und den erlegten Betrag (so spendet etwa »Witwe Moritz aus dem Anlasse, daß sie nach längerer Zeit Nachricht von ihrem im Felde stehenden Sohne erhalten hat«, 25 Kronen[115]). Da nehmen die unzähligen Hilfsaktionen, Notfonds und Sammlungen wie »Gold gab ich für Eisen« (bei der patriotische Bürgerinnen und Bürger etwa einen Ring, ein Paar Ohrgehänge, eine Krawattennadel, eine Uhrkette oder Manschettenknöpfe spenden), der »Wehrmann im Eisen« (eine der zahlreichen Spendenaktionen zugunsten von Kriegswitwen und -waisen[e]) Spalten um Spalten ein. Desgleichen »Auszeichnungen für Verdienste im Kriege«: Tag für Tag wird kundgetan, daß der Kaiser resp. der König beschlossen habe zu ernennen: »in Anerkennung hervorragender Dienstleistung vor dem Feinde« dem Obersten X den Orden der Eisernen Krone zweiter Klasse mit der Kriegsdekoration; »in Anerkennung tapferen und erfolgreichen Verhaltens vor dem Feinde« dem Generalmajor Y das Ritterkreuz des Leopold-Ordens mit der Kriegsdekoration; »in Anerkennung tapferen Verhaltens vor dem Feinde dem vor dem Feinde gefallenen« Major Z die Kriegsdekoration zum Orden der Eisernen Krone dritter Klasse.[116] Desgleichen »Aus dem Goldenen Buch der Armee«: Nicht nur die jeweilige Tapferkeitsmedaille, sondern auch die »Heldentat« jener namentlich Genannten wird hier angeführt, mit der sie »im Ringen mit dem Feinde« und »zur Bewunderung aller Bürger« den Ruhm des Vaterlands »in unvergleichlich tapferer Art« erhöhten.
Da haben auch die geistigen Regimenter längst mobil gemacht. Die erste öffentliche Initiative zur moralischen Aufrüstung der deutschen Bevölkerung durch Größen aus Wissenschaft und Kunst datiert vom 4. Oktober 1914. Der »Aufruf an die Kulturwelt«, der an diesem Tag in den großen deutschen Tageszeitungen erscheint und, in zehn Sprachen übersetzt, weltweit verbreitet wird, trägt die Unterschriften von dreiundneunzig Repräsentanten deutscher Geisteswelt, darunter sechsundfünfzig Professoren. Sie verwahren sich darin »gegen die Lügen und Verleumdungen, mit denen unsere Feinde Deutschlands reine Sache in dem ihm aufgezwungenen schweren Daseinskampfe zu beschmutzen trachten«; bestreiten, »daß wir freventlich die Neutralität Belgiens verletzt haben«, »daß eines einzigen belgischen Bürgers Leben und Eigentum von unseren Soldaten angetastet worden ist, ohne daß die bitterste Notwehr es gebot«; sprechen den Franzosen und den Engländern, »die sich mit Russen und Serben verbündeten und der Welt das schmachvolle Schauspiel bieten, Mongolen und Neger auf die weiße Rasse zu hetzen«, das Recht ab, »sich als Verteidiger europäischer Zivilisation zu gebärden«; und versichern abschließend in patriotischem Überschwang, »daß wir diesen Kampf zu Ende kämpfen werden als ein Kulturvolk, dem das Vermächtnis eines Goethe, eines Beethoven, eines Kant ebenso heilig ist wie sein Herd und seine Scholle«. In der »Erklärung der Hochschullehrer des Deutschen Reiches« vom 16. Oktober 1914 machen die 3016 Unterzeichneten dem Epitheton »geistiges Leibregiment der Hohenzollern«, mit dem die Berliner Universität vom Physiologie-Ordinarius Emil Du Bois-Reymond bedacht wurde, alle – zweifelhafte – Ehre, indem sie »mit Entrüstung« das Ansinnen der »Feinde Deutschlands, England an der Spitze«, zurückweisen, zugunsten der Akademiker »einen Gegensatz machen [zu] wollen zwischen dem Geiste der deutschen Wissenschaft und dem, was sie den preußischen Militarismus nennen. In dem deutschen Heere ist kein anderer Geist als in dem deutschen Volke, denn beide sind eins, und wir gehören auch dazu. […] Unser Glaube ist, daß für die ganze Kultur Europas das Heil an dem Siege hängt, den der deutsche ›Militarismus‹ erkämpfen wird, die Manneszucht, die Treue, der Opfermut des einträchtigen freien Volkes.«[117]
Das gemeine Volk wird »mitgenommen«: Auf dem Gelände des Kaisergartens und der angrenzenden Galizinwiese im k. k. Prater findet von Mai bis Oktober die »Kriegsausstellung Wien 1917« statt, eine überarbeitete Neuauflage des im Jahr zuvor auf 50.000 Quadratmetern inszenierten Spektakel-Themenparks mit musikalischem Begleitprogramm. War die Galizinwiese 1916 noch von einem engmaschigen Netz unterschiedlicher Schützengräben-, Verteidigungs- und Stollenanlagen durchzogen – das erste, bereits im Herbst 1915 im Prater veranstaltete »Kriegsspektakel« und der Publikumsmagnet, der Schützengraben, war nunmehr in die Abteilung »Marine-Schauspiele« integriert –, erwarten das p. t. Publikum – Eintritt 1 Krone, an Sonn- und Feiertagen 60 Heller, Kinder und Mannschaft 40 Heller – am Ende seines Parcours durch die Trophäenhalle und die Schaustellungen der einzelnen Waffengattungen, vorbei an Prothesen-Werkstätten, den Abteilungen »Kriegsgefangenenwesen«, »Kunst«, »Kriegsgräber«, »Literatur«, der »Halle der Verbündeten« und der Kriegsfürsorge, dort nunmehr das aus Innsbruck überstellte Kolossal-Rundgemälde »Die Schlacht am Berg Isel bei Innsbruck am 13. August 1809« von Michael Zeno Diemer, der Pavillon der Sappeurtruppe und jener der »Marine-Schauspiele« (neu auch die Abteilung »Ernährungswesen und Hauswirtschaft im Kriege«). Das Ziel des »patriotischen Vorhabens« ist indes unverändert: »In erster Linie der Bevölkerung einen Einblick in die moderne Kriegführung zu gewähren, den Zusammenhang aller mit dem Kriege in Verbindung stehenden geistigen, wirtschaftlichen und sozialen Tätigkeit darzulegen, den ungeheuren Apparat zu demonstrieren, der in Bewegung gesetzt werden muss, um dem einzigen grossen Ziele zuzusteuern, ferner über die ungeheure Wichtigkeit, die der Arbeit jedes Einzelnen im Hinterlande zukommt, aufzuklären, und auf die Notwendigkeit hinzuweisen, dass jedermann im Hinterlande seine Pflicht tun und sich der Gesamtheit unterordnen müsse. In zweiter Linie die zur Linderung der Kriegsschäden geschaffenen militär-humanitären und Fürsorge-Einrichtungen zu stärken und zu popularisieren. / Die Ausstellung sollte auch einen patriotischen Mittelpunkt in der Zeit der Bedrängnis schaffen und durch ihren vorwiegend belehrenden Charakter Verständnis für die ungeheure Arbeit, die aufgewendet werden muss, um die im Volke schlummernden Kräfte für einen einzigen bestimmten Zweck dienstbar zu machen, zu wecken und das Zusammengehörigkeitsgefühl aller Nationen des Staates zu stärken.«[118] – Weniger verblümt 1916: »Die Bevölkerung wird sich ein Bild über alles das machen, was mit dem Kriege in innigem Zusammenhang steht, und wenn überhaupt die Opferwilligkeit der Bevölkerung noch steigerungsfähig ist, ermutigt werden, bis zum Ende auszuharren.«[119] – Karl Kraus glossiert 1916 unter dem Titel »Es zieht« einen Zeitungsbericht über die Abteilung 21 der Kriegsausstellung, »Kunst«: »… um die Palme ringen …. Die imposanten Winterlandschaften stellen gewissermaßen die kriegerischen Ereignisse in den Schatten … . Schattenstein … . fesselt der Blick … . Mehrere Landschafter der Wiener Künstlervereinigungen haben gewissermaßen durch den Krieg an Tiefe und geistiger Auffassung gewonnen … . Das Ölgemälde ›Operation einer Schußwunde‹ … . im Vordergrunde unsere braven Soldaten … . in dieser flüchtigen Übersicht … . ein Ruhmestitel unserer Kriegsmaler … . Aufmachung … . kennzeichnen den ehrlich-künstlerischen Zug, der durch alle Säle geht« – mit dem Fazit: »Zumachen!«[120]
Anton Kuh verbringt den Ersten Weltkrieg im Hinterland. Nach gut drei Monaten Dienst in einer Ersatz-Kompanie Ende Oktober 1915 für »waffenunfähig« erklärt, bleibt ihm der Schimpf des Armeeliteratentums, dem im Rahmen des Kriegspressequartiers die – bis auf wenige Ausnahmen auch willfährig erfüllte – Aufgabe zugedacht ist, den Seelenaufschwung und die »Moral« jener im Felde wie auch an der »Heimatfront« in Lyrik und Prosa zu befördern, erspart. Minutiös nimmt sich Kuh der ganz banalen Schrecken des Hinterlands an: der erstickenden Dumpfheit eines militarisierten Alltags, der Unbarmherzigkeit von Militärärzten, die bei Assentierungen Krüppel für diensttauglich erklären, der materiellen Not, der Verelendung, des Hungers, der Verzweiflung, der Brutalisierung. Vom allgemeinen Begeisterungstaumel der »großen Zeit« keine Spur, dennoch finden sich vereinzelt Arbeiten, die – ganz auf der Linie des »Prager Tagblatts« – Konzessionen an die Ressentiments gegenüber den Kriegsgegnern erkennen lassen.[121]
Er schildert unter den Rubriken »Kleine Chronik«, »Vom Tage« und »Notizen« die Atmosphäre in der vom Krieg gebeutelten Reichshaupt- und Residenzstadt, glossiert die zunehmend prekäre Versorgungslage, die behördlich verfügten Einschränkungen des gesellschaftlichen Lebens und Treibens: Zu Silvester 1915 etwa werden die Wiener unter Hinweis auf den »Ernst der Kriegszeit«, daran erinnert, »daß viele Familien in Trauer, viele in banger Sorge um ihre im Felde stehenden, verwundeten, gefangenen oder vermißten Angehörigen sind. Dieser Hinweis wird für jeden, der Gemüt und Gesittung besitzt, wohl an sich genügen, um zu vermeiden, daß Kränkungen durch taktlosen Silvesterlärm und Silvesterulk erfolgen. Überdies sind solche Ausschreitungen behördlich verboten und die Wache hat den Auftrag, rücksichtsvoll, aber nötigenfalls auch strenge vorzugehen.«[122] Aufgrund der »kriegsbedingt« ohnehin prekären Versorgungssituation und überdies rückgängigen Kohlelieferungen werden behördlicherseits am 16. Dezember 1916 drastische Sparmaßnahmen verfügt: Nicht nur haben Gewerbebetriebe (ausgenommen Lebensmittelhändler) spätestens um 19 Uhr zu schließen und wird die Außenbeleuchtung von Vergnügungsetablissements, Gasthäusern und Geschäftslokalen verboten, auch die Sperrstunde wird für Gasthäuser auf 23 und für Kaffeehäuser auf 24 Uhr festgesetzt und per 12. Feber 1917 vorverlegt auf 22 resp. 23 Uhr.[123]
Der durch den schneereichen und eisig kalten Winter 1916/1917 verursachte extreme Kohlemangel zieht nicht nur die Sperre der Theater-, Konzert- und Kinosäle, die Schließung der Schulen, die beinah gänzliche Einstellung der öffentlichen Beleuchtung sowie die Vorverlegung der Gaststätten-Sperrstunde nach sich, sondern im Feber auch eine weitere Einschränkung des Betriebs der öffentlichen Verkehrsmittel. Seit Ende September 1916 ist auch der Stellwagenverkehr auf ein Minimum reduziert; man braucht die Pferde für »kriegswichtige« Transporte. Per 13. Feber 1917 wird der Stellwagen außer Dienst gestellt.[124] Die Einführung der Sommerzeit in Österreich-Ungarn im Jahr 1916 – der Grund erhellt aus der amtlichen Kundmachung: »bessere Ausnützung des Tageslichtes und Ersparung an künstlicher Beleuchtung«[125] – kommt Anton Kuh, den bekennenden Neurastheniker, besonders hart an.