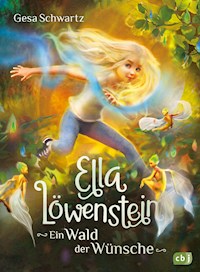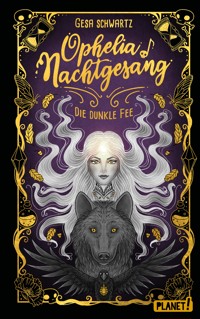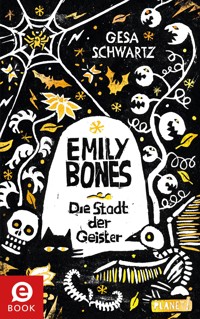12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Planet! in der Thienemann-Esslinger Verlag GmbH
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Wenn Schatten lebendig werden Ash Traumfeuer ist ein Schatten. Er lebt im magischen Prag unserer Welt und stiehlt den Menschen die Träume. Denn Träume sind in der Schattenwelteine kostbare Währung. Sein Leben ändert sich schlagartig, als unter seinesgleichen eine rätselhafte Krankheit um sich greift. Ash geht dem nach und begegnet dabei der zwölfjährigen Lucy. Sie sucht nach ihrem Vater, einem Schattenjäger, dessen Verschwinden mit den mysteriösen Vorkommnissen zusammenhängt. Gemeinsam machen Lucy und Ash sich auf, um mit vereinten Kräften und viel Magie Lucys Vater zu finden und den Untergang ihrer Stadt zu verhindern ... Ein außergewöhnliches Buch mit Tiefgang und Humor Von Gesa Schwartz außerdem bei Planet! erschienen: Emily Bones - Die Stadt der Geister Ophelia Nachtgesang
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Das Buch
Ash Traumfeuer ist ein Schatten. Er lebt im magischen Prag unserer Welt und stiehlt den Menschen die Träume. Denn Träume sind in der Schattenwelt eine kostbare Währung. Sein Leben ändert sich schlagartig, als unter seinesgleichen eine rätselhafte Krankheit um sich greift. Ash geht dem nach und begegnet dabei der zwölfjährigen Lucy. Sie sucht nach ihrem Vater, einem Schattenjäger, dessen Verschwinden mit den mysteriösen Vorkommnissen zusammenhängt. Gemeinsam machen Lucy und Ash sich auf, um mit vereinten Kräften und viel Magie Lucys Vater zu finden und den Untergang ihrer Stadt zu verhindern ...
Die Autorin
© Moutevelidis Photography
Gesa Schwartz wurde 1980 in Stade geboren. Sie hat Deutsche Philologie, Philosophie und Deutsch als Fremdsprache studiert. Ihr besonderes Interesse galt seit jeher dem Genre der Phantastik. Nach ihrem Abschluss begab sie sich auf eine einjährige Reise durch Europa auf den Spuren der alten Geschichtenerzähler. Für ihr Debüt „Grim. Das Siegel des Feuers“ erhielt sie den Deutschen Phantastik Preis in der Sparte Bestes deutschsprachiges Romandebüt. Seither wurden ihre Bücher mehrfach ausgezeichnet und in viele Sprachen übersetzt. Gesa Schwartz lebt mit ihrer Familie in Hamburg und schreibt am liebsten in ihrem Zirkuswagen.
Mehr über Gesa Schwartz: www.gesa-schwartz.de
Gesa Schwartz auf Facebook: https://www.facebook.com/GesaSchwartz
Der Verlag
Du liebst Geschichten? Wir bei Planet in der Thienemann-Esslinger Verlag GmbH auch!Wir wählen unsere Geschichten sorgfältig aus, überarbeiten sie gründlich mit Autor*innen und Übersetzer*innen, gestalten sie gemeinsam mit Illustrator*innen und produzieren sie als Bücher in bester Qualität für euch.
Deshalb sind alle Inhalte dieses E-Books urheberrechtlich geschützt. Du als Käufer*in erwirbst eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf deinen Lesegeräten. Unsere E-Books haben eine nicht direkt sichtbare technische Markierung, die die Bestellnummer enthält (digitales Wasserzeichen). Im Falle einer illegalen Verwendung kann diese zurückverfolgt werden.
Mehr über unsere Bücher, Autor*innen und Illustrator*innen auf:www.thienemann-esslinger.de
Planet! auf Facebook:www.facebook.com/thienemann.esslinger
Planet! auf Instagram:https://www.instagram.com/thienemannesslinger_kinderbuch
Viel Spaß beim Lesen!
1
Ash
Das Dach des Veitsdoms war verteufelt glatt. Mit ausgebreiteten Armen balancierte Ash auf dem First, den schwarzen Hut tief in die Stirn gezogen. Sein Mantel wehte im nächtlichen Wind der Goldenen Stadt, der Regen schlug ihm ins Gesicht. Doch er achtete nicht darauf. Er konzentrierte sich auf sein Ziel: den Dachreiter, der vor ihm aufragte. Langsam bewegte Ash sich darauf zu, Schritt für Schritt über das verfluchte Metall.
»Was zur Hölle tust du da?«
Im letzten Moment hielt Ash das Gleichgewicht. Hinter dem Dachreiter lugte eine dunkle Gestalt hervor. Sie sah aus wie eine Mischung aus Äffchen und Katze mit pechschwarzem Fell und leuchtenden grünen Augen. Ihr breiter Mund zeigte messerscharfe Zähne.
»Verdammter Nachtalb«, stieß Ash aus. »Das ist nicht der richtige Ort, um mich zu erschrecken, Fumi!«
»Das ist für gar nichts der richtige Ort«, gab Fumi zurück. »Du hast mit deinem Brennenden Brief fast meine Efeutute abgefackelt, so überschwänglich war er geschrieben. Und ich verstehe ja, dass du deine Entlassung aus dem Kerker feiern willst. Aber hätten wir das nicht auch bei mir machen können?«
»Eine modrige Gruft entspricht nicht meiner Vorstellung von Gemütlichkeit.«
»Ganz im Gegensatz zu einem Kirchendach in strömendem Regen. Schon klar.« Fumi schüttelte sich, dass die Tropfen nur so flogen. »Scheint ganz so, als hätten dich die zwei Wochen im Kerker noch sonderbarer gemacht, als du es ohnehin schon bist.«
»Siebzehn Nächte«, verbesserte Ash ihn. »Und ja, schon möglich, dass mir die ewige Finsternis etwas auf die Stimmung geschlagen hat. Immerhin habe ich beinahe gar nichts Schlimmes getan.«
Fumi schnalzte mit der Zunge. »Den Hut des Königlichen Buchhalters zu stehlen und mit unsichtbarer Kreide zu bemalen, die mitten in einer hochoffiziellen Sitzung des Finanzgremiums anfängt zu blinken und einen Pferdehintern zeigt – als nichts würde ich das kaum bezeichnen.«
»Es war ein Ochsenhintern«, stellte Ash fest. »Weil der Buchhalter ein Hornochse ist. Wie ich hörte, hat die Königin heimlich gelacht.«
»Eingesperrt hat sie dich trotzdem.«
»Sie hat mich auch wieder freigelassen.«
Fumi zuckte die Achseln. »Natürlich. Weil du immer noch einer ihrer besten Jäger bist.«
»Sie hat mich aus ihrer Gilde geworfen.«
»Du hast ihr keine Wahl gelassen. Wie viele ihrer Regeln hast du in den letzten Monaten gebrochen? Alle?«
»Regeln sind doch genau dafür da«, meinte Ash. »Um gebrochen zu werden. Das ist ihr ganzer Reiz.«
Fumi seufzte. »Manche Regeln machen durchaus Sinn. Zum Beispiel die, nach der wir uns vor den Menschen verbergen sollen. Findest du es wirklich klug, auf der höchsten Kathedrale des Landes herumzuturnen? Noch dazu in einem verflixten Menschenkörper?«
Ash schnaubte. »Das ist kein Menschenkörper, wann merkst du dir das endlich? Das ist ein magisches Meisterwerk! Sieh hin! Meine Haut ist glatt wie Marmor, mein Haar silbern wie Sternenlicht! Dieser Körper ist ein idealer Schutz vor allen Widrigkeiten dieser Welt. Ich muss mich nur wieder daran gewöhnen, jenseits des Schattenreichs damit herumzulaufen. Und wo könnte ich das besser als hier oben?«
»Ja, ja«, murmelte Fumi. »Du kennst dieses Dach in- und auswendig. Jede zerbrochene Schindel, jede Feder des Wetterhahns. Kein Wunder, so oft, wie du hier herumspazierst. In welcher Welt auch immer.«
»Du sagst es. Ich bin der Meister dieses Dachs.« Ash sprang auf den Dachreiter zu, so schnell, dass sein Mantelsaum in schwarzem Feuer aufflammte. Dann lehnte er sich rücklings an den Turm. Fumis Schreck über das Feuer kitzelte Ashs Nacken. Nachtalbenfell war in magischen Flammen mitunter sehr leicht entzündlich.
»Die Menschen werden begeistert sein, wenn sie einen brennenden Schatten über ihre Kirche springen sehen«, seufzte Fumi.
»Kein Mensch schaut bei diesem Wetter nach oben. Abgesehen davon, dass die Menschen in ihrer Ahnungslosigkeit sowieso nichts erkennen würden. Sie haben keinen Blick mehr für das Magische. Das weißt du doch.«
»Und was ist mit den Jägern der Königin? Denen, die noch Mitglieder ihrer Gilde sind und alles tun würden, um dem Bestienbezwinger Ash Traumfeuer für seine ewige Arroganz einen Denkzettel zu verpassen?«
Ein Blitzen ging durch Ashs Blick. »Die sitzen gerade auf ihrer jährlichen Hauptversammlung in der Schattenburg und hören sich langweilige Vorträge an. Und anschließend planen sie ebendort den bevorstehenden Ball der Königin, auf dem sich die hochwohlgeborenen Schatten drei Tage und Nächte selbst bejubeln werden. Kurz: Sie bekommen nichts mit von dem, was heute Nacht im Regen der Menschenwelt passiert. Glaub mir, der Bestienbezwinger spricht aus Erfahrung.«
Ein breites Lächeln flog über Fumis Gesicht. »Das hättest du auch gleich sagen können!«
»Dann hättest du ja viel weniger Angst gehabt. Wie langweilig.« Ash zog seine Spielkarten aus der Tasche und warf sie von einer Hand in die andere. Die silbernen Ringe an seinen Fingern klirrten und die Karten landeten akkurat übereinander. »Na also«, verkündete er stolz. »Ich bin schon fast wieder der Alte. Bis auf eine Kleinigkeit.« Er drehte sich zu Fumi um. »Schau mir in die Augen. Wie sehen sie aus?«
»Wie der verfluchte Nachthimmel mit tausend funkelnden Sternen«, meinte Fumi. »Wie auch sonst? Du bist ein Schatten. Du hast Schattenaugen.«
»Normalerweise sind sie schwarz«, warf Ash ein. »Jetzt sind sie grau. Der Kerker hat mir die Kräfte geraubt. Meine Magie ist schwach wie ein Trollweib an Neumond.«
Fumi wischte sich einen Regentropfen aus dem Auge. »Nun ja. Regen und Kälte werden sie dir kaum wiedergeben.«
»Nein«, stimmte Ash ihm zu. »Aber die Farben da drüben schon.«
Fumi schaute über die Dächer – und sog die Luft ein. In dichten Strömen ging der Regen auf die Gassen nieder. Und aus dem Meer der glühenden Lichter stiegen die ersten nächtlichen Träume der Menschen auf, schillernd wie Seifenblasen. Fumi seufzte verzückt.
»Ich habe sie noch nie von hier oben gesehen«, flüsterte er andächtig.
»Deswegen habe ich dich herbestellt«, erwiderte Ash. »Ich brauche einen Flug durch die Träume, um neue Kraft zu sammeln. Und mit wem macht das mehr Spaß als mit meinem besten Freund?«
Fumi warf ihm einen Blick zu. »Deinem besten Freund mit ausgezeichneten Ohren und einer Nase, die jeden Jäger schon lange vor dir riechen würde? Nur für den Fall, dass vielleicht doch einer unseren Weg kreuzt? Gib es zu, du willst mich zu deiner eigenen Sicherheit dabeihaben!«
»Mein ganz persönliches Frühwarnsystem.« Ash schubberte über Fumis Kopf, bis der Alb aussah wie ein Pudel mit Föhnfrisur. »Aber wenn du Angst hast, dass uns irgendwer dabei erwischt, wie wir gegen die allseits so beliebten Regeln verstoßen, und dir nicht der Sinn nach einem kleinen Abenteuer steht …«
Fumi grinste. »Ich bin ein Nachtalb, du bist ein Schatten. Wir sind dafür gemacht, nicht gesehen zu werden.« Und etwas leiser fügte er hinzu: »Jedenfalls solange die Jäger der Königin in der Burg festsitzen.«
Ash trat an den Rand des Daches. »Bereit für einen Flug auf dem Feuer der Träume?«
Schnell sprang Fumi auf Ashs Schulter. »Bereit, wenn du es bist. Wir …«
Ehe er den Satz beenden konnte, stürzte Ash vor. Fumi krallte sich in seine Schulter und schrie in den schrillsten Tönen. Ash hingegen lachte das raue, dunkle Lachen eines Schattens.
Ja, dachte er, als der Wind sein Feuer neu entfachte. Ich bin wieder da!
Mühelos griff er nach dem Seil, das von einer der Fialen hinabhing, und lief an der Fassade abwärts. Er kam am Boden auf, und im selben Moment, da das Seil zu Asche wurde, begann er zu rennen.
»Du bist vollkommen verrückt«, keuchte Fumi. »Hättest du mir nicht was von dem Seil sagen können?«
»Wo bleibt denn da der Spaß?«
Sie eilten die Treppe zur Prager Burg hinab und sprangen auf ein angrenzendes Hausdach. Da schwebten sie direkt vor ihnen: die Träume der Menschen. Manche waren klein wie Spatzen, andere groß wie Findlinge. Ash sah einen Traum von einem wellenschlagenden Ozean, und mit einem kreischenden Fumi auf der Schulter sprang er mitten hinein. Sofort wurden sie beide von tobenden Wellen erfasst. Ash fühlte das Grollen des Meeres und breitete die Arme aus. Wie ein Vogel erhob er sich in die Luft und flog aus dem Traum heraus.
»Und ich dachte, wir könnten nicht mehr nasser werden«, rief Fumi, als sie triefend über das Dach kugelten. Aber der Nachtalb lachte vor Vergnügen, und gleich darauf sprangen sie in rascher Folge durch weitere Träume.
Sie landeten in einem Berg aus Süßigkeiten, hechteten über weiche Wattewolken und glitten durch die Wärme von drei roten Sonnen.
Fumi warf begeistert die Arme in die Luft, als sie durch einen schillernden Regenbogen stoben, und Ash konnte sie spüren: die Gefühle und Gedanken der Menschen, die diese Träume zum Leben erweckten. Sie waren es, die die Farben leuchten ließen, und sie flossen wie bunte Ströme durch ihn hindurch, bis jede Erinnerung an den finsteren Kerker verdrängt war.
»Warum machen wir das nicht öfter?«, fragte Fumi, als sie schließlich stehen blieben.
Um sie herum stiegen viele kleine Träume auf.
Ash betrachtete einen Sonnenaufgang, der an seinem Gesicht vorbeischwebte. »Leider hocken die Jäger der Königin nur einmal im Jahr alle zusammen«, meinte er. »Würden wir so was wie heute jede Nacht veranstalten, wären uns Dauerkarten für den Kerker sicher.« Er berührte den Sonnenaufgang, der sich umgehend in eine Kugel aus Eis verwandelte. Schnell schnappte Ash sie aus der Luft und ließ sie in seinem Mantel verschwinden.
Fumi kicherte. »Wenn die Menschen wüssten, dass wir ihre Träume in der Schattenwelt als Währung benutzen ... oder dass es überhaupt eine Schattenwelt gibt, die neben ihrer eigenen existiert! Sie würden wahrscheinlich verrückt werden.«
Ash lächelte, während er weitere Träume in seine Taschen steckte. Auf den Basaren seiner Welt konnte man mit ihnen die schönsten Dinge kaufen. Einen Schal aus Regenbogen. Einen magischen Hut. Oder den Geschmack von Wolken. Und ganz nebenbei erfüllten die menschlichen Träume die Schattenwelt mit etwas, das jedes Anderwesen zum Leben brauchte: Magie.
Ash betrachtete seine Finger, an denen ein wenig Farbe haften geblieben war. »Sie haben keine Ahnung«, sagte er leise. »Die Menschen wissen nicht mehr, wie mächtig ihre Träume sind.«
Fumi öffnete den Mund, um etwas zu erwidern. Aber stattdessen kam ein lautes »Hatschi!« über seine Lippen. »Oha«, schniefte er. »Irgendwas riecht hier komisch.«
Ash blickte sich um. »Vielleicht der Traum da von den grünen Wildschweinen? Die sehen ganz schön stinkig aus.«
»Nein«, murmelte Fumi. »Es riecht nach … Schatten.«
Ash witterte, und da roch er ihn auch: diesen eigentümlichen Duft von Asche, Nacht und Zedernholz, der sein Volk auszeichnete. Er war kaum wahrzunehmen. Nur Schatten untereinander konnten ihn riechen. Und die feine Nase eines Nachtalbs.
So lautlos wie möglich folgten sie der Fährte. Mit wenigen Ausnahmen war es den Schatten und übrigen Anderwesen nicht erlaubt, ihre Welt zu verlassen. Zu groß war die Gefahr, dass sie den Menschen auffielen. Und wozu die Menschen fähig waren, wenn sie von Anderwesen Wind bekamen, war in der Schattenwelt allgemein bekannt.
»Sieh nur«, raunte Fumi. »Du bist tatsächlich nicht der einzige Sammler hier heute Nacht.«
Ash folgte seinem Blick. Ganz in der Nähe färbten sich mehrere Träume schwarz und zerbrachen.
»Das ist kein Sammler«, sagte Ash dunkel. »Das ist ein Dieb.«
Fumi hielt den Atem an. »Und was tun wir jetzt?«
»Das, was Jäger eben tun«, erwiderte Ash mit einem Lächeln. »Wir werden ihn fangen.«
2
Lucy
Schlaftrunken richtete Lucy sich auf. Gerade noch war sie in ihrem Traum auf einem Greifenvogel durch einen gewittergrünen Himmel geritten. Jetzt saß sie kerzengerade in ihrem Bett. Es war mitten in der Nacht. Irgendetwas hatte sie geweckt. Aber was?
Sie schaute sich in ihrem Zimmer um, doch alles sah aus wie immer. Der Schreibtisch neben ihrem Bett. Ihr Kleiderschrank. Und ihr Bücherregal, das Zweigstellen auf dem Boden aufgemacht hatte, weil Lucy einfach zu viele Bücher hatte. Das meinte jedenfalls ihr Vater, wenn er wieder einmal über einen ihrer Büchertürme stolperte.
Man kann gar nicht zu viele Bücher haben, war immer Lucys Antwort. Du weißt das ja wohl am besten, wenn ich mir deine eigene Büchersammlung so anschaue. Und dann lächelte ihr Vater.
Da war es wieder! Ein lautes Poltern aus dem Keller. Lucy gähnte. Keine Frage, dieser Radau hatte sie geweckt. Wahrscheinlich hantierte ihr Vater in seinem Labor herum. Sie hätte zu gern nachgesehen, woran er gerade arbeitete, und warf einen schuldbewussten Blick auf ihre Mathebücher. Eigentlich müsste sie sich jetzt umdrehen und weiterschlafen. Am Morgen stand ein wichtiger Test in der Schule an, und in Mathe war sie nicht gerade eine Leuchte. Was möglicherweise daran lag, dass sie es furchtbar langweilig fand.
Langweilig ist gut, pflegte ihr Vater zu sagen. Es bedeutet Sicherheit.
Lucy sah das völlig anders. Es gab kaum etwas, das sie so gefährlich fand wie Langeweile. Denn da kamen ihr die verrücktesten Ideen.
Wieder polterte es. Entschlossen schlug Lucy die Bettdecke beiseite. Bei dem Lärm konnte sie ohnehin nicht schlafen. Sie würde ihrem Vater Gesellschaft leisten, bis er mit dem Gerumpel fertig war. Vielleicht konnte sie ihn überreden, ihr von seinen neuesten Abenteuern zu erzählen. Denn anders als sie selbst, der nur in Büchern spannende Dinge passierten, erlebte ihr Vater wirklich welche.
Sie stand auf und spürte eine seltsame Kälte, die über die Dielen an ihr hochkroch. Obwohl die Heizung glühte, zogen sich Eisblumen über den Spiegel an der Wand. Lucys Herz schlug schneller.
Es war lange her, seit ihr Vater zuletzt Besuch aus der anderen Welt gehabt hatte – dem Reich der Schatten, in dem die Anderwesen lebten. Aber das hier roch förmlich nach Magie.
Aufgeregt schlüpfte Lucy in ihren Morgenmantel. Ob ein Anderwesen zu ihnen gekommen war?
So leise wie möglich huschte Lucy die Treppe ins Erdgeschoss hinab. Hinter deren Geländer versteckte sie sich hin und wieder, um die geheimen Besucher ihres Vaters zu beobachten. Doch jetzt gab es nichts zu sehen. Die Geräusche kamen tatsächlich aus dem Keller.
Trotzdem wollte Lucy so wenig Lärm wie möglich verursachen. Immerhin wusste sie nicht, wer der nächtliche Besucher war. Viele Anderwesen waren nicht gut auf Menschen zu sprechen. Und es gab einige magische Kreaturen, die auf Störungen sehr empfindlich reagierten. Wie der Werwolf, der als kleiner blasser Mann zu ihrem Vater gekommen war, um mit ihm über seine Wutanfälle zu sprechen. Als plötzlich die Kirchturmglocken geschlagen hatten, da hatte er sich vor Schreck verwandelt. Versehentlich hatte er dabei mit einer einzigen Klauenbewegung zwei Tische und eine Küchenwaage kaputt gemacht. Hinterher hatte er sich vielmals entschuldigt. Aber Lucy, die das Ganze von ihrem Versteck auf der Treppe aus mitbekommen hatte, war noch nächtelang von Albträumen mit Werwölfen und fliegenden Küchenwaagen heimgesucht worden.
Sie schlich sich zur Kellertür und lauschte. Lucy rechnete fest damit, die Stimme ihres Vaters zu hören oder vielleicht die Worte eines Anderwesens. Doch stattdessen schepperte es noch einmal. Dann war es still. Lucy zog die Brauen zusammen. War ihr Vater womöglich gar nicht zu Hause? Aber wer randalierte sonst dort unten im Keller herum?
Sicher war es die dicke graue Ratte, die hin und wieder durch ein Abflussrohr in den Keller kam und die Vorräte fraß. Das letzte Mal hatte sie Lucys Winterjacke als Nachtisch angeknabbert und die magischen Utensilien ihres Vaters durcheinandergebracht. Wahrscheinlich hatte das Tier jetzt irgendeinen Kältezauber umgestoßen, denn auch über die Türklinke zogen sich Eisblumen. Lucy drückte sie vorsichtig hinunter. Dieses Mal würde sie ihre Jacke verteidigen!
Ein schwacher Minzgeruch wehte ihr entgegen. Wie immer schauderte sie beim Anblick der dunklen Treppe. Sie hielt den Atem an, als sie dennoch tapfer die Stufen hinabschlich. Schritt für Schritt verließ sie die gemütliche Wohnung mit den plüschigen Teppichen, den Blumen in den Vasen (auch wenn die meisten davon vertrocknet waren), und den kleinen Lämpchen an den Wänden. Am Fuß der Treppe breitete sich ein anderes Reich vor ihr aus. Das Reich ihres Vaters.
Deckenhohe Regale formten schmale Gänge, und darin türmten sich uralte Bücher, magische Artefakte und gläserne Phiolen. Lucy kam sich wie immer vor wie in einem magischen Labyrinth.
Die Ratte war nirgends zu sehen. Wahrscheinlich hatte sie das Weite gesucht, als sich die Kellertür geöffnet hatte. Und natürlich hatte sie vorher noch ein wenig Unordnung gemacht.
Lucy blieb vor dem Schreibtisch ihres Vaters stehen. Dort lag eine zerbrochene Phiole. Die Magie hatte sich bereits verflüchtigt. Vermutlich hatte sie tatsächlich den Kältehauch verursacht, der durchs Haus gefegt war. Lucy warf die Scherben in den Abfalleimer und musste lächeln. Sie dachte daran, was andere Väter für gewöhnlich in ihren Kellern hatten: eine Modelleisenbahn, eine Hausbar oder eine Werkstatt. Ihr Vater war anders.
Er wusste, dass Schatten nicht nur eine Projektion waren, sondern lebendige Wesen, die in einer eigenen Welt lebten: dem Reich der Schatten, das parallel zur Welt der Menschen existierte. Er wusste auch, dass Anderwesen jeder Art von dort in die Menschenwelt wechselten. Und dass nicht alle freiwillig wieder gehen oder sich friedlich verhalten wollten. Dann kamen die Jäger zum Zug – Schatten und Menschen wie er, die die Anderwesen zurück in ihre Welt trieben.
Lucy betrachtete sein Foto, das über dem Schreibtisch hing. Es zeigte ihren Vater bei der Kellerrenovierung vor vielen Jahren. Nodin saß auf seiner Schulter – sein Schatten, der die Gestalt eines Habichts bevorzugte und Lucy mit roten Augen durchdringend anblickte. Die Augen ihres Vaters aber funkelten blau und schelmisch, seine Haare standen lausbubenhaft von seinem Kopf ab. Sein Äußeres ließ nicht darauf schließen, was in ihm steckte. Doch er war Ezechiel Novak. Der mächtigste Jäger der menschlichen Welt.
Lucy wusste, dass dieser Name den meisten magisch bewanderten Menschen und auch vielen Anderwesen gehörigen Respekt einjagte. Aber das lag nur daran, dass niemand wusste, wer ihr Vater wirklich war. Keiner außer ihr hatte seinen albernen Tanz gesehen, mit dem er sie von schlechten Träumen ablenkte. Niemand kannte seine Kochkünste, die sich auf panierte Bananenpfannkuchen beschränkten, bei diesem einen Rezept aber Weltklasse waren. Und weder Menschen noch Anderwesen wussten, dass niemand Lucy so trösten konnte wie ihr Vater. Nicht nur, weil er mit dunkler Stimme die schönsten Geschichten erzählte. Sondern weil er Lucy verstand, gerade dann, wenn sie selbst keine Ahnung hatte, was mit ihr los war. Er hatte ein weiches Herz. Und dieses Herz schloss auch die Anderwesen mit ein.
Sie strich über die Ledersessel, die vor dem Tisch standen. Ihr Vater war für seine mächtigen Zauber und Waffen gefürchtet, und es war ihm ein Leichtes, gefährliche Anderwesen im Kampf zu besiegen. Doch er war nicht wie andere Jäger. Er brachte die Anderwesen nicht immer gleich zurück in ihre Welt. Da erwarteten sie oft heftige Strafen, denn die Königin, die dort herrschte, hatte nicht unbegründet einen gnadenlosen Ruf. Deshalb sprach Ezechiel Novak oft mit den Anderwesen, die er in der Menschenwelt fand. Und anschließend überließ er es meist ihnen, ins Schattenreich zurückzukehren. Auf diese Weise wäre mehr zu erreichen als mit Gewalt, so sagte er immer, und das habe er von einer ganz besonderen Jägerin gelernt.
Lucy betrachtete das Foto, das neben dem Bild ihres Vaters hing. Es war ein Porträt ihrer Mutter. Ihr Name war Anthea. Mit ihrem hellblonden Haar und dem schmalen Gesicht wirkte sie zart. Aber ihr Blick war unnachgiebig und ihr Lächeln das einer Kämpferin. Auch sie war eine Jägerin gewesen.
Neben ihrem Bild hing ihr Schwert in einem Glaskasten. Es hieß Fhar’lar, was in der Sprache der Schatten Singendes Schwert bedeutete. Denn es barg die Lieder der Elfen, so hatte sie es Lucy immer erzählt. Doch Lucy würde diese Lieder niemals mehr hören, ihre Mutter würde das Schwert nie wieder ergreifen. Sie war in der Welt der Schatten umgekommen, als Lucy sechs Jahre alt gewesen war.
Lucy berührte den Anhänger um ihren Hals. Es war derselbe wie der ihrer Mutter auf dem Bild: ein halbes Herz an einer Silberkette. Die andere Hälfte trug ihr Vater, den der Tod seiner Frau fast gebrochen hätte. Lucy erinnerte sich an seine Verzweiflung. Mit aller Macht hatte er damals den Schatten finden wollen, der seine Frau getötet hatte. Dafür hatte er mächtige und grausame Zauber erschaffen und war mit aller Härte gegen die Anderwesen vorgegangen. Besonders den Schatten hatte er hart zugesetzt. Viele von ihnen hassten ihn bis heute dafür. Aber schließlich hatte er seine Rachsucht hinter sich gelassen und war zurückgekehrt zu dem Weg des Mitgefühls, den er vorher gegangen war – gemeinsam mit seiner Frau.
Lucy hatte nicht vergessen, wie damals Anderwesen jeder Art bei ihnen ein und aus gegangen waren. Manche waren sogar so etwas wie ihre Freunde geworden. Lucy erinnerte sich auch an die warme Stimme ihrer Mutter. Ihr weiches Haar. Und an ihre letzten Worte, die sie zu Lucy gesagt hatte, damals, als sie zur Jagd aufgebrochen war, unwissend, dass sie nie zurückkehren würde.
Du brauchst mich nicht zu vermissen, hatte sie geflüstert wie jedes Mal, wenn sie sich voneinander verabschiedet hatten, und Lucy einen Kuss auf die Stirn gegeben. Ich bin in den Sternen. Jetzt. Und für immer.
Niemals, das wusste Lucy, würde sie diese Umarmung zwischen allen Welten vergessen.
Sie holte tief Luft. Meistens kam sie mit ihrem Leben zurecht. Aber wenn sie an ihre Mutter dachte, vermisste sie sie noch genauso stark wie damals. So sehr, dass es wehtat. Und wie immer fragte Lucy sich auch jetzt, was geworden wäre, wenn ihre Mutter nicht gestorben wäre. Sie hätte Lucy aufwachsen sehen. Sie hätte Lucys ersten Schultag erlebt und sie ins Bett bringen können. Sie wäre einfach ihre Mama aus Fleisch und Blut gewesen. Dann wäre Lucy auch eine Jägerin geworden. Und ihr Vater hätte nicht versucht, sie vor jedem noch so kleinen magischen Ding zu beschützen, wie er es jetzt tat. Doch ihre Mutter war gestorben. Als Lucy es erfahren hatte, war sie vor lauter Trauer schwer krank geworden. Und am Ende hatte sie ihren Schatten verloren, wie es häufig vorkam bei tiefstem Schmerz. Normalerweise starben die Menschen ohne einen Schatten, das wusste Lucy. Aber sie hatte überlebt. Und seitdem war alles anders.
Lucy spiegelte sich in den beiden Bilderrahmen. Sie hatte den Mund ihres Vaters. Die Augen und die Haare ihrer Mutter. Und doch unterschied sie sich völlig von ihnen. Ihr Blick war unsicher und voller Zweifel, ihr Gesicht blass und sie selbst klein und dürr. Sie sah jünger aus, als sie tatsächlich war. Auch sie hatte magische Kräfte, aber die reichten gerade, um Anderwesen sehen zu können und kleinere Zauber zu wirken. Und zu allem Überfluss litt sie auch noch unter Höhenangst. Lucy seufzte. Tief in ihrem Inneren war sie schwach. Sie würde nie eine Jägerin sein. Doch immerhin konnte sie davon träumen, einmal in die Schattenwelt zu kommen und Abenteuer zu bestehen. Denn in ihren Träumen war alles möglich.
Ein Kratzen ließ Lucy herumfahren. Es klang wie von Klauen auf Stein, und Lucy schluckte schwer. Sie hatte sich geirrt. Sie war nicht allein hier unten.
3
Ash
Vorsichtig ließ Ash sich in die Gasse hinab. Hier nahm er den Geruch seines Volkes noch stärker wahr. Es kam nicht oft vor, dass er Schatten begegnete, die genauso gern die Regeln brachen wie er. Und wenn doch, waren die Zusammenstöße meist nicht von angenehmer Art. Fumis Fell kitzelte seine Wange, als sie um die Ecke bogen. Eine Straßenlaterne am Ende der Gasse spendete etwas Licht. Und da stand er – der Dieb.
Auf den ersten Blick wirkte er wie ein alter Mann. Aber er hatte für seinen leiblichen Körper nicht so große Kunstfertigkeit aufgebracht wie Ash. Seine Hand, die an der Hauswand lehnte, war klauenähnlich, sein Haar hatte eine unnatürlich grüne Farbe. Und auch wenn Ash sie nicht sehen konnte, wusste er, dass die Augen des Fremden den Nachthimmel in sich trugen: schwarz und sternenbesetzt. Dort vor ihnen stand ein Schatten, gekleidet in die Maske eines Menschen. Doch er sammelte nicht deren Träume von den Dächern. Er raubte sie direkt aus ihren Herzen.
Ash blieb stehen. Er kannte diesen Schatten. Es brauchte nicht mehr als ein Nicken und Fumi huschte von seiner Schulter. Sofort sprang Ash vor. Sein menschlicher Körper löste sich auf und sein Schattenleib jagte als brennender Rabe die Gasse hinab. Dicht hinter dem Dieb kehrte Ash in seinen Menschenkörper zurück und packte ihn am Kragen.
»Was zum Teufel …«, keuchte der Schatten, als Ash ihn herumwirbelte und gegen die Wand presste.
»Der hat nichts damit zu tun«, erwiderte Ash. »Sogar er würde sich schämen für das, was du hier tust. Du warst einmal ein Krieger der Königin, und jetzt sieh dich an! Verflucht, Mo! Was soll das?«
Mos Augen waren seltsam verhangen. »Ich nehme mir ein paar Träume, wieso auch nicht?«, raunte er mit schwerer Zunge. »Du hast doch dasselbe gemacht.«
Mo witterte und Ash wusste, dass er die Farben an seinen Fingern riechen konnte. »Ich bestehle die Menschen nicht«, sagte Ash. »Ich nehme nur das, was sie sonst vergessen würden. Es widerspricht jeder Ehre unseres Volkes, Träume zu rauben, die nicht freiwillig zu uns kommen!«
Mo lachte rasselnd. »Ausgerechnet du sprichst von Ehre. Der sagenhafte Ash Traumfeuer! Der Bestienbezwinger und gleichzeitig der Dorn im Auge der Königin, weil er immer nur das tut, was er will. Der Schatten, der ohne einen Menschen leben kann. Du hast leicht reden. Du bist stark genug, du kommst allein zurecht. Aber ich nicht! Und auch andere Schatten nicht. Wir sterben, wenn wir keinen Menschen haben. Genau wie die Menschen, die keinen Schatten haben. Hast du das vergessen?«
Ash lockerte seinen Griff keinen Fingerbreit. »Du hast einen Menschen. Ich kann ihn in deinen Augen sehen. Er liegt im Bett und schläft. Und wenn er aufwacht, wird er seinen Schatten vermissen.«
»Blödsinn«, stieß Mo aus. »Kaum ein Mensch achtet überhaupt jemals auf uns, und meiner schon gar nicht. Er ist schwach, seine Träume sind dünn und blass. Das, was ich brauche, kann er mir nicht geben. Das können nur die Träume aus den Herzen der Menschen. Sie haben die größte Kraft, das weißt du. Sie können mein Leiden erträglich machen.«
»Welches Leiden?«, fragte Ash dunkel. »Als jämmerlicher Dieb ertappt zu werden?«
Mo stieß ein Husten aus. »Erkennst du das etwa nicht? Ich bin krank!«
Fumi kicherte laut los. Offenbar hockte er direkt über ihnen in der Regenrinne. Ash schüttelte den Kopf. »So eine dämliche Ausrede habe ich lange nicht gehört. Schatten werden nicht krank.«
»Das galt vielleicht früher«, sagte Mo. »Aber jetzt nicht mehr.« Er hustete so heftig, dass sein magerer Körper in Ashs Faust bebte. »Ich habe sie gesehen«, wisperte er. »Die anderen, denen es so geht wie mir. Arme Schlucker, wie ich es bin, die niemandem mehr auffallen. Einige husten so wie ich, andere haben Schüttelfrost. Und manche brechen einfach zusammen und stehen nicht mehr auf. Wie Menschen!«
Das letzte Wort ließ Ash frösteln – eine Regung, die er lange nicht mehr empfunden hatte. Da hörte er ein Wimmern. Er umfasste Mo fester. »Guter Versuch, mich abzulenken«, murmelte Ash und drehte Mos Gesicht dem Fenster zu. »Aber hier gibt es jemanden, dem es schlechter geht als dir. Viel schlechter. Sieh dir das Kind an, das du bestohlen hast. Sieh hin!«
Gemeinsam schauten sie in das dunkle Zimmer. Dort lag ein Mädchen von acht oder neun Jahren in seinem Bett. Ihr Gesicht war blass, sie atmete schwer wie unter einem Albtraum.
»Sie wird sterben«, raunte Ash an Mos Ohr. »So einfach ist das. Ihre Träume sind das Leben, besonders jene, die im Herzen wohnen. Wenn du sie ihr nimmst, bleibt ihr nichts. Nur Leere. Und Menschen sind nicht für die Leere gemacht.«
Kreidebleich starrte Mo in das Zimmer. Der Schleier vor seinen Augen hob sich. Er wirkte, als wäre er bei diesem Anblick aus einem Fiebertraum erwacht. Zitternd öffnete er die Klaue. Ash berührte die Scherben, die darin lagen. Schimmernd flogen sie durch die Luft, zurück zu dem schlafenden Kind, und sanken in dessen Brust ein. Einen Wimpernschlag lang hörte das Mädchen auf zu atmen. Dann sog es die Luft ein, und mit erleichtertem Seufzen fiel sie in einen ruhigen Schlaf.
Mos Körper war unter Ashs Faust erschlafft. Er stand gegen die Wand gelehnt da und schaute zu dem schlafenden Kind hinein. »Es tut mir so leid«, flüsterte er. »Ich war … wie in einem schrecklichen Traum.«
»Schatten träumen nicht«, erwiderte Ash. »Verdammt, Mo. Früher warst du der beste Fährtensucher der Königin. Du hast das Schattenreich vor den gefährlichsten Kreaturen beschützt, genauso wie die Welt der Menschen. Was ist nur aus dir geworden?«
»Das siehst du doch«, wisperte Mo. »Ein Nichtsnutz und Dieb.«
Ash schwieg kurz. »Du hast deinen Menschen verloren«, sagte er dann. »Das passiert manchen von uns. Aber du hast einen neuen Menschen gefunden und …«
»… und es ist nicht dasselbe«, unterbrach Mo ihn. »Ich bin in Trauer, begreifst du das nicht? Und jetzt erzähl mir nicht, dass Schatten nicht trauern. Ich bin eure verfluchten Regeln so leid! Ich habe noch Leben in mir, verstehst du? Und Sehnsucht nach dem, was ich verloren habe – nach dem, was ihr verleugnet! Nach einer wirklichen Verbindung zu den Menschen!«
»Die Menschen stärken unsere Magie mit ihren Träumen«, sagte Ash. »Sie sorgen dafür, dass wir am Leben bleiben, so wie wir dafür sorgen, dass sie am Leben bleiben, denn nur Menschen mit einem Schatten können träumen. Wenn die Menschen untergehen, gehen auch wir unter. Aber …«
»Aber das ist alles?« Mo schüttelte den Kopf. »Nein, das ist es nicht. Früher waren wir eins, Bestienbezwinger – Schatten wie auch Menschen. Wir haben voneinander gelernt und einander beschützt. Es gab keine Grenzen, keine Unwissenheit, keine Angst. Es war eine bessere Welt als jetzt. Und du weißt das ganz genau. Du weißt, was es heißt, alles zu verlieren. Du hast keinen Menschen mehr. Doch er fehlt dir jeden Tag. Du glaubst, tot zu sein in deinem schwarzen Herzen aus Asche. Vielleicht hoffst du es sogar. Aber das stimmt nicht. Und egal, mit welchen fremden Träumen du ihn vergräbst, er ist immer in dir: dein Schmerz.«
Ash erwiderte Mos Blick, doch ein anderes Bild tauchte aus seinem Inneren auf: das Bild eines Kindes, eines Jungen mit blonden Haaren und einem stummen Lachen auf dem Mund. Noah. Wie ein Stich ging sein Gesicht durch Ash hindurch, ehe es wieder in eisiger Stille versank.
»Ich bin ein Schatten«, erwiderte Ash regungslos. »Ich fühle keinen Schmerz.«
Er rechnete mit einer spöttischen Bemerkung. Aber Mo sah ihn nur an, und in seinen Augen tauchte eine seltsame Regung auf. Etwas wie Mitgefühl.
Im nächsten Moment krümmte Mo sich zusammen. Heftiger Husten schüttelte ihn. Ash spürte das Beben der dürren Glieder unter seinen Fingern. Und als Mo sich in seinen Arm krallte, konnte er es nicht mehr abstreiten: Mo wirkte wirklich krank. Verdammt krank sogar.
»Etwas Böses geschieht in der Welt der Schatten«, raunte Mo. »Denk an meine Worte. Etwas Böses zieht herauf!« Noch einmal grub er seine Finger in Ashs Arm. Dann sank er bewusstlos zusammen.
Ash fühlte, wie Fumi auf seiner Schulter landete. Behutsam drehte er Mos Kopf und berührte den dunklen Fleck in dessen Mundwinkel. Eine warme Flüssigkeit blieb an Ashs Finger haften. Er schauderte, als er im Schein der Straßenlaterne erkannte, was es war. Der verfluchte Schatten blutete. Wie ein Mensch.
»Was machen wir jetzt?«, flüsterte Fumi kaum hörbar.
Ash starrte auf das Blut an seinem Finger. So mussten sich die Menschen fühlen, wenn sie aus einem seltsamen Traum erwachten. Nur dass er nicht aufwachen würde.
Seufzend legte er sich Mo über seine freie Schulter. Was auch immer mit dem Kerl los war, er konnte ihn nicht einfach hier liegen lassen. Und es gab nur einen, der wusste, was jetzt zu tun war.
»Wir bringen ihn dorthin, wo er hingehört«, sagte Ash und setzte sich in Bewegung. »Ins Reich der Schatten.«
4
Lucy
Diese verfluchte Ratte! Lucy meinte, Krallen auf Stein zu hören, ehe es wieder still wurde. Sie stellte sich vor, dass die Ratte zu ihr herüberlinste, aus irgendeinem Versteck unter den Regalen. Vielleicht überlegte sie sich gerade, welches Kleidungsstück sie als Nächstes anknabbern konnte. Aber da hatte sie die Rechnung ohne Lucy gemacht!
Sie schnappte sich den Kescher, der an der Wand lehnte. Ihr Vater hatte damit mal eine dunkle Sylphe gefangen, gerade daumengroß und auf den ersten Blick furchtbar niedlich – bis sie wie ein Hai ins Netz gebissen hatte. Lucy erinnerte sich immer noch an das Knirschen des Metalls, ehe ihr Vater die Sylphe zurück in die Schattenwelt gebracht hatte. Dieses Netz würde auch einer Ratte standhalten, so viel war sicher.
Lucy huschte zu der Stelle hinüber, von der das Geräusch gekommen war. Sie musste aufpassen, wo sie hintrat, denn in diesem Bereich des Kellers hatte ihr Vater magische Fallen drapiert für den Fall, dass irgendein Anderwesen bei ihm einbrechen und sich an seinen Artefakten zu schaffen machen sollte.
Nicht alle Fallen konnte man auf den ersten Blick erkennen. Einige waren als Buch getarnt, andere verbargen sich unter einem Tarnzauber. Doch Lucy wusste, wohin sie treten musste. Zu oft war sie schon in die zuschnappenden Käfige hineingetapst.
Es raschelte direkt vor ihr. Lucy stieß den Kescher unter das Regal – und fing nichts als ein Papierknäuel, das knisternd in Flammen aufging. Lucy zog die Brauen zusammen. Die Brennenden Briefe aus der Schattenwelt kannte sie. Aber seit wann entzündete sich Papier von ganz allein? Sie bückte sich, um unter das Regal zu schauen. Im selben Moment scharrte es hinter ihr. Instinktiv wich sie aus – und dicht neben ihr schlug ein Besenstiel im Regal ein. Lucy fuhr herum und erschrak.
Vor ihr stand ein brennendes Ungetüm. Es war etwa halb so groß wie sie selbst, schwebte in der Luft und hatte schmale Sehschlitze, die wie Blitze flackerten. Es erinnerte an einen Tintenfleck, veränderte seine Form aber rasend schnell. Und es hielt noch immer den Besenstiel umfasst.
Ein Schatten, schoss es Lucy durch den Kopf. Die mächtigsten Kreaturen der anderen Welt. Die Herrscher des Schattenreichs. Und das Volk, in dem die Verachtung für die Menschen am größten war.
Lucys Herz raste. Mit zitternden Fingern hob sie den Kescher, worauf der Schatten erschrocken aufschrie. Er stieß den Besenstiel vor und traf Lucy an der Schulter. Sie taumelte gegen das Regal und brachte es zum Einsturz. Polternd fielen die Bücher auf Lucy nieder, die auf die Knie ging und ihren Kopf mit den Armen schützte. Das letzte Buch traf sie am Rücken, dann war es still.
Lucy hörte nur ihren Schädel dröhnen und ein leises Knistern. Benommen sah sie auf. Der Schatten war noch immer da. Winzige Feuerfunken fielen aus der Schwärze seines Körpers und erloschen am Boden.
Er ist verletzt, dachte Lucy unwillkürlich, denn der Funkenflug sah aus wie eine Spur aus Blut. Aber Schatten bluten doch nicht!
Was auch immer das für eine Kreatur war: Jetzt kam sie näher. Lucy hielt den Atem an. Sicher glaubte das Wesen, sie berauben zu können – das Kind ohne Schatten. Sie presste die Zähne aufeinander. Sie mochte keine Jägerin sein wie ihre Mutter. Doch sie war mehr als ein jämmerlicher Knochensack auf zwei Beinen, den man einfach bestehlen konnte!
Lucy hielt die Augen halb geschlossen, während das Geschöpf immer näher kam. Sollte es ruhig denken, dass sie von der Bücherlawine ohnmächtig geworden war. So unauffällig wie möglich tastete sie über die Wälzer. Lucy hatte einige davon gelesen, und sie erinnerte sich gut daran, wie mühsam es gewesen war, die lateinischen Formeln der Zaubersprüche zu lernen. Ihr Vater hatte sie dazu gebracht. Von der Schattenwelt hielt er sie zwar fern aus Angst, ihr könnte etwas zustoßen. Doch er hatte ihr beigebracht, sich zu verteidigen, wenn es darauf ankam. Sie wusste, wie sie sich von magischen Fesseln befreite. Sie konnte sich fremde Zauber aneignen, jedenfalls manchmal. Und sie kannte viele magische Formeln.
Latein ist nützlich, ging die Stimme ihres Vaters durch ihren Kopf. Man weiß nie, wann man es einmal braucht.
Lucy grub die Finger in eines der Bücher. Es war dick und schwer – und es würde ihr jetzt beistehen. Gerade glitt das Feuerwesen noch näher heran. Lucy wartete, bis sich seine glühenden Augen auf sie richteten. Dann riss sie das Buch auf und rief atemlos: »Fiat lux!«
Es werde Licht – und genau so geschah es. Gleißende Helligkeit brach aus den Buchstaben. Die Kreatur stieß einen Schrei aus. Sie jagte in rasender Geschwindigkeit durch den Keller davon. Der Besen fiel krachend zu Boden. Lucy kam auf die Beine. Sie sah noch, wie das Wesen hinter einem Bücherregal verschwand. Ein Raunen ging durch die Luft, es roch nach flirrender Asche. Und die Kreatur war verschwunden.
Schwer atmend ließ Lucy das Buch sinken. Es war ein Blendzauber gewesen, den sie gewirkt hatte. Ein Magiestück, das zwar ungeheuer gefährlich aussah, es aber gar nicht war. Sie hatte das seltsame Wesen getäuscht. Und es war darauf hereingefallen. Lucy schaute sich um. Jetzt war sie wirklich allein.
Sie ging zu dem Regal hinüber, hinter dem der Eindringling verschwunden war. Sicher war er durch einen offenen Spalt im Mauerwerk entkommen. Ihr Vater musste also wieder einmal die Fugen erneuern, um potenziellen Dieben keine Chance zu geben. Lucy blickte hinter das Regal – und erstarrte.
Es war kein Riss, der dort auf der anderen Seite lag. Es war ein Spiegel. Ein schwarzer Spiegel.