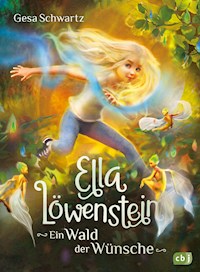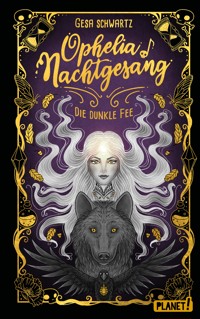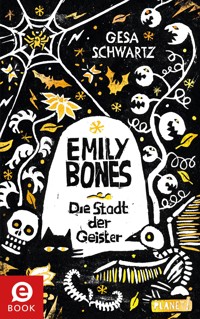6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: hockebooks
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Der Gargoyle Grim ist ein Schattenflügler. Seine Aufgabe ist es, das Steinerne Gesetz zu wahren. Dieses Gesetz besagt, dass niemals ein Mensch von der Existenz der Anderwelt, zu der Grim gehört, erfahren darf. Doch eines Tages wird das Gesetz aufgrund eines mysteriösen Pergaments gebrochen. In den Katakomben von Paris will Grim zusammen mit der Sterblichen Mia, einer Seherin des Möglichen, herausfinden, was es damit auf sich hat. Keiner von beiden ahnt, dass sie einem Geheimnis auf der Spur sind, das das Schicksal der ganzen Welt verändern könnte. Band 1 der Grim-Trilogie von Gesa Schwartz.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 878
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Gesa Schwartz
Grim
Das Siegel des Feuers
Roman
Kapitel 1
Regungslos hockte Grim auf dem Dachfirst über dem siebten Stock, die schwarzen Schwingen hoch über seinen Kopf erhoben, und starrte hinab auf die Straße. Seine Klauen hatten sich in die Fassade gekrallt, als wären sie ein Teil davon, und der Regen prallte von seinem Obsidianleib ab wie von der Hauswand unter ihm. Fast schien es, als säße nichts als eine riesige, dämonenhafte Statue dort oben, und nicht einmal dem aufmerksamsten Beobachter wären die nebelgleichen Wölkchen aufgefallen, die hin und wieder mit einem Seufzen aus dem steinernen Mund entwichen. In dieser Nacht jedoch schaute ohnehin niemand nach oben. Nur vereinzelt huschten Menschen tief unten auf dem Asphalt vorüber, die Köpfe unter dem Regen geduckt wie unter zischenden Schwertern.
Grim konnte es ihnen nicht verdenken. Er hasste dieses Wetter. Vor über zweihundert Jahren war er von Italien nach Paris gekommen und er hatte geglaubt, sich irgendwann an den Regen zu gewöhnen, an das feuchte Klima, die tief hängenden Wolken, den pfeifenden Wind. Aber er hatte sich nie daran gewöhnt, im Gegenteil, immer schlimmer war es geworden, und nun, da ihn dieser verfluchte Auftrag seit Stunden daran hinderte, sich ein trockenes Plätzchen zu suchen, fühlte er sich plötzlich so alt wie noch nie. Er zwinkerte, sodass die Regentropfen von seinen steinernen Wimpern fielen. Wie lange hockte er nun schon auf irgendwelchen Dächern herum, stunden- und tagelang, wie lange wartete er schon auf irgendwelche Sterblichen, wie lange schon war er ihnen gefolgt? Er wusste es nicht, er wusste nur eines: zu lange. Dabei gab es weiß Gott spannendere Aufgaben zu erledigen. Beispielsweise die Sache mit den Vampiren, die wieder einmal in sinnlose Clangefechte mit den Werwölfen verwickelt waren und geradezu danach gierten, zur Raison gebracht zu werden. Oder der durchgedrehte Poltergeist, der seit Tagen wie ein Verrückter die Bilder im Louvre umhängte, dass es eine Freude war, und der immer noch nicht gefasst war.
Grim schnaubte leise. Nicht, dass es ihn sonderlich kümmerte, ob die Mona Lisa auf einmal neben dem Toilettenschild für Herren zu finden war oder ob sich Vampire und Werwölfe die Köpfe einschlugen – ohnehin war es ein lächerlicher Zwist zwischen diesen beiden, der niemanden mehr hinterm Ofen hervorlockte, es sei denn, er war zufälligerweise ein Gargoyle und um die Sicherheit der Stadt bemüht. Doch solche Aktionen wurden zwangsläufig irgendwann von Menschen bemerkt und damit gefährdeten sie das, was seit Jahrhunderten wie ein schweres Tuch über den steinernen Gassen von Paris lag: das Vergessen. Die Menschen ahnten nichts von den Geschöpfen, die unter ihnen lebten, erst recht nichts von den Gargoyles, und wenn Grim eines wusste, dann dass sie nie von ihnen erfahren durften – niemals. So lautete das Steinerne Gesetz.
Dennoch waren diese Fälle gewissermaßen Routine. Natürlich waren sie immer noch spannender als sein eigener langweiliger Auftrag, aber bei Weitem nicht so anspruchsvoll wie diese andere Geschichte – die Sache mit den Morden. Ein Kribbeln zog über Grims steinerne Haut, als er daran dachte. Seit geschlagenen drei Wochen schlich ein namenloses Grauen durch die Schattenwelt von Paris. Siebzehn Tote gab es bis jetzt, jeder einzelne auf bestialische Weise ermordet – und allesamt überaus mächtige Geschöpfe. Hochmagische Gestaltwandler. Starke Werwesen. Uralte Vampire. Sie alle waren mit scheinbarer Leichtigkeit zur Strecke gebracht worden, aber ohne erkennbares Muster: Einen Werwolf hatte man ohne Haut gefunden, einen Vampir so ausgiebig gepfählt, dass er ausgesehen hatte wie ein Nadelkissen, und keines der Opfer stand in irgendeiner Beziehung zu einem der anderen. Fest stand nur eines: Der Mörder musste über unvorstellbare Kräfte gebieten, um diese Wesen in die Knie zu zwingen.
Grim zog die Brauen zusammen. Hätte man ihm diese Angelegenheit anvertraut, wäre der Fall längst erledigt gewesen, davon war er überzeugt. Aber nein, er durfte die Drecksarbeit machen und im Regen auf Häusern herumsitzen, während die elenden Speichellecker seines Vorgesetzten Mourier wie die Schmeißfliegen um die Morde kreisten. Bis jetzt hatten sie in ihrem ratlosen Dilettantismus nicht das Geringste erreicht, verschwendeten aber dennoch einen Großteil ihrer Zeit damit, die lächerliche Krönungszeremonie des Königs vorzubereiten, als gäbe es nichts Wichtigeres auf der Welt.
Er hatte gerade eine Klaue gelöst und streckte sie, sodass kleine Steinsplitter zur Straße hinabfielen, als sich im Gebäude auf der anderen Seite eine Tür öffnete. Laute Musik quoll auf die Straße, Grim roch Alkohol und Zigaretten. Angewidert verzog er das Gesicht. Er würde nie verstehen, wie die Menschen ihren eigenen Gestank ertragen konnten. Drei Männer traten auf die Straße, die Tür fiel hinter ihnen ins Schloss. Grim rührte sich nicht. Er sah zu, wie zwei von ihnen die Straße hinabgingen und sich ein Taxi riefen. Der dritte blieb allein zurück, schlug seinen Jackenkragen hoch und stapfte in die andere Richtung. Grim hatte nichts an seiner Haltung verändert, und doch spürte er in jeder Faser seines Körpers, dass er in diesem Moment nichts mehr war als ein zum Sprung bereites Raubtier. Er hörte die Tür des Taxis zuschlagen. Im selben Moment breitete er die Schwingen aus und glitt seinem Opfer über die Häuserdächer lautlos nach.
Mit hochgezogenen Schultern schob sich der Mann an einer Gruppe Menschen vorbei und bog in eine Seitengasse ab. Eine Laterne warf ihr flackerndes Licht auf weggeworfene Kippen, alte Zeitungen und leere Bierflaschen. Der Mann blieb stehen, um sich eine Zigarette anzuzünden. Er war allein in der Gasse, abgesehen von einer Katze, die um einen metallenen Müllcontainer strich und nach Essbarem suchte.
Grims Schatten glitt übers Kopfsteinpflaster, seine Schwingen durchschnitten die Luft. Doch der Mann bemerkte ihn erst, als die steinerne Faust des Gargoyles bereits seine Kehle umfasst hielt. Seine Zigaretten landeten mit dumpfem Geräusch in einer Pfütze. Panisch strampelte er mit den Füßen, denn Grim hatte ihn ein ganzes Stück emporgehoben, und griff nach den riesigen Klauen. Der Schreck verzerrte sein Gesicht zu einer Maske der Angst.
»Zeige dich«, grollte Grim leise. Er wusste, dass allein sein Anblick den Menschen zu Tode ängstigen musste. Die dunkle Gestalt, das menschliche, aber steinerne Gesicht mit der Narbe quer über dem rechten Auge, die klauenartigen Hände und Füße … Möglicherweise mochte er im ersten Moment noch wirken wie ein außergewöhnlich großer Mensch mit schulterlangem tiefschwarzen Haar, doch spätestens mit Blick auf seine riesigen Schwingen wurde auch dem ignorantesten Sterblichen klar, dass er im besten Fall einen Engel vor sich hatte – einen Engel aus Schatten und Dunkelheit. Doch schlimmer als all das war seine Stimme. Sie klang wie das Bersten großer Felsen, und obwohl er sich bemühte, ruhig zu sprechen, löste ihr Ton bei dem Menschen wie üblich Entsetzen aus.
Aber es war nicht der Mensch, mit dem er sprach.
»Zeige dich«, wiederholte er. »Oder hast du Angst?«
Ein animalisches Keuchen kroch aus der Kehle des Menschen, und gleich darauf verzerrte sich dessen Gesicht zu einer bösartigen Fratze. Die Haut zog sich zusammen, als würde sie rasend schnell altern, die Lippen wichen zurück und gaben den Blick frei auf nadelspitze schwarze Zähne. Grim fühlte ihn, den Dämon, der sich in diesem Sterblichen eingenistet hatte wie eine Ratte in einem Kadaver. Dann veränderten sich die Augen, und Grim konnte ihn sehen: Die Pupille weitete sich, sie franste an den Rändern aus und kroch über das Weiß der Augen wie schwarze Tinte über ein frisches Laken. Und aus dem Dunkel starrte Grim Hass entgegen.
Er lächelte. Es war doch immer wieder faszinierend, wie eindrucksvoll Dämonen über menschliche Körper herrschen konnten. Jetzt verzog sich der Mund, die hochgezogenen Lippen waren blau angelaufen, und Speichel troff aus dem Mundwinkel. Schwere, klebrige Worte schlugen Grim entgegen und dieser typische Gestank nach faulen Eiern, den Menschen ausatmeten, wenn sie von einem Dämon besessen waren. Grim hielt den schlaffen Körper ein Stück weiter von sich weg.
»Da bist du ja«, stellte er fest. »Ich weiß, es muss für einen Parasiten wie dich sehr verlockend sein, sich in diesem Körper einzunisten und ihm nach Lust und Laune jedes einzelne Tröpfchen auszusaugen. Aber laut Paragraf dreihundertsiebenunddreißig des GBG ist es dir verboten, dich länger als nötig in einem Wirt aufzuhalten. Du raubst diesem hier seit sieben Tagen das Leben und zuvor hast du zwei weitere ins Jenseits befördert, ein Vergehen, das mit achthundert Jahren Diamantfeuer geahndet wird. Bist du geständig?«
Das Diamantfeuer war eine ziemlich unangenehme Art der Bestrafung. Für gewöhnlich mieden Dämonen Diamanten wie Menschen das Feuer, denn wenn sie ihnen zu nahe kamen, jagten gewaltige Energieströme durch ihren Körper. Nicht selten setzten sie den jeweiligen Dämon dabei in Brand, immer jedoch fügten sie ihm äußerst heftige Schmerzen zu. Grim war daher nicht überrascht, als der Dämon ihm statt einer Antwort eine wüste Beschimpfung auf Ungarisch entgegenschleuderte. Es klang, als würde er sich mit Gewalt die Stimmbänder des Menschen zunutze machen – wie ein Kind, das sich über eine Geige hermacht und den Bogen wütend über die Saiten zieht.
Grim seufzte. Was hatte er erwartet? Intellektuellen Austausch? Schließlich handelte es sich bei diesem Dämon nur um einen Holokliten, wie die gargoylschen Stielaugen von der Spurensicherung bei der Untersuchung seiner letzten Opfer festgestellt hatten. Holokliten waren eine sehr schwache Gattung der Dämonen – vor allem in Geistesangelegenheiten.
Grim lächelte geduldig. »Wenn du schon …«
Weiter kam er nicht. Er spürte noch, wie der Körper des Menschen sich zusammenzog, der Dämon sich mit enormer Geschwindigkeit aus seinen Klauen wand und ihm heftig gegen die Brust schlug. Im nächsten Moment flog Grim durch die Luft und landete scheppernd in dem metallenen Müllcontainer. Fauchend machte sich die Katze aus dem Staub, die dort nach Nahrung gesucht hatte, und Grim roch sofort den bestialischen Gestank menschlicher Abfälle. Er stieß den Atem aus. Ein gewöhnlicher Holoklit – von wegen! Dieser Kerl gehörte zu den stärksten Dämonen, mit denen er es je zu tun gehabt hatte, ein Phy, mindestens aber ein Iphryr stand ihm gegenüber. Dämliche Stielaugen, sie würden es nie lernen, Informationen auszuwerten! Sie waren beinahe so schlimm wie Menschen – nicht einmal Augen hatten sie im Kopf, geschweige denn ein Gehirn!
Er starrte den Dämon an, der in der Mitte der Gasse stehen geblieben war, leicht geduckt und mit diesem verschlagenen, todesgierigen Blick, den nur Wahnsinnige oder Untote haben können.
»Verfluchter Bastard«, grollte Grim. Das Metall knirschte unter ihm, als er sich erhob. Sein Körper hatte einen formvollendeten Abdruck im Container hinterlassen, inklusive Klauen. Mit schweren Schritten trat er in den Schein der Laterne. Seine Klauenfüße, die sich nie daran gewöhnt hatten, in Schuhe gezwängt zu werden, knirschten auf dem Asphalt.
»Wenn du schon Ungarisch reden willst«, fuhr er fort, als hätte das Containerintermezzo gar nicht stattgefunden, »mach das gefälligst anständig. Du rollst das R nicht richtig!« Und dann rollte er das R zur Veranschaulichung bei einer raschen Folge ausgesucht derber Schimpfwörter. Sie verfehlten ihre Wirkung nicht.
»Törichtes Steinhirn«, zischte der Dämon und verzog den Mund des Menschen zu einem boshaften Lächeln. »Wer bist du, dass du mir befehlen willst? Ich weiß – dein Volk hat die Schlacht von Prag gewonnen, jene Schlacht, die uns Dämonen beinahe auslöschte und die Erde auf ewig schwarz färbte vom Blut der gefallenen Vampire. Ihr habt gesiegt – ihr habt die Macht über die Schattenwelt an euch gerissen. Doch das ist lange her. Die Zeiten haben sich geändert. Seht euch an! Seht, was aus euch geworden ist! Selbst vor ihnen habt ihr Angst, ihr alle!« Mit einer fahrigen Bewegung schlug er sich gegen die Brust und hinterließ blutige Kratzer in der Haut des Menschen.
Grim zeigte keine Regung. Der Körper des Menschen war nichts mehr als eine dünne Haut, die über der Finsternis lag, eine zitternde Blase angefüllt mit stinkender Fäulnis. Und doch war dieser Körper verletzlich – und es war seine Aufgabe, ihn zu beschützen.
»Ihr und euer albernes GBG«, kreischte der Dämon. »Gesetzbuch der Gargoyles, dass ich nicht lache! Wie dick ist es inzwischen? Habt ihr eigentlich auch ein Gesetz, wie man in der Nase zu bohren hat?« Er brach in schrilles Gelächter aus.
»Immerhin haben wir Nasen, in denen man bohren kann – im Gegensatz zu euch. Es muss in der Tat erbärmlich sein, sich zeit seines unsterblichen Lebens in klebrigen Menschenkörpern herumzutreiben, nur um sich am Hintern kratzen zu können!«
Der Dämon presste die Zähne zusammen. Ein Rasseln ging durch den Menschenleib, als er sich vorbeugte. »Ich vergaß«, zischte er boshaft, »ich spreche mit einem Gargoyle, einem unfehlbaren … Aber da ist ein Fehler in eurer … Existenz!« Das letzte Wort dehnte er, dass es klang wie das Zischen einer Schlange. »Ihr seid nicht besser als wir. Doch, natürlich, nicht wahr? Denn ihr klaut ihnen die Träume, was für ein Heldenmut!« Er spuckte einen stinkenden Brocken Schleim aus. »Versteckt euch in den Schatten, ihr mächtigen Helden der Nacht – aus Angst, Angst, Angst!«
Grim spürte, dass seine Klauen sich zu Fäusten geballt hatten, und ließ seine Gelenke knacken. »Kreatur der Finsternis«, sagte er leise. »Noch heute Nacht wirst du für deine Taten büßen. Dafür werde ich sorgen.« Er murmelte den Zauber und spürte, wie sich das Feuer in ihm seinen Weg brach. Krachend schoss es in seine rechte Faust und setzte sie in schwarze Flammen. Seine Augen verwandelten sich in glühende Kohlen. Der Regen verdampfte zischend auf seinem Körper, geistergleich zogen die Rauchschwaden davon.
Der Dämon stierte ihn an, etwas wie Achtung hatte sich in seinen Blick geschlichen. Grim hörte die Formel, die über die spitzen Zähne rollte. Klirrend wuchsen messerscharfe Nägel aus den Fingern des Menschen, Fluchfeuer entfachten sich auf der eingefallenen Haut. Der Dämon erhob sich kreischend in die Luft.
Für einen Augenblick schien die Zeit stillzustehen. Der Regen erstarrte um sie herum, die Flammen hörten auf zu flackern, selbst die Wolken, die wie zerfetzte Kleider über den Himmel zogen, hielten inne. Dann zerbrach der Moment, und der Dämon stürzte auf Grim nieder.
Grim sprang zurück, sein Mantel flatterte durch die Luft wie ein Rabenschwarm, doch er war nicht schnell genug. Die Klauen des Dämons trafen seine Wange, Blut lief über sein Gesicht, und im nächsten Moment spürte er den Fuß des Dämons in seinem Bauch. Keuchend landete er auf dem Pflaster. Teufel noch eins, der Kerl war schnell. Verschwommen sah er die Gestalt des Dämons, hocherhoben stand er über ihm in der Luft. Etwas Grelles schoss auf Grim zu, er erkannte es erst, als es sein Gesicht traf. Fluchfeuer. Im nächsten Moment war die Gasse verschwunden, er war in einem Wald aus Flammen. Sie bissen in die nackte Haut seines Oberkörpers, rissen an seiner Hose und seinem Mantel, versuchten, seine Augen auszubrennen. Es war, als würde ihm mit tausend winzigen Klingen die Haut abgezogen, aber das Schlimmste waren die Stimmen. Das Feuer sang, es rief nach ihm, es raubte ihm fast den Verstand. Grim sah Gesichter in den Flammen, Menschenkinder, sie standen nicht weit von ihm entfernt, sie lachten und winkten ihm.
Für einen Moment wollte er nichts weiter, als zu ihnen zu gehen, ganz gleich, was dann mit ihm werden würde. Aber der Moment war nur kurz. Er war ein Gargoyle, verflucht noch eins, und er ließ sich nicht um den Verstand bringen, schon gar nicht in einer stinkenden Gasse von einem dahergelaufenen Dämon. Er drehte sich auf den Rücken und drückte die Handflächen gegen das kühle Pflaster der Straße. Regungslos ertrug er die Bisse der Flammen. Nach und nach erloschen sie, bis nur noch stinkender Qualm übrig blieb.
Grim hielt die Augen geschlossen, der Rauch benebelte ihm die Sinne. Er fühlte, wie der Dämon leichtfüßig und siegessicher auf seine Brust sprang, spürte die eiskalten Klauen auf seinem Gesicht und den klebrigen Dämonenatem an seinen Lippen. Betäubend kroch er Grims Rachen hinab und bereitete den Weg für seinen Meister. Er wollte sich in ihm einnisten, dieser Mistkerl, was bildete er sich ein! Grim riss die Augen weit auf, noch immer loderte sein Feuer in ihnen. Der Dämon erstarrte, Entsetzen spiegelte sich in seinem Blick.
»Wie hast du …«, stammelte er. »Du hast das Fluchfeuer überlebt. Das hat noch niemand …«
Grim lächelte dunkel. »Dann«, sagte er leise, »nenn mich niemand.«
Er sprang auf die Füße, stieß die flammende Faust vor und packte den Dämon an der Kehle. Entschlossen riss er einen glühenden roten Leib aus dem Menschen. Während der menschliche Körper lautlos zu Boden fiel, schaute Grim in ein verbranntes, lippenloses Gesicht. Von Ekel erfüllt sah er, dass sich unter der Haut etwas bewegte, wie Spinnenbeine, die von innen gegen das Fleisch drückten. Der Dämon wollte schreien, aber nichts als ein Krächzen drang aus seiner Kehle. Seine blutig glänzende Haut verfärbte sich an der Luft und schlug knisternd Blasen. Zitternd murmelte der Dämon einen Zauber, und gleich darauf zog sich eine graue Schicht über seinen Körper, faltig und rau wie die Haut sehr alter Schildkröten.
Grim zog etwas aus seiner Tasche. Er hielt den Diamanten dicht vor die Augen des Dämons, der bei diesem Anblick beinahe die Besinnung verlor. »Nein!«, kreischte er und schlug mit den Klauen auf Grim ein, der sich davon nicht im Mindesten beeindrucken ließ.
»Nenn mir deinen Rang«, verlangte er und drückte den Diamanten auf die Stirn des Dämons. Zischend verbrannte die Haut und wurde schwarz, der Dämon jaulte markerschütternd auf. Grim löste den Diamanten und ließ ihn Atem holen.
»Zweiter Grad, siebter Kreis, Phy«, keuchte der Dämon.
Grim schnaubte verächtlich. Hatte er es doch gewusst. Stümper von Stielaugen!
Der Dämon sah ihn an. Für einen Moment war nichts als Traurigkeit in seinem Blick. »Ihr Gargoyles«, flüsterte er und zum ersten Mal hatte seine Stimme jeden Anflug von Hass verloren. »Einst eherne Engel, Helden auf Flügeln aus Stein. Was ist aus euch geworden? Nun seid ihr genauso arm dran wie wir.«
Ehe Grim etwas hätte erwidern können, flog der Kopf des Dämons zurück, die spitzen Spinnenbeine stachen durch die Haut. Blut rann ihm übers Gesicht. Etwas brach durch den Kieferknochen, Grim sah schwarze Leiber, die sich rasselnd über das aufgebrochene Fleisch hermachten. Ein entsetzliches Knacken ging durch den Körper, dann hing das Wesen schlaff in Grims Klauen. Mit einem Rauschen entzündeten sich grüne Flammen, Fluchfeuer außer Kontrolle. Schnell ließ Grim den Dämon fallen und sah zu, wie die dürre Gestalt vom Feuer verzehrt wurde. Am Ende meinte er, sie hätte geseufzt – aber es hätte auch ein Lachen sein können, ein irres, verfluchtes Lachen aus der Dunkelheit.
Grim fuhr sich über die Augen. Zur Hölle noch eins, so hatte er sich diese Nacht nicht vorgestellt. Er schaute auf das verkohlte Wesen zu seinen Füßen. Es hatte sich lieber umgebracht, als in das glitzernde Gefängnis gesperrt zu werden. Lautlos ließ er den Diamanten zurück in seine Tasche gleiten. Eherne Engel … Helden auf Flügeln aus Stein … Was ist aus euch geworden?
Ein Klappern riss Grim aus seinen Gedanken. Noch ehe er sich umdrehte, wusste er, woher es kam. Menschen! Grim seufzte leise, und tatsächlich: Hinter ihm, platt gegen die Wand gedrückt, kauerte der gerade noch bewusstlose Mann und starrte ihn aus tellergroßen Augen an. Grim ging in langen Schritten auf ihn zu und hob ihn, so sanft er es vermochte, am Kragen hoch.
»Du hast etwas gesehen«, sagte er leise. »Etwas, das nicht für deine Augen bestimmt war.«
Der Mensch hatte alles vergessen, was er in den ungefähr vierzig Jahren seines bisherigen Lebens gelernt hatte, inklusive des Sprechens, ohne zu sabbern. Er speichelte auf Grims Hand. Es war widerwärtig. Grim beschloss, es kurz zu machen.
»Vade, memoria!«, grollte er und unterdrückte ein Stöhnen. Dieses verfluchte Latein!
Doch es wirkte. Umgehend schwand der Schrecken vom Gesicht des Menschen und Grim schaute in zwei glasige Augen, die nur darauf warteten, ihn hereinzulassen. Entschlossen fixierte er die matte Pupille und stürzte sich vor. Um ihn her wirbelten die Gedanken wie Bilder, die jemand in Seifenblasen gefangen hatte. Er löschte alle Erlebnisse, die der Mann mit dem Dämon gehabt hatte, und er fand noch etwas anderes: Er sah den Menschen, der noch immer reglos in seinen Klauen hing, wie er einen kleinen Wasserspeier dabei beobachtete, wie er die Fassade Notre Dames hinabkletterte. Dilettanten! Nur die Snobs von Notre Dame konnten auf eine solche Idee kommen. Es war kein Steinblut mehr in ihren Adern, kein Erz aus den tiefsten Schluchten dieser Welt. Ihre Vorbilder, ja, die hätten sich nicht in helllichter Nacht an der Fassade des gargoyleträchtigsten Ortes von ganz Paris herabgelassen. Aber die Wasserspeier Notre Dames waren nur Kopien, billige Repliken des einstigen Glanzes der Gargoyles von Paris, was sollte man anderes von ihnen erwarten? Seufzend hauchte Grim seinen eisigen Atem gegen die Erinnerung und brachte sie mit leisem Klingen zum Platzen. Umgehend zog er sich aus den Gedanken des Menschen zurück und bettete ihn, so sanft wie es ihm möglich war, auf die nasse Erde.
Für einen Moment blieb Grim neben ihm stehen und schaute auf ihn hinab. Helden auf Flügeln aus Stein.Sind wir das etwa nicht mehr? Ohne uns, so dachte er, wärt ihr ganz schön aufgeschmissen. Um ein Haar hätte dieser Dämon dich ausgepresst wie eine Zitrone. Ich habe mein Leben für dich riskiert. Aber du … du wirst dich nicht einmal daran erinnern. Vielleicht wirst du dich fragen, wie du mitten im Regen in dieser schäbigen Gasse hast einschlafen können. Du wirst dich über die Abschürfungen an deinen Händen, über die Schmerzen an deinem Hals und die merkwürdigen Kratzspuren auf deiner Brust wundern. Vielleicht wirst du noch eine Weile an diesen seltsamen Abend zurückdenken. Aber dann … Grim seufzte leise. Dann würde der Mensch ihn vergessen.
Grim hingegen vergaß niemals. Denn er war ein Gargoyle, ein Schattenflügler der Nacht, in den Festen des Feuers geschmiedet und als glühender Klumpen auf die Erde geworfen, um zu schützen, was sein war: die Ewigkeit des steinernen Blutes.
Doch Grim war müde. Dabei hatte die Nacht gerade erst begonnen.
Kapitel 2
»Ihr Scheißbullen, was fällt euch ein, das ist Freiheitsberaubung, ihr könnt mich …«
Die Tür fiel mit leisem Klicken ins Schloss und schnitt das Gebrüll des Betrunkenen ab, der gerade von zwei Polizisten über den Flur geführt wurde.
Mia verschränkte die Arme vor der Brust. Seit geschlagenen fünfzehn Minuten hockte sie nun mit diesem Wurstgesicht von einem Polizisten in seinem Büro und wartete darauf, dass er aufhörte zu telefonieren. Er hatte bisher noch kein Wort mit ihr gesprochen, stattdessen klappte er ununterbrochen sein Stempelkissen auf und zu – klick-klack, klick-klack – und warf ihr missbilligende Blicke zu. Offensichtlich hatte sie ihn in seinem Beamtenkoma gestört. Dabei konnte sie sich auch Angenehmeres vorstellen, als mitten in der Nacht in einem Polizeirevier herumzusitzen, auf einem quietschenden Plastikstuhl, weit weg von jeder Art von Tisch oder Tür. Unauffällig sah sie auf die Uhr. Sie hatte nicht mehr viel Zeit. Sie musste hier verschwinden, am besten sofort, aber der Polizist ließ sie nicht aus den Augen. Es fehlte nur noch, dass er das Zimmer abdunkelte und ihr eine Lampe ins Gesicht hielt, als wäre sie eine Schwerverbrecherin. Dabei hatte sie gar nichts getan, nun ja … fast nichts.
Mit einem Seufzen legte der Polizist den Hörer auf die Gabel, streckte beide Arme von sich, als hätte er sich ziemlich lange nicht mehr bewegt (was in der Tat so war), und beugte sich über einen Zettel auf seinem Schreibtisch.
»So, so«, machte er, während er beide Augenbrauen hochzog. »Interessant.«
Mia konnte sich mindestens fünfzig Dinge vorstellen, die garantiert interessanter waren als das, was da auf dem winzigen Zettel stand, aber sie verzichtete darauf, ihrem Gegenüber das mitzuteilen.
»Einbruch also«, stellte der Polizist fest. Er wedelte mit dem Zettel durch die Luft und sah Mia zum ersten Mal direkt an. Er hatte farblose Augen, in denen sich unverhohlen Schadenfreude spiegelte.
Mia erwiderte seinen Blick regungslos und sagte leise, aber bestimmt: »Nein.«
Der Polizist lächelte, als hätte er genau diese Reaktion erwartet. »Wie nennt man unerlaubtes Betreten eines Friedhofsgeländes denn in deiner Welt? Was hattest du da überhaupt vor? Eine kleine schwarze Messe abhalten?«
Mia fauchte zurück: »Nein, ich wollte Foucaults Schädel ausgraben und im Internet verkaufen.«
Für einen Moment lief ein Zucken über das Gesicht des Polizisten. Dann beschloss er offensichtlich, sich nicht provozieren zu lassen, atmete tief durch und fuhr fort: »Also, was hattest du auf dem Friedhof zu suchen?«
Mia lächelte unschuldig. »Ich bin eingeschlafen, kurz vor der Schließung, tja …«
Der Polizist lachte auf, kurz und hart. »Eingeschlafen, natürlich. Wir haben Ende Oktober, aber Madame schläft erst einmal eine Runde auf dem Friedhof. Dumm nur, dass ich dir kein Wort glaube.«
Mia schwieg. Dumm war hier nur eins, und zwar das Auftauchen der Sicherheitsheinis mit ihren verdammten Tölen. Normalerweise kontrollierten sie den Friedhof kurz nach der Schließung und verschwanden dann wieder. Danach gab es nur noch die Nachtwächter, und die konnte man problemlos an der Nase herumführen. Aber ausgerechnet heute mussten die Kontrolleure sich mit den Nachtwächtern verquatschen, und so war Mia bei ihrer verspäteten Runde von ihnen entdeckt worden – zum ersten Mal seit fünf Jahren. Ihr Gesicht verdunkelte sich, was der Polizist offensichtlich seinen eigenen Worten zuschrieb. Zufrieden nickte er.
»Ein Einbruch ist kein Kavaliersdelikt«, dozierte er. »Das kann empfindliche Strafen nach sich ziehen, da kommt was auf dich zu, das kann ich dir versprechen. Vor allem, wenn etwas beschädigt wurde. Das mit den schwarzen Messen ist nicht aus der Luft gegriffen, verstehst du? Wir hatten solche Fälle, lange ist das noch nicht her. Aber du behauptest, damit nichts zu tun zu haben?«
Mia seufzte. »Doch, na klar. Schwarze Klamotten, schwarze Fingernägel – da ist Hähneköpfen doch fast dasselbe, nicht wahr?«
Der Polizist musterte sie kurz. Sein Unverständnis stand ihm ins Gesicht geschrieben, dabei sah sie an diesem Abend noch nicht einmal sonderlich aufsehenerregend aus. Sie trug hohe Schnürstiefel, ein langärmliges schwarzes Kleid und ihren Clochardwesternmantel – er war wie ein Waffenrock geschnitten und hatte zwei tiefe Taschen, in denen man allerhand Kram verstauen konnte, daher hatte Mia ihm diesen Namen gegeben. Sie war nicht übermäßig geschminkt und trug nur drei silberne Ringe. Alles in allem also kein Grund, gleich die Augenbrauen bis zum Haaransatz hochzuziehen. Der Polizist war da natürlich anderer Meinung.
»Und was haben wir hier?« Er griff nach Mias Tasche, die neben ihm auf dem Tisch lag, und drehte sie um. Sofort prasselten mehrere Bleistifte, Kreidestücke und Federn heraus und verunreinigten seine blitzblank geputzte Schreibtischunterlage. Mia verzog das Gesicht, als er nach ihrem Zeichenblock griff. Mit spöttischer Miene begann er, darin zu blättern, sah kurz auf und ließ seinen Blick erneut über Mias Klamotten wandern.
»Ein Grufti, der Comics malt – das habe ich auch noch nie gesehen«, sagte er.
»Scheiß Schubladendenker«, murmelte Mia und hoffte, dass es laut genug gewesen war, um bei ihrem Gegenüber anzukommen. Aber der seufzte nur und begann etwas in seinen Computer zu tippen.
Mia verdrehte die Augen. Einfingersuchmethode, na großartig. Sie würde im Morgengrauen noch hier sitzen. Unruhig rutschte sie auf dem Stuhl hin und her. Immerhin war sie nicht allein. Nebenan bollerte irgendjemand gegen die Wand und brüllte Beleidigungen.
»Beginnen wir mit dem Protokoll«, seufzte der Polizist mit einer Inbrunst, als würde er damit in die Hölle hinabsteigen, um die Welt zu retten. »Wie ist dein Name?«
Mia verzog das Gesicht. Auch das noch. »Mia Lavie«, sagte sie leise.
Der Polizist nickte, und sie dachte schon, dieses Mal drum herumzukommen. Doch dann hielt er inne und fasste nach dem Stempelkissen. Klick. Klack. »Bist du verwandt mit diesem Maler? Er hieß …«
»… Lucas Lavie, ja, und er war mein Vater.«
Der Polizist sah sie an, Mia konnte die Schublade auf- und wieder zurollen hören.
»Ja, ein großer Künstler«, sagte der Beamte, während er sich wieder dem Bildschirm zuwandte. »Und du bist also seine Tochter. Ich verstehe nicht viel von Kunst, Malerei und so, aber um seine Bilder kam man ja gar nicht mehr herum. Einige fand ich sogar ganz ansprechend, dieses blaue da, mit den Gesichtern …«
Mia lehnte den Kopf gegen die Wand. Manche Dinge änderten sich nie.
»Schade, dass er irgendwann durchgedreht ist«, fuhr der Polizist fort, aber seine Stimme drang nur noch vage an ihr Ohr. Sie hatte wenig geschlafen in der Nacht zuvor. Sie war hundemüde. »Er hat Dinge gesehen, nicht wahr? So stand es in der Zeitung. Ist verrückt geworden. Hat er sich nicht … mit einem Schrotgewehr …« Er tippte sich an die Schläfe und drückte ab, als hielte er eine Waffe in der Hand.
»Es war eine Walther P38, Kaliber neun Millimeter.« Mia hörte sich selbst wie aus weiter Ferne, der Polizist erwiderte irgendetwas, aber sie antwortete nicht. Müde fuhr sie sich über die Augen, nannte ihm ihre Anschrift und bemerkte erst auf den zweiten Blick die Eisblumen, die sich in rasender Geschwindigkeit auf dem Glas des Fensters bildeten.
Mia zog die Brauen zusammen. Sie konnte das Knistern des Eises hören, als die filigranen Muster entstanden, doch damit war sie offensichtlich allein. Der Polizist war vollends damit beschäftigt, ihre Adresse richtig in den Computer zu tippen.
»Wohnst du dort allein?«, fragte er gerade.
Leise atmete sie aus. »Ich bin siebzehn und gehe noch zur Schule, wie sollte ich mir eine eigene Wohnung leisten können? Nein, ich lebe mit meiner Mutter und meiner Tante zusammen. Vor zwei Jahren hat auch Jakob, mein Bruder, noch bei uns gewohnt, aber seit er studiert, hat er seine eigene Wohnung. Wollen Sie auch wissen, ob Haustiere bei uns leben? Meine Tante hat einen Kanarienvogel und …«
Ein Seitenblick des Polizisten ließ sie verstummen. Sie setzte sich auf und beobachtete, wie die Eisblumen außen am Rand des Fensters emporkrochen und sich an der Innenseite wieder hinabbewegten. Sie räusperte sich und deutete zum Fenster. Der Polizist sah sie an.
»Was soll das?«, murmelte er. »Es regnet, na und?«
Währenddessen suchten die Eisblumen ihren Weg an der glühenden Heizung hinab, Mia hörte das Metall leise knacken, überzogen den Fußboden und hielten zielstrebig auf den Polizisten zu. Mias Atem gefror in der Luft. Jetzt erreichte das Eis die schwarzen Halbschuhe des Beamten, knisternd kroch es darüber hin und bildete ein zartes Spitzenmuster auf dem Leder.
»Hören Sie«, begann Mia, doch der Polizist fiel ihr ärgerlich ins Wort.
»Es dauert nur länger, wenn du mich alle paar Minuten unterbrichst«, sagte er, ohne sie anzusehen. Er fuhr sich mit der Hand an die Brust, seine Finger schabten Raureif von seinem Revers, als er sich kratzte.
Mia spürte, wie ihr Herz anfing zu rasen. Was ging hier vor? Atemlos sah sie, wie das Eis am Hals des Polizisten hinaufkroch, er hustete, als würde er es fühlen – aber er sah es nicht. Seine Lippen wurden blau, seine Finger klackten wie Eiswürfel auf die Tasten. Erstarrt sah Mia, wie Splitter von seinen Händen abflogen, seine Finger bröckelten, gefrorenes Fleisch löste sich, und er schrieb trotzdem weiter, als würde er nichts davon bemerken.
»Nein«, flüsterte Mia, dankbar, dass sie noch eine Stimme hatte. Da wandte der Polizist ihr das Gesicht zu, seine Haut war blau angelaufen und mit dunklen Adern durchzogen. Knisternd krochen die Eisblumen über ihn hin, erreichten seine Augen – mit leisem Knacken brachen seine Augäpfel und im gleichen Moment fing er an zu lachen, laut und schrill.
»Nein!« Mia sprang auf, stürzte zur Tür – und fühlte die Wärme um sich herum. Verwirrt drehte sie sich um und schaute in das rosige Gesicht des Polizisten. Sie sah zum Fenster. Das Eis war verschwunden. War es überhaupt da gewesen?
»Alles klar so weit?« Der Polizist zog die Brauen zusammen. »Wir waren bei deinem Geburtsdatum.«
Mia nickte und ging benommen zurück zu ihrem Stuhl. Hatte sie geträumt? Ja, so musste es gewesen sein. Sie war eingeschlafen und hatte sich dieses Szenario zusammenfantasiert. Aber es war so kalt gewesen …
»Pass lieber auf, dass du nicht auch noch verrückt wirst«, stellte der Polizist fest und sah sie an, als wäre es nur eine Frage der Zeit, dass sie sich eine Waffe schnappen und in alter Familientradition ihr Gehirn an der Wand verteilen würde. »Erste Anzeichen sind ja schon erkennbar.«
Mia wollte etwas erwidern, doch ihre Kehle war wie zugeschnürt. Sie musste hier raus, sonst würde sie diesem Kerl sein Stempelkissen auf den Kopf hauen. Sie hatte sich gerade überlegt, in einem plötzlichen Anfall von Übelkeit unbedingt auf die Toilette zu müssen, als die Tür aufgerissen wurde und ein Kerl in braunen, zerschlissenen Klamotten und mit einer Fahne, dass man schon vom Geruch betrunken werden musste, wie ein Kugelblitz ins Zimmer schoss.
»Ihr blöden Arschlöcher«, grölte er, warf sich über den Schreibtisch und packte den ängstlich zurückweichenden Polizisten am Kragen. »Ich will endlich …«
Was er wollte, ging in würgendem Gurgeln unter. Offensichtlich war dem Ärmsten sein Alkoholgenuss zu Kopf gestiegen, sodass sich nun der grüngelbe Inhalt seines Magens auf die Uniform des Beamten ergoss. Gerade, als er sein Werk beendet hatte, stürmten drei Polizisten in den Raum und rissen ihn vom Schreibtisch. Mia warf einen letzten Blick auf das totenblasse Wurstgesicht, dann drückte sie sich im allgemeinen Trubel aus dem Zimmer.
Kaum stand sie auf der Straße, schlug ihr eisiger Wind entgegen. Sie knöpfte ihren Mantel zu und grub die Hände tief in ihre Taschen. Über die Rue de Clignancourt war es nur ein kurzes Stück bis zur Metro, aber natürlich war gleich die erste Ampel auf ihrem Weg rot. Nachdenklich betrachtete sie das Haus auf der anderen Straßenseite. Dunkle Adern zogen über seine Fassade, fast so … fast so wie die Haut des Polizisten, als das Eis gekommen war. Sie musste mehr schlafen, und das bald, sonst würde sie wirklich noch den Verstand verlieren – wie ihr Vater.
Sie erreichte die Metrostation Marcadet Poissonniers. Ein warmer Luftzug fuhr ihr wie der Atem eines lebendigen Wesens ins Gesicht, als sie die Treppe hinablief. Das Tunnelsystem empfing sie mit seinen kalkweißen Kacheln und dem kaugummigefleckten Boden, auf dem alle paar Meter Obdachlose saßen. Sie schaute an die Decke. Regelmäßig wurde sie frisch gestrichen, man konnte die Farbe fast noch riechen. Und doch wellte sich die Tunnelhaut überall und schlug Blasen, als wäre sie lebendig, tumoröses Gewebe in den Gedärmen der Stadt. Schimmel hatte sich in das saubere Weiß gefressen und verteilte in grün-feuchten Rinnsalen seinen Speichel auf dem Boden.
Mia holte tief Atem. Hier unten war eine andere Welt, und diese Welt sammelte das, was dort oben in der Stadt des Lichts keinen Platz mehr hatte. Es war eine schmutzige, eine harte Welt, aber sie ließ sich ihre Hässlichkeit nicht nehmen. Sie war da. Sie würde immer da sein, die Welt der Schatten – so lange, wie es die Welt des Lichts gab.
Sie erreichte den Bahnsteig, dröhnend fuhr die Metro Richtung Mairie d’Issy ein. Mia setzte sich auf einen der mit Filzstift bemalten Sitze. Die Neonleuchten über ihr flackerten, immer wieder blieben sie sekundenlang ganz aus. Eine leere Dose rollte scheppernd vor und zurück und draußen vor dem Fenster tanzten Notbeleuchtungen in den Tunneln.
Und du bist also seine Tochter. Seufzend betrachtete sie sich im Fenster der Metro. Sie hatte das blasse, schmale Gesicht ihrer Mutter und auch deren dunkle Haare, die ihr bis zum Kinn reichten. Aber ihre Augen … ihre Augen waren nicht schön und blau wie die ihrer Mutter, sondern grün – beunruhigend grün sogar. Manchmal blieben die Menschen stehen, um sie anzustarren, als wäre sie ein entlaufenes Zootier. Weil du hübsch bist, sagte ihr Bruder immer, wenn sie ihm davon erzählte, aber sie wusste, dass das nicht alles war. Sie hatte eine besondere Begabung dafür, die kleinen Schwächen der Menschen zu durchschauen, ihre Eigenheiten und Wünsche zu erkennen, ohne dass sie mitunter mehr als einige Worte mit ihnen gewechselt hatte. Vielen Menschen machte das Angst, das wusste Mia, und nicht immer wollte sie sehen, was sie im Inneren der Menschen fand. Manchmal schien es Mia, als gäbe es eine gläserne Wand zwischen ihr und den anderen, eine Mauer, die nur sie wahrnahm und die sie unabänderlich von den Menschen trennte. Sie hatte Freunde, Menschen, die sich zur schwarzen Szene zählten wie sie selbst, und doch umgab sie ein Schleier aus Einsamkeit, den sie nicht durchbrechen konnte.
Auch deshalb liebte sie die Nacht. Deren Dunkelheit wusste, wer sie war. Mia sehnte sich nach den Geheimnissen, die sich in den Schatten verbargen, und wollte ihnen so nah kommen wie irgend möglich. Die meisten Menschen jedoch fürchteten sich vor der Finsternis, weil sie nicht wussten, was sie dort erwartete. Mia hingegen fühlte sich unendlich von ihr angezogen – aus demselben Grund. Es war ein Zauber in der Welt, den sie sich nicht erklären konnte und der nachts besonders stark für sie fühlbar wurde. Sie wünschte sich oft, anderen davon erzählen zu können, aber jedes Mal, wenn sie es versuchte, trat etwas in ihren Blick, das die Menschen verunsicherte. Es hatte auch in den Augen ihres Vaters gelegen, und die Leute hatten fast so etwas wie Angst vor ihm gehabt – grundlos und instinktiv.
Mia gähnte, und ihr war kalt. Am liebsten hätte sie sich einfach ins Bett gelegt und an nichts, an gar nichts mehr gedacht. Ja, normalerweise wäre sie sofort nach Hause gefahren.
Aber nicht heute Nacht.
Kapitel 3
Wie Hagelkörner prallten die Regentropfen gegen Grims Gesicht, als er durch die Nacht flog. Das Wasser war ihm in den Nacken gelaufen, der Mantel klebte an seinem Körper, und ihm war verflucht noch mal eiskalt. Aber immerhin hatte er ein Ziel.
Unter ihm pumpte der nie versiegende Verkehr durch die Straßen, rote und goldene Adern im Geflecht der Nacht, vereinzelt dröhnte Musik aus Kneipen und Bars, doch ansonsten lag die Stadt in tiefem Schlaf. Er konnte sie spüren, die Träume der Menschen, die wie Rauchschwaden an seinen Klauen haften blieben, wenn er nah genug an ihren Fenstern vorüberflog. Ja, die Stadt schlief – aber nicht überall.
Bereits von Weitem sah er das grelle Licht der Leuchtreklamen, flackernde Herztöne im Dunkel der Nacht – das Pigalle-Viertel, Vergnügungsmeile der Menschen, wenn es dunkel wurde in der Stadt des Lichts. Kristallen tanzten die Lichter über Grims Haut, als er in den hellen Kegel eintauchte. Er flog tiefer, umfasste einen Flügel der roten Mühle und gab ihm kräftig Schwung. Funken sprühten, die Menschen kreischten, als sie das Feuerwerk sahen, und applaudierten begeistert. Grim lachte. Wenn die wüssten.
Er landete in einer Seitengasse auf dem Dach eines heruntergekommenen Hauses mit verschlossenen Fensterläden. Ein grauer Quader mit leuchtend roter Metalltür bildete den Treppenhausausgang. Irgendjemand hatte ein Graffiti in Form eines geschlossenen Auges an die Tür gesprüht. In schnellem Rhythmus klopfte Grim an. Sofort ging ein Seufzen durch die Tür und mit leisem Knirschen öffnete sich das Auge. Grim fühlte sich von einer gelb umrandeten Pupille gemustert. Surrend schoss ein blauer Lichtstrahl aus dem Auge, glitt über sein Gesicht und zog sich wieder zurück.
»Willkommen im ›Zwielicht‹«, murmelte eine Stimme im Inneren der Tür. Diese öffnete sich gleich darauf und gab den Blick frei auf eine schmale Steintreppe.
Schnell trat Grim ein. Wohlige Wärme umfing ihn, als er die Treppe hinabging und in einen dunklen, von hohen Gewölben durchzogenen Saal trat. Der Putz blätterte von der Decke und die Eichendielen waren verschmiert von Ruß und Schmutz. Fackeln hingen an den Säulen rings um die hölzerne Theke und tauchten alles in ihr flackerndes Licht. Irgendwo spielte jemand Akkordeon. Es war brechend voll. Werwölfe lungerten auf abgerissenen Sofas herum, Kobolde hockten betrunken an den hölzernen Tischen und heruntergekommene Gestaltwandler lehnten an den Säulen und rauchten. Ein fleckig grauer Gnom sprang mit einem für seine Körpergröße gewaltigen Bauchladen von Tisch zu Tisch und verkaufte Morgendämmerungsaroma, den Duft der Mittagssonne und die Farben des Regenbogens. Bei den Geschöpfen des »Zwielichts« fand er dankbare Abnehmer. Sie mieden die wahre Sonne, wenn sie konnten. Der Dampf der Wasserpfeifen waberte durch den Raum und milderte jedes Geräusch.
Grim atmete ein. Hier herrschte nicht die unterkühlte Stimmung wie in den Bars und Kneipen der Gargoyles in Ghrogonia, hier gab es auch keinen, der die Waldschrate vor die Tür setzte, weil sie angeblich zu sehr nach Knoblauch rochen. Das »Zwielicht« kannte keine Unterschiede. Hier waren alle gleich. Er bewegte sich langsam an den Tischen vorbei, grüßte hier und da und genoss die gedämpfte Atmosphäre. Hier würde es niemandem einfallen, wie in den ghrogonischen Koboldabsteigen nackt auf dem Tisch zu tanzen oder herumzuschreien und …
»Full House! Heureka, Full Hoooooouse!«, kreischte es da so laut, dass Grim zusammenfuhr. Er folgte dem Geschrei in eine Ecke, wo gerade ein marmorner Teufel mit langen Eckzähnen einen Freudentanz auf dem Tisch aufführte.
Grim stöhnte. Fibi, natürlich. Und da waren auch die anderen, der feuerspuckende Wasserspeierdrache Bocus und die uralte Steinziege Klara. Sie lachten so laut über Fibis Tanz, dass die Gewölbe davon widerhallten. Grim verzog das Gesicht. Und ausgerechnet diese Gargoyles waren seine Freunde. Er beobachtete Fibis Tanz mit einem Lächeln. Immerhin war er nicht nackt.
»Grim, welch seltener Anblick zu dieser Nachtzeit!« Bocus hatte ihn bemerkt und ließ seine von Ruß und Asche geschwärzten Zähne sehen.
Klara klopfte auf den steinernen Schemel neben sich. »Setz dich, setz dich!«, sagte sie leicht lispelnd.
Aufatmend ließ Grim sich fallen, streifte den tropfenden Mantel ab und hängte ihn neben eine der Fackeln.
»Hast wohl ’ne anstrengende Nacht gehabt, hm? Und dann noch dein Lieblingswetter – Regen! Du armer Teufel!« Fibi liebte es, mephistophelische Ausdrücke zu verwenden. Gerade schob er seine Hände über den Tisch und häufte einen Berg kleiner, glitzernder Kristalle vor sich auf.
»Und verletzt bist du auch.« Klara deutete auf Grims Wange und legte ihm mitfühlend einen Huf auf die Schulter.
Grim schnaubte. »Wäre alles nicht so schlimm, wenn ich mich auf meine …« Er überlegte kurz und verzog das Gesicht. »… Informanten, haha, verlassen könnte. Dank ihnen habe ich es statt mit einem Holokliten mit einem Phy zu tun bekommen, und …«
Bocus machte große Augen. »Holla, der war nicht ohne, könnte ich wetten! Aber du hast ihn fertiggemacht, wie immer, nicht wahr?«
Grim dachte an das armselige verkohlte Wesen, das im Regen zu seinen Füßen gestorben war. Auf einmal hatte er ein Kratzen im Hals.
»Dann wird es dich freuen zu hören, dass deine lieben Kollegen in der Zwischenzeit richtig fleißig waren«, sagte Klara und griff nach den Karten. Blitzschnell warf sie sie durch die Luft, fing sie wieder auf und mischte so das Blatt.
Grim spürte den Schatten, der sich seiner bemächtigte. Kollegen – also diejenigen, die an seiner Stelle mit den Mordfällen betraut worden waren: die Speichellecker Mouriers. Grim konnte sie nicht ausstehen.
»Sie haben wieder mal den Mörder gefasst«, meinte Fibi, während er sein Blatt aufnahm.
Grim bewegte seine Karten in den Klauen, ohne sie anzusehen. »Lasst mich raten«, murmelte er. »Es ist ein Hybrid.«
»Richtig!« Bocus riss in gespielter Überraschung die Augen auf. »Wie bist du nur darauf gekommen? Er soll einen der Senatoren, Phor Kramas, soweit ich weiß, hinterrücks ermordet haben – dabei wurde er wohl erwischt, und nun machen sie ihn mal eben für alle anderen Morde gleich mit verantwortlich.«
Grim zog die Brauen zusammen. »Phor Kramas … der hatte nicht einmal genug Stärke, um sich auf magische Weise ein Ohrloch zu schießen. Alle Opfer des Mörders waren mächtige Wesen – das ist das Einzige, was sie verbindet. Kramas passt nicht ins Schema.«
Klara zuckte mit der Achsel. »Wer interessiert sich denn noch für das Schema? Viele haben Angst. Hauptsache, alle paar Tage kann jemand hingerichtet werden – dann sind sie zufrieden. Und die sogenannten Kommissare klopfen sich gegenseitig auf die Schulter.«
Fibi hob den Kopf und seufzte tief. »Wenn man vom Teufel spricht.«
Lautes Lachen drang von der Treppe zu ihnen, gepaart mit schweren, steinernen Schritten. Grim stöhnte. Schon hörte er das hechelnde, unterwürfige Lachen von Krallas – erst seit drei Monaten in der Stadt und aufgrund seiner hohen magischen Stärke und vor allem seiner Kriecherei bei Mourier dennoch schon der zweithöchste Schattenflügler nach Grim selbst. Krallas war ein großer, hagerer Gargoyle. Seine steinerne Haut war bleich wie ein aufgeweichter Käse, seine Augen blickten farblos und ohne Wimpern oder Augenbrauen. Er ging immer ein wenig gebeugt und betrachtete sein Gegenüber nie geradeheraus, sondern stets mit halb geneigtem, seitlich gewandtem Kopf. Grim hatte ihn vom ersten Augenblick an nicht sonderlich gemocht, aber seit Krallas mit der Aufklärung der Morde betraut worden war, verabscheute er ihn regelrecht. Grim seufzte. Konnte er denn nicht einfach mal in Ruhe irgendwo sitzen? Aber Krallas gefiel es, von Zeit zu Zeit ins »Zwielicht« zu kommen, arrogant in die Runde zu glotzen und die kleinen Taschenspieler das Fürchten zu lehren, die er in diesem Etablissement vermutete. Meist umgab er sich mit frisch ernannten Schattenflüglern, die noch jung genug waren, um auf seinen schmierigen Glanz hereinzufallen. Grim brauchte sich nicht umzudrehen, um sie zu sehen: Fünf junge Rekruten waren es, allesamt menschenähnlich, wenn man von den winzigen Hörnern auf ihren Schädeln und den langen Teufelsschwänzen einmal absah, die sie wie Ratten hinter sich herzogen. Und alle steckten sie in der steinledernen Uniform der OGP, um die Brust eine Schärpe, auf der für jeden sichtbar zu lesen war: Schattenflügler, Sondereinsatzkommando. OGP – ein lächerlicher Name für das Exekutivorgan der Anderwelt, der auf Mouriers Mist gewachsen war: Oberste Gargoyle Polizei.
Grim schnaubte verächtlich. Alberne Namen und Uniformen waren für Mourier überaus wichtig. Grim hingegen hatte für die Einheitskleidung der OGP nicht viel übrig und sich immer wieder erfolgreich gegen sie gewehrt. Denn eines wusste er genau: Ein Gargoyle musste nicht die Gewandung eines Schattenflüglers tragen, um einer zu sein – ebenso wenig, wie eine strahlende Rüstung jemanden in einen Ritter verwandeln konnte.
Doch um das zu erfahren, brauchte es seine Zeit. Die Rekruten waren tatsächlich alle noch nicht lange dabei, und Grim vermutete, dass sie ihre Uniform seit ihrer Ernennung noch nicht einmal abgelegt hatten. Wahrscheinlich waren sie schon mit ihr verwachsen. Grim musste lächeln. Er erinnerte sich an seine eigene Ernennung zum Schattenflügler, daran, wie stolz und aufgeregt er gewesen war, und spürte, dass er den Jungspunden ihre Arroganz nicht übel nehmen konnte. Aber Krallas war etwas anderes. In dieser Nacht konnte Grim ihn nicht ertragen, das wusste er.
Er schob seinen Stuhl zurück und griff nach seinem Mantel. Was zu viel war, war zu viel. Er musste hier raus. Schnell verabschiedete er sich von seinen Freunden, schob sich wortlos an dem OGP-Trupp vorbei und hatte schon die Treppe erreicht, als er das Wispern hinter sich hörte. Er tat so, als wäre ihm etwas aus der Tasche gefallen, bückte sich und lauschte. Ja, sie redeten über ihn.
»Strafversetzt …«, drang es an sein Ohr. »Vom Schattenflügler zum Erinnerungslöscher … tiefer Fall … Aber nur auf Zeit, wie ich gehört habe …«
Ein Lächeln überzog Grims Gesicht. Solange das alles war, was sie über ihn zu reden hatten, konnte er … Da hörte er es, klar und deutlich, wenn auch mehr gehaucht als gesagt: »Verräter.«
Langsam richtete Grim sich auf und wandte sich zu der Gruppe um. Eine Weile tuschelten sie noch weiter, dann merkten sie, dass er sie ansah.
»Wer hat mich gerade so genannt?«, grollte er, obwohl er genau wusste, wer es gewesen war. Seine Stimme brach sich dunkel in den Gewölben des Saals, und die Gruppe der Uniformierten rückte zusammen wie eine Schafherde beim Anblick des Wolfes. Grim meinte sogar, leises Zähneklappern zu hören. Zur Hölle, was seid ihr für Waschlappen! Krallas stand vor ihnen wie ein ausgestoßenes Herdenmitglied. Blitzschnell packte Grim ihn an der Kehle, riss ihn in die Luft und drückte zu. Japsend strampelte Krallas mit den Beinen, die Augen quollen ihm aus dem Kopf. Spätestens jetzt war jedes Gespräch im Saal verstummt.
»Du warst das?«, fragte Grim leise und schaute Krallas direkt in sein angstverzerrtes Gesicht.
»Nein«, keuchte der und krallte seine Hände hilflos in Grims Klauen. »Ich wollte nur …«
»Du bist nur ein lächerlicher Speichellecker Mouriers«, sagte Grim ruhig. »Aber auch du bist Mitglied der OGP. Oder irre ich mich?«
Krallas starrte ihn aus seinen farblosen Augen an, als wäre ihm der Antichrist erschienen. »Nein«, krächzte er.
Grim zog ihn zu sich heran, so nah, dass er die Schweißperlen auf Krallas’ Stirn sehen konnte.
»Erster Grundsatz der OGP: Sei ein Gargoyle«, sagte er, ohne seinen Griff zu lockern. »Zweiter Grundsatz der OGP: Sei ein Gargoyle!«
Mit diesen Worten schleuderte er Krallas zu Boden. »Ihr seid nicht nur dumm und unerfahren, ihr benehmt euch auch noch wie winselnde Menschen!«, fuhr er die anderen der Gruppe an und machte einen Schritt auf sie zu. Sofort wichen sie vor ihm zurück. »Ist hier noch jemand, der mich einen Verräter nennt, mich, der seit Jahrhunderten im Dienst des Königs steht?« Er nickte zufrieden, als er die ehrfurchtsvollen Gesichter sah, und raunte leise: »Gut.«
Noch einmal warf er einen Blick auf die jämmerliche Kreatur zu seinen Füßen, dann fuhr er herum und stampfte die Treppe nach oben. Natürlich wusste er, worauf sie anspielten. Seine Versetzung in den Streifendienst – zeitlich begrenzte Versetzung im Übrigen – kam ja nicht von ungefähr, und es war auch nicht das erste Mal. Er hatte schon immer in erster Linie seine eigenen Regeln befolgt, und er war bekannt dafür, dass er die Gesetze der Gargoyles mitunter ein wenig … nun, dehnte. Und ja, er hätte sich diese … Geschichte nicht zuschulden kommen lassen dürfen. Er hätte den Menschenjungen ausliefern müssen, der sich in die Nähe der geheimen Eingänge gewagt hatte, jener Eingänge, die in die anderweltliche Unterwelt von Paris führten. Grim wusste, dass er einen Fehler begangen hatte – und er würde ihn jederzeit wiederholen. Machte ihn das etwa zu einem Verräter?
Er stieß die Tür auf und spürte sofort den eisigen Wind auf seinem Gesicht. Egal. Alles war besser als Krallas dort unten. Er warf sich in die Nacht und schwebte eine Weile weit oben über der Stadt. Kaum hatte die Kälte ihn ein wenig beruhigt, wurde der Regen stärker. Er musste ins Trockene, auf der Stelle, aber zurück ins »Zwielicht«? Auf keinen Fall. Er warf einen Blick auf die Straßen unter sich. Ganz in der Nähe gab es einen Ort, an dem er seine Ruhe haben würde. Ein düsteres Lächeln stahl sich auf sein Gesicht. Lautlos überflog er ein paar Häuserzeilen, entdeckte den nassen Sand der Arènes de Lutèce und ließ sich tiefer sinken. Mit leisem Knirschen schob er das oberste Fenster eines der umstehenden Häuser auf und zwängte sich hinein. Für einen Moment war es stockdunkel, dann hatten seine Augen sich an die Finsternis gewöhnt und er konnte sich umsehen.
Nichts hatte sich verändert seit seinem letzten Aufenthalt vor wenigen Wochen. Diese Etage war seit Längerem unbewohnt, auch wenn er sich gut vorstellen konnte, dass die Taubeninnung längst einen Antrag auf Besiedelung gestellt hatte. Mistige Kreaturen. Er sog die Luft ein. Kein Gargoyle war seitdem in diesem Gebäude gewesen, so viel stand fest, aber er witterte den Geruch von Menschen, kleinen Menschen. Ja, Kinder waren hier gewesen, vermutlich hatten sie in den verlassenen Räumen gespielt. Grim fuhr sich mit seiner Klaue über die Augen und lächelte. Er mochte es, Menschenkindern beim Spielen zuzusehen. Sie waren in einer Welt zu Hause, die ihm für immer verwehrt bleiben würde – eine Welt aus unverstellten Gefühlen, Träumen und Hoffnungen, fernab von den kühlen Gefilden der Erkenntnis, und manchmal, in samtschwarzen, einsamen Nächten fühlte Grim eine Sehnsucht nach dieser Welt, die ihn erschreckte. Denn eines wusste er genau: Kein anständiger Gargoyle sehnte sich nach etwas, das die Menschen betraf. Meist gelang es ihm, mit der Maske der Verachtung auf die Welt der Sterblichen zu blicken, und sein Schauspiel war so überzeugend, dass er seiner Rolle selbst mehr glaubte als dem, was er unter ihr verbarg. Und doch gab es nichts, das ihn so sehr traf wie das Lachen oder Weinen eines Kindes. Manchmal schon hatte er sich gewünscht, diese kleinen Wesen festzuhalten, die Zeit einzufrieren, damit sie für immer so bleiben konnten. Für immer. Ein Frösteln überzog ihn bei diesen Worten.
Langsam ging er eine Weile auf und ab und hinterließ riesige Klauenabdrücke auf dem staubigen Boden. Er hörte die Ratten in den Rohren unter den Dielen. Sie begrüßten ihn, neugierig, wie sie waren. Eine Weile sprach er mit ihnen in Gedanken. Dann setzte er sich ans Fenster und schaute hinaus auf die Arena. Moosbewachsen erhoben sich die Sitzreihen im fahlen Schein der Laternen, die Bäume rauschten leise im Wind. Tagsüber spielten die Menschen hier Fußball oder Boule, Liebespaare trafen sich auf den Stufen, und manchmal kamen Touristen und machten unschlüssig ein paar Fotos von Sand und Steinen. Für die Menschen gehörte dieser Ort zu ihrer Stadt, aber sie hatten vergessen, was er eigentlich bedeutete. Dieser Platz war ein Ort der Geschichte, der Grim Ruhe vor lästigen Nervensägen garantierte. Denn kein Gargoyle kam freiwillig hierher.
Umso erstaunter war er, als er plötzlich ein vertrautes Geräusch hörte. Steinerne Schwingen in der Luft. Er schob das Fenster auf und versuchte Witterung aufzunehmen, doch der Wind schlug ihm mit eisiger Hand den Regen ins Gesicht und machte seinen Plan zunichte. Vorsichtshalber zog Grim sich in den Schatten des Hauses zurück. Ihm stand nicht der Sinn nach einem Schwätzchen und nach dummen Fragen schon gar nicht. Das Rauschen der Schwingen kam immer näher. Grim beugte sich vor und hob überrascht seine steinernen Brauen.
»Moira«, flüsterte er unhörbar.
Mit elegantem Schwingenschlag landete eine Gargoylefrau mitten in der Arena. Wie Grim selbst hatte sie auf den ersten Blick erstaunliche Ähnlichkeit mit einem Menschen. Sie trug eine Toga, die sich sanft um ihre schmale Taille wand, und hatte die langen Haare kunstvoll hochgesteckt. Ihre Augen lagen dunkel und geheimnisvoll in ihrem Gesicht. Sie sah jung aus, dabei war sie der älteste Gargoyle, den Grim kannte. Doch ihre Haut war grau geworden mit der Zeit und in ihrem Inneren wucherte die Todesrose, eine Krankheit, die vor allem sehr alte Gargoyles heimsuchte und ihre Eingeweide zerfraß, bis sie innerlich hohl waren. Grim musste Atem holen, als er daran dachte. Nicht nur einmal hatte er erlebt, wie Moira Schmerzen gelitten hatte wegen dieser Krankheit. Doch in ihren Augen funkelte die lebhafte Schwärze des Steinblutes, das auch das seine war. Wie er war auch sie vulkangeboren und sie hatte sich seiner angenommen, damals, als er ziellos durch Italien geirrt war, hatte ihn nach Ghrogonia gebracht und ihm ein Stück Wärme gegeben mitten in dieser kalten Stadt. Seit er sie kannte, lebte sie zurückgezogen auf den Friedhöfen, mal hier, mal dort, und hielt sich aus allem heraus. Das war auch ein Grund, warum Grim sie mochte. Aber was suchte sie an diesem Platz?
Auf einmal flackerten die Laternen, dann gingen sie aus. Grim fühlte den leisen Hauch von Magie. Warum löschte Moira das Licht? Fürchtete sie, dass sie beobachtet werden könnte, von Menschen vielleicht? Grim hatte kein Problem damit, durch Regen und Dunkelheit zu sehen. Deutlich erkannte er, wie Moira in der Arena auf und ab ging. Ihre Krallen machten auf dem nassen Sand kaum ein Geräusch. Nur Grim konnte sie hören. Gerade hatte er beschlossen, sich zu erkennen zu geben, als er Schritte hörte.
Dieses Mal war es ein Mensch, der sich näherte. Alarmiert setzte Grim sich auf und stellte zu seiner Beruhigung fest, dass Moira erstarrt war. Er hielt den Atem an. Natürlich hatte sie die Schritte auch gehört. Jetzt betrat ein junger Mann den Platz, ungewöhnlich dünn war er und sein helles Haar leuchtete zu Grim herauf wie ein weißes Segeltuch. Was, zur Hölle noch eins, hatte der hier zu suchen? Die Arena wurde nachts geschlossen, er musste eingebrochen sein. Aber warum? Angespannt beobachtete Grim, wie der Mensch sich Moira näherte. Vermutlich wunderte sich der Kerl, wie diese Statue in die Arena gekommen war. Aber er würde schon eine Erklärung finden, die Menschen konnten immer alles erklären, was sie nicht verstanden. Es war nicht einfach, absolut still zu stehen, wenn man das Blut in seinen Adern spürte, das wusste Grim, und er fühlte Mitleid mit Moira, als der Junge dicht vor ihr stehen blieb. Noch immer verharrte sie regungslos. Der junge Mann hingegen stand eine Weile einfach da. Dann lächelte er und berührte Moira an der Schulter. Grim presste die Zähne zusammen. Was sollte das? War das einer von diesen Verrückten, die nachts mit Steinfiguren sprachen und sie behandelten, als wären sie ihre Freunde? Angestrengt fixierte er Moiras Gesicht. Sie schien den Jungen anzusehen, der konzentriert vor sich hin nickte, als würde ihm jemand etwas sehr Bedeutendes erzählen. Grim wurde blass unter seiner Obsidianhaut. Konnte das sein? Er beugte sich weiter vor und lauschte durch den Regen, doch er hörte nichts als das vermaledeite Aufschlagen der Tropfen auf Sand und Steinen. Verwirrt starrte er Moira an und da – ganz deutlich – passierte es: Sie lächelte.
Der Schreck traf Grim so plötzlich, dass er wie von einem Schlag getroffen zurückfuhr. Fassungslos sah er zu, wie Moira die Hand hob und dem Jungen über die Wange strich. Was, zur Hölle noch eins, tat sie da? Grim war außer sich. Er musste sich am Fensterrahmen festhalten, um nicht zu schwanken. Sie zeigte sich einem Menschen, einem Sterblichen, sie brach den jahrhundertealten Pakt, sie riskierte alles, alles! Niemals war es vorgekommen, dass ein anständiger Gargoyle sich absichtlich einem menschlichen Auge gezeigt hatte, niemals seit der Alten Zeit, und das hatte seine Gründe! Wie konnte sie es wagen, alles zu verraten, was die Sicherheit ihres Volkes begründete? War es ihr gleichgültig, was geschehen mochte, wenn das herauskam?
Grim fühlte, wie ihm kleine Kiesel von der Stirn rieselten, so sehr hatte er die Brauen zusammengezogen. Nein, er würde sie nicht verraten, aber was, wenn er nicht der Einzige war, der etwas wusste? Er musste mit ihr sprechen, so viel war klar, doch erst einmal sollte er herausfinden, was dort unten vor sich ging. Sie sprachen Grhonisch, das wusste er, die uralte Gedankensprache der Gargoyles. Was für ein Verrat! Grim schüttelte sich bei dem Gedanken, einen Menschen Grhonisch sprechen zu hören.
Wieder streckte Moira die Hand aus, sie hielt etwas zwischen den Fingern. Grim kniff die Augen zusammen und erkannte ein in dunkles Leder verschnürtes Päckchen. Der junge Mann nahm es entgegen, seine Hände strichen über das Leder und seine Augen leuchteten, als hätte er einen Schatz gefunden. Der Regen hatte aufgehört und als Grim angestrengt lauschte, hörte er drei Worte auf Grhonisch: »Ich danke dir.«
Doch es war nicht der Mensch gewesen, der diese Worte gesprochen hatte, nein, Moiras Stimme war es, die in Grims Schädel widerhallte.
Noch einmal sahen sich die beiden an. Dann wandte der Junge sich ab und ging über den Platz. Moira blieb stehen, wo sie war. Kaum war der Mensch verschwunden, schob Grim das Fenster auf. Es knarrte kaum hörbar, doch Moira wandte sich um und schaute ihn an. Ein Flackern ging durch ihren Blick, eine Schwärze, die Grim frösteln ließ.
Moira, dachte er, als er seine Schwingen ausbreitete. Was hast du getan?
Kapitel 4
Wie wütende Hummeln rasten die Autos an ihr vorbei. Die eiserne Brücke der Rue Caulaincourt vibrierte unter ihren Füßen, es schüttete wie aus Eimern und außerdem war es kalt. Unter ihr lag der Cimetière de Montmartre mit seinen verwitterten Gräbern und den alten, knorrigen Bäumen, deren Blätterrauschen durch den Regen drang wie eine nie enden wollende Totenklage.
Angespannt schaute Mia zu dem Damenquintett hinüber, das sich in der Nähe der Friedhofstür versammelt hatte und redete, als gäbe es kein Morgen. Aber den gab es, und Mia blieb nicht mehr viel Zeit. In ziemlich genau einer Stunde würde der alte Maurice sich seinen Hut aufsetzen und seine Runde machen, und da er nicht mehr der Jüngste war, konnte das einige Zeit dauern. Sie musste diese Sache vorher erledigen und rechtzeitig wieder verschwinden, wenn sie nicht zweimal in einer Nacht beim Wurstgesicht und seinem Stempelkissen landen wollte. Aber diese dämlichen Tratschtanten mussten sich natürlich ausgerechnet jetzt in strömendem Regen vor diese Tür stellen!
In diesem Moment schoss ein Taxi heran, hielt mit quietschenden Reifen mitten in einer Pfütze neben den Damen und durchnässte zwei von ihnen bis auf die Knochen. Keifend stürzten sich alle fünf auf den Taxifahrer, der geduldig die Türen öffnete und eine nach der anderen in seinen Wagen lud. Mit missmutigem Gesicht murmelte er ein Schimpfwort, verschwand hinterm Steuer und fuhr mit seiner wütenden Fracht davon.
Mia zog zwei silberne Gegenstände aus ihrer Tasche, die merkwürdige Ähnlichkeit mit Zahnarztsonden hatten. Prüfend schaute sie sich um, aber kein Fußgänger war zu sehen.
Jetzt.
Sie rannte zur Tür und klemmte den Spanner ins Schloss. Lucas hatte ihr einmal gesagt: Du hast Schlösser geknackt, seit du fünf bist – weil du Grenzen und Barrieren nicht akzeptieren willst, die andere dir setzen. Mia wusste nicht, ob tatsächlich eine psychologische Bedeutung hinter dieser Fähigkeit steckte, aber Begabung und Leidenschaft für das Knacken von Schlössern waren ihr tatsächlich in die Wiege gelegt worden. Schon als kleines Kind hatte sie mühelos das Schloss ihrer Spardose aufgebrochen und diese Fähigkeit in jahrelanger Übung immer mehr verfeinert.
Für dieses Schloss an der Friedhofstür brauchte sie sieben Sekunden. Vorsichtig schob sie das Tor auf und zwängte sich durch den Spalt. Leise fiel es hinter ihr zu.
Für einen Moment stand sie regungslos und lauschte. Gedämpft durch das Rauschen der Bäume drangen die Geräusche der Straße an ihr Ohr. Sie atmete ein. Vor ihr lag die Stadt der Toten.