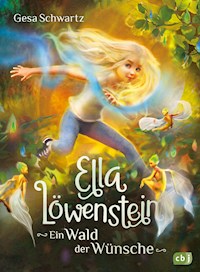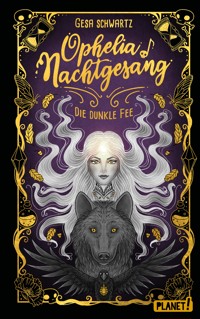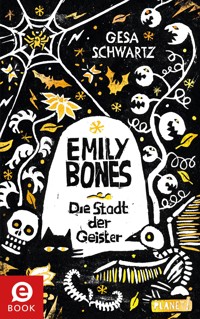6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: hockebooks
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
„Nephilim“ ist der erste Teil der Chroniken der Schattenwelt. Der junge Nando, der in Rom bei seiner Tante lebt, wird zusehends in die mystische Schattenwelt hineingezogen, die unsichtbar vor den Augen der Menschen in unserer Welt existiert. Mit einem Traum, in dem ihn ein geheimnisvoller Fremder zu sich ruft, beginnt seine Reise. Kurz darauf spürt Nando, dass nichts mehr ist wie zuvor: Sein Körper gewinnt immer mehr an Stärke und übernatürlichen Fähigkeiten. Als wäre das nicht genug, muss er die neuen Kräfte gegen ein Schattenwesen einsetzen und um sein Leben kämpfen. Er kann sich befreien, bleibt aber mit einer schrecklichen Erkenntnis zurück: Er selbst gehört der dunklen Seite an – er ist der Sohn des Teufels. Und Luzifer hat etwas mit ihm vor. Er will die Kräfte seines Sohnes nutzen, um die Tore zur Hölle zu öffnen und so zum Herrscher über die Welt der Menschen werden. Nando hat nur eine Chance, sich diesem Weg zu widersetzen – und dieser führt durch die Dunkelheit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1057
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Gesa Schwartz
Die Chroniken der Schattenwelt
Band 1:Nephilim
Roman
1
Rom ertrank im Regen. Das Wasser sammelte sich in den Straßen, die Konturen der Stadt verschwanden hinter dunstigen Schleiern und verwandelten sich in undeutliche Schemen. Nur gelegentlich brach der Mond durch die Wolkendecke, die sich in dieser Nacht wie ein schweres schwarzes Tuch über die Dächer gelegt hatte, und schickte seinen gleichgültigen Schein über Pfützen aus rotem und grünem Neonlicht.
Das Unwetter hatte die Menschen auch im Viertel San Lorenzo von den Straßen vertrieben, und so hörte Enzo nichts als das wütende Trommeln der Tropfen auf dem Asphalt und seine eigenen Schritte, strauchelnd und tappend zwischen all den Wasserlachen. Er hatte gelernt, den Regen zu hassen. Seine Finger schlossen sich steif vor Kälte um seinen Geigenkasten und sein nasser Mantel schlug gegen seine Knie, dass es ihm das Laufen schwer machte. Vereinzelt glitt das goldene Licht aus den Wohnungen der Häuser über sein Gesicht, und wie stets bei dieser Berührung überkam ihn auch nun der Impuls, stehen zu bleiben und zu den erleuchteten Fenstern hinaufzuschauen, schweigend und mit dieser atemlosen Sehnsucht des Ausgestoßenen nach dem Gewöhnlichen. Dieses Licht hatte eine Stimme, es hatte einen Geruch – und es hatte auch eine Faust, die es Enzo mit dem Zorn einer verschmähten Geliebten vor die Brust schlug und ihm eines ganz deutlich zeigte: Niemals würde er inmitten dieses Glanzes stehen, der immer wieder warm und golden zu dem einsamen Wanderer auf der Straße herausbrach. Enzo fühlte diese Gewissheit in sich brennen wie ein aufflackerndes Kohlestück, und er schüttelte den Kopf über den Zorn des Lichts. Es lag nicht in seiner Entscheidung, in diesem Glanz zu leben. In diesem Punkt hatte er niemals die Wahl gehabt.
Er zog sich die Fliegermütze tiefer ins Gesicht und blinzelte angestrengt gegen den Regen. Am anderen Ende der Straße erkannte er die Leuchtreklame des Restaurants. Ein Lächeln flog über sein Gesicht. Nun war es nicht mehr weit. Er hob den Geigenkasten vor seine Brust und rannte mit ihm quer durch die Pfützen bis zur Schwarzen Gasse. Zu beiden Seiten hockten die Häuser verlassen und missmutig wie schlecht gelaunte Kröten nebeneinander, dürftig beleuchtet von flackernden Straßenlaternen. Am Ende lag ein mit trostlosen Graffitis übersäter, längst geschlossener Nachtklub. Noch immer hing ein Teil des Namens als riesiges Schild über dem Eingang. Die andere Hälfte stand schräg wie eine Spielkarte gegen die Häuserecke gelehnt. Enzo lief darauf zu, zog in einer schnellen Bewegung die Plane zurück, die halb zerrissen vom Schild herabhing, und blickte auf ein sorgfältig ausgelegtes Nest aus Zeitungen, Decken und alter Kleidung.
»Casa, dolce casa«, murmelte er, bettete den Geigenkasten auf eine Jacke und setzte sich rücklings auf einen Stapel Zeitungen. Mit nassen Fingern streifte er sich die Schuhe von den Füßen, stellte sie sorgsam schräg gegen das Schild, hängte die tropfende Mütze an einen Nagel an der Hauswand und zog sich ins Innere seiner Behausung zurück.
»Du wirst wohl in hundert Jahren noch nicht wieder trocken sein, wie ich das sehe«, sagte Enzo zu seinem Mantel, während er ihn auf ein paar Zeitungen ausbreitete. »Aber mach dir nichts draus. Fische sind ihr ganzes Leben lang nass, und stört es sie etwa? Na also.«
Er nickte dem Mantel zu wie nach einem langen und fruchtbaren Gespräch und beugte sich fürsorglich über seinen Geigenkasten.
»Keine Sorge«, murmelte er, während er den Deckel öffnete und der Geige einen Blick zuwarf. »Du bist ganz trocken geblieben, kein Grund zur Aufregung.« Vorsichtig stellte er sie zwischen einen Stapel zusammengefalteter Kartons und einen Berg Mützen und breitete eine Zeitung als Dach darüber. Dann setzte er sich ihr im Schneidersitz gegenüber, die nackten Füße in den Kniekehlen vergraben, und nickte gedankenverloren vor sich hin.
»Ja, früher, da hast du recht, da wäre ich schneller gelaufen bei diesem Mistwetter«, sagte er. »Aber man wird nun mal nicht jünger, nicht wahr? Wie lange ist das jetzt her, seit wir uns in dieser Stadt niederließen? Fünfhundertdreiundsechzig, sagst du? Nun, das dürfte in etwa zutreffen, meine Liebe. Ich schätze, es waren fünfhundertachtundsechzig Jahre und siebeneinhalb Monate, um genau zu sein.« Er nickte vor sich hin. »Fünfhundertachtundsechzig Jahre … Wer hätte gedacht, dass alles einmal so endet?«
Ein Geräusch ließ ihn zusammenfahren, etwas wie das Rasseln schuppiger Leiber unter Mauerwerk. Er warf der Geige einen Blick zu und legte den Finger an die Lippen. Vorsichtig blinzelte er durch den Regen, der ein wenig nachgelassen hatte. Neblige Schleier zogen über den Boden, es dampfte aus einem nahe gelegenen Kanaldeckel. Enzo beugte sich vor, um besser sehen zu können, als er ein Scharren hörte, ganz in seiner Nähe. Fast zeitgleich bemerkte er die große Spinne auf seiner Hand. Angewidert schüttelte er den Arm und schleuderte das Tier hinaus in den Regen. Dort blieb es sitzen und starrte lauernd zu ihm herüber. Im selben Moment liefen Eiskristalle über den Hals seiner Geige, so schnell, dass er sie wachsen sehen konnte. Ein Schauer lief ihm über seinen Rücken wie die Erinnerung an einen bösen Traum. Gleich darauf fuhr ein heftiger Windstoß in seine Behausung, wirbelte die Zeitungen durcheinander und riss die Kartons in die Höhe. Enzo griff nach seiner Geige, hielt die Zeitungen fest und ließ sich auf einen Kleiderhaufen fallen, als der Sturm so plötzlich aufhörte, wie er gekommen war. Er strich sich die Haare aus der Stirn. Ein Ton hing in der Luft wie das Klingen eines halb gefüllten Glases unter der Berührung eines am Rand entlangfahrenden Fingers. Enzo spürte, wie ihm das Blut aus dem Kopf wich. Im selben Moment sah er den Fremden.
Er hockte auf dem Bretterstapel vor der Hauswand gegenüber, pechschwarz und so in sich zusammengesunken, dass man ihn fast für einen Berg Lumpen hätte halten können. Aber aus den Ärmeln des langen Mantels ragten ungewöhnlich weiße Hände und der Regen tropfte von einem dunklen, breitkrempigen Hut, der das Gesicht vollständig verbarg. Neben ihm saß ein schwarzer Wolf, hoch aufgerichtet und lauernd. Enzo fuhr sich über den Mund wie ein Verdurstender.
»Nein«, flüsterte er kaum hörbar. »Das ist unmöglich.«
Da hob der Fremde den Kopf. Sein Gesicht war kalkweiß und lippenlos, die Haut zog sich wie uraltes Pergament über die hohen Wangenknochen und die scheinbar mehrfach gebrochene Nase, und die Augen lagen so tief in ihren Höhlen, dass es schien, als wäre da nichts als Finsternis. Enzo schreckte zurück, doch nicht vor dem Schrecken dieses Anblicks.
Er sah dieses Gesicht nicht zum ersten Mal.
Seine Hand grub sich so fest in die Zeitungen, dass seine Gelenke knackten, doch er fühlte es nicht.
Er war gekommen.
Für einen Augenblick konnte Enzo nicht atmen, das Grauen schloss sich fest um seine Brust. Doch gleich darauf durchflutete ihn ein anderes Gefühl. Die Zeit war gekommen. Das Leben im Schmutz und im Verborgenen, die Jahrhunderte in den Schatten – jetzt würde es enden. Er holte tief Atem, fast schien es ihm, als täte er es zum ersten Mal. Und mit einer einzigen raschen Bewegung löste er sich aus seiner Erstarrung und trat hinaus in den Regen. Er fühlte die Tropfen, die nur noch leicht fielen, wie Liebkosungen auf seinem Gesicht, und der Boden unter seinen bloßen Füßen war beinahe warm.
»Bhrorok«, sagte er und hörte zum ersten Mal seit unendlich langer Zeit wieder seine wirkliche Stimme, tief und kraftvoll, wie sie damals gewesen war.
Der Fremde, der kein Fremder mehr war, öffnete den Mund, doch er antwortete nicht. Stattdessen kroch Nebel über seine Lippen, zäh wie Sirup. Er brachte die Luft zum Erstarren, Eisblumen zogen sich durch den Regen. Enzo sah die weißen Hände mit den schwarzen, eingerissenen Nägeln und wie sich etwas Madengroßes schmatzend und rasselnd unter der Haut der rechten Hand entlangwand. Dann neigte Bhrorok den Kopf und ein Wort glitt aus seinem Mund, getragen von einer Stimme, die heiser klang wie ein Schrei im Sturm.
»Yrphramar.«
Enzo schauderte. Wie lange war er nicht mehr mit diesem Namen angesprochen worden? Ein bitteres Lächeln stahl sich auf seine Lippen. War es nicht ein Hohn, dass ausgerechnet diese Kreatur ihm den Respekt zollte, den er verdiente – als erstes Wesen seit so langer Zeit?
Er erwiderte die Geste, auch er neigte den Kopf, und während er das tat, flackerten tausend Bilder durch seinen Sinn. Er sah sich auf Schlachtfeldern und auf der Jagd, spürte den bitteren Geschmack der Beschwörungen auf seinen Lippen und den warmen Klang der Zauber, und auf einmal fühlte er den Schmutz von sich abfallen, all den Unrat, den er in dieser falschen Welt angesammelt hatte, und als er den Blick hob und Bhrorok ansah, war er nicht mehr Enzo mit dem Geigenkasten. Yrphramar – das war sein Name. Er war ein Krieger, ein Jäger, das war er immer gewesen. Er war geflohen und nun hatte man ihn gestellt. Doch er würde nicht kampflos aufgeben – er würde überhaupt nicht aufgeben. Er sah, dass auch Bhrorok die Veränderung wahrgenommen hatte, und bemerkte etwas wie Befriedigung in dessen aschfahlem Gesicht.
Bhrorok erhob sich lautlos. In langen, schweren Schritten durchzog er die Pfützen und blieb in einiger Entfernung stehen. Das düstere Licht der Straßenlaternen ließ seine Gestalt noch dunkler erscheinen.
Yrphramar drehte die Fläche seiner linken Hand nach oben, die Regentropfen blieben glitzernd wie Tau darauf liegen. Noch einmal ließ er die Luft in seine Lunge fließen und bewegte sich langsam auf die Mitte der Gasse zu, seitwärts wie ein Mungo vor der Kobra, bis er Bhrorok in weitem Abstand gegenüberstand. Der Wolf hockte noch immer neben dem Bretterstapel, regungslos wie zuvor.
Yrphramar bewegte die Lippen und sprach die Formel. Sanft glitten die Worte über seine Zunge. Er spürte, wie das Feuer in seine Augen trat, kurz durchzuckte ihn heftiger Schmerz. Dann wurde sein Blick klar, er sah jede Einzelheit Bhroroks wie unter einem Brennglas und fühlte die Flammen, die rot glühend aus seinen Augen loderten.
Bhrorok hatte sich kaum verändert. Nur die Farbe war aus seinen Augen gewichen, weiß und wächsern stierten sie durch den Regen herüber, und seine Züge mit dem halb geöffneten Mund hatten etwas Leichenhaftes bekommen.
Gleichzeitig hoben sie die rechte Faust vor ihre linke Schulter. Für einen Augenblick hielt die Welt um sie herum den Atem an. Die Regentropfen erstarrten im Fallen, das Flackern der Straßenlaternen setzte aus, selbst der Nebel, der aus dem Kanal kroch, verharrte. Dann begann der Kampf.
Mit einem Schrei wich Yrphramar der Druckwelle aus, die krachend hinter ihm in die Wand schlug. Er rollte über den Boden, die Finger der linken Hand gespreizt, ergriff etwas in der Luft und riss Bhrorok die Beine unter dem Körper weg. Krachend landete der auf dem Rücken, sprang auf und schleuderte einen grünen Blitz in Yrphramars Richtung. Schnell kam dieser wieder auf die Füße, floh vor dem Blitz die Hauswand hinauf und rannte an ihr weiter direkt auf Bhrorok zu. Im Lauf beschwor er den Regen, die Tropfen wurden zu Messern, die sich zischend auf seinen Feind stürzten.
Doch Bhrorok duckte sich, nur einzelne Tropfen zerschnitten ihm die Wange. Schwarzes Blut rann über sein Gesicht, schon hatte er einen Donnerzauber gewirkt und warf ihn Yrphramar entgegen, der gerade noch rechtzeitig in Deckung gehen konnte. Schnaufend erhob er sich in die Luft und schickte einen Flammenstrahl zu Bhrorok hinab. Dieses Mal konnte er nicht ausweichen. Yrphramars Zauber traf ihn so heftig, dass es augenblicklich nach verbranntem Fleisch stank und ihm die Kleider in Fetzen vom Körper hingen. Doch noch immer stand er da, er schwankte nicht und schrie auch nicht vor Schmerzen. Nur in seinen leeren weißen Augen hatte sich etwas wie Wut verfangen, als er jetzt den Arm hob und schwarze Flammen wie Schlangen aus seinen Fingern schossen.
Yrphramar stob rückwärts durch die Luft und warf die Flammen mit einem Spiegelzauber zurück. Er rang nach Atem. Die Magie kostete ihn mehr Kraft als erwartet, immer wieder zogen schwarze Schatten an seinen Augen vorüber, doch die körperlichen Auswirkungen waren noch nicht alles. Ein grausamer Schwindel pochte hinter seiner Stirn und als er kurz die Augen schloss, schien es ihm, als würde er auf einem Drahtseil in undurchdringlicher Finsternis stehen. Er fühlte es unter seinen Füßen und wusste um den Abgrund, der unter ihm lag. Das Seil knarzte und kaum, dass er schwankte, loderte die Dunkelheit um ihn herum auf. Er kannte die Versuchung, die in ihr lauerte, und er spürte die Furcht vor dem Abgrund in seinen Schläfen pulsen. Lange war er vor ihm geflohen, lange hatte er ihn gefürchtet und verachtet. Er sog die Luft ein, langsam und fließend. Nun war es an der Zeit, dem ein Ende zu setzen. Sein Herz raste, als er die Augen aufriss und Bhrorok auf sich zukommen sah, und er hörte die Musik, die tief aus seinem Inneren aufwallte und ihn fest auf dem Seil hielt.
Entschlossen traf er Bhrorok mit einem Sturmzauber an der Stirn, stürzte auf ihn zu und schlug seinen Kopf wieder und wieder gegen die Hauswand. Schwarzes Blut lief ihm über die Finger, doch Yrphramar sah nichts als die toten, weißen Augen, die keinen Schmerz zu kennen schienen. Stattdessen trat eine kalt glühende Grausamkeit in Bhroroks Blick.
Mit einer Bewegung, die zu schnell war für Yrphramars Augen, schlug Bhrorok ihm die Arme zurück, packte ihn an der Kehle und schleuderte ihn die Gasse hinab. Er krachte gegen die Hauswand, fiel wie leblos zu Boden und konnte nur unter Schmerzen Luft holen. Gerade noch rechtzeitig sah er den Feuerwirbel, der auf ihn zuraste, und konnte sich hinter einem Schutzzauber verbergen. Knisternd glitten die Flammen an seinem Schild ab und erloschen. Sie hatten den Asphalt zu beiden Seiten der Gasse in Brand gesetzt, und hinter dem versagenden Zittern seines Zaubers sah Yrphramar seinen Feind kommen, die brennende Straße unter seinen Füßen. Er fühlte, wie der Boden unter Bhroroks Schritten zitterte, spürte, wie er gepackt und an der Kehle in der Luft gehalten wurde. Ein winziger schwarzer Punkt hatte sich in Bhroroks Augen gebildet, nadelfein, als hätte er alle Grausamkeit der Welt auf einem einzigen Fleck versammelt. Yrphramar stieß seine rechte Hand in Bhroroks Schulter, seine Finger gruben sich in faulendes Fleisch, und dieses Mal zuckte etwas wie Schmerz über das kalkweiße Gesicht. Dann öffnete Bhrorok den Mund.
»Wo finde ich Obolus?«
Yrphramar brauchte eine Weile, bis er verstand, dass Bhrorok nur das Restaurant meinen konnte, das sich einige Straßen weiter befand. Es fiel ihm nicht leicht, Atem zu holen, irgendetwas steckte in seiner Lunge. Dennoch stieß er die Luft so verächtlich aus, wie es ihm möglich war.
»Deswegen bist du gekommen?«, keuchte er, während er seinen Herzschlag in den Schläfen fühlte. »Du, Kreatur der Finsternis, Diener der Schatten, fragst mich nach dem Weg?« Er wollte noch einmal lachen, aber die Klaue um seinen Hals drückte zu. »Wieso?«, presste er hervor. »Wieso willst du das wissen?«
Da glitt etwas über Bhroroks Gesicht, das ein Lächeln hätte sein können, wäre es nicht so grausam gewesen. »Der Junge«, raunte er. »Ich suche den Jungen.«
Yrphramars Augen wurden schmal. Ein Schmerz wie von einem Messerhieb zog durch seine Brust. Er hatte sich also nicht geirrt. Die Schatten umdrängten das Licht, sie gierten mit ihren tödlichen Schleiern nach ihm, und sie würden es mit sich reißen und die Welt in den Abgrund stürzen, wenn es nicht stark genug war. Schon spürte er die Finsternis, die aus Bhroroks Innerem loderte, und er hörte dessen Stimme wie im Traum.
»Folge den Schatten«, raunte Bhrorok kaum hörbar. »Folge ihnen und lebe – oder stirb.«
Noch einmal spürte Yrphramar die Versuchung, dem Ruf aus der Dunkelheit zu folgen und jeden Kampf, jede Zerrissenheit für alle Zeit zu vergessen. Doch die Musik in ihm war stark. Donnernd brandete sie auf und trieb das Bild eines jungen Mannes in seinen Geist. Er schaute in ein Gesicht mit blauen, unruhigen Augen, und er spürte einen Schauer der Freundschaft und Zuneigung, der ihn mit ungeahnter Macht durchströmte. Doch ehe der Junge auf seine zaghafte Weise lächelte, drängte Yrphramar sein Bild zurück und mit ihm den Schreck, der mit tödlichen Klauen nach seiner Kehle greifen wollte. In rasender Geschwindigkeit zogen die Gedanken durch seinen Sinn, er hatte viele Möglichkeiten – und keine.
Die Kälte hatte seine Finger taub gemacht, sie steckten wie leblos in Bhroroks Körper. Niemals. Sein Kiefer knackte, als er den Mund öffnete, und seine Zunge gehorchte ihm nicht mehr. »Armselige Kreatur«, brachte er dennoch hervor und sah das Nichts in Bhroroks Blick wie eine Wolke aus Gift auf sich zurasen. »Ich werde meinen festen Stand nicht verlieren wegen eines Sklaven wie dir. Scher dich zurück in die Schatten, die dich erschaffen haben!«
Mit letzter Kraft stieß er den Kopf vor. Er hörte, wie Bhroroks Nase brach. Keuchend landete Yrphramar auf dem Boden, seine Finger fanden seine Geige und augenblicklich durchströmte ihn ein Gefühl, das jede Kälte vertrieb. Er strich über die Saiten und eine Melodie erklang, die sich mit seiner inneren Musik vermischte und für einen Moment wie ein Riss durch den Regen ging. Dann wurde der Ton durchbrochen von einem Laut, der so schrecklich war, dass Yrphramar erschrocken wäre, wenn er ihn nicht schon einmal gehört hätte.
Bhrorok schrie.
Er hockte am Boden, die Hände so tief in sein Gesicht gekrallt, dass blutige Striemen über seine bislang unverwundete Wange liefen, und schrie aus Leibeskräften mit all den Stimmen jener, die er verschlungen hatte. Yrphramar schloss die Augen, er ertrug dieses Bild nicht, und er zog den Bogen über die Saiten, schneller und schneller, bis die Melodie in einem fulminanten Feuerwerk die Fenster der verlassenen Häuser bersten und die Regentropfen wie tausend winzige Sonnen zerspringen ließ. Ein zarter Ton hing in der Luft, als Yrphramar sein Lied beendete. Er zitterte, als er die Augen öffnete. Da lag Bhrorok, zusammengesunken auf dem Bretterstapel, wo er ihn begrüßt hatte. Sein Köter war verschwunden.
Schwer atmend ging Yrphramar auf Bhrorok zu. Er murmelte den Zauber, als er hinter sich ein Keuchen hörte. Er fuhr herum. Hinter ihm saß der Wolf. Und noch ehe Yrphramar den Blick gewandt hatte, wusste er, dass er verloren hatte.
»Narr«, hörte er Bhroroks Stimme.
Im nächsten Moment fühlte Yrphramar, wie eine kalt glühende Faust seinen Brustkorb durchstieß. Mit letzter Kraft riss er seine Geige in die Luft und schmetterte sie Bhrorok ins Gesicht. Das Holz zersplitterte, als wäre es gesprengt worden, und feiner, silberner Staub rieselte durch die Luft. Zischend landete er auf Bhroroks Haut, brannte sich in weißes Fleisch und traf selbst den Wolf, der jaulend zurücksprang. Schwarze Krater bildeten sich dort, wo die Staubkörner Bhroroks Gesicht berührten. Schmerz flammte über seine Züge, doch in seinen Augen stand nur Verachtung.
Die Kälte in Yrphramar wurde unerträglich, aber er spürte keine Schmerzen. Er fühlte nur die Dunkelheit, die lauernd auf ihn wartete, und sah die zarten Umrisse eines goldenen Schmetterlings, der sich aus den Überresten seiner Geige in den Nachthimmel schwang und davonflog.
Für einen Moment starrte Bhrorok ihn an, etwas wie Erstaunen spiegelte sich auf dem kalkweißen Gesicht. Dann zog er Yrphramar dicht vor seinen Mund. Eine klebrige schwarze Zunge leckte über mehlige Haut und aus seinem Mund krochen Maden, dicke, schwarze Käfer und zuckende Würmer.
Yrphramar wollte schreien, doch sein Körper gehorchte ihm nicht mehr. Das Ungeziefer sprang auf sein Gesicht, er fühlte scharfe Beine wie Rasierklingen auf seiner Haut. Blut lief ihm über das rechte Auge, etwas riss Fleisch aus seiner Wange. Immer mehr Käfer hüllten ihn ein, bis er nichts mehr sah und hörte als das feuchte Knistern ihrer schwarzen Leiber.
Da fühlte er, wie sein Kiefer sich öffnete, er konnte nichts dagegen tun, und die Käfer glitten über seine Lippen und seine Kehle hinab. Ich sterbe, dachte er erschrocken, und gleichzeitig spürte er etwas in seinen Händen, es war der hölzerne Griff seiner Geige. Sanft strich er in Gedanken mit dem Bogen über die Saiten, er spielte auf, ein letztes Mal. Dann durchzog ihn der Schmerz von tausend fressenden Mäulern und alles wurde schwarz.
Bhrorok wartete, bis seine Schergen ihr Werk beendet hatten. Mit einem einzigen Atemzug kehrten sie zu ihrem Herrn zurück und verschwanden in seinem fahlen Körper. Langsam wischte er sich über den Mund wie nach einem gelungenen Mahl. Dann ließ er sein Opfer fallen. Lautlos sank Yrphramar auf den Asphalt.
Bhrorok stieg über ihn hinweg. Ein Lächeln lag auf seinem lippenlosen Mund, als er am Ende der Gasse stehen blieb. Der Wolf riss den Kopf in den Nacken, er witterte. Bhrorok warf einen Blick zurück zu dem leblosen Körper.
»Narr«, sagte er noch einmal.
Dann wandte er sich um und verschwand in der Nacht.
2
Für einen Augenblick wusste er nicht, wer er war. Er hätte alles sein können: Mensch oder Tier, Engel oder Teufel, oder einer der Regentropfen, die in silbernen Schnüren an der Scheibe des Restaurants herunterliefen und wie tausend winzige Augen daran hängen blieben.
»Nando Baldini! Träumst du?«
Schlagartig war er wieder wach. Er fühlte den Wischlappen wie einen nassen Zwieback zwischen seinen Fingern, hörte das Wasser, das prasselnd in den Eimer lief, und schaute in das Gesicht seines Chefs. Signor Bovino reichte Nando gerade einmal bis zur Brust, hatte aber die Angewohnheit, den Kopf in den Nacken zu werfen und in vollendeter Herablassung auf die Welt zu blicken, als würde er jeden um mindestens zwei Köpfe überragen.
»Du sollst arbeiten, hörst du?«, rief er und riss die ein wenig zu kurz geratenen Arme in die Luft. »Ich bezahle dich nicht, damit du aus dem Fenster glotzt! Und was machst du da überhaupt?« Er deutete auf den Wischeimer, als hätte er ihn noch nie gesehen, und stellte das Wasser ab. »Halb voll ist genug, verstanden? Du sollst aus dem ›Obolus‹ kein Schwimmbad machen, sondern den Boden wischen, Herrgott noch eins!«
Nando hob die Schultern. »Ich dachte …«, begann er, aber Signor Bovino wischte seine Bemerkung mit einem Gesichtsausdruck beiseite, als hätte ihn etwas Klebriges angesprungen.
»Du denkst!«, rief er, während er sich ein leuchtend gelbes Regencape überzog. »Das überlässt du besser mir. Vergiss nicht, die Abrechnung zu machen, räum das Lager auf und wehe, du wischst wieder ohne den Spezialreiniger!«
Nando sah zu, wie Signor Bovino sich die Kapuze so fest um sein rundes Gesicht zog, dass seine Wangen zusammengepresst wurden. Es hätte nur der Leuchtreflektor in Katzenform gefehlt und aus Signor Bovino wäre ein ziemlich fetter Grundschüler geworden, zumindest auf den ersten Blick.
»Ich dachte, dass ich das Lager morgen machen könnte«, sagte Nando und fühlte sich umgehend von einem vernichtenden Blick getroffen. »Ich habe doch heute Geburtstag, verstehen Sie, und meine Tante …«
Signor Bovino schnaubte, als gäbe es nichts Unwichtigeres auf der Welt. »Deine Privatvergnügungen interessieren mich nicht. Das Lager wird heute gemacht, dass das klar ist. Musst dich eben beeilen und weniger vor dich hin träumen.«
Nando presste die Zähne zusammen. Abgesehen davon, dass er sich ohnehin Schöneres vorstellen konnte, als an seinem Geburtstag Überstunden einzulegen, bemühte sich seine Tante Mara seit Tagen darum, das geplante Festessen vor ihm geheim zu halten. Seine Mutter war Köchin gewesen, regelmäßig hatte sie zu seinem Geburtstag ein mehrgängiges Menü zusammengestellt, und sein Vater hatte ihm einen Kuchen gebacken, gespickt mit Kerzen und überzogen mit leuchtend rotem Zuckerguss. Seine Eltern hatten nicht viel Geld gehabt, aber bei dem gemeinsamen Essen hatten sie nie gespart und waren stets bemüht gewesen, Nandos Geburtstag so zu gestalten, als wäre ihr Sohn ein Prinz, der nur aus Versehen bei armen Leuten gelandet war. Seit seiner Geburt hatten sie das getan – bis zu jener Nacht vor neun Jahren, als sie ihn verlassen hatten. Mara war die Schwester seiner Mutter, und obgleich sie keinerlei Talent für die Zubereitung jedweder Mahlzeiten hatte, weigerte sie sich standhaft, diese Tradition aufzugeben. Sie war eine Künstlerin, eine Malerin allererster Güte, die ihre Küche für gewöhnlich nur nutzte, um darin zu rauchen und wie ein Kutscher über die Politik der Regierung zu fluchen. Dennoch war Nando sich ziemlich sicher, dass sie neben dem Festessen entgegen ihrer Gewohnheit und Fähigkeit einen Geburtstagskuchen fabrizieren würde. Er sah sie vor sich, wie sie mit mehlverkrusteten Händen in der Küche stand und in Rezepten wühlte, um ihm eine Freude zu machen, stellte sich vor, wie sie ihre langen schwarzen Locken mit einem Kochlöffel zusammengedreht hatte, und bemerkte sie genau, die tiefe Falte zwischen ihren Brauen, als ihr zum dritten Mal die Eierschale mitsamt Inhalt in die Schüssel gefallen war. Unerschütterlich trat sie jedes Jahr aufs Neue in den Kampf mit Kochlöffeln, Rezepten und zerbrechlichen Suppenterrinen, um das Andenken ihrer Schwester in Ehren zu halten und Nando eine Freude zu machen, und es fiel ihm schwer, angesichts der Worte seines Chefs ruhig zu bleiben. Er holte tief Luft. Er hätte wissen müssen, dass Signor Bovino so reagieren würde. Es war immer dasselbe.
An der Tür wandte sein Chef sich noch einmal um. »Und lass die Penner draußen, hörst du? Ich bin kein Almosenverein.«
Damit riss er die Tür so stürmisch auf, dass die Messingglöckchen darüber hektisch anfingen zu bimmeln, ließ sie offen stehen und lief hinaus in die Nacht. Eisiger Wind schleuderte Regentropfen ins Restaurant. Schnell schloss Nando die Tür, sah seinen Chef im Regen verschwinden und betrachtete sein Spiegelbild in der Scheibe. Seine dunklen, halblangen Haare hingen ihm in die Stirn, unbändig standen sie zu beiden Seiten von seinem Kopf ab und erinnerten ihn an seinen Vater, der zeit seines Lebens eine ähnliche Unfrisur getragen hatte. Seine Augen hingegen blickten in demselben unruhigen Blau, das auch in den Augen seiner Mutter gelegen hatte. Ein Brennen durchzog seinen linken Arm, der von den Fingern bis hinauf zur Schulter mit Brand- und Schnittnarben übersät war. Seit jener Nacht vor neun Jahren waren mehrere Nerven irreparabel geschädigt und die Funktionen seiner Hand zeitweise stark eingeschränkt. Taubheitsgefühle und Greifschwächen traten häufig auf, ohne dass er es beeinflussen konnte. Er hatte sich an diese Behinderung gewöhnt, aber besonders an Tagen wie diesem erinnerte sie ihn mit wortloser Grausamkeit an die Ereignisse von damals.
Er holte tief Luft, doch seine Eltern fehlten ihm so sehr, dass ihm das Atmen schwerfiel. Entschlossen wandte er sich ab. Er hatte keine Zeit, um sich in trübsinnigen Gedanken zu verlieren. Abrechnung, Lager aufräumen und dann auch noch Wischen mit dieser widerwärtigen Essiglösung, die Signor Bovino eigenhändig zusammengemischt hatte und die dermaßen stank, dass es in der Tat keinem Keim einfallen würde, sich auf ihr niederzulassen. Er musste sich beeilen, um nicht zu spät zu seinem eigenen Festessen zu kommen. Er ging zur Kasse, einem riesigen, messingfarbenen Ungetüm aus dem vorigen Jahrhundert – Signor Bovino weigerte sich standhaft, eine neue anzuschaffen, dieser ganze neumodische Schnickschnack ist der größte Quatsch, den man sich vorstellen kann – und zog an dem Hebel zum Öffnen des Geldfachs. Nichts rührte sich.
»Nein«, murmelte Nando eindringlich. »Tu mir das nicht an. Nicht heute.« Noch einmal zog er an dem Hebel, ein metallenes Klirren ertönte im Inneren der Kasse, dann etwas wie ein Seufzen – und der Hebel bewegte sich nicht mehr. Nando versuchte es vorsichtig und mit Gewalt, aber es half alles nichts. »Verdammtes Mistding!«, rief er und schlug mit der flachen Hand gegen die Kasse, dass die Münzen in ihrem Inneren klimperten und seine Handfläche brannte. Wütend presste er die Zähne aufeinander. »So einfach kommst du mir nicht davon«, murmelte er und griff nach dem Schraubenzieher, der im untersten Fach des Tresens lag. Gerade hatte er das Geldfach ein winziges Stück weit aufgehebelt, als der Regen mit Wucht gegen die Glastür schlug.
Nando lief ein Schauer über den Rücken, als er gleich darauf das leise, klopfende Geräusch der Tropfen an der Tür hörte, so als würde eine unsichtbare Hand Einlass begehren. Es war ein Regen, wie er in seinem Traum fiel – jenem Traum, der sich seit sieben Tagen jede Nacht wiederholte: Er eilte durch die nächtlichen Straßen Roms. Er war auf der Flucht, ohne zu wissen, wer oder was ihn verfolgte. Die Stadt schien verlassen, doch die Schatten, die in den Häusernischen und Hinterhöfen lauerten, verbanden sich zu unheilvollen Schemen und jagten mit Klauenhänden hinter ihm her. Gleichzeitig neigten sich die Häuser zu ihm herab, als würden sie im Schein des Mondes schmelzen und ihn mit ihren starren Augen aus zerbrochenem Glas näher betrachten wollen. Dann hörte Nando die Stimme. Wispernd kroch sie über den Asphalt und drang aus den Abwasserkanälen wie zäher Nebel hervor, dem sie mehr glich als jedem Laut, der aus der Kehle eines lebendigen Wesens hätte entweichen können. Sie war wie flammender Wüstenwind, schmeichelte, lockte und drohte, ohne jemals auch nur ein Wort zu sprechen, und doch verstand Nando sie instinktiv. Es war, als glitte sie mit glühenden Fingern über seine Haut und die Kehle hinab bis in sein Innerstes, und dort umstrich sie seine Gedanken, entfachte Sehnsüchte, von denen er bislang nichts geahnt hatte, und nährte seine Furcht vor dem Geist, der sie war. Sie wollte, dass Nando zu ihr kam, und sie bekam stets, was sie begehrte. In jedem Ton ihrer heiseren Gesänge schwang eine Grausamkeit mit, ein Hohngelächter, das Nando das Fleisch von den Knochen fressen würde, sobald er ihrem Ruf folgte. Tausendzüngig hatte sie Ozeane aus Finsternis überwunden, war durch Erz und Feuer gegangen und hatte Himmel zerbrechen sehen, nur um ihn zu finden – und sie würde erst ruhen, wenn er in ihrem Sturm zu Asche verbrannt war.
Nacktes Grauen pochte in Nandos Schläfen, wenn er in seinem Traum vor der Stimme davonlief. Sie folgte ihm wie ein Fluch und je häufiger sich der Traum wiederholte, desto verheißungsvoller und drohender rief sie nach ihm und desto schwerer fiel es ihm, ihrem Ruf nicht zu folgen. Doch jedes Mal, wenn er kurz davor stand, den Lockungen zu erliegen, gelangte er in eine von silbrigem Dämmerlicht erfüllte Gasse und die Stimme wurde zurückgedrängt, sodass er sie kaum noch wahrnahm. Stattdessen sah er eine Gestalt, die auf dem von Unrat bedeckten Asphalt kauerte. Es war ein junger Mann und obgleich der Mond in voller Pracht über den Häusern stand, schienen seine Strahlen für einen Augenblick einzig auf dem Körper des Fremden zu liegen. Mit einer Hand stützte er sich am Boden ab, er hielt den Kopf geneigt, sodass sein Gesicht in den Schatten verborgen lag, und aus seinem Rücken ragten gewaltige Schwingen wie die Flügel eines Engels. Aber sie waren blutig und zerrissen und der Körper des Mannes sah aus, als wäre er von riesigen Vögeln verwundet worden. Seine halb zerfetzte Kleidung hing wie Lumpen von seinem Körper herab. Er war barfuß und obwohl er sich nicht rührte, wusste Nando ohne jeden Zweifel, dass der Fremde ihn vor der Stimme retten konnte, die in diesem Moment erneut hinter ihm aufwallte und ihn zu sich rief. Doch Nando zögerte, näher zu treten und die Hand nach einem der Flügel auszustrecken. Er verstand, dass der Fremde auf ihn wartete, und aus Gründen, die er selbst nicht vollends durchdrang, erschreckte ihn diese Erkenntnis mehr als die grausame Stimme hinter ihm. Und jedes Mal war sie es, die den Traum zerriss.
Seufzend schüttelte Nando die Bilder ab. Der Traum wartete auf ihn. Mit boshafter Geduld hockte er an den Rändern seines Bewusstseins und lauerte auf den Augenblick, ihn mit sich in die Dunkelheit zu ziehen. Doch Nando hatte schon immer ausgesprochen realistische Träume gehabt und früh gelernt, ihnen nicht zu viel Bedeutung beizumessen. Entschlossen, nicht vor einem leblosen Messingding zu kapitulieren, beugte er sich wieder über die Kasse und hatte gerade den Schraubenzieher angesetzt, als ihn ein erneutes Klopfen gegen die Glastür aufsehen ließ – heftiger dieses Mal, denn es kam nicht vom Regen. Dort stand eine Gestalt, groß und ganz in Schwarz gekleidet. Der Regen tropfte von einem breitkrempigen Hut, der das Gesicht vollständig verbarg.
Nando seufzte. Es war kein Geheimnis, dass er den Obdachlosen des Viertels nach Feierabend etwas Warmes zu essen gab, sehr zum Missfallen von Signor Bovino. Aber gerade in diesem Moment hatte er anderes zu tun, als Suppe aufzuwärmen, zumal er den Fremden noch nie zuvor gesehen hatte. Er zog die Brauen zusammen. Es war weder der alte Mo, der jahrelang in Spanien gelebt hatte, ehe es ihn hierher verschlagen hatte, noch Carla, deren Körper mit Abszessen übersät und von Drogen gezeichnet war, oder Enzo mit dem Geigenkasten, dieser liebenswerte alte Kerl, der mit seiner Geige sprach, als würde sie ihn verstehen, und den Nando nicht nur seit Jahren kannte, sondern mit dem ihn auch eine tiefe Freundschaft verband. Auch war es keiner von den Übrigen, die regelmäßig zu ihm kamen.
Da hob der Fremde die Hand und klopfte noch einmal. Nando fuhr sich durch die Haare. Verfluchtes gutes Herz. Er ließ von der Kasse ab, drehte den Schlüssel herum und öffnete die Tür.
Das Erste, das Nando wahrnahm, war der seltsame Geruch, der von dem Fremden ausging. Er war samten, schwer und kühl, ein Duft wie Schnee und Frühlingsahnen zugleich, und strich wie ein Atemzug über seine Wangen.
»Setz dich da hin, ich bring dir gleich was zu essen.« Nando deutete flüchtig auf den Tisch in der Ecke. Dann stellte er den Herd an, auf dem noch ein Topf mit Suppe stand, schüttete ein paar Brotkanten in einen Korb und widmete sich wieder der Kasse. Doch der Schraubenzieher half nicht mehr. Er verbeulte nur das Geldfach, das sich kein Stück weiter öffnete. Ärgerlich knallte Nando sein Werkzeug auf den Tresen und stellte fest, dass der Fremde noch immer an der Tür stand, regungslos, als wäre er zu Eis erstarrt.
»Du kannst dich ruhig setzen«, sagte Nando und deutete noch einmal auf den Tisch. »Die Suppe ist gleich warm, dann …«
Da hob sein Gegenüber den Kopf und sah ihn an. Dunkles, von weißen Strähnen durchsetztes Haar quoll unter dem Hut hervor, fiel weit über die Schultern und umrahmte ein regloses Gesicht mit Adlernase und bronzefarbener Haut. Die Augen des Fremden waren durchdringend und teerschwarz wie das Gefieder eines Raben. Nando hätte unmöglich sagen können, wie alt sein Gegenüber sein mochte, denn obgleich sein Haar das eines betagten Mannes sein konnte, wirkte sein Gesicht nicht älter als das eines Menschen Mitte vierzig, und seine Augen … Der Fremde neigte leicht den Kopf, als hätte er Nandos Gedanken gehört, und nickte kaum merklich. Er setzte sich an den Tisch in der Ecke, ohne sich abzuwenden.
Nando riss seinen Blick los und wartete ungeduldig darauf, dass die Suppe kochen würde. Gerade heute hatte er keine Zeit für merkwürdige Fremde, es war schon schlimm genug, dass diese verfluchte Kasse klemmte und er Signor Bovino erklären musste, dass er daran keine Schuld trug. Er seufzte innerlich, als er daran dachte.
»Also«, sagte er, um nicht weiter darüber nachzudenken und die unangenehme Stille zu durchbrechen. »Ich habe dich hier noch nie gesehen. Wie ist dein Name?«
Er hatte gelernt, dass Namen auf der Straße eine wichtige Bedeutung hatten. Die meisten Obdachlosen, die er kannte, gaben sich selbst einen neuen Namen, wenn sie ihr bürgerliches Leben verließen.
Der Fremde schwieg eine Weile. Erst, als Nando schon dachte, dass er seine Frage nicht gehört hatte, nickte er langsam. »Mein Name ist Antonio Montanaro«, erwiderte er mit einer Stimme, die rau klang, als hätten heftige Stürme zu lange mit ihr gespielt, und gleichzeitig von einem warmen, melodischen Unterton getragen wurde. Nando war sich sicher, noch nie zuvor eine solche Stimme gehört zu haben, und er ertappte sich dabei, wie er den Fremden anstarrte. Verlegen griff er nach dem Schraubenzieher, drehte ihn zwischen den Fingern und legte ihn wieder weg.
»Nicht gerade ein ungewöhnlicher Name«, stellte er fest und hasste sich im selben Moment dafür. Wie oft hatte er diesen Satz gehört, wenn er sich selbst vorgestellt hatte. »Ich bin Nando«, sagte er und fuhr schnell fort: »So, wie du aussiehst, kommst du nicht aus der Gegend.«
Erst, als er es ausgesprochen hatte, fiel ihm auf, wie recht er damit hatte. Der Fremde hatte sich in einen zerschlissenen Mantel gehüllt, wie Nando ihn bei zahlreichen Obdachlosen in ähnlicher Art jeden Tag sah, doch darunter trug er eine schwarze Hose mit grauen Streifen, eine passende Weste und schwere, von Gamaschen überzogene Stiefel. Seine Hände steckten in ledernen Handschuhen und um seinen Hals, halb verdeckt vom Kragen des unförmigen Mantels, lag eine alte Schweißerbrille mit merkwürdig schimmernden Gläsern. Nando zog die Brauen zusammen. Dieser Fremde war kein Obdachloser, da war er sich ziemlich sicher, und während er in diese schwarzen Augen schaute, überkam ihn zunehmend ein ungutes Gefühl. Kaum merklich lächelte er über sich selbst. Ihm waren schon genügend Menschen begegnet, die auf den ersten Blick absonderlich gewirkt hatten, und bislang hatte ihm keiner davon den Kopf abgerissen und falsch herum wieder auf die Schultern gesetzt.
»Woher kommst du also?«, fragte er und stellte befriedigt fest, dass seine Stimme keinerlei Misstrauen erahnen ließ.
Da lächelte Antonio, als hätte er die ganze Zeit auf diese Frage gewartet. Es war ein seltsames Lächeln, das seine Augen mit einer weißen Flamme weit hinten in den Pupillen spiegelten. Er beugte sich vor und senkte die Stimme, als wollte er Nando ein Geheimnis verraten.
»Kennst du einen Ort, an dem man den Herzschlag der Drachen hören kann?«, fragte er leise.
Nando lachte auf. »Wenn man meinen Chef dazuzählt, befinden wir uns gerade an einem«, sagte er, doch Antonio erwiderte sein Lächeln nicht. Nando wurde ernst. Er hatte schon viele abenteuerliche Geschichten von seinen Nachfeierabendgästen gehört und immer lebhaften Anteil an ihnen genommen, denn er wusste, dass es zeitweise leichter war, in Träumen zu leben als in der Wirklichkeit.
»Nun ja«, sagte er und zuckte mit den Schultern, »das hast du wohl nicht gemeint, was?«
Antonio erwiderte nichts. Kurz schien es, als würde sich das Schwarz der Iris in das Weiß der Augäpfel fressen wie dunkles Blut in frisch gefallenen Schnee. Doch gleich darauf begann die Lampe über dem Tresen zu flackern und Nando konnte nicht mehr sagen, ob es nicht nur Schatten waren, die sich in den Augen seines Gegenübers sammelten. Der Blick des Fremden tastete über sein Gesicht wie Finger aus Wind, und als Antonio zu sprechen begann, sah Nando nichts mehr als die Dunkelheit in dessen Augen, die sich hob und senkte wie das Schlagen eines gewaltigen Schwingenpaares.
»Ich komme von einem Ort jenseits des Lichts«, raunte Antonio kaum hörbar. »Stürme aus Nebel und Flammen verbergen ihn vor der Welt, Klauen aus Erz halten ihn umklammert, und keine sterbliche Seele, die in seine Gassen geriet, hat ihn jemals wieder verlassen, ohne das Herz an ihn verloren zu haben. Häuser mit Türen aus glänzendem Metall schmiegen sich an rauen Fels, roter Staub weht über die Kopfsteinpflaster und trägt den Atem der Stadt in jeden Winkel meiner Welt. Es gibt eine Ebene ohne Zeit, dort, wo ich wohne, und Sterne aus Feuer und Eis. Morgens erwache ich mit dem Klang berstender Gesteine, ich überdauere den Tag im Angesicht schwelender Feuer und bade des Nachts meine Füße im schwarzen Wasser des Flusses, der meine Stadt aus Finsternis durchzieht. Ich habe auch einen Himmel, er glüht in goldenem Schein, und es gibt Scheusale in den Schatten, die nur darauf warten, mich zu erbeuten. Es ist ein Ort, wo Helden eine Heimat finden. Und manchmal, wenn man das Ohr fest gegen die Haut der uralten Gesteine presst, kann man ihn hören: den Herzschlag der Welt. Die Stadt, aus der ich komme, heißt Bantoryn.«
Wie ein kalter Windhauch strich das letzte Wort Nando die Haare aus der Stirn. Irrte er sich, oder war das Licht auf einmal dunkler geworden? Er schüttelte den Schauer ab, der ihm über den Rücken kriechen wollte.
»Und was tust du dann an einem Ort wie diesem hier?«, fragte er und stellte fest, dass er plötzlich heiser war. Er räusperte sich. »Ich meine – an einem Ort für Helden gibt es sicher mehr zu sehen als hier.«
Da fing die Suppe an zu kochen. Nando tauchte die Kelle ein und füllte etwas in einen tiefen Teller.
»Ich bin gekommen, um dich dorthin mitzunehmen«, sagte Antonio direkt hinter ihm. Plötzlich war er vor dem Tresen aufgetaucht. Nando fuhr erschrocken zusammen. Er versuchte noch, den rutschenden Teller mit seiner vernarbten Hand festzuhalten, doch es gelang ihm nicht und er schüttete sich die kochende Suppe über die Finger. Fluchend warf er den Teller ins Spülbecken und hielt seine Hand unter kaltes Wasser.
»Das soll wohl ein Scherz sein!«, rief er ärgerlich und wusste selbst nicht genau, ob er sich mehr über seinen Schmerz aufregte oder über sich selbst, weil er diesen Verrückten hereingelassen hatte. Das Wasser lief über seine Hand, bis sie eiskalt war. Schließlich drehte er den Hahn zu und wandte sich um. Er seufzte. Das schlechte Gewissen hatte schon immer leichtes Spiel mit ihm gehabt. »Es tut mir leid«, sagte er ruhiger. »Aber ich hatte einen langen Tag. Und ich habe wirklich andere Sorgen, als an einen Ort zu reisen, von dem ich noch nie gehört habe.« Er lächelte. »Ich dachte, es sei ein Platz für Helden, und wenn ich eines ganz sicher nicht bin, dann das: ein Held. Was sollte ein Tellerwäscher wie ich dort tun? Geschirr spülen und Suppe kochen für Bedürftige?«
Antonio sah ihn gedankenverloren an. Er schien den letzten Satz gar nicht gehört zu haben.
»Du bist etwas Besonderes«, sagte er kaum hörbar. »Mehr, als du ahnst.«
Nando stieß die Luft aus. »Unsinn«, erwiderte er und wollte noch mehr sagen, doch im nächsten Moment sprang Antonio vor. Mit einem Satz, der zu schnell war, als dass Nando ihn mit den Augen hätte verfolgen können, glitt Antonio über den Tresen, packte ihn mit der linken Hand im Nacken und presste die rechte auf seine Brust, dorthin, wo das Herz war. Erschrocken griff Nando nach Antonios Hand, doch sie hatte sich fest in sein Hemd gekrallt, während sein Nacken wie in einem Schraubstock gefangen war. Eiskalt war diese Hand, und Nando nahm Antonios Duft wahr, eine seltsame Mischung aus brennenden Tannenzweigen und Meerluft, die von dem samtenen Aroma durchzogen wurde, das Nando bereits bei seinem Eintreten wahrgenommen hatte. Noch immer konnte er es nicht deuten, doch es legte sich erneut kühl auf seine Wangen. Er wollte schreien, aber nichts als ein heiseres Krächzen drang aus seiner Kehle.
»Du bist ein gewöhnlicher Mensch«, raunte Antonio und nun sah Nando, dass seine Augen nicht schwarz waren, wie es den Anschein gehabt hatte. Diese Augen waren golden und ihr Anblick war so unwirklich, dass Nando anfing zu zittern. »Du hast eine Familie, du liebst deine Tante, deine Freunde, deinen Krempel, du erledigst deine Arbeit in diesem schäbigen Restaurant und wirst Schule und Ausbildung ohne großes Aufsehen abschließen. Ja …« Er stieß die Luft aus, die in einem eisigen Schwall Nandos Gesicht traf und ihm den Atem nahm. »Auf den ersten Blick gleichst du unzähligen anderen jungen Männern. Aber in deinem Inneren sieht es anders aus. Ganz anders!«
Nando spürte seinen Herzschlag in der Kehle, er ertrug den Blick in Antonios Augen nicht länger, ebenso wenig wie dessen Worte, die mit eiskalter Glut seinen Rachen hinabstoben und ihn verbrannten. Mit einem Schrei stieß er die rechte Faust vor und traf Antonio an der Schulter. Nando hörte das Knacken seiner Knöchel, doch er fühlte keinen Schmerz. Stattdessen sah er wie in Zeitlupe, wie Antonio rücklings über den Tresen flog und mit voller Wucht inmitten einiger Stühle landete.
Mit weit aufgerissenen Augen starrte Nando auf seine Hand. Sein Schlag konnte unmöglich so heftig gewesen sein, dass er einen ausgewachsenen Mann quer durch den Raum hätte befördern können. Oder doch? Atemlos sah er zu, wie Antonio auf die Beine kam und sich den Staub von den Kleidern klopfte. Kurz glaubte er, einen erneuten Angriff abwehren zu müssen, aber Antonio hob den Blick und sah ihn an, als wollte er ihn für diesen Gedanken tadeln.
»Niemals wird jemand den Ort jenseits des Lichts betreten, der das nicht will«, sagte er leise. »Bantoryn ist dein Ziel, auch wenn du es noch nicht weißt. Doch du wirst deinen Weg erkennen, und dann wirst du ihn gehen. Immer schon schien es dir, als würde mit der Welt etwas nicht stimmen, als wäre ein Fehler darin, den du dir zwar nicht erklären kannst, den du aber dennoch fühlst. Du spürst, dass dich etwas von den gewöhnlichen Menschen unterscheidet. Und du trägst eine Sehnsucht nach etwas anderem in dir, nach etwas jenseits all dessen, was dein Auge sieht – etwas, für das du zeit deines Lebens keine Worte gefunden hast. Wie oft hattest du schon das Gefühl, ein fremdes Leben zu leben, in etwas hineingeraten zu sein, das nicht das deine ist? Wie oft hast du darüber nachgedacht, dass diese Welt mehr sein könnte, viel mehr, als sie zu sein scheint? Oft, sehr oft hast du das getan und immer geahnt, dass die Wahrheit hinter diesen Gedanken liegt, die du nicht durchdringen kannst. Ist es nicht so? Und alles ist noch schlimmer geworden seit dem Tag, an dem die Träume begannen.«
Auf einmal war Nandos Mund trocken wie Sandpapier. Er hörte den Regen, der wie Hohngelächter gegen die Scheibe schlug. »Was weißt du über meine Träume?«
Antonio trat einen Schritt auf ihn zu und Nando erschrak über die Bewegung so sehr, dass er zurückwich. »Folge mir«, erwiderte Antonio kaum hörbar. »Folge mir nach Bantoryn und du wirst es erfahren.«
Nando wollte etwas erwidern, aber es war, als läge eine tonnenschwere Last auf seinem Brustkorb, die ihm das Sprechen unmöglich machte. Er schüttelte den Kopf.
Antonio nickte, als hätte er mit dieser Reaktion gerechnet. »Bald schon wirst du keine andere Wahl mehr haben«, erwiderte er leise. »Deine Welt wird zerbrechen und sie wird dich mit sich reißen, wenn du nicht vorbereitet bist. Du stehst kurz vor dem Erwachen. Und eines wirst du erkennen: Es gibt keine Sicherheit jenseits des Lichts, das du verloren hast.«
Antonio schwieg einen Moment, dann öffnete er den Mund wie jemand, der noch etwas sagen will und nicht kann. Doch schließlich schüttelte er den Kopf und legte die Hand auf die Klinke. Er warf einen Blick auf die Kasse, es klingelte leise in ihr, und dann sprang das Geldfach auf. Nando fuhr zusammen, so sehr erschrak er von dem plötzlichen Geräusch. Er starrte Antonio an, der unbewegt an der Tür stand, als wäre die Kasse von ganz allein aufgesprungen, und hörte auf einmal seinen Namen: Nando.
Doch dieses Mal hatte Antonio nicht den Mund zum Sprechen bewegt. Seine Stimme war in Nandos Kopf geflogen wie ein Gedanke. Ein Frösteln lief Nando über den Rücken. Nie zuvor, das wusste er, hatte er seinen Namen auf diese Weise ausgesprochen gehört, so sanft und so – traurig. Antonio neigte leicht den Kopf und Nando fühlte sich von dem dunklen Gold seiner Augen umfangen wie von einem Tuch aus Nacht.
Ein lautes Knacken ließ sie beide zusammenfahren. Nando verlor Antonios Blick und fand sich mit einem Schlag von der Last auf seiner Brust befreit. Er hustete und sah, dass das plötzliche Geräusch von einem Insekt herrührte, einem Schmetterling, der unablässig gegen die gläserne Tür flog. Er schimmerte eigentümlich, doch noch ehe Nando ihn genauer hätte betrachten können, stieß Antonio die Luft aus wie nach einem heftigen Schlag. Er fuhr herum, seine Augen standen in goldenem Feuer, als er Nando ansah. Dann riss er die Tür auf und verschwand so schnell in der Nacht, dass es schien, als wäre er nichts als ein Geist gewesen. Nur seine Worte blieben zurück.
Erst sind es nur Träume, hörte Nando seine Stimme in seinem Kopf. Aber eines Tages, bald schon, werden sie wahr.
3
Avartos Palium Hor stand auf dem Dach eines heruntergekommenen Mietshauses, fühlte, wie der Regen seinen Nacken hinabrann, und verfluchte Gott. Nicht, dass er an die Existenz einer solchen Entität geglaubt hätte – seit den Ersten Tagen war es auch in seinem Volk alles andere als selbstverständlich, sich bei klarem Verstand zu dieser Möglichkeit zu bekennen. Aber das Fluchen half ihm, seine reglose Fassade aufrechtzuerhalten, die vermaledeiten Sturzbäche an seinem Körper hinabgleiten zu lassen und den Blick unverwandt auf jenes Restaurant gerichtet zu halten, in dem der Junge mit den blauen Augen auf die geöffnete Tür starrte und sich offensichtlich nicht überwinden konnte, sie wieder zu schließen.
Seit fünf Stunden verharrte Avartos regungslos. Seine rechte Hand ruhte auf dem Knauf seines Schwertes und er hörte auf das gleichmäßige Prasseln der Regentropfen, die gegen seinen matten, wie eine Weste gearbeiteten Brustharnisch schlugen. Darüber trug er einen schwarzen Gehrock mit einem kapuzenbewehrten Umhang, der ihn mit den Schatten der Nacht verschmolz und vor unliebsamen Blicken verbarg. Seine Hose war schwarz wie seine ledernen Stiefel, die bis hinauf zur Wade reichten und deren mit silbernen Beschlägen versehene Spitzen sich hervorragend als Waffe eigneten. Auf dem Rücken trug er seinen Bogen und den Köcher mit den schwarzen Pfeilen. Der Regen hatte sein blondes, fast weißes Haar, das in trockenem Zustand in leichten Wellen bis auf seine Schultern hinabfiel, trotz der Kapuze größtenteils durchnässt. Auf den ersten Blick wirkte sein ebenmäßiges Gesicht sanft, beinahe zart, doch in dem goldenen Licht, das in seinen Augen flammte, lag ein harter, kalter Ausdruck, und selten sah man ihn ohne das leicht spöttische Lächeln auf seinen Lippen.
Avartos war ein Geschöpf des Lichts. Er hatte die Schlange von Bagdad mit bloßen Händen zerrissen und die Ghule der Wälder im Norden gelehrt, was Furcht bedeutet. Er war in die Ruinen unter Moskau hinabgestiegen, um den Lindwurm zu jagen, und er hatte den Kopf des letzten Basilisken der lichten Welt mit einem einzigen Hieb von dessen Leib getrennt. Für sein Volk hatte er das getan, und das alles nur aus einem einzigen Grund: Weil er ein Krieger und ein Jäger war. Und er hatte ein Ziel.
Seine Hand schloss sich fester um sein Schwert. Seit Jahrhunderten war er jenem Geschöpf auf der Spur, das sich hinter dem Namen Antonio Montanaro verbarg, und ausgerechnet nun, da diese Kreatur allein und unaufmerksam nur wenige Schritte von ihm entfernt durch den Regen gehastet war, hatte er sie nicht stellen dürfen. Er zwang sich zur Ruhe, ließ seine Empfindungen in die kalte Stille seines Inneren fallen und brachte sie dort zum Erlöschen. Die Geräusche um ihn herum glitten von ihm ab wie der Regen, und er erinnerte sich an seinen Plan. Er musste abwarten und beobachten, wie die Dinge sich entwickeln würden. Es war nur eine Frage der Zeit, bis seine Stunde kommen würde.
Avartos fixierte den Jungen im Restaurant mit seinem Blick. Dessen ungebetener Gast war unerwartet schnell wieder gegangen und hatte jede Menge Verwirrung zurückgelassen. Avartos konnte sie fühlen, die Unsicherheit und Furcht, die sich in diesen Momenten durch Geist und Körper des Jungen wühlten, er spürte die flachen Atemzüge und kurz darauf die trügerischen und doch so beruhigenden Wellen der Flucht, als der Junge sich jene merkwürdigen Vorkommnisse mit dem bisschen Verstand zu erklären versuchte, das in einem Geschöpf wie ihm vorhanden war. Er war schwach wie alle Menschen, daran bestand kein Zweifel, und doch … Der Samen ruhte in ihm. Lange war er im Verborgenen gewachsen und nun stand er kurz davor, ins Licht hervorzubrechen. Als hätte er diesen Gedanken gehört, setzte der Junge sich in Bewegung und ging zur Tür.
Avartos’ Muskeln spannten sich und für einen Moment spürte er den letzten Atemzug des Jungen auf seinem Gesicht – jenen Atemzug, den schon unzählige seiner Art getan hatten, ehe sie in Avartos’ Armen gestorben waren. Er ließ seinen Blick über die schmale Gestalt des Jungen schweifen. Früher hätte er ihn mit einem Fingerzeig zu Asche verbrannt oder ihn mit seinen schwarzen Pfeilen durchbohrt, doch nun … Er ließ seine Knöchel knacken und entspannte die Hand, die er zur Faust geballt hatte. Nun hatte er andere Pläne.
Sein Blick verfinsterte sich, als er zusah, wie der Junge die Tür schloss. Antonio Narrentum blieb nicht mehr viel Zeit. Der Junge stand bereits am Abgrund und bald, sehr bald schon würde er den ersten Schritt in die Finsternis tun. Möglicherweise blieb Antonio dann keine Wahl mehr und er würde erstmals in all der Zeit gegen seine Prinzipien verstoßen und einen von jenen zwingen, ihm zu folgen. Er ahnte nicht, dass Avartos ihn beobachtete, dass der Erste Offizier Ihrer Majestät nur darauf wartete, dass er den nächsten Schritt tat. Avartos spürte seinen eigenen Herzschlag, der nur alle paar Minuten einmal erklang, durch seinen Körper pulsieren und in dem jämmerlichen Gemäuer unter ihm widerhallen. Er wartete schon lange auf den Moment, der nun in greifbare Nähe rückte, und entgegen jeder Vorschrift konnte er die Freude darüber kaum zügeln. Der Junge war der Schlüssel. Er würde Avartos in ihren Bau führen, nach Bantoryn, in das Nest jener, die alles gefährdeten, was die Existenz seines Volkes begründete, und Avartos würde die Welt von ihnen befreien – ein für alle Mal.
Geduldig sah er zu, wie der Junge den Boden des Restaurants reinigte, das Licht löschte und durch eine schmale Holztür in den Keller ging. Ein kaum merklicher Schimmer glitt unter der Tür hindurch, kurz hörte Avartos noch die Schritte des Jungen, dann war es still.
Zum ersten Mal, seit er auf dem Dach Position bezogen hatte, wandte Avartos den Blick. Er schaute in die Richtung, in die Antonio verschwunden war, und fühlte noch einmal das zitternde Flattern des goldenen Schmetterlings, dieses hilflosen Zaubers, der eine Botschaft gewesen war. Etwas Schreckliches musste geschehen sein, wenn jene eines ihrer obersten Gesetze brachen und auf so unvorsichtige Weise miteinander in Kontakt traten. Er warf einen letzten Blick in Richtung des Restaurants, ehe er herumfuhr und Antonios Fährte aufnahm. Der Herzschlag des Jungen war Avartos bis ins Mark gefahren. Als leiser Impuls pochte er durch seine Brust, als wäre es sein eigenes Herz, das da schlug. Avartos glitt mit gewaltigen Sprüngen über die Dächer und sein Lächeln verstärkte sich. Niemals würde er diese Beute verlieren. Der Tag seines Triumphs war nah.
4
»Obolus« – die Leuchtbuchstaben spiegelten sich in den Pfützen und warfen blaues Licht auf Bhroroks weiße Haut. Regungslos schaute er durch die schwarzen Augen seines Spiegelbildes ins Innere des Restaurants. Hinter den Fenstern lag Dunkelheit – und Licht. Schwach leuchtete es hinter dem Tresen auf, die Ahnung eines Schimmers bloß. Aber wo Licht war, da war auch Leben, das hatte Bhrorok in dieser lauten, stinkenden Welt schnell gelernt.
Er legte seine rechte Hand gegen die Tür. Schwarze Risse durchzogen das Glas und färbten es dunkel wie verfaulende Blätter. Leise blies er seinen Atem dagegen und ließ es als Ascheflocken zu Boden rieseln. Es knirschte, als er seinen Fuß auf das Linoleum setzte, und ein widerlicher Gestank schlug ihm ins Gesicht. Stöhnend wedelte er durch die Luft, als könnte er ihn so vertreiben, und drehte sich ungeduldig zu seinem Wolf um. Nur widerstrebend sprang das Tier durch die offene Tür, die Lefzen angezogen, und lief unschlüssig hin und her. Bhrorok zog ein Tuch aus seinem Mantel, ein schwarzes, schmutzstarrendes Etwas, und presste es sich vor die Nase. Erleichtert sog er den Duft von Blut und Verwesung ein. Dann hörte er auf zu atmen.
Sein Blick glitt über den feucht glänzenden Boden. Die Stühle standen auf den Tischen, aber eine der Herdplatten hinter dem Tresen war noch warm. Ein boshaftes Lächeln kroch auf Bhroroks Lippen, als er auf das Licht zutrat. Es fiel als schmaler Kranz aus der geschlossenen Kellertür, und da – irgendetwas rumorte dort unten. Für einen Moment kam Bhrorok der Gedanke, mit einem kräftigen Tritt durch die Decke zu brechen und die Kreatur im Fallen zu erschlagen. Aber ein derart rasches Ende seiner Opfer war nicht nach seinem Geschmack, und außerdem durfte der Junge nicht sterben, ehe Bhrorok von ihm bekommen hatte, was er brauchte.
Er ließ die Knöchel seiner rechten Hand knacksen und öffnete die Tür zum Keller. Die nackte Glühbirne flackerte kurz. Eine staubige Steintreppe führte abwärts, er roch mindestens achtzehn Spinnennester und unzählige Asseln unter den Platten. Ihre Leiber knackten, als er die Steine mit seinen Schritten vereiste und zum Bersten brachte. Nach wenigen Stufen konnte er einen Blick in den Keller werfen und sah lange Gänge aus Kisten, Kartons und Regalen, die sich am Ende in fahlem Dämmerlicht verloren. Der Wolf war auf eine Kiste gesprungen, in kurzen, scharfen Atemzügen sog er die Luft ein, dann verschwand er in einem der Gänge. Bhrorok bewegte die Finger, als würde er ein Musikstück dirigieren, und ließ dabei schwarze Nebelfäden aus seinen Händen entweichen. Zäh waberten sie in den Raum und schwängerten die Luft mit ihrem Gift, das jede Kreatur mit Ausnahme ihres Schöpfers und seines Wolfs binnen weniger Momente lähmen würde … abgesehen von dem Getier, das immer schon Bhroroks Nähe gesucht hatte.
Suchend ließ Bhrorok den Blick durch die Gänge schweifen, er spürte, wie das Ungeziefer ihm nachkroch, hörte auch den Wolf, der einen Gang nach dem anderen absuchte, und sah das flackernde Licht am anderen Ende des Kellers. Dort scharrte etwas, er hörte es atmen, etwas, das Licht brauchte, um in der Dunkelheit zu sehen.
Wenn er ein Herz gehabt hätte, wäre ihm nun das Blut schneller durch den Körper gerauscht. So fühlte er nichts als das tosende Gurgeln seines Hungers, als er Schritt für Schritt auf das Licht zutrat, lautloser als die Asseln unter seinen Füßen. Eine Kiste versperrte ihm die Sicht. Er witterte. Menschenblut.
Mit einer einzigen Bewegung zerschlug seine Faust das Holz und fasste nach dem, was dahinter war. Er ergriff etwas Zappelndes, ein schrilles Quieken zerfetzte die Luft. Wütend riss Bhrorok die Faust zurück und starrte auf die sich windende Ratte zwischen seinen Fingern. Mit einem Tritt stieß er die Kiste beiseite. Die Glühbirne über einem winzigen Tisch begann heftig zu flackern, als er sich näherte. Jemand hatte hier gesessen, ein Zettel lag dort und Stifte, und der Pullover – Bhrorok griff ihn mit der freien Hand und presste ihn sich vors Gesicht. Ein Mensch, ein Junge – der Junge.
Er stieß einen Schrei aus. Schon stand der Wolf neben ihm, er stürzte sich auf den Pullover und verschlang ihn in einem Stück. Bhrorok drehte sich um sich selbst. Die Luft war grau geworden von seinem Gift, doch er witterte keinen Geruch von Tod, wenn man von der Ratte in seiner Faust und den Schaben hinter dem Wandputz einmal absah. Er war zu spät gekommen.
Mit mächtigen Schritten stampfte er den Gang zurück zur Treppe und verließ das Restaurant, ohne sich um die Fassade zu kümmern, die ihm dabei im Weg stand. Polternd krachten die Steine auf die Straße. Er legte den Kopf in den Nacken, aber der Duft des Jungen war verschwunden, der Regen hatte ihn fortgespült. Der Wolf irrte ziellos umher, knurrend und jaulend wie unter Schmerzen.
Bhrorok spürte, wie die Wut ihm in den Nacken stach. Zischend murmelte er den Zauber. Blut trat ihm aus den Augen und lief seine Wangen hinab. Dann sperrte er das Maul auf und ließ sie frei, die klebrigen Heuschrecken mit ihren ledernen Flügeln. Sie rissen ihm die Lippen auf, als sie ihn verließen, und ergossen sich als flirrende schwarze Wolke über die Straße. Ihre Flügel machten ein Geräusch wie brechende Kinderknochen, sie fraßen die Vögel, die unter dem Dachfirst schliefen. Dann stoben sie als riesiger schwarzer Fluss durch die Nacht davon.
Bhrorok sah ihnen nach. Niemand entkam ihrer Gier. Sie würden ihn finden. Er strich seinem Wolf über den Kopf, seine weißen Finger gruben sich in das Fell wie in einen Berg schwarzer Maden. Dann hob er die tote Ratte vor seinen Mund und biss ihr mit wohligem Seufzen den Kopf ab.
5
Nando rannte. Er hatte das Lager nicht fertig aufgeräumt und zu allem Überfluss auch noch das Licht brennen lassen – Signor Bovino würde ihm den Kopf abreißen. Aber jetzt gab es Wichtigeres. Er würde Mara nicht mit ihrem misslungenen Essen allein lassen, und selbst wenn er dafür die kommenden Abende mit unbezahlten Überstunden verbringen musste, war das ein geringerer Preis als die nur halb verborgene Enttäuschung in Maras Blick, falls er nicht kommen würde.
Er überquerte die Via dei Reti mit ihrem von den Schienen der Straßenbahnen zerschnittenen Pflaster und den heruntergekommenen Häusern, deren putzbröckelnde Fassaden von hektisch angeklebten Plakaten bedeckt waren. Die kleinen Geschäfte in den unteren Etagen hatten ihre Rollläden mit den Graffitis heruntergelassen, und während vereinzelt aus einem halb geöffneten Fenster der Fernseher dröhnte, hatte sich ein Klappladen aus seiner Verankerung befreit und schlug nun in raschem Stakkato gegen die Hauswand. Das Geräusch begleitete Nandos Schritte ebenso wie das Rauschen des Wassers in den Rinnsalen zu beiden Seiten der Straße und das stetige Prasseln des Regens auf dem Asphalt, doch er hörte es kaum. Denn in seinem Kopf klangen Antonios Worte wider, deutlich und klar, als hätte er sie gerade erst ausgesprochen. Ich komme von einem Ort jenseits des Lichts. Nando schüttelte den Kopf, als könnte er Antonios Stimme so aus seinen Gedanken vertreiben.
Er hatte schon einige merkwürdige Geschichten von den Obdachlosen gehört, die er nach Feierabend bewirtete, aber so ein seltsamer Kerl war ihm noch nie begegnet. Es ist ein Ort, wo Helden eine Heimat finden.