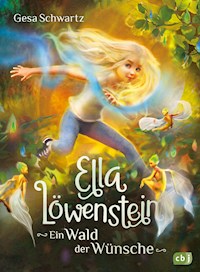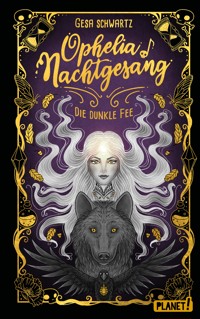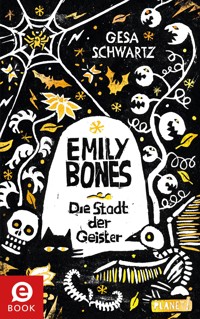12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Gefühle sind in unserer Welt ein Zeichen von Schwäche. Und wer schwach ist, stirbt. New York City. Einst brachten grausame Drachenreiter Tod und Zerstörung, und ihr König tyrannisiert nun die Welt. Die letzten freien Menschen verstecken sich in den U-Bahn-Tunneln, unter ihnen auch die Diebin Sira. Sie hasst alle Drachen, seit ihre Familie durch deren Feuer starb. Als ihr Versteck angegriffen wird, ist ausgerechnet Drachenreiter Norik, Anführer der Rebellen, ihre Rettung. Durch ihn lernt sie, dass nicht alle Drachen böse sind, und er bietet ihr einen Weg, selbst Drachenreiterin zu werden, um sich an den Reitern des Königs rächen zu können. Doch Norik ist ebenso mächtig wie unberechenbar. Ist es klug, ihm zu vertrauen? Oder wird er alles niederbrennen, was Sira wichtig ist? Die Dilogie »In Fire and Rain« verbindet Fantasy, Romance und Dystopie und bietet jede Menge Action, Abenteuer und Romantik. Los geht es mit »Sturmkuss«, den Abschluss der Geschichte bildet »Feuerherz«. Band 1: In Fire and Rain − Sturmkuss Band 2: In Fire and Rain − Feuerherz
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Entdecke die Welt der Piper Fantasy!
www.Piper-Fantasy.de
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, schreiben Sie uns unter Nennung des Titels »In Fire and Rain« an [email protected], und wir empfehlen Ihnen gerne vergleichbare Bücher.
© Piper Verlag GmbH, München 2025
Dieses Werk wurde vermittelt durch die AVA international GmbH Autoren- und Verlagsagentur, www.ava-international.de.
Redaktion: Uta Dahnke
Illustration: Bente Schlick, www.benteschlick.com
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Covergestaltung: Markus Weber Guter Punkt, München
Coverabbildung: Markus Weber, Guter Punkt, München unter Verwendung von Motiven von AdobeStock
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Wir behalten uns eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.
Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem Buch (etwa durch Links) hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen. Eine Haftung dafür übernimmt der Verlag nicht.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
Illustration
Vorwort
1
Sira
2
Sira
3
Sira
4
Sira
5
Sira
6
Sira
7
Sira
8
Norik
9
Norik
10
Norik
11
Nhor’garoth
12
Sira
13
Sira
14
Sira
15
Norik
16
Sira
17
Sira
18
Norik
19
Sira
20
Sira
21
Sira
22
Nhor’garoth
23
Sira
24
Sira
25
Sira
26
Sira
27
Sira
28
Norik
29
Norik
30
Sira
31
Sira
32
Sira
33
Sira
34
Sira
35
Sira
36
Norik
37
Sira
38
Sira
39
Sira
40
Sira
41
Sira
42
Nhor’garoth
43
Sira
44
Sira
45
Sira
46
Sira
47
Norik
48
Sira
49
Sira
50
Sira
51
Sira
52
Sira
53
Norik
54
Norik
55
Sira
56
Sira
57
Sira
58
Sira
59
Sira
60
Sira
61
Sira
62
Norik
63
Sira
64
Sira
65
Sira
66
Norik
67
Sira
68
Nhor’garoth
69
Sira
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
Illustration
Vorwort
Ihr Lieben,
was passiert, wenn man die richtige Geschichte zur falschen Zeit schreibt? So war es bei Ära der Drachen, erschienen 2016 beim Egmont Lyx Verlag. Damals hatte Lyx noch eine Fantasysparte. Sie wurde allerdings mit dem Verkauf von Lyx an Lübbe 2016 eingestellt. Ära der Drachen war das letzte Fantasybuch des Verlags, und schon vorher wurde die Luft für die Fantasy sehr dünn.
Diese Entwicklung war für mich spürbar und hat sich auch auf die Arbeit an Ära der Drachen ausgewirkt. So kam es, dass ich meine Geschichte in Teilen nicht so erzählen konnte, wie sie es verdient hat. Daran hat niemand Schuld, schon gar nicht die lieben Redakteur:innen des Lyx-Verlags. Für mich ist es allerdings immens wichtig, ein zukunftsorientiertes Umfeld (in diesem Fall für die Fantasy) zu haben, damit meine Geschichten sich entfalten können, und so bin ich sehr glücklich, dieses Umfeld im Fantasyprogramm des Piper Verlags gefunden zu haben. Jetzt konnte ich meine Geschichte endlich so erzählen, wie sie sein sollte. Und so ist In Fire and Rain entstanden.
Da ich mich in den letzten Jahren auch als Autorin entwickelt habe, ist In Fire and Rain jedoch weit mehr als nur eine Neufassung von Ära der Drachen. Nicht umsonst sind es nun zwei Bände geworden. Neue Figuren, neue Spannungsbögen, neue Plot-Twists – insgesamt 87 komplett neue Kapitel sprechen in meinen Augen für sich. Ich freue mich, diese Geschichte jetzt mit euch teilen zu können – so, wie sie es verdient hat.
Ich wünsche euch ganz viel Freude in der Welt der Drachen. Und vergesst nicht, dass ihr fliegen könnt.
HerzlichGesa
1
Sira
Ich renne. Das Licht meiner Fackel huscht über die Tunnelwände und wird nach wenigen Armlängen von der Finsternis verschluckt. Ich kann gerade genug erkennen, um mir an den tief sitzenden Stahlrohren nicht den Kopf zu stoßen. Die Gleise unter meinen Füßen sind feucht und verteufelt glatt. Aber ich werde nicht langsamer. Ich bin sowieso schon spät dran.
Ich weiche einem herabhängenden Kabelstrang aus und ignoriere die nervige Stimme in meinem Kopf, die mir zuflüstert, dass ich einen anderen Weg hätte nehmen sollen. Einen, der länger ist, aber dafür sicherer. In diesem Tunnel war lange niemand mehr. Keiner weiß, was in ihm lauert.
Aber ich wurde in der Unterwelt geboren, in diesem Labyrinth aus maroden U-Bahn-Tunneln, Abwasserkanälen und Versorgungsgängen, das noch immer tief unter den Straßen New Yorks liegt, auch wenn die Stadt selbst schon längst nicht mehr existiert. Ich habe gelernt, mich der Dunkelheit anzupassen. Mit meiner schwarzen Lederhose und dem engen Oberteil in der gleichen Farbe verschmelze ich mit den Schatten. Meine geschnürte Lederweste bietet mir die ideale Kombination aus Bewegungsfreiheit und Schutz. Ich weiß, wie man in der Dunkelheit überlebt … und dass es in ihr keine Sicherheit gibt. Nirgends.
Das Scharren ist kaum zu hören, aber es dringt mir bis ins Mark. Ich bleibe stehen und ziehe das Messer aus meinem Beinholster. Mein Atem geht flach. Ich sollte umkehren, sicherheitshalber. Aber ich habe keine Zeit für einen Umweg. Also gehe ich weiter. Vor meinem geistigen Auge taucht mein Onkel Kane auf, der wie während einer unserer Lektionen spöttisch die Brauen hebt.
Sira, höre ich ihn sagen. Dein Mut wird dir eines Tages das Genick brechen … oder dir den Hals retten.
Der Gedanke an ihn beruhigt mich. Ich richte meine gesamte Aufmerksamkeit auf den Bereich jenseits des Lichts. Kalt und konzentriert, wie Kane es mir beigebracht hat.
Es stinkt nach Fäulnis und Verwesung, aber das ist nichts Ungewöhnliches hier unten. Wachsam gehe ich weiter. Die Gefahr kann direkt über mir sein, in den alten Wartungsräumen und Bahnstationen. Sie hockt unter mir, in Kanälen, in die sich niemand wagt. Und sie schleicht neben mir durch die Dunkelheit, nur durch eine dünne Wand aus bröckelndem Stein von mir getrennt. Die Gefahr ist immer da. Und jeder, der mutig oder naiv genug ist, sich allein in die verlassenen Tunnel zu wagen, riskiert, getötet zu werden.
Wieder das Scharren, lauter dieses Mal. Ein schemenhafter Umriss taucht vor mir auf, so groß, dass er fast den gesamten Tunnel ausfüllt. Ein alter Zug, ein Relikt der Vergangenheit. Er stammt aus einer Zeit, in der die Menschen die Unterwelt nur genutzt, aber nicht in ihr gelebt haben. Damals war die Oberwelt noch ihr Zuhause. Eine unwirkliche Vorstellung. Diese Zeit liegt so weit zurück, dass ich sie nur aus Erzählungen kenne.
Mit jedem meiner Schritte wird das Scharren lauter. Ich schleiche neben dem Zug her und lasse den Blick über die Graffitis an seiner Außenwand schweifen. Früher sind die Menschen in diesem Ding durch die Unterwelt gefahren, und die Tunnel waren nicht mehr als unterirdische Wege. Was für ein seltsamer Gedanke.
Das Scharren ist jetzt ganz nah. Ich hebe mein Messer. Lautlos setze ich einen Fuß vor den anderen, spähe an dem Zug vorbei – und stoße die Luft aus. Eine Ratte hockt zwischen den Gleisen. Empört blinzelt sie in den Fackelschein, bevor sie weiter an etwas herumknabbert. Ihre Krallen kratzen über ein Stück Metall. Es ist dieses Scharren, das ich gehört habe.
Die Ära der Menschen ist vorbei, hat Kane beim Anblick einer Ratte oft gesagt. Und er hatte recht. Die Menschen hausen in der Finsternis, auf ihre Instinkte angewiesen wie Tiere. Viele Bewohner meiner Enklave hassen die Ratten mehr als alles andere. Vielleicht, weil sie ihnen so ähnlich geworden sind. Lichtscheu. Schreckhaft. Versteckt im Dunkeln.
Ich betrachte das, woran die Ratte nagt, und mir wird übel. Es ist eine halb verrottete menschliche Hand. Die Ratte schaut mich an, während sie kaut. Sie sähe beinahe niedlich aus, wenn sie nicht gerade Menschenfleisch fräße. Aber ich nehme es ihr nicht übel. Wir haben alle Hunger hier unten.
Die Ratte legt den Kopf schief, im selben Moment wie ich. Sie spannt den Körper an, doch ich bin schneller. Der Griff meines Messers trifft ihren Schädel. Ihre Knochen brechen mit einem leisen Knacken. Sie ist sofort tot.
Ich brauche nicht lange, um das Tier an meinen Rucksack zu binden. Es wird höchste Zeit, dass ich die Schleuse erreiche. Ich muss den ersten Käfig erwischen – den Käfig hoch ins Licht.
Eilig schiebe ich mein Messer zurück an seinen Platz, da streift ein Luftzug meinen Nacken. Er ist nicht kalt wie der übliche Wind in den Tunneln, sondern warm. Ein Atemhauch. Ich reiße mein Messer hoch, doch es ist zu spät. Schon schließt sich ein Arm um meine Kehle. Meine Finger krallen sich in grobes Leder.
»Hallo, Prinzessin«, raunt eine dunkle Stimme dicht an meinem Ohr. »Ganz allein?«
2
Sira
Ich ziehe mit meinem ganzen Gewicht den Arm nach unten, packe das Handgelenk und drehe mich unter ihm aus der Umklammerung. Mit festem Griff reiße ich den Arm auf den Rücken meines Gegners, der ein schmerzerfülltes Keuchen ausstößt.
»Nicht so allein, wie ich gern wäre«, knurre ich und drücke sein Handgelenk noch etwas höher. »Was zum Teufel hast du hier zu suchen, Rico?«
»Ich wollte dir beim Jagen zuschauen, Pocahontas«, stöhnt er. »Ist ehrlich gesagt das Schönste, was ich seit unserer letzten Begegnung gesehen habe.«
Ich schnaube. Pocahontas. So nennt er mich, seit wir uns vor Jahren zum ersten Mal im Dreck unserer Welt begegnet sind. Aus offensichtlichen Gründen: Mit meinem langen, dunklen Haar und den braunen Augen sehe ich der indigenen Prinzessin ähnlich, und wie sie benutze ich neben meinem Messer am liebsten Pfeil und Bogen für die Jagd.
»Dann musst du in der Hölle unterwegs gewesen sein.« Ich lasse ihn mit einem kräftigen Stoß los. Er fängt den Sturz geschickt ab und dreht sich mit der Geschmeidigkeit einer Raubkatze zu mir um.
Rico. Anführer der stärksten Söldnertruppe der Unterwelt von New York. Bei unserer ersten Begegnung haben wir uns gehasst. Ich ihn, weil er mich behandelt hat wie ein dummes Kind. Er mich, weil ich mir das nicht gefallen ließ. Dann hat er meinem Bruder und mir bei der Flucht aus der letzten Enklave geholfen, und als wir uns vor einigen Monaten in einem der Tunnel begegneten, hat sich unser Verhältnis erneut verändert.
Er trauerte um eine seiner Söldnerinnen, und ich war erschöpft von meinem letzten erfolglosen Beutezug. Wir haben nicht viel geredet, aber ich spüre noch immer Ricos Hände auf meiner nackten Haut und den Rausch, in den wir uns gestürzt haben. Es tat gut, für eine Weile nicht mehr allein zu fallen, sondern zu zweit. So gut, dass wir uns seitdem immer wieder mehr oder minder zufällig über den Weg gelaufen sind.
Sein Grinsen wird breiter. »Manche behaupten, ich hätte die Hölle in mir«, sagt er und verschränkt die Arme vor der Brust. »Ich denke eher, ich würde einen guten Luzifer abgeben. Fehlen nur noch die Flügel, und ich wäre der ideale gefallene Engel, meinst du nicht? Auch wenn ich natürlich durch und durch ein netter Kerl bin.«
Mein Blick schweift unwillkürlich über seinen Körper. Sein schwarzer Pullover liegt eng an seinem muskulösen Oberkörper an, seine Lederjacke ist zerkratzt, seine Hose wie meine mehrfach geflickt. Und wie ich trägt er nicht nur Arm- und Beinschienen und fingerlose Handschuhe, sondern auch ein Messer. Aber seine hellgrauen Augen blitzen vor Übermut, als könnte er sich nichts Besseres vorstellen, als hier unten in der Dunkelheit zu leben. Sein dunkles, kurz geschorenes Haar betont sein markantes, immer ein wenig spöttisches Gesicht, und als er jetzt ein schiefes Lächeln zustande bringt, könnte man ihm beinahe glauben. Er sieht tatsächlich aus, als wäre er ein netter Kerl. Aber nur fast.
»Sorry, aber ich muss los.« Ich stecke mein Messer zurück in mein Holster und ziehe mich in einen der Waggons hoch. Der Zug reicht fast bis zum Ende des Tunnels, und es kommt mir gelegen, nicht über Trümmer oder Tote klettern zu müssen. »Der Käfig wartet.«
Rico hält mühelos mit mir Schritt. »Also alles beim Alten. Du rennst durch die Dunkelheit und riskierst dein Leben.«
»Wie wir alle.« Ich stemme mich gegen eine klemmende Waggontür. »Was ist mit dir? Ich dachte, du sicherst mit deinen Leuten eine Enklave in Philadelphia.«
Er stößt die Tür mit der Schulter auf. »Wir waren zu spät dran. Als wir ankamen, haben wir nur noch Asche gefunden. Und verkohlte Leichen.«
Der Gedanke an den Gestank von verbranntem Fleisch lässt mich über einen herausgerissenen Sitz stolpern. Ich kenne diesen Geruch nur zu gut, und er weckt immer noch Übelkeit in mir. »Und da dachtest du dir: Hey, wo ich schon mal dabei bin, spaziere ich doch gleich noch durch die gefährlichsten Tunnel dieser Stadt.«
»Wir sind Menschen«, sagt er schlicht. »Für uns ist es überall gefährlich. Ich bin hier, weil ich ein Dieb bin und über uns eine Welt voller Schätze liegt. Es wurde einfach Zeit, New York mal wieder zu besuchen. Zwei Tunnel hier in der Nähe sind eingestürzt, also blieb mir nur dieser Weg.«
Ich drücke mit den Händen gegen die nächste Tür. »Du kannst überall auf Beutezug gehen. Bist du wirklich nur für ein paar Schätze in die Stadt zurückgekommen?«
»Vielleicht auch bloß für einen.«
Seine Stimme ist auf einmal so dunkel, dass ich mich zu ihm umdrehe. Er steht direkt hinter mir und streicht über meine Wange. Seine Finger sind rau, aber die Berührung ist so zärtlich, dass ich unwillkürlich meine Hand auf seine lege. »Du hast mir gefehlt, Sira.«
Seine Worte gehen mir unter die Haut, und ich lache heiser, um es nicht zu zeigen. »Pass auf, dass dich niemand hört«, warne ich ihn. »Sonst merken deine Leute noch, dass du nicht nur aus Grausamkeit und Muskeln aus Stahl bestehst, du Halsabschneider.«
Ein gefährlicher Funke lodert in seinen Augen auf, der deutlich macht, dass er sich normalerweise nicht so nennen lässt. Er greift mir ins Haar und drückt mich mit dem Rücken gegen die Tür. »Beim letzten Mal hat dir gefallen, was ich mit deinem Hals gemacht habe.«
Sein Atem gleitet über meine Haut, und ich erinnere mich an unsere letzte Begegnung. Seine Finger in meinem Haar. Seine Lippen, fordernd und leidenschaftlich. Unsere nackten Körper, an eine Tunnelwand gelehnt. Meine Beine um seine Hüfte geschlungen. Seine Bewegungen in mir, grob und sanft zugleich. Unser keuchender Atem, der die Dunkelheit erfüllte.
Er beugt sich vor. Seine Lippen berühren meinen Hals, doch ich presse die Hände gegen seine Brust. »Ich muss gehen«, flüstere ich. »Der Käfig …«
»Vergiss den Käfig«, raunt er, und sein Atem streift mein Ohr. »Du brauchst nicht mehr in die Oberwelt zu gehen, wenn du nicht willst. Nie wieder.«
Ich ziehe die Brauen zusammen. »Wie meinst du das?«
Er zieht sich zurück, gerade weit genug, um mir in die Augen schauen zu können. Ich kann seinen Herzschlag unter meinen Händen spüren. »Wenn du willst, nehmen wir dich in die Truppe auf. Alle sind einverstanden. Ich habe mit ihnen gesprochen.«
Ich starre ihn an. »Du hast was?«
»Ich habe ihnen gesagt, wer du bist. Eine Diebin und Jägerin mit jahrelanger Erfahrung, furchtlos und nicht zimperlich. Wie du weißt, ist es nicht leicht, bei uns aufgenommen zu werden.«
Das weiß ich allerdings. Ricos Söldnertruppe ist klein, kaum zwei Dutzend skrupellose Kriegerinnen und Krieger, die ohne feste Bleibe durch die Welt ziehen. Sie sind immer in Bewegung, bieten auf diese Weise weniger Angriffsfläche. Gleichzeitig sind sie sehr wählerisch, wenn es um neue Mitglieder geht.
»Was ist mit …«, fange ich an.
»Dein Bruder ist uns willkommen«, beantwortet Rico rasch meine Frage, »solange wir ihm keine Märchen erzählen müssen.«
Ich stoße die Luft aus. »Andor würde eher euch welche erzählen. Am liebsten welche, in denen ihr eure Köpfe verliert. Er hält nicht viel von bezahlten Mördern.«
Rico zuckt gleichgültig die Schultern. »Alle Menschen sind Mörder, wenn es darauf ankommt. Warum sollte ich mich nicht für das bezahlen lassen, was ich am besten kann?«
»Die Hölle hat ihre eigenen Regeln, nicht wahr?«
»Hast du jemals daran gezweifelt?« Er zieht mich näher an sich. »Du musst dich nicht bedanken, aber ein kleines Lächeln wäre nett. Jetzt. Oder später.« Sein Blick fällt auf den Anhänger an meinem Hals. »Den solltest du allerdings abnehmen. Meine Truppe duldet es nicht, dass jemand etwas von unseren Feinden am Körper trägt.«
Er senkt den Kopf. Seine Lippen streifen meine Haut, und für einen Moment will ich nichts mehr, als mich in diesen Augenblick fallen zu lassen, genau wie bei unserem ersten Mal. Es gab Zeiten, da ich mir gewünscht hätte, mit den Söldnern zu ziehen. Früher, als ich noch ein Kind war und keine Ahnung hatte, was Krieg bedeutet. Aber die Zeiten haben sich geändert.
»Du musst deinen Feind kennen, wenn du ihn töten willst«, flüstere ich, während Rico meinen Kopf weiter zur Seite neigt und leicht zubeißt. »Du musst lautlos sein wie er. Schnell wie er. Und ebenso … tödlich.«
Mit diesem Wort drücke ich mein Messer gegen Ricos Leiste, direkt über der Arterie. Er erstarrt. Langsam hebt er den Kopf und sieht mich an. Er hat nicht bemerkt, dass ich die Waffe gezogen habe.
»Dieser Anhänger ist ein Geschenk meines Onkels«, sage ich ruhig. »Er hat ihn mir kurz vor seinem Tod gegeben, und er erinnert mich immer daran, wer mein Feind ist. Ich werde ihn niemals abnehmen. Und du solltest nicht von Dingen sprechen, von denen du nichts verstehst. Auch nicht über mich, schon gar nicht vor einer Truppe von Gangstern.«
Eine Spur von Kälte zeigt sich auf Ricos Gesicht. »Du weist uns zurück?«, fragt er ungläubig. »Ich dachte, du willst so schnell wie möglich aus deiner Enklave abhauen und deinen Bruder von hier wegschaffen. In drei Tagen könntest du mit uns kommen, und dann …«
»… wäre ich eine Söldnerin. Doch leider bin ich im Gegensatz zu dir nicht käuflich. Ich werde niemals mein Leben für jemanden riskieren oder jemanden umbringen, nur weil ich dafür bezahlt werde. Und außerdem habe ich eigene Pläne, wie ich von hier verschwinden kann.«
Er lässt mich los und weicht einen Schritt zurück. »O ja, deine geheimnisvollen Pläne, von denen niemand weiß. Glaubst du wirklich, dass irgendwo ein besseres Leben auf dich wartet?«
Ich zucke mit den Schultern. »Ich weiß es nicht. Aber ich muss danach suchen. Und mir ist klar, dass du das nicht verstehst. Du brauchst den Krieg, genau wie deine Leute. Nur so könnt ihr sein, wer ihr seid. Euch gefällt das. Mir nicht. Ich habe vielleicht nicht viel. Aber ich habe meine Freiheit. Und die wird mir niemand nehmen. Auch du nicht.«
Er starrt mich an. Ich sehe die Wut, die in ihm aufsteigt, und kurz glaube ich, dass er sich einfach umdrehen und verschwinden wird. Aber dann fährt er sich über die Augen, und ein Schimmer zeigt sich in ihnen, so sanft, wie ich es noch nie bei ihm gesehen habe. Immer, selbst in der innigsten Umarmung, war da eine Distanz zwischen uns. Bis jetzt.
Rico nickt langsam, und zum ersten Mal habe ich das Gefühl, dass er mich versteht. Ein Lächeln zupft an meinem Mundwinkel, aber ich dränge es zurück. Gefühle haben in der Unterwelt keinen Platz.
Rico legt den Kopf schief, als hätte er meinen Gedanken gehört. »Du bist eiskalt, Prinzessin«, sagt er. »Gut, wenn man überleben muss. Pass nur auf, dass du nicht eines Tages daran erstickst.«
Kurz sehen wir uns an und wissen beide, dass dieser Moment eine Zäsur ist – der Atemzug, der die Welt in ein Vorher und ein Nachher trennt.
Dann geht ein Geräusch durch den Tunnel, das den Zug erbeben lässt, ein Grollen von solcher Tiefe, dass ich es bis in meine Knochen spüre. Rico stößt einen Fluch aus, und wir setzen uns wieder in Bewegung.
Die Gefahr ist ganz nah.
3
Sira
Die Schleusentür begrüßt uns wie üblich mit dem Widerwillen, sich zu öffnen. Wir stemmen uns dagegen, keuchend, weil wir den gesamten Weg bis hierher gerannt sind, und das nicht nur, weil wir den Käfig erreichen wollen, bevor er in die Oberwelt fährt, sondern auch, weil uns das Grollen gefolgt ist, durch drei Tunnel und zwei niedrige Gänge voll stinkendem Morast, ehe es plötzlich verstummte. Die anschließende Stille war beinahe noch schlimmer. Rico weiß ebenso gut wie ich, wie grausam sie zerbrechen kann, und wir sind beide erleichtert, als es uns nun gelingt, diese verfluchte Schleusentür aufzuschieben.
Dämmriges Licht fällt uns ins Gesicht. Sofort umgeben uns die Stimmen der Diebe, die mit uns in die Oberwelt fahren werden – lebensmüde Abenteurer wie wir selbst, die ihre Haut riskieren, um die Schätze einer verlorenen Welt zu bergen.
Heute sind sie zu dritt: Stan mit dem feuervernarbten Gesicht, Alexander, der selten mehr als drei Worte am Stück spricht, und Ashley, die sich die verschlungenen Tätowierungen selbst auf ihren kahlen Schädel gestochen hat. Als Rico und ich an ihnen vorbeigehen, nicken sie uns respektvoll zu.
Rico ist für viele hier unten eine Art Held und wird auch so behandelt. Ich hingegen musste um die Anerkennung kämpfen. Vielleicht, weil ich eher so aussehe, als müsste ich beschützt werden. Dass ich nicht die geringste Lust habe, mich beschützen zu lassen, hat sich allerdings inzwischen herumgesprochen. Und nach der einen oder anderen Auseinandersetzung wagt es inzwischen keiner mehr, mir den Zutritt zur Oberwelt zu verwehren.
»Das wurde auch Zeit.« Der alte Sol hockt in dem spärlich beleuchteten Tunnel wie üblich auf einem mickrigen Klappstuhl, direkt vor dem Käfig, den er eigenhändig gebaut hat: ein rostiges Ding mit zwei Kurbeln. Früher ist er selbst in die Oberwelt gefahren, doch seit er im Licht seinen linken Arm verloren hat, zieht er es vor, den Liftboy zu spielen, wie er selbst sagt. »Wir warten schon eine Ewigkeit, und ihr wisst, dass die Zeit an der Schleuse langsamer vergeht als überall sonst.«
Ich stecke meine Fackel in den Sandeimer neben ihm. »So lernt man Geduld. Hast du mir das nicht beigebracht?«
Sols Miene ist griesgrämig wie immer, aber mit meinem Auftauchen ist ein Funke in seinen Blick getreten. Jetzt schaut er mit dem Anflug eines Lächelns zu mir hoch. »Manchmal frage ich mich, was ich dir überhaupt beigebracht habe. Anstand scheint nicht darunter gewesen zu sein.«
»Sie kann anständig fluchen«, wirft Rico hinter mir ein. »Vielleicht hast du das gemeint, alter Mann.«
Sol erfasst ihn mit seinem Blick, und ich muss beinahe lachen, als Rico ein wenig zurückweicht. Sol mag alt und gebrechlich sein, aber vor seinem Killerblick haben selbst gestandene Jäger wie Rico noch immer Respekt. »Zeigt mir eure Ausrüstung«, knurrt Sol und fährt sich durch sein spärliches weißes Haar. »Wir hocken schon viel zu lange hier rum.«
Er nimmt Schutzanzug und Atemmaske aus meinem Rucksack und prüft sie auf ihre Funktionstüchtigkeit. Sol ist sehr genau, was die Sicherheit betrifft. Er erzählt immer wieder gern die Geschichte von der defekten Maske, die ihn fast das Leben gekostet hätte, wäre er nicht in letzter Sekunde von seinen Begleitern gerettet worden. Er hat mir viele wichtige Lektionen beigebracht, als ich selbst an der Seite meines Onkels meine ersten Schritte in die Oberwelt unternommen habe, und er war es, der mich in seinem Käfig mitgenommen hat, auch wenn ich noch sehr jung war – als einziger Schleusenwärter der Unterwelt. Vielleicht lag das daran, dass Sol nicht nur seinen Arm im Licht verloren hat. Auch seine Frau und seine Tochter sind darin umgekommen. Vielleicht findet er einfach, dass es an der Zeit ist, sich ein wenig Verlorenes zurückzuholen.
Rico und die anderen fachsimpeln über die Durchschlagskraft einer Armbrust, während Sol die Nähte meines Anzugs kontrolliert. Ich beuge mich zu ihm vor. »Du siehst müde aus«, sage ich zu ihm.
Er blickt zu mir auf. »Du meinst, ich bin normalerweise noch schöner als jetzt?« Er zwinkert, aber er ist tatsächlich sehr blass. Er wirkt erschöpft. Ausgezehrt.
»Warst du krank? In unserer Enklave ging gerade wieder ein Virus um. Andor hatte es erwischt, deshalb war ich die letzten Tage nicht hier.«
Sol hebt die Brauen. »Wie geht es Andor jetzt?«
Ich muss lächeln, so sanft klingt seine Stimme auf einmal. Sol kennt meinen kleinen Bruder seit dessen Geburt, und er hat ihn von der ersten Sekunde an ins Herz geschlossen. »Es geht ihm viel besser. Ich muss ihn schon wieder davon abhalten, stundenlang zu zeichnen. Natürlich hält er sich nicht an meine Vorschriften.«
Sol lacht leise. »Und das ist gut so. Soll er sich wegträumen, der Junge. Das ist das Beste, was er tun kann. Und Bilder für seinen alten Freund Sol malen. Ich habe immer eins von ihm dabei.« Er klopft sich auf die Brusttasche seines Hemds. »Heute ist es ein Sonnenaufgang. Hilft mir dabei, mich zu erinnern, dass es mehr auf der Welt gibt als Dunkelheit. Richte ihm das ruhig aus.«
»Das mache ich gern.« Ich beobachte, wie Sol Ricos Atemmaske unter die Lupe nimmt, und hole Luft, als seine Hände zittern.
Doch bevor ich etwas sagen kann, sieht Sol mich seufzend an. »Rico hat recht«, sagt er. »Ich bin alt, Sira. Erstaunlich alt für die Welt, in der wir leben. Und dafür geht es mir wirklich gut.«
Sein Lächeln sinkt wie ein warmer Stein in mich hinein.
»Kein Wunder«, sagt Rico hinter mir. »Wem würde es nicht gut gehen, wenn er hier unten sitzen könnte, während andere da oben ihre Haut riskieren?«
Sofort kehrt die Schärfe auf Sols Gesicht zurück. »Ich bin lange genug ins Licht gefahren, um eins zu wissen: Es ist sehr viel besser, dort oben Kopf und Kragen zu riskieren, als hier in der Stille zu hocken und auf Wahnsinnige wie dich zu warten. Ich sehe es dir an: Du brennst doch schon wieder darauf, dein verfluchtes Leben aufs Spiel zu setzen. Du bist verrückt, Rico. Wie wir alle.«
Rico strafft die Schultern. »Das nehme ich als Kompliment.«
Ich drehe mich halb zu ihm um. »Du nimmst doch alles als Kompliment.«
»Solltest du auch tun«, gibt er zurück. »Erleichtert das Leben.«
Sol schiebt uns unsere Sachen hin und nickt. »Alles in Ordnung. Zieht euch um. Wir sind spät dran. Und seht zu, dass ihr da oben auf euch aufpasst. Dort gibt es Wichtigeres als irgendwelche zwischenmenschlichen Dramen.«
Ein leichtes Zittern liegt in seiner Stimme, das mich erschaudern lässt. Sein Blick schießt zwischen Rico und mir hin und her, und ich fühle mich seltsam ertappt. Sol hatte immer schon sehr feine Antennen. Im Gegensatz zu Stan und Alexander.
»Überleben zum Beispiel.« Stan verzieht sein vernarbtes Gesicht zu einem Grinsen. »Als wenn das was Neues wäre.«
Alexander nickt seufzend, aber Ashley ist still, und Rico schaut mit ernster Miene auf Sol hinab. Offenbar hat auch er den Unterton in Sols Stimme gehört. »Was ist los, alter Mann? Du siehst aus, als hättest du einen Geist gesehen.«
»Unsere Welt ist voller Geister«, murmelt Sol. »Lebendiger und toter. Und ich bin einer von ihnen.«
Ich ziehe die Brauen zusammen. »Hast du nicht gerade gesagt, dass wir es eilig haben? Also raus mit der Sprache. Was stimmt nicht mit dir?«
Sol schaut auf seine Finger, und als er den Blick hebt und mich ansieht, weiß ich, dass ich die Antwort nicht hören will. Aber ich kann mich nicht abwenden, als er sagt: »Die letzten drei Trupps sind nicht zurückgekehrt.«
Namen schießen mir durch den Kopf, die Namen der Jäger und Diebe aus meiner Enklave, die in den letzten Tagen ins Licht gefahren sind. Ich habe keinen von ihnen mehr seit ihrem Aufbruch gesehen, was nicht ungewöhnlich ist. Unsere Enklave ist die größte der Unterwelt. Es ist leicht, sich dort nicht zu begegnen. Und wir waren keine Freunde. Keiner von uns. Dafür ist das Risiko zu groß, im Licht zu bleiben. Ich kann nicht mehr zählen, wie viele von uns es über die Jahre erwischt hat. Aber nie so viele auf einmal in so kurzer Zeit.
Ich muss an das Grollen denken, das, nah wie lange nicht mehr, hinter Rico und mir her war, und ich schlucke schwer, als ich begreife, dass das nur eins bedeuten kann: Sie sind auf der Jagd. Nach uns.
Ich nehme meinen Rucksack auf, durchbreche die Starre, in die Sols Nachricht mich gestürzt hat. Sieh nicht zurück. Niemals, flüstert Kanes Stimme in meinem Kopf, und ich konzentriere mich auf Sols Gesicht, die Blässe seiner Haut, die Erschöpfung in seinen Augen, die ich auf einmal verstehe. Als Schleusenwärter hat er in seiner kleinen Enklave einen guten Stand. Die Jäger und Diebe, die ins Licht fahren, geben ihm für gewöhnlich von ihrer Beute etwas ab. Aber wenn niemand aus der Oberwelt zurückkommt, gibt es auch nichts zu teilen, und das bedeutet, dass Sol seit drei Tagen wenig bis nichts gegessen hat.
Ich binde die Ratte von meinem Rucksack. »Nimm du sie«, sage ich.
Sol starrt zuerst mich an, dann die Ratte. »Ich will keine Almosen. Das …«, fängt er an, aber ich lasse ihn nicht ausreden.
»Das ist das Mindeste, was ich tun kann«, sage ich, während ich Rucksack und Bogen schultere und das Holster schließe. »Wir brauchen dich hier unten. Wie sollen wir sonst dort oben unser Leben riskieren?«
»Sie hat recht«, pflichtet Rico mir bei, und seine Stimme hat einen ungewohnten Anflug von Sanftheit. »Nimm das Vieh, alter Mann, und pack es gut weg. Ich werde das Gewicht deiner Provianttasche heute noch verdoppeln.«
Stan und Ashley murmeln zustimmend, Alexander nickt wortlos, und als Sols Finger über das Fell der Ratte streichen, huscht ein Lächeln über sein Gesicht. »Ich sag’s ja«, murmelt er, »wir sind allesamt wahnsinnig, und ihr erst recht.«
Ich nehme die Zärtlichkeit in seinem Blick wahr, ehe er sich wieder hinter die Maske des alten Kriegers zurückzieht und zum Käfig geht. Er öffnet ihn, während wir unsere Fackeln holen. Dann dreht Sol sich um und schaut uns an.
Das Zögern ist wie ein Atemholen. Alexander umfasst seine Fackel fester, Stan greift sich an die Wange, als würde er noch einmal das Feuer spüren, das ihn verbrannt hat, Ashley streicht langsam über ihren kahlen Schädel, und Rico ballt die freie Hand zur Faust. Wieder höre ich die Namen der anderen in meinen Gedanken. Die Namen derer, die nicht zurückgekommen sind. Mir ist klar, dass nicht alle von ihnen im Licht gestorben sind. Einige haben dort oben Schlimmeres erfahren als den Tod. Aber ich weigere mich, Angst zu haben. Denn Angst bedeutet Schwäche. Und wer schwach ist, stirbt.
Mit einem Ruck setze ich mich in Bewegung und betrete als Erste den Käfig. Rico und die anderen folgen mir schweigend. Eine seltsame Feierlichkeit legt sich über uns, wie immer, wenn Sol wie jetzt das Metallgitter vor uns zuzieht. Keinem steht mehr der Sinn nach einem Wortgefecht. Nicht so kurz vor dem, was uns erwartet.
Sol legt die Hände auf die Kurbel. »Seid vor Sonnenuntergang zurück, sonst müsst ihr zusehen, wie ihr in eure Enklaven kommt. Nehmt, was ihr kriegen könnt und …« Für einen winzigen Moment wird sein mürrisches Gesicht weich, als er mich ansieht. »Gebt gut auf euch Acht.« Er lächelt kaum merklich. Dann packt er die Kurbel, und der Käfig fährt in die Höhe.
4
Sira
Ich weiß nicht, wie oft ich mit den Händen an meinen Waffen auf diesem rostigen Gitter gestanden und zugesehen habe, wie Gesteinsmassen an mir vorbeiziehen, während ich mich der Oberwelt nähere, und mich überkommt immer noch dasselbe Gefühl wie beim ersten Mal, als der Käfig wenig später einrastet und ich mir die Atemmaske vors Gesicht schiebe. Ich folge den anderen eine kurze Sprossenleiter aufwärts, die in einen breiten Tunnel führt. Die Luft ist trocken und rußgeschwängert, am Ende zeichnet sich pechschwarz die letzte Schleuse ab.
Dicht vor ihr lösche ich meine Fackel. Ich taste mich an der Wand der Schleuse entlang, spüre meinen beschleunigten Puls, das Adrenalin, jeden angespannten Muskel. Dann trifft helles Licht meine Augen. Ich mache die ersten Schritte, beinahe blind. Im Schutz des letzten Tunnelstücks gehe ich vorwärts und trete aus dem Zwielicht, und da liegt sie: die Welt, die wir Menschen verloren haben.
Die Ruinen New Yorks ragen wie ein Scherenschnitt in einen brennenden Himmel. Viele der niedrigeren Gebäude sind eingestürzt, durch die Skelette einiger Wolkenkratzer flackern die magischen Feuerströme des Himmels. Die Straßen sind aufgebrochen, Unkraut wuchert überall. In der Ferne ächzen die Brückenreste im Wind, und überall steigt schwarzer Rauch aus den Trümmern. Er streicht über die verkohlten Autos und erfüllt die Luft mit glühenden Funken. Hin und wieder flackern sie auf, als hätte ein Atemzug sie angefacht. Und über allem steht die Sonne, ein blasser, gelber Fleck über der verlassenen Stadt.
Ich trete einen Schritt vor. Das Wasser verdampft auf meinen Stiefeln, und ich lege die Hand auf mein Messer. Denn es gibt hier noch Leben …
»Was ist, Prinzessin?«, fragt Rico hinter mir. »Wir gehen zum Central Park, ein paar Pelze jagen. Kommst du mit? Ich verspreche auch, dir deine Beute nicht streitig zu machen.«
Ich wende mich nicht um, während ich in einen Trümmerhaufen greife und wie die anderen Asche auf meinem Anzug verteile, um meinen Geruch zu überdecken. Manchmal erscheint es mir absurd, immer noch die alten Namen der Orte zu benutzen. Ich weiß, was man unter einem Park versteht. Das, was da mitten in der Stadt wuchert und nach und nach immer mehr Straßenzüge erobert, ist definitiv keiner. Es ist ein Dschungel, und ein tödlicher noch dazu. Ich habe mich ihm schon oft gestellt. Doch jetzt habe ich ein anderes Ziel. »Das würdest du eh nicht schaffen«, gebe ich zurück, »und du weißt ja: Ich arbeite allein.«
Nur uns beiden ist klar, dass diese Worte noch eine weitere Bedeutung haben. Das Nachher hat begonnen, in dem wir beide unserer Wege gehen werden und in dem es kein uns mehr gibt. Ich sehe Rico an. Er lächelt unter seiner Atemmaske, und ich nehme mir vor, ihn nicht zu vergessen, diesen sanften Schimmer, der hin und wieder in seinen Augen auftaucht. Dann macht er sich mit den anderen auf den Weg.
Ich werfe noch einen Blick in den Himmel, auf Feuer und Rauch, und laufe in die entgegengesetzte Richtung.
Die heiße Luft flimmert über dem Asphalt, aber ich bin so schnell, dass meine Füße kaum den Boden berühren, und lasse mich weder von Mauervorsprüngen noch von Trümmerresten aufhalten. Ich setze über die Hindernisse hinweg, als würde ich fliegen – genau so, wie mein Onkel es mich gelehrt hat. Er hat mir beigebracht, wie man sich möglichst schnell durch die Stadt bewegt. Anfangs schienen mir die Ruinen New Yorks noch unüberwindlich, aber ich habe rasch gelernt, sie als Terrain voller Möglichkeiten zu sehen. Mit jedem Sprung, jedem Balanceakt überwinde ich Grenzen – meine eigenen und die meiner Umgebung –, und das gefällt mir.
Ich biege in eine schmalere Seitenstraße ab, und es wird etwas kühler. Der Asphalt hat hier irgendwann einmal Blasen geschlagen, aber jetzt liegt er zwischen einem halb eingestürzten Einkaufszentrum und einem windschiefen Wohnblock fast vollständig im Schatten. Ich schaue zu den zerbrochenen Fensterscheiben hoch. Es gibt noch ein paar Vorhänge – sehr nützlich in den meist kühlen Tunneln der Unterwelt. Offenbar wurde das Gebäude seit meinem letzten Besuch hier noch von niemandem sonst geplündert. Es wird dort oben voller Dinge sein, die nur darauf warten, von mir mitgenommen zu werden – Becher, Pfannen, seltsame Gegenstände, die die Menschen früher gesammelt haben und die sich hervorragend als Waffen eignen. Auf dem Markt könnte ich all das gut verkaufen, aber ich konzentriere mich auf mein Ziel. Wenn alles gut geht, wird in diesem Gebäude größere Beute auf mich warten.
Ein Grollen hallt über die Häuserschluchten, so tief, dass man es mehr fühlt als hört. Ich springe über eine Mauer und flüchte in eine ausgebrannte Wohnung. Mir steht nicht der Sinn danach, mir vom Urheber dieses Grollens das Fleisch von den Knochen fressen zu lassen.
So leise wie möglich bewege ich mich durch die Räume. Vereinzelt sind unter all dem Ruß und Schmutz noch Tapeten zu erkennen, auch halb verkohlte Möbel und Spielzeug. Mir kommt es so vor, als würde ich mit jedem Zimmer, das ich durchquere, einen Teil derjenigen kennenlernen, die früher hier gelebt haben. Ob sie sich hätten vorstellen können, dass einmal jemand sein Leben riskieren würde, um ihre alten Messer zu stehlen? Ich lächle unter meiner Maske, während ich hier und da kleinere Dinge in meinen Rucksack stopfe. Dieses Mal bin ich nicht wegen irgendwelcher Messer gekommen.
Mein Herzschlag beschleunigt sich, als ich den Durchbruch in der Wand erreiche. Der Vorhang, den ich bei meinem letzten Besuch davor gezogen habe, ist noch da. Ein gutes Zeichen dafür, dass nichts und niemand seitdem hier war.
Ich raffe den Vorhang beiseite und gelange in eine düstere Erdgeschosswohnung. Roter Qualm dringt aus Rissen im Boden, nur der Flammenschein von der Straße spendet etwas Licht. Er erhellt verkohlte Möbel, Mauerreste – und einen funkelnden dunkelblauen Kristall, der inzwischen zu lohnender Größe angewachsen ist.
Ehrfürchtig löse ich den Kristall vom Boden. Er wird mir nun mehr einbringen als alle Pelze und Pfannen der Stadt. Er ist dunkelblau wie das Meer, das ich vor Jahren in dem Buch meines Onkels gesehen habe.
Der Gedanke durchbricht meine Anspannung. Ich kenne nur den Ozean vor den Toren New Yorks. Er ist pechschwarz, und die glitzernden Blasen, die manchmal daraus aufsteigen, enthalten keinerlei Sauerstoff. Feuer lauert in der Tiefe dieses Wassers. Es gibt der tödlichen Hitze des Himmels Antwort, und ich hasse es.
Umso mehr träume ich davon, einmal das Meer ganz im Westen, jenseits der Brennenden Berge, bei Nacht zu sehen. Kühl und samten und voller Geheimnis, mit tausend Glitzerlichtern auf den Wellen. Die meisten Menschen können das nicht verstehen, aber anders als sie kenne ich die Oberwelt. Ich weiß, was Wind bedeutet und wachsendes Gras, und ich sehne mich aus tiefstem Herzen nach diesem Meer der Nacht.
Ein Keckern fährt mir wie ein Faustschlag in den Magen. Gleich darauf schiebt sich der Schädel eines Reptils durch das Loch in der Mauer. Messerscharfe Zähne ragen über die starren Lippen. Die mannsgroße Echse steht auf zwei Beinen, ihre gekrümmten Krallen kratzen über den Stein, und noch ehe ich drei weitere ihrer Art hinter ihr ausmache, weiß ich, dass ich entdeckt wurde.
Jetzt erfasst das Biest mich mit seinem Blick. Seine Augen sind kalt und klug. Es ist darauf trainiert, Menschen wie mich aufzuspüren, ausgebildet von Wesen, die mächtiger sind, als ich erahnen kann. Und eines ist sicher: Sie verfehlen niemals ihr Ziel.
Der Schrei der Kreatur ist hell wie ein Vogelruf. Sie springt in den Raum, dicht gefolgt von ihren Begleitern. Schnell stopfe ich den Kristall in meine Tasche und schwinge mich aus dem Fenster hinter mir auf die Straße. Der Boden erzittert unter den Sprüngen der Echsen. Mit scharfen Kehllauten jagen sie mir nach. Ich schlage einen Haken, hechte über einen Trümmerhaufen und renne ein marodes Treppenhaus hoch. Das Geländer splittert, als meine Verfolger mir nacheilen, aber die Enge des Hauses verschafft mir einen Vorteil. Oben trete ich die verkohlte Tür aus den Angeln und laufe aufs Dach.
Ich bin den brennenden Wolken jetzt so nah, dass die Hitze kaum zu ertragen ist. Aber schlimmer sind die Schreie meiner Verfolger. Wie Peitschenhiebe treiben sie mich über Trümmerberge auf benachbarte Häuser. Ich reiße meinen Bogen nach vorn, lege den Pfeil an, und er erwischt eins der Biester mit solcher Wucht, dass es taumelt und abstürzt. Sein Zischen bricht abrupt ab, als es unten aufschlägt.
Ich schlittere ein eingestürztes Dach hinunter und lande auf einem halb zerbrochenen Schornstein. Mein Atem geht schnell. Oft genug habe ich die Opfer dieser Kreaturen gesehen. Menschen mit aufgeschlitzten Bäuchen und durchstochener Luftröhre, deren Arme in Fetzen hingen. Diebe wie ich, die vom Gift dieser Echsen binnen weniger Augenblicke gelähmt wurden. Und während sie starben, haben sie nichts als die eiskalten Augen dieser Bestien gesehen.
Mit einem waghalsigen Sprung lande ich auf einem weiteren Dach – und begreife, was meine Verfolger vorhaben. Es gibt im Umkreis kein Haus, keinen Trümmerberg mehr, der für mich erreichbar wäre. Da ist nur eine Leiter, die in einen von giftigen gelben Dämpfen erfüllten Hinterhof führt. Eine Falle.
Ich werfe einen Blick über die Schulter. Eins dieser Mistviecher setzt zum Sprung an. Rasch schiebe ich meinen Bogen auf den Rücken. Meine Füße rutschen auf der rostigen Feuerleiter aus. Ich prelle mir das Handgelenk, lande in dem Hof, renne auf das rote Licht am Ende des einzigen Ausgangs zu. Meine Verfolger springen direkt vor mich.
Mein Herz hämmert gegen meine Rippen. Ich ziehe mein Messer. Es fängt durch die gelben Dämpfe an, zu glühen, aber ich lasse es nicht fallen. Ich kenne diesen Qualm, der selbst die besten Schutzanzüge innerhalb kürzester Zeit zersetzt. Meine Verfolger verharren regungslos. Ich meine, Genugtuung in ihren Blicken zu erkennen, während ich vor ihnen zurückweiche, langsam, als könnte ich das Unaufhaltsame noch verhindern. Dabei komme ich einer der Dampfsäulen zu nah. Zischend erfasst sie den Ärmel meines Anzugs. Ich spüre die Hitze noch brennender. Meine Verfolger keckern. Es klingt wie ein wahnsinniges Kichern. Jetzt kommt der erste von ihnen näher. Er beobachtet, wie sich mein Anzug auflöst und der Dampf nach meiner Maske greift. Seine Muskeln spannen sich an, als ich unter der Hitze schwanke. Ein einziger Atemzug in dieser tödlichen Luft, das weiß jedes Kind der Unterwelt, zwingt einen Menschen für gewöhnlich in die Knie.
Auch mein Verfolger weiß das. Das Keckern in seiner Kehle wird tief. Das Spiel ist vorbei. Er kommt näher, doch irgendetwas an mir scheint ihn zu irritieren. Ich zittere nicht, ich winde mich nicht vor ihm, wie es vermutlich all die anderen Menschen getan haben, die er getötet hat. Stattdessen erwidere ich seinen Blick, hebe die Hand – und ziehe mir die Maske vom Gesicht.
Noch nie zuvor habe ich eine solche Stille in der Oberwelt wahrgenommen wie in diesem Moment. Ich höre den Wind nicht mehr, nicht das überraschte Keckern meiner Verfolger, nicht einmal meinen eigenen Herzschlag. Ich fühle nichts als das kalte Glühen in den Augen dieser Wesen – und den unerschütterlichen Willen, im Moment meines Todes etwas anderes zu sehen als das.
Und dann, langsam und fließend, atme ich ein. Die Luft brennt in meiner Lunge. Kurz glaube ich, daran ersticken zu müssen, doch gleich darauf fließt die Hitze mit sanfter Gewalt in meine Glieder und betäubt jeden Schmerz.
Ein grausames Lächeln huscht über meine Lippen, und ich flüstere nur ein Wort: »Showtime.«
5
Sira
Ich springe vor und ziehe der vorderen Bestie mein Messer durch die Kehle. Krächzend taumelt sie zur Seite und bricht zusammen. Dunkles Blut spritzt auf den Asphalt.
Die Schreie der verbliebenen Echsen zerfetzen die Luft. Ich renne auf einen Schutthaufen zu, da trifft mich ein Tritt in den Rücken. Ich pralle gegen ein Trümmerstück, greife nach einem Mauerstein über meinem Kopf und ziehe mich gerade noch rechtzeitig hoch, bevor die Zähne der Angreifer mich zerreißen können.
Mit voller Wucht trete ich einem von ihnen ins Auge. Er weicht zurück, doch sein Begleiter setzt zum Sprung an. Ich lasse mich fallen und werfe mich zu Boden, und als er über mich hinwegsetzt, reiße ich das Messer hoch und schlitze ihm den Bauch auf. Warmes Blut trifft mein Gesicht, der schwere Körper schlägt hinter mir auf. Gleichzeitig stürzt sich der letzte Verfolger auf mich. Mein Tritt hat ihn auf der linken Seite blind gemacht, aber er ist immer noch verteufelt schnell. Knirschend schlagen seine Zähne neben meinem Kopf zusammen, seine Klaue gräbt sich in meine Schulter. Der Schmerz raubt mir den Atem. Blut läuft über meinen Arm, das Messer entgleitet meiner Hand. Wieder stößt das Untier den Kopf vor. Ich rolle mich zur Seite, aber sein Schädel streift meine Schläfe.
Der Schmerz explodiert in meinem Kopf. Halb betäubt weiche ich vor meinem Angreifer zurück und pralle rücklings gegen die Wand. Er springt vor, reißt sein Maul zum tödlichen Biss auf. Im selben Moment stoße ich mich von der Mauer ab, rutsche über das Blut seiner Gefährten auf ihn zu und trete ihm gegen das linke Knie. Ein entsetzliches Knacken erklingt, dicht gefolgt von einem markerschütternden Brüllen, als das Biest auf dem blutigen Boden das Gleichgewicht verliert. Es schlittert bis zur Wand und prallt dagegen. Keuchend packe ich die Feuerleiter – und ziehe sie mit aller Kraft herab. Mit einem Knirschen bohrt sie sich in die Brust des Untiers und zerschlägt sein Rückgrat.
Schwer atmend sehe ich meinen Feind an. Seine Lider flattern, und ich lasse seinen Blick erst los, als sein Körper erschlafft. Unzählige Menschen mögen durch ihn gestorben sein, aber das Letzte, was er in dieser Welt gesehen hat, ist mein Gesicht.
Schwankend stecke ich mein Messer weg. Die Wunde in meiner Schulter ist tief, und mein Kopf fühlt sich an, als würde er platzen. Ich zittere vor Erschöpfung, doch gleichzeitig rauscht wilder Triumph durch meinen Körper. Diese Angreifer waren nur niedere Kreaturen, das Fußvolk jener, in deren Auftrag sie töten sollten. Nichtsdestotrotz habe ich vier von ihnen besiegt.
So schnell ich kann, schnappe ich mir meine Maske und schleppe mich in die nächste Gasse. Noch einen Angriff dieser Art werde ich nicht überleben, das ist mir klar. Ich muss sofort zum Käfig zurück.
Gerade habe ich das Ende der Gasse erreicht, als ich etwas höre. Es ist mehr ein Vibrieren in der Luft als ein wirkliches Geräusch, und doch weicht mir das Blut aus dem Kopf. Von einem Moment auf den anderen ist jede Freude über meinen Sieg wie weggeblasen. Zum ersten Mal an diesem Tag verspüre ich Angst.
Meine Beine sind plötzlich so schwer, dass ich mich dazu zwingen muss, mich zu bewegen. Es ist hell, viel zu hell dort, wo ich stehe. Ich muss mir ein Versteck suchen. Jetzt.
Ich stoße mich von der Hauswand ab. Der Mauervorsprung auf der anderen Straßenseite liegt im Schatten, aber er ist so weit entfernt. Unendlich weit. Ich renne darauf zu, ich bekomme kaum noch Luft, meine Lunge ist viel zu klein. Ich glaube, todbringende Hitze im Nacken zu spüren. Das letzte Stück fliege ich fast und drücke mich dann so eng an die Mauer, dass der Stein mir ins Fleisch schneidet. Aber ich fühle es kaum. Alles, was ich deutlich wahrnehme, ist der riesige Schatten, der nun auf mich zugleitet.
Ich will ihm nicht mit meinem Blick folgen und tue es doch. Ich starre in den glühenden Himmel, hoch zu dem Wesen, das gewaltig wie der Tod mit fast lautlosem Schwingenschlag durch die Häuserschlucht fliegt.
Seine Haut ist schwarz wie Vulkangestein, und als es Atem holt, lodert das Feuer in seinem Inneren auf und überzieht seinen Körper mit grünen Flammen. Rauschend entzünden sie sich auf seinen Flügeln. Glutklumpen fallen auf die Stadt nieder und hinterlassen tiefe Krater im Asphalt.
Ich schütze meinen Kopf mit den Händen, wohl wissend, dass ich gegen diese Glut nichts ausrichten kann. Und während der Schrei dieses Wesens über die Häuserschluchten hereinbricht, schaue ich zu seinen Augen empor – diesen goldenen, in wildem Feuer entfachten Augen, die Fleisch und Stein durchdringen können und alle Weisheit und Grausamkeit der Welt in sich tragen.
Erst als die Kreatur aus meinem Blickfeld verschwunden ist, hole ich Luft. Direkt vor mir lodert ein Klumpen grüner Glut, doch er verströmt keine Hitze. Eis breitet sich von ihm aus. Ich schultere meinen Rucksack, dann meinen Bogen, und ohne mich noch einmal umzudrehen, laufe ich zwischen den Feuern die Straßehinab.
Zum Käfig, schießt es mir durch den Kopf. Zum Käfig, so schnell du kannst.
Und dann, während ich renne, leise und geduckt wie ein gejagtes Tier, denke ich an die Worte meines Onkels.
Die Ära der Menschen ist vorbei.
Noch einmal fühle ich den Luftzug unter den mächtigen Schwingen, höre wieder den Schrei, der jeden sterblichen Gedanken auslöschen kann, und sehe erneut diese Augen vor mir, deren Goldton jede Frage, jede Antwort, jedes Geheimnis der Welt in sich birgt.
Ja, denke ich und schaue hinauf zum brennenden Himmel. Dies ist die Ära der Drachen.
6
Sira
Die Enklave glüht im Schein der Flammen. Über den Feuertonnen braten Ratten. Dunst wabert aus den Kanalöffnungen, die zu den unteren Regionen der einstigen U-Bahn-Station führen, und die Rotoren der Turbinen wälzen träge die feuchtwarme Luft um. Schwach nur taucht die Notstrombeleuchtung auch die Baracken in rötliches Licht, und über allem liegt der Geruch von Rauch, Schweiß und Furcht. An keinem anderen Ort der Unterwelt ist er so konzentriert wie hier, in der größten Enklave der Menschen unter den Straßen New Yorks.
Ich stoße einen Kerl zurück, der mir vor die Füße taumelt, und setze meinen Weg fort. Normalerweise weichen die Menschen mir aus, aber das Herz der Station ist wie immer um diese Zeit gnadenlos überfüllt. Abends, wenn die Diebe von der Jagd kommen, verlassen die Leute ihre Hütten, schieben sich durch die engen Gassen und kaufen Dinge aus einer Welt, die sie noch nie mit eigenen Augen gesehen haben. Oder sie treiben sich das Opium der Schatten in die Venen, um von ihr zu träumen.
Überall neben den Baracken hocken reglose Gestalten, die Arme von Einstichstellen übersät, und stieren an die Decke der Station, die ihre Träume noch schneller zerstört hat als ihre Körper. Sie liegt näher an der tödlichen Oberfläche als all die anderen Refugien der Menschen, und trotzdem wächst sie noch immer. Gründe dafür gibt es viele. Manche Menschen haben immer schon hier gelebt und bleiben, weil sie nicht wissen, wohin sie sonst gehen sollen. Andere kommen, um Gebrauchsgegenstände aus der Oberwelt zu stehlen. Die meisten aber sind für das Gold der Drachen hier – wie ich.
Nirgendwo wachsen diese vielfarbigen Kristalle so zahlreich wie in den Ruinen von New York City. Verflüssigt als Droge missbraucht, halten sie, je nach Reinheit, in geschmiedeter Form selbst dem Feuer der Drachen stand und erzielen hohe Preise auf den Märkten der Unterwelt. So verschafft das Drachengold den Dieben – mit viel Glück –, wovon sie ein Leben lang geträumt haben.
Manche von ihnen gieren nach Macht. Andere wollen in einer der als sicherer geltenden, tief in der Erde liegenden Enklaven ein neues Leben beginnen. Wieder andere sehnen sich danach, das Gebiet jenseits der Großen Wüste zu erkunden, in der Hoffnung, dort etwas anderes zu finden als den ewig brennenden Himmel. Doch die Suche nach Drachengold ist gefährlich, und die meisten, die einmal gekommen sind, bleiben am Ende ganz hier … tot oder lebendig oder in einem elenden Zustand dazwischen.
Ein tiefes Grollen lässt mich die Hand auf mein Messer legen. Nicht weit von mir entfernt stehen die Drachen der Händler, die für den Nachtmarkt in die Station gekommen sind, der morgen Abend stattfinden wird. Alle paar Monate wird er an einem anderen Ort veranstaltet, ausgerufen immer erst wenige Stunden vorher von einem der Spinnenmänner – kampferfahrenen Wanderern, die die Oberwelt im Auge behalten, um die Enklaven vor Überfällen zu schützen.
Der Nachtmarkt ist der größte seiner Art und eine hervorragende Gelegenheit, um Geschäfte zu machen. Deshalb werden zu dieser Zeit selbst Drachen in der Station geduldet. Ich werfe ihnen einen kühlen Blick zu. Sie sind kaum größer als Mulis und bergen nur schwache Magie, und trotzdem starren sie mich mit der typischen Arroganz der Drachen an, als würden sie genau wissen, wer ich bin – eine Diebin wie so viele andere, getrieben von Wahnsinn und Gier.
Verächtlich wende ich mich ab. Ich habe ein anderes Ziel. Und ich bin kurz davor, es zu erreichen. Wenn alles gut geht, werde ich die Anwesenheit der Drachen auf dem Nachtmarkt nur dieses Mal noch ertragen müssen.
Meine Baracke liegt abseits der Wege im dunklen Teil eines Gleisbetts, errichtet aus Holz und Metall. Im Inneren ist sie gemütlicher, als man von außen vermuten würde. Ich ducke mich unter dem vorstehenden Dach und trete ein.
Leise lege ich Rucksack und Bogen auf der Pritsche neben der Tür ab und lasse den Blick prüfend durch den Raum gleiten. Die Wände sind mit Teppichen verkleidet, gedämpft dringen die Geräusche der Station zu mir. Durch die Regale und die Bilder an den Wänden wirkt der Raum fast wie ein Zimmer, wie es sie einst in den Wohnungen der Oberwelt gab. Ein Perlenvorhang verdeckt den Zugang zum hinteren Teil der Baracke, schwach erleuchtet vom Schein einer kleinen Deckenlampe.
Nur wenige Behausungen verfügen über elektrisches Licht, und selbst mancher Dieb muss sich zwischen Feuer und Finsternis entscheiden, weil er sich diesen Luxus nicht leisten kann. Mein Onkel aber war ein guter Dieb, und er hat es sich in unserer vorigen Enklave nicht nehmen lassen, das Licht in die Dunkelheit zu holen. Mit eigenen Händen hat er dort unsere Baracke errichtet, und als Andor und ich nach dem großen Brand in unsere jetzige Enklave fliehen mussten, habe ich es ihm nachgemacht.
Onkel Kane hat mir früh beigebracht, nach Blutwürmern Ausschau zu halten, die manchmal aus dem feuchten Boden in die Baracken kriechen und schwere Krankheiten auslösen können. Ich habe ihre schuppigen Körper schon oft zwischen den Holzscheiten beim Ofen scharren hören, aber jetzt bleibt alles still.
Beruhigt gehe ich auf den Perlenvorhang zu – und stolpere über etwas. Im letzten Moment fange ich mich und lande neben einem komplizierten Konstrukt aus transparenten Drähten und metallenen Haken.
Der Perlenvorhang gleitet beiseite, und ich schaue in das Puppengesicht einer Frau mit leuchtend roten Haaren, die drohend eine Pfanne in der Hand hält. Sie trägt einen von meinen ausgeleierten Pullis – und stößt die Luft aus, als sie mich erkennt.
»Du bist es«, sagt sie erleichtert und lässt die Pfanne sinken. »Du hast mich zu Tode erschreckt!«
Ich verziehe das Gesicht. »Tolle Begrüßung. Erst stolpere ich über eine Rattenfalle, und dann springt eine wild gewordene Kim ins Zimmer, um … Ja, was eigentlich? Wolltest du mich erschlagen oder mir was zu essen braten?«
Kim stellt die Pfanne beiseite. »Bin ich froh, dass du es bist. Ich dachte wirklich, ich müsste jemanden ausschalten.«
»Und das wolltest du mit der alten Pfanne erledigen?« Ich grinse. »Aber Andors Falle ist ziemlich effektiv.«
Kim betrachtet die Konstruktion mit einem Lächeln. »Ja, gegen die Ratten der Unterwelt sind wir gewappnet. Dein Bruder hat heute drei Fallen für Gavin gebaut, zwei wurden schon abgeholt. Jetzt werkelt er gerade an der vierten herum. Davor hat er an neuen Bildern gemalt. Ich habe mit allen Tricks versucht, ihn zum Schlafen zu bringen, aber er sagte, er würde sich im Schlaf schrecklich langweilen, also was sollte ich tun? Er ist eben genauso stur wie du.«
Ich seufze. In der Tat hat mein kleiner Bruder einen Dickschädel, der fast so hart ist wie der Stein, der unsere Enklave umgibt. »Und sein Fieber ist nicht zurückgekehrt?«
Kim schüttelt den Kopf. »Was auch immer das wieder für ein Virus war, er scheint ihn überwunden zu haben. Aber er hat mir von dem Albtraum erzählt, den er letzte Nacht hatte. Dass du nicht wiedergekommen bist und er ganz allein war.«
Ich reibe mir die Augen. »Sein üblicher Albtraum. Er hat ihn letzte Nacht immer wieder geträumt und ist schreiend aufgewacht. Deswegen bin ich heute früh noch bei ihm geblieben. Um ihm wenigstens ein bisschen Sicherheit zu geben.«
»Du gibst ihm viel mehr als nur ein bisschen Sicherheit«, sagt Kim sanft. »Und er ist so stolz auf dich. Heute hat er mir wieder erzählt, wie furchtlos du dich immer ins Licht wagst. Du bist seine Heldin.«
Ich muss lächeln. »Und er ist mein Held. Ich weiß nicht, ob ich an seiner Stelle all seine Krankheiten durchgestanden hätte, ohne die Hoffnung zu verlieren. Danke, dass du auf ihn aufgepasst hast.«
Ich greife in meinen Rucksack und gebe ihr eine kleine silberne Dose. Kim stößt ein verzücktes Lachen aus, als sie den Deckel öffnet.
»Puder«, flüstert sie. »Ich habe seit Ewigkeiten keins mehr gehabt! Meine Kunden lieben es. Es verleiht mir eine kühle Aura, hat mir mal einer gesagt.«
Sie vollführt eine theatralische Geste, die mich zum Lachen bringt. Aber als Kim den Pulli auszieht, wird sie wieder ernst. Darunter trägt sie ein bauchfreies Shirt, das mehr zeigt als verhüllt, und einen Rock, der ebenso gut ein Gürtel sein könnte. Als sie sich auf den Schemel vor dem Spiegel setzt, bemerke ich die blauen Flecken an ihrem Hals, groß wie Hände, die sich zu fest um ihre Kehle geschlossen haben.
»Du solltest auch lernen, Fallen zu bauen«, sage ich und schaue zu, wie Kim sich die Lippen nachzieht. »Oder komm mit in die Oberwelt und nimm dir als Diebin, was dir gefällt. Schlimmer als hier unten kann es nicht werden.«
Kim wirft mir einen spöttischen Blick zu. »Für dich vielleicht nicht … obwohl ich da meine Zweifel habe, wenn ich mir deine Schulter ansehe. Aber ich habe kein Talent fürs Fallenbauen, und ich bin nicht so mutig wie du. Du weißt doch: Ich fürchte mich vor allem. Und Männer sind nicht so schlimm wie die Drachen dort oben.« Sie hält kurz inne. »Jedenfalls die meisten nicht.«
Für einen winzigen Moment verliert sich ihr Lächeln. Der rote Lippenstift leuchtet in ihrem Gesicht wie ein Schrei, und ich muss daran denken, was Kim mir einmal über ihre Arbeit erzählt hat. Ich lasse mich bezahlen für das, was die Männer mit mir tun, und warum auch nicht? Sie tun es doch sowieso.
Ich hole tief Luft, um der Hilflosigkeit in mir keinen Raum zu geben. »Du kannst jederzeit hier schlafen, wenn du willst.« Ich weiß, dass Kim die Dunkelheit und alles, was in ihr lauert, fürchtet, und kurz glaube ich, dass sie nicken wird. Aber dann sieht sie mich an, und ihre Augen sind die einer alten Frau.
»Ich komme zurecht«, sagt sie mit diesem Lächeln, das wie eine Maske ist, und ich nicke kaum merklich. Kim mag sich zu schwach fühlen, um den Drachen zu begegnen, aber sie ist genauso eine Kämpferin wie ich. Sie hat gelernt, zu überleben, und sie hält sich an ihren Masken fest, weil sie manchmal das Einzige sind, was Halt geben kann. Vielleicht verstehe ich mich auch deshalb so gut mit ihr. Weil ich genauso bin.
Kim öffnet die Tür, und als das Licht der Station auf ihr Gesicht trifft, ist es vollständig zurück, das liebliche Puppengesicht, das alles hinter sich verbirgt. Noch einmal lächelt sie mir zu. Dann fällt die Tür hinter ihr ins Schloss.
7
Sira
»Seid ihr endlich fertig mit euren Frauengesprächen?«
Andor steht mit zerzausten Haaren hinter dem Perlenvorhang und grinst, als ich die Augen verdrehe.
»Was bitte weiß ein zehnjähriger Junge über Frauengespräche?«, frage ich zurück.
Er hebt die Brauen, wie immer, wenn ich eine für ihn völlig absurde Frage stelle, und schiebt selbstsicher das Kinn vor. »Genug, um sie nicht zu stören. Ich dachte …« Er verstummt, da sein Blick auf meine Wunde fällt. Die Schnüre des Vorhangs tanzen aufgeregt durcheinander, als er zu mir läuft. »Was ist passiert?«
Wie immer würde ich ihm die Wahrheit gern ersparen, und wie immer weiß ich, dass er eine Lüge nicht akzeptieren würde. Also erzähle ich ihm so knapp wie möglich von meinem Kampf mit den drei niederen Drachen. Andor hört mit der ihm eigenen stillen Aufmerksamkeit zu, die seine Augen noch eine Spur dunkler färbt. Am Ende holt er tief Luft. »Du hast ohne Maske gegen sie gekämpft. Hat es jemand gesehen?«
Ich muss lächeln. So oft habe ich ihm eingeschärft, dass niemand von meiner Fähigkeit, an der Oberfläche zu atmen, erfahren darf, dass er bei dieser Frage beinahe meinen strengen Tonfall bekommen hat. Ich schüttele den Kopf. »Es war niemand in der Nähe.«