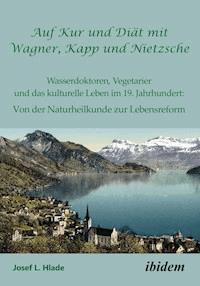
16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ibidem
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Es war Mitte September 1851, als Wagner die erste von seinen zahlreichen ‚Kaltwasser-Kuren´ antrat. Von da an war er begeisterter ‚Wasserfreund´, der täglich verschiedene Wasseranwendungen praktizierte und auch auf eine strenge Diät achtete. Wasserfreund blieb er sein Leben lang. Als Wagner seine Ideen für eine mögliche Regeneration präsentierte, zeigte er sich schließlich auch als Anhänger des Vegetarismus, der sich in Deutschland aus der Wasserkur heraus entwickelte. Es ist anzunehmen, dass Wagner sich bei dieser Idee zur Erneuerung an Konzepten der Lebensreform orientierte, in deren Zentrum Wasserheilkunde und Vegetarismus standen. Es kann sogar behauptet werden, dass Wagners sogenannte ‚Kunstreligion´ in ungeahnter Weise von naturheilkundlichen bzw. vegetarischen Ideen beeinflusst wurde. In diesem Sinne verglich bereits Friedrich Nietzsche das Erlösungskonzept der Lebensreformer mit dem von Wagner. Josef Hlade lädt den Leser dazu ein, ihm in die faszinierende Welt des 19. Jahrhunderts und seiner immer noch aktuellen Themen zu folgen. Begleiten wir Wagner beim Versuch, ein „Naturmensch" zu werden, und gehen wir mit Nietzsche auf „Gesundheitsjagd" - und lernen Ernst Kapps amerikanische Kolonie Sisterdale kennen, die zeigt, dass Ideale der Wasserheilkunde mit Ideen des utopischen Sozialismus Hand in Hand gingen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
ibidem-Verlag, Stuttgart
Inhaltsverzeichnis
Einführung
„Ihm war das Wasser mehr als das Mittel, womit man schmutzige Haut und schmutzige Eingeweide reinigt und stärkt; er suchte und fand im Wasser eine alle gesellige Verhältnisse reinigende und verklärende Macht. Er fasste die Hydropathie vom Standpunkt der sozialen Frage auf, noch ehe diese Tagesfrage war.“[1]
Ernst Kapp über J. H. Rausse
Die Badekur ist schon sehr alt. Bereits in der Antike gab es öffentliche Badeanstalten und auchschon Hippokrates trat für die Anwendung von kaltem Wasser ein. Das war das die Hydrotherapie(oder auch Hydropathie)gegenüber anderen Kurverfahren Auszeichnende. Um die AnwendungenderKaltwasser-Kurwird es hier primär gehen. Die Pioniere der deutschen Hydrotherapie hießenSiegmund (1664-1742)undJohann Siegmund Hahn (1696-1773), deren Popularisator war allerdings erstVincenz Prießnitz (1799-1851). Auf dessen Wasserkur baute schließlich auchJ. H. Rausse (1805-1848)auf, der den geistigen Überbau schuf und das naturwissenschaftliche Fundament zu legen versuchte. Nach seinen Verordnungen gingen später Wagner und Nietzsche auf Kur.Ernst Kapp warmit ihm noch persönlich bekanntund wurde schließlich sein Biograph; außerdem war er selbst als Hydrotherapeut tätig.
Eine Wasserkur nach den Prinzipien von Rausse bestand einerseits aus Wasseranwendungenwie kalten Bädern, Duschen mit kaltem Wasser oder Übergießungen und sogenannten Halb-Bädern. Außerdem standen das Wassertrinken und andereFormen des inneren und äußeren Genusses des Wassers am Programm. Ferner gab es ergänzende Verfahren wie „Schwitzkuren“ oder „Packungen“. Was weiterhin als wichtig galt, war viel Bewegung, etwa in Form des Wanderns. Seit Beginn war aber auch eine gewisse Diät, die man strikt einhalten musste, Teil einer solchen Kur.
Beenden wir unsere Schilderung des Wesens einer Wasserkur und kommen wir direkt zur Beschreibung des Innovativen dieser Untersuchung. Es soll hier also um die Rolle der sogenannten Hydrotherapie, aberauch um die Frage der Ernährungam Beispiel des Vegetarismus im 19. Jahrhundert gehen. Namentlich um die kulturellen Implikationen der beiden Formen der Naturheilkunde, wie man die Hydrotherapie später nannte, und zu deren festem Bestandteil der Vegetarismusin der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde.
Zur Erweiterung der Hydrotherapie zum Vegetarismus trug maßgeblich der Rausse-Schüler und NachfolgerTheodor Hahn (1824-1883)bei. Er lebte abMitte der 1850er Jahre streng vegetarisch und machte die vegetarische Ernährung zu einem Teil der „naturgemäßen Lebensweise“, welche dieAnhänger der Naturheilkunde zur Lebensdoktrin erhoben.
Dass die Ernährung im 19. Jahrhundert einen wichtigen kulturellen Faktor darstellte,scheint einigermaßen bekannt.[2]Es gibt zum Beispiel einige interessante Arbeiten von Michel Onfray, die die Ernährung als kulturellen Faktorschildern.[3]Dabei beginnen Onfrays Darstellungen bereits deutlich vor dem 19. Jahrhundert. Namentlich widmet der Autor bereits der AntikeTeileseiner Werke.[4]Anders alsvielevon Onfrays Protagonisten, waren die Proponenten der hier vorgestellten Strömungenabereher Asketen. Genuss entstand bei ihnen durchEnthaltsamkeit.
Der Vegetarismus-DoyenTheodor Hahn äußerte hierzu: „Das Zauberwort dieser Erlösung aber, es heißt: Entsagung und Selbstzucht.“[5]Gemeintwarendamit eine fleischlose Ernährung und der Verzicht auf Rausch und Genussmittel.Hahn verstand seinen Vegetarismus als eine Voraussetzung fürdieWiederkehr des Guten. Der Einfluss von Rauschmitteln, aber auch ein grausamer Umgang mit Tieren zerstöre das menschliche Gewissen.Bereits die Vertreter der Wasserheilkunde,aber auch jene des Vegetarismus, der in Deutschland aus der Wasserheilkunde entstand, wollten die soziale Frage durch ihre Verordnungen lösen.
Auf die Enthaltsamkeit und das Maßhalten inFragen der Ernährungals wichtigenTeil der Beschäftigung des speisenden Menschen im 19. Jahrhundert,wird in diesem Zusammenhang noch recht wenig Augenmerk gelegt.
Interessant scheint hier, dass auch der Protagonistmehrerer Werkevon Onfray[6]–Friedrich Nietzsche–ganz spezielle Gründe hatte, warum ervehementfür das Maßhalten und den Verzicht gewisser Nahrungs-und Genussmittel eintrat,nämlich eine an naturheilkundlichen Vorschriften orientierte Diät, die er einhalten wollte.Allerdings machte er naturheilkundliche Kuren ohne vegetarische Ernährung, die es zu dieser Zeit auch noch immer gab. Denn nicht alle Naturheiler folgten TheodorHahns Erweiterung zum Vegetarismus.
In diesem Sinne erscheint Nietzsche keinesfalls inkonsequent, wenn er gegen die deutsche Küche ankämpfte, aber gleichzeitig Beefsteaks und Lachsschinken gegessen habe.Es ging ihm nicht um diefette und schwere Küche der Deutschen, sondern darum, dass siegrundsätzlich eine falsche Diät darstelle.[7]Fernersei Nietzschenach Onfrayaber grundsätzlichdocheinAsketgewesen,obwohler theoretisch den Rauschgepredigthabe.Hierzu ist zu sagen, dass der „Rausch“ bei Nietzsche keinesfalls durch Nahrungsmittel eintreten sollte, sondern eher durch Taten, deren Voraussetzung eine nüchterne Lebensweise sei.Bei ihm war der Genuss also gar nicht sosehr vom Essen abhängig, wie man gemeinhin annimmt.
In deutscher Sprache hat sich mit Nietzsches „Gastrosophie“ in neuerer Zeit Harald Lemke beschäftigt, der Nietzschein diesem SinnealsGenuss-Philosophendarstellt.Lemke spricht bei Nietzsche von der „Gastrosophie des guten Geschmacks und der Lebenskunst einer fröhlichen Alltagsküche“sowie voneiner „gedachten Ästhetik der Existenz“ in Essensfragen.[8]Seine ernährungstechnisch asketische Zeit hätte er zwar selbst nie überwunden,trotzdem aber die „traditionelle Diätmoral“ schärfstens kritisiertund zumindest theoretisch an einer „neuen Moral des Essens“ gearbeitet.[9]
Tatsächlich trat Nietzsche mit seiner Kritik gegen die „Diätmoral“in erster Linie aber nichtfür den „Genuss“ ein, sondern forderte eine bewusste Enthaltsamkeit gewisser Nahrungsmittel, die den Deutschen im Allgemeinen träge gemacht hätten. So meint er,der Gesunde habe klares Wasser alkoholischen Getränken vorzuziehen, das gleiche galt ihm in Bezug auf das Rauchen.Gerade jemand, der intellektuell etwas leisten möchte, müsse eine vernünftige Diät befolgen und auf gewisse Dinge verzichten.Anders als Harald Lemke behauptet[10], scheint Nietzsche gerade den Alkoholkonsum zumindest theoretisch grundsätzlich abgelehnt zu haben, wobei ihm die fetten und schweren Speisen, die Onfray als Grund für Nietzsches Ablehnung der deutschen Küche anführt[11], nicht als schlimmstes Übel galten.
Auf das Wasser als Getränk kam er wohl während seiner vielen „Kaltwasser-Kuren“, während dererer,um seine Gesundheit wiederherzustellen,nicht nur große Mengen an Quellwasser trinken musste, sondern auch darin badete, sich damitübergossoder seine Körperöffnungen ausspülte.[12]Außerdem stand seit damals eine spezielle Ernährung am Programm, die Nietzsche mitleichtenÄnderungen bis zuletzt fortführte und die er auch inseinen Werken empfehlen wird. Hierzu zählte auch der Verzicht auf sogenannte „Gifte“ wie Alkohol oder Tabak.Das Essen von Beefsteaks hatte ihm ein Kurarzt empfohlen;wiederFleisch zu essen und kalte Bäder zu nehmen,aber der spätere Vegetarismus-BefürworterWagner. In diesem Sinne riet der aktive Anhänger der Hydrotherapie Nietzsche Mitte der 1870er Jahre: „Baden sie auch! Essen sie Fleisch!“[13]
Auch über die Ernährung als medizinisches Heilmittel scheint es ausreichend Literatur zu geben.[14]Gerade dieses Gebiet scheint einigermaßen aufgearbeitet, wobei man aber vielleicht die Ideen dieser medizinisch gedachten Ernährungslehren gerade auf ihre kulturellen Ziele zu untersuchen vergessen hat. Denn oft war nicht nur die Gesundheit vordergründiges Ziel, sondern auch ein gesellschaftlicher Wandel, der auf der Grundlage der Ernährung stattfinden sollte. Diese Idee verfolgte im 19. Jahrhundert zumindest die Naturheilkunde bzw. später der Vegetarismus.Auf die Spezialliteratur zu Ernährungsidealen der Naturheilkunde bzw. des Vegetarismus wird in dieser Untersuchung noch hinreichend verwiesen werden.
Viel mehr alsumeine Darstellung der Naturheilkunde bzw. des Vegetarismus als medizinische Richtung–unter welche die meisten der rezenten Werke über diese Thematik zu zählen sind–geht es hier um die soziale Implikation dieser Strömung, die zumindest seit Rausse genuin in der Lehre verankert war. Es ging nicht um die Heilung eines einzelnen Kranken, sondern um die Erneuerung der Gesellschaft auf der Grundlage derWasserheilkundebzw.des Vegetarismus.Insofern war die Naturheilkunde von Rausse tatsächlich bereits eine Lebensreform.
Dass die Ernährung gerade im 19. Jahrhundert für die Moral verantwortlich gemacht wird, scheintaufgrund der medizinischen Sichtweise der meisten Darstellungennur wenig untersucht.Zwar erkennenmanche, meist aus einer anderen Richtung kommendeForscher, darunter sicherlich auch etwa Onfray,einen klaren Zusammenhang zwischen Ernährung und Moral, dass die Ernährung aber gerade zum entscheidenden Faktor für die Moral werden sollte, zeichnete etwa speziell den Vegetarismus aus.
Die Debatte, ob der Vegetarismus tatsächlich als entscheidender Faktor für die Moral tauge, war etwa ein Streitthema zwischen Richard Wagner und Friedrich Nietzsche im Jahr 1869.Wagner verneinte diese These, die Nietzsche damals zumindest in den Raum stellte, nachdem er eine ähnliche Auffassung über die „Wasserheilkunde“ nur wenige Jahre zuvor nach für ihn persönlich enttäuschenden Ergebnissen aufgeben musste. Damals galt ihm die „Wasserheilkunde“ als „Religion“, wie er selber im Rückblick schreiben wird. 1879 kam es allerdings zueinem Wandel in Wagners Denken: Nun galt ihm der Vegetarismus als eine der allerwichtigsten Maßnahmen einer von ihm ins Auge gefassten Erneuerung der Gesellschaft.Wir kommen bald darauf zurück.
Noch weniger Literaturals zu den kulturellen Auswirkungen des Vegetarismusfindet man über die Auswirkungen der „Wasserheilkunde“ auf das kulturelle Leben im 19. Jahrhundert.[15]Wenig bekannt dürfteesauch sein, dass sowohl „Wasserheilkunde“ als auch der „Vegetarismus“ aus der gleichen Wurzel entsprungen sind undbereits dieProponentender „Wasserheilkunde“durch sie entscheidend auf die Moral wirken wollten.
Dass so mancher ihnen glaubte–darunterderbereits genannteKomponist Richard Wagner,des Weiterender Begründer der Technikphilosophie Ernst Kapp und derhier ebenfalls bereits erwähntePhilosoph Friedrich Nietzsche–soll die folgende Untersuchung zeigen.Die Beziehung von allen dreien zurWasserheilkunde unddemVegetarismus ist bis jetzt kaum behandelt worden.[16]Der Einfluss von Wasserheilkunde und Vegetarismus war aber auf alle drei dermaßen stark, dass die Aufarbeitung dieser Zusammenhänge durchaus gerechtfertigtscheint, wie die folgenden Seiten dieser Untersuchung zeigensollen.
Sie bezieht sich noch auf die Zeit vor der sogenannten „Lebensreform“, die um 1900 einsetzte und diese Ideen auf einem relativ breiten Feld durchsetzte.Ihre Ideen wirken auch heute noch nach, wenn es nicht sogar heute noch eine „Lebensreform“ gibt.[17]Sie zeigt, dass ähnliche Diskurse bereits Anfang des 19. Jahrhunderts existierten und keine zu unterschätzende Rolle spielten. Gerade in dieser Zeit sinddie Ursprünge der„Lebensreform“zu suchenund gerade hier vorgestellte Anhänger von „Wasserheilkunde“ und „Vegetarismus“ werden zu wichtigen Verbreitern der späteren Ideen. In dieser Arbeit werden uns hierfür exemplarischder KomponistWagner und die beidenPhilosophenNietzsche und Kapp als Beispiel dienen.
Dieum 1900 entstandene Bewegung der „Lebensreform“–die sich sowohl für den Vegetarismus aussprach, aber auch „Wasseranwendungen“ und andere „Naturheilverfahren“ ins Zentrum ihres Strebens nach einem „naturgemäßen Leben“rückte–hattedabeiwohl ihrenbedeutendstenVorläufer in J. H. Rausse.Er war es, der diemeisten ihrer Ideale bereits im Vormärz vertrat.Um seine „Wasserheilkunde“ bzw. „Naturheilkunde“ und die von seinem Schüler Theodor Hahn vollzogene Erweiterung zum Vegetarismus und deren Rezeption wird es hier primär gehen.
Die „Lebensreformer“gingensubstanzielldavon aus, dass eine sogenannte „Selbstreform“ am Anfang jeder Erneuerung zu stehen habe, die sie sichletztlichauch für die Gesellschaft wünschten.Es ging dabei um eine Versöhnung mit der Natur, aus der man die Mittel zur Erneuerung entnehmen müsse. Oft bedeutete dasauch eine physische Rückkehr in die Natur und eine Flucht vor dem als verwerflich empfundenen städtischen Leben.Vielfach entstand der Wunsch,sichgegen denEinfluss des modernenLebens abzuschotten. So gab es Versuche,autarke Gemeinschaften zu gründen, die ein Gegenmodell zur anderen Lebenswelt werden sollten.
Dabei hatten die einzelnen „Lebensreformer“ ganz verschiedene Ideen, was man unter dieser „Selbstreform“ und den anderen Mitteln, die zurVerbesserung der Menschheit dienen sollten, zu verstehen habe. Viele glaubten weiterhin, wie Rausse, die Sorge für Gesundheit habe am Anfang zu stehen, andere fanden neue Mittel. So zählt man auch etwa die Strömung der „Reformpädagogik“ zur „Lebensreform“. Wenn man auch Richard Wagner, wie ich vermute,in gewisser Weise zu den „Lebensreformern“ zählenkann, dann galt für ihn wohl die Kunst alszentralesMittelderErneuerung.
Wie sich in dieserUntersuchungzeigen wird,war Wagner auf die Idee,mit seiner Kunst auch eine Missionzu verbinden, offenbardurch die Bekanntschaft mit Rausse gekommen:So war es während seinerKaltwasser-Kurin Albisbrunn, da in ihm, gleichzeitig mit der Idee des„Rings“selbst, auch die Idee erwachte, mit seiner Musik einen ähnlichen Beitrag für die Menschheit leisten zu können.Wagner fing wohl erst jetzt, entscheidend durch Rausses Konzeption bestärkt, zu glauben an, seine Kunst könne in ganz ähnlicher Weise zu einer Reform beitragen.
In seinen letzten Jahren dachte Wagner, auch hierwiederumentscheidend durchKonzepte wie jenesvon Rausse bestärkt, an eine„Regeneration“und wollte Schopenhauers„absoluten Pessimismus“, den er zwischenzeitlich verinnerlicht hatte,durch eine vorsichtig optimistische Weltsicht ersetzten, die erwiederumim Denken der Naturheilerbzw. Vegetarierfand.Der sogenannte „Tiermord“ stünde am Anfang der Entstehung des Bösen und nur ein Verzicht auf Fleisch und Drogen könne die Wiederkehr des Guten ermöglichen.Der Vegetarismus habe einen entscheidenden Beitrag zur Erneuerung der Gesellschaft zu leisten und sei für die von ihm ins Auge gefasste Reform mindestens genauso wichtig wie seine neue Art der Kunst.Jetzt ersetzte das Ideal des Vegetarismus jenes der Wasserheilkunde;der Ansatz blieb aber derselbe.Nunwarfür ihn ein Leben nach den Prinzipien des VegetarismuseineVoraussetzung der„Regeneration“, zu der aber auch seine Kunst entscheidend beitragen könne.
Rausse,Wagners„Wasserprophet“ in den 1850er Jahren,hatte die ungewöhnliche Idee, durch eine an sich nicht dafür vorgesehene Sache wie seine „Wasseranwendungen“ die Menschheit reformieren zu wollen.Eine Kur sollte einem eine ganz neue Welt eröffnen. Der Weg zur Bekehrungsolltenicht über den Intellekt stattfinden, sondern über eine tiefergehende Reinigung, auf diediemoralische Umkehr erst folge.
Gerade dadurch könnte auch Wagner auf die–grundsätzlich ebenso überraschende–Idee gekommen sein, mit der Kunst zu einem gesellschaftlichen Wandel beitragen zu wollen. Eswarnicht mehr abwegig,durch ansich ungewöhnliche Mittel den ersten Schrittvorzubereiten, den das Naheliegende nicht zu schaffen schien. Vielleicht wollte er das Publikum bereits davor mit seinen Werken belehren, wie etwaSchiller es der Kunst einräumte. Zur Erlösungslehre wurde seine Kunstvermutlicherst nach der Rezeption von Rausse und seiner Theorie.
Dabeimüsseder Wandeloffenbargar nicht so sehr durch moralische Einsichten, die man aus der Kunst gewinne vonstattengehen, sondernvielmehrdurchdie Kunst alsein therapeutisches Verfahren,das tiefer greife.Wagner wollte mit seiner Musik in gewisser Weise bis in die „Eingeweide“ wirken.Die moralischen Einsichten waren dannallem Anschein nachals Folge dieser grundsätzlichen Reform durch die Kunst gedacht.
In diesem Sinne war Wagner ein „Lebensreformer“,der wie viele andere vonJ. H. Rausses mit der Wasserheilkunde verbundenen Idee inspiriert wurde,mit seinem Metier das gleiche erreichen zu wollen, wasdiesefür die Menschheit versprach.In den 1880er Jahren, als Wagner sich neuerlichdem„lebensreformerischen“ Gedankengut annäherte, war die Wasserheilkundebei vielen Gläubigenbereits vom Vegetarismus als Träger der Idee abgelöst worden;das Ziel blieb aber das Gleiche: Eine Erneuerung auf der Grundlage einer Selbstreform.
BereitsJ. H. Rausseschuf den geistigen Überbau dieser später auf eine Erneuerung fokussierten „Fluchtbewegung“. Schon er wollte auf der Grundlage der Philosophie vonJean-JacquesRousseau(1712-1778)jene Wiedergeburt der Menschheit erreichen,von der auch die „Lebensreformer“ noch träumten. Bei ihm standen noch die sogenannten „Wasseranwendungen“ im Mittelpunkt. Später rückte sein Nachfolger Theodor Hahn den Vegetarismus ins Zentrum.
Sowohl die Hydrotherapieals auch der Vegetarismusbildeten bis in die Zeit der „Lebensreform“ den „Kernbereich“ der Bewegung, was in großen Teilen auf Rausse undHahnzurückging. Andererseits halfen Persönlichkeiten bei derVerbreitung der Ideen: Hierfürsteht etwa ganzprominentRichard Wagner, in den 1850er „radikaler Wasserfreund“, bis zuletzt gemäßigterWasseranwenderund in seinen letzten Jahren auch Befürworter des Vegetarismus.
Wagner blieb dabei nicht nur jemand, der selbst regelmäßig kalte Bäder nahm, sondern verband die mögliche Erneuerung der Gesellschaft mit einer vegetarischen Lebensweise, die einen moralischen Neubeginn überhaupt erst möglich mache. Seine Ideen blieben nicht ungehört: Viele Wagnerianer wurden aufgrund der von ihm geäußerten Empfehlung einer vegetarischen Lebensweise, die etwaden Alkoholverzicht und auchden Verzicht auf Tabak einschloss, zu Vegetariern, Alkohol-Abstinenten und Nichtrauchern. In gleicher Weise kam es vielerorts durch Wagnerianer zur Gründung von „Naturheilvereinen“,in denen man kalte Bäder und andere Wasseranwendungen durchführte.Wagner wurde damit schließlich auch zu einem Vorläufer, wenn nicht sogar wichtigen „Propheten“ der Lebensreform.
Einer,der von den Wagnerianern zudenIdeen der Naturheilkunde und Vegetarismus bekehrt wurde, war der SchriftstellerPeter Rosegger(1843-1918). Viele Ideen desAutorsscheinen auf diese Bekanntschaft zurückzugehen. Auch Rosegger war jemand, der sich für den Tierschutz einsetzte, den Vegetarismus befürwortete, eine Mäßigkeitspflege im Umgang mit Alkohol empfahl, Quellwasser trank und nicht zuletzt eine ganz ähnliche Einstellung zum Natürlichen pflegte.
Friedrich Nietzsche lebte 1869 vorübergehend vegetarisch, wurde aber nach kurzer Zeit, wie bereits erwähnt,gerade von Richard Wagnerselbstvom Vegetarismus abgebracht. Damals war Wagner nämlich noch ein Vegetarismus-Gegner, der Nietzsche durch eine zornige Ansprache den Vegetarismus ausredete.Als Nietzsche erste Krankheitssymptome seines Syphilis-Leidens zeigte, empfahl er ihm allerdings kalte Bäder, die bei seinem„nervösen Leiden“Wunder gewirkt hätten. Später schickte WagnerNietzsche auch nochauf Kur, wobei gerade ein gewisser Zusammenhang zwischen Wagners „Wasserfreundschaft“ und dem Bruch mit Nietzsche bestand, wie sich zeigen wird. Nichtsdestotrotz machte Nietzsche die Kur und sammelte dort so glückliche Erfahrungen, dass er selbst noch in seinen letzten Schriften davon schwärmt.
Im Gegensatz zu Wasseranwendungen, die er lange gemeinsam mit einer naturheilkundlichen Diät gegen sein Leiden anwendet, verachtet Nietzsche allerdings den Vegetarismus. In seiner Abrechnung mit Wagner–„Der Fall Wagner“ (1888)–kommt es auch zur Abrechnung mit dem Vegetarismus, den Wagner nun in sein Konzept für eine mögliche Erneuerung der Menschheit aufgenommen hatte.Wasseranwendungen und eine Lebensweise, wie er sie während seiner vielen„Kaltwasser-Kuren“ kennenlernte, lobt er dagegen ausdrücklich in seiner erst posthum erschienen Autobiographie „Ecce homo“. Dort wird er namentlich auch eine„natürlicheLebensweise“seinem früheren Gelehrten-Dasein als Ideal entgegenstellen und gleichzeitig mit dem Stubenhockertum abrechnen.
Die Naturheilkunde versuchte mit ihren Methoden,ganz ähnliche Krankheitssymptome zu kurieren, wie man sie ab den 1880er Jahrenunter dem Begriff„Neurasthenie“versammelte. Wagner versuchte schon in den 1850er Jahren,seine „Nervosität“ durch „Wasseranwendungen“ zu heilen. Nietzsche glaubte in seinen letzten Lebensjahren,an„Neurasthenie“erkrankt zu sein,und versuchte,die aus dieser Krankheit entstandenen Symptome ebenfalls durch naturheilkundliche Methoden zu behandeln.
Dabei stellten Naturheiler wie J. H. Rausse bereits Anfang des 19. Jahrhunderts einen sehr bedenklichen Einfluss des städtischen Lebens und der modernen Lebensweise auf den Organismus fest, viele Jahre vor dem Aufkommen des „nervösen Zeitalters“.In diesem Sinne übte die Naturheilkunde auch eine frühe Kritik an der Moderne, die von Seiten der Psychiater erst um 1900 in großem Umfang einsetzte und sich in der Diagnose „Neurasthenie“ niederschlug.[18]
Ernst Kapp war aber wohl der radikalste Anhänger von den dreien: Er gründete in Texas eine „Freidenker-Kolonie“, wobei auch die „hydropathische Idee“ von Rausse zur Umsetzung kam.In diesem Sinne ordinierte Kapp in „Sisterdale“, so hieß die Kolonie, auch als Hydrotherapeut und genoss in ganz Texas einen guten Ruf als Wasserarzt.Noch in Deutschland hielt er über Rausse und seine „Wasserheilkunde“ fest: „Er fasste die Hydrotherapie vom Standpunkt der sozialen Frage auf, noch ehe diese Tagesfrage war.“[19]
Erst politische Umstände–Kapp und seine Kolonie kämpften an der Seite der Unionsstaaten gegen den „Sklaven-Staat“ Texas–beendeten das Projekt, allerdings ohne die Wirkung des in viele Richtungen weisenden Engagements der Kolonie aufhalten zu können. Kapp kehrte nach Deutschland zurück und schrieb dort seine heute noch bedeutende Schrift „Grundlinien einer Philosophieder Technik“(1877).Inaller Eilehatte er bald nach dem Tod von Raussedie einzige uns erhalteneBiographieüber ihngeschrieben. DasVorwortdazuverfassteer bereitsauf demSchiff,mit demer nach Amerika unterwegs war, weil ihn das politische Engagement zur Auswanderung zwang.
Schonimersten Abschnitt befasst sich dievorliegende Untersuchungganz zentralmit der „Hydrotherapie“ bzw. „Naturheilkunde“ in der Tradition von J. H. Rausse. Rausse warwohlderjenige, der die Philosophie von Jean-Jacques Rousseau in die Naturheilkunde einbrachte,und damit letztlich auch den Weg für eine ähnlich ausgerichtete „Lebensreform“ freimachte. Dabei orientierte sich Rausse, der eigentlich Francke hieß, aber seinem Idol auch durch eine Namensänderung näher kommen wollte, an Rousseaus zentralen Rat imEmile: „Lebe naturgemäß, sei geduldig und lasse dich nicht mit Ärzten ein.“[20]
Rousseau empfahl selbst,mehr oder weniger ausdrücklich,eine vegetarische Lebensweise und machte sich auchsonst so manche Gedanken zur Ernährung[21]und anderen Teilen des physischen Aspektes eines „naturgemäßenLebens“, war aber für die Naturheiler vor allem mit seiner radikalen Zivilisationskritik von Bedeutung.Nicht die Umsetzung seiner Diätvorschriften stand im Mittelpunkt des Strebens der Naturheiler, sondern das Erreichen des Ziels einer Wiedergeburt der Menschheit durch Rückorientierung.
Die allgemeine Idee Rousseaus war dabei viel wichtigerals einzelne Äußerungen über diesen oder jenen Sachverhalt. Rausses konkrete Vermutung, was am Anfang dieser Erneuerung zu stehen habe, fand dabei in Rousseau auch gar keinen echten Vorläufer:Seit seinem Aufenthaltin der Kuranstaltam Gräfenberg von Vincenz Prießnitzim Jahr 1837glaubteer,dessen „Hydrotherapie“ sei möglicherweise der Schlüssel zur Rückkehr des Menschen zu den Werten des Naturzustandes.Jenem Zustand, in dem der Mensch nach Rousseau wunschlos glücklich und frei von Krankheiten gewesen sei.Viele glaubten an ihn und seine Theorie, darunter Richard WagnerundErnst Kapp.
Ab Mitte der 1850er Jahre brachte der Rausse-Schüler und Nachfolger Theodor Hahn schließlich den Vegetarismus in die Naturheilkunde ein. Hahn, der nicht nur Kapp kannte, sondern auch mit Wagnerkorrespondierte, galt nun der Vegetarismus als wichtigstes Mittel einer möglichen Erneuerung. In diesem Sinne wollte er auch die „soziale Frage“ durch die Mittel des Vegetarismus lösen.Wagner seinerseits versuchte Hahn, der nach der Revolution von 1848/49 ebenfalls in die Schweiz auswandern musste, in die Nähe seines Zürcher Exils zu locken, wo er einen Zirkel aus Intellektuellen, die an der Wiedergeburt der Menschheit arbeiten sollten, geplant hatte.
Wagner, der in den 1850er Jahren an die Erlösung der Menschheit durch die „Wasserheilkunde“ glaubte, setzte später auch auf das Erlösungskonzept von Theodor Hahn. In „Religion und Kunst“ (1880) stellt Wagner schließlich die vegetarische Lebensweise an den Beginn einer zu erhoffenden Erneuerung. Hahn hatte zu dieser Zeit gerade sein Hauptwerk „Das Paradies der Gesundheit“ (1879) veröffentlicht, das sich deutlich besser verkaufte als seine anderen Werke. Hahn starb allerdings bereits 1883, im gleichen Jahr wie Wagner, sodass er die noch größere Verbreitung des Vegetarismus, der seinen Höhepunkt während der„Lebensreform“erreichte, nicht mehr miterleben konnte.
Einleitung
„Der Schutt der Laster, Staub und Moder der Gelehrsamkeit, am meisten aber die Vergiftung durch Medizin und Rauschgetränke, haben den Menschen zu einer Karikatur gemacht, die einem kranken Affen mehr gleicht, als einem Menschen.“[22]
J. H. Rausse über den modernen Menschen
Richard Wagner(1813-1883)wurdeMitte des Jahres 1851 zu einem Anhänger der Naturheilkundebzw. der Hydrotherapie von J. H. Rausse. Erbliebbis zu seinem Todein Freund derselben und vor allem ihrer Ideen–wenn auch in kritischer Distanz zu speziellen Verordnungen.Sich langsam von der radikalen Theorie verabschiedend, schrieb er an seinen „Wasserfreund“ Uhlig: „In R. (Rausse) sprach mich vor Allem der frische Zug auf die Natur hin an.“[23]Der von Wagner in seiner Spätschrift „Religion und Kunst“(1880)gut geheißeneLebensstilauf Grundlageder Ansichten„der Vegetarianer, der Tierschützer und der Mäßigkeitspfleger“[24]weist auf eine Rückbesinnung Wagners auf die geistigen Ideen der Naturheilkunde hin.Wagner schreibt dortu. a.„selbst denheutigenSozialismus“könne manaus starken inneren Gründen„als sehr beachtenswert“ einschätzen,„wenn er mitden …Verbindungen der Vegetarianer, der Tierschützer und der Mäßigkeitspfleger in eine wahrhaftige und innige Verbindung träte.“[25]
Dieseauchzu diesem Zeitpunktnoch vorhandenen Ideale von Raussewurden damals in Deutschland,vor allem durch den Wagner persönlich bekannten Rausse-Schüler und NachfolgerTheodor Hahn(1824-1883)vertreten.Dieser–der zeitweiligMitglieddes „Bundes der Kommunisten“war–dachte selbst an eine ArtSozialismus auf der Grundlage des Vegetarismus, des Tierschutzes und der Mäßigung. Dafür steht speziell seine 1869 in 1. Auflage erschienenePublikation: „Der Vegetarismus als neues Heilprinzip zur Lösung der sozialen Frage.Seine wissenschaftliche Begründung und seine Bedeutung für das leibliche, geistige und sittliche Wohl des Einzelnen, wie der gesamten Menschheit“ (1. Auf. Grieben 1869).Wagner selbst glaubte an eine mögliche Rückkehr zueiner „wahren Religion“, getragen auch voneinerBesinnung auf die Werte des „Vegetarismus“. Diese könne die so notwendige „Regeneration“ einleiten.
Aufmerksam auf die Ideen der Naturheilkunde machte Wagner sein FreundTheodor Uhlig (1822-1853), derbereits vor Wagnerein Anhänger der Rausse‘schen Wasserheilkunde war. Er war es, der ihn zu seiner ersten Kur in der Kaltwasserheilanstalt in Albisbrunn bei Haussen im Kanton Zürich(ab 15. September 1851)überredete und ihn davor bereits mit Theodor Hahn bekannt machte, als sie beide seine Wasserheilanstalt in Horn bei Rohrschach nahe St. Gallen besichtigten.[26]Unter Einfluss Uhligs entschlosssichWagner,bereits bevor er auch die genannte Kaltwasserkur in Albisbrunn antrat,tatsächlichnach den Rausse‘schen Prinzipien zu leben. Die privat durchgeführte Kur reichte Wagner allerdings bald nicht mehr, am 8. September1851schrieb er an Uhlig: „Das Halbe kann ich nun einmal nicht leiden: mit der bloßen Diät ist mir nichts geholfen.“[27]
Eine Kur unterAnleitung musste her.Dieseabsolvierte er schließlichgemeinsam mit seinen FreundenKarl RitterundHermann Müller. Am 15. September 1851trat er sie anund am 23. November 1851schloss er sie ab. Mit dieser Kur war er nicht restlos zufrieden, dennoch setzte er auch privat hydrotherapeutischeVerfahren(u. a. aus Wasseranwendungen und einer speziellen Diät bestehend)fort und suchte brieflichenRat von Theodor Hahn.
Uhlig hatte Wagner während eines Besuches von Juli bis August 1851 dringend empfohlen, hydrotherapeutische Verfahrenzwecks Heilung seiner angegriffenen Gesundheit anzuwenden. Wagner entschloss sich, sein Leben nach der Hydrotherapieauszurichten–dazu begann er auch die Schriften von Rausse zu lesen.Er glaubte zu dieser Zeit,tatsächliche Heilung von seinen Leiden durch die Hydrotherapie zu erreichen.Letztlich sollte die Kur inAlbisbrunn seine Gesundheit endgültig wiederherstellen.Er litt damalsu. a.unter Darmträgheit und einer schmerzhaften Gesichtsrose.
Gleichzeitig war vor allemseine Psyche sehr angegriffen. Er war oft sehr niedergeschlagen und nervlich stark überreizt, was seine körperlichen Leiden sicherlich verschlechterte, wenn nicht sogarauslöste.Später wird ihm ein anderer naturheilkundlicher Arzt–ein gewisserDr. Vaillant, praktizierendinMornex bei Genf–die Diagnose stellen, er habe in erster Linie einpsychisches Leiden, das keine zugrundeliegende körperliche Ursache hätte.Möglicherweiselitt Wagner tatsächlich aneiner Angsterkrankung,viele seiner Schilderungen klingen danach, alshatteer aus heutiger Sicht eineAngststörung.[28]Über seine Zustände,die ihn noch lange plagten und die er meistens mit Wasseranwendungen behandelte,berichtet er etwaFriedrich Nietzschenoch 1873.
In einem Brief vom 21. Septembererzähltervon seinemArzt, dertrotz des großen Unbehagens,das Wagner plage,keinernsteskörperliches Leiden finden könne;er versichere ihm, er „sei ein unverwüstlich gesunder Mensch“, obwohl er sich „während durch den Tag und die Nacht mit Elenden Zuständen dahinschleppe, von denen er [sein Arzt] lächelnd behauptet, das seien die ganz gewöhnlichen Leiden des ‚Genies‘.“[29]Für seine doch in Wirklichkeit robuste Gesundheit sprechen etwa seine anstrengenden Wanderungen der 1850er Jahre in den Schweizer Bergen, durch die er–zum Teil sicherlich aus dem Kalkül seiner Anhängerschaft der Naturheilkunde–seine Leiden,von denen er nicht immer wusste,dass sie vorallem psychischer Natur waren,kurierenwollte.
Selbst1873–Wagner war wohl nichtmehr so fit wie 20 Jahre zuvor, als er die anstrengenden Wanderungen in den Schweizer Bergen unternahm, allerdings wohl noch nichttödlichkrank[30]–zweifelte Wagner noch daran, dass erkörperlicheinigermaßengesund sei.Ein Jahr späteraberhatte Wagner zum ersten MalernsteHerzprobleme, die nie wieder weggehen.[31]Wahrscheinlich litt erin seinen letzten JahrenunterAngina pectoris, an deren Folgen er schließlich am 13. Februar 1883 in Venedig verstarb.[32]
AuchNietzsche erkanntenervöseKrankheitszüge bei Wagner und stellte,als er bereits mit Wagner gebrochen hatte,im„Fall Wagner“ (1888)folgende polemische Diagnose, die vielleicht auchauf das Wissen um die Diagnose, die Wagner selbsterstmalsin den 1850er Jahren von Dr. Vaillant gestellt bekam,zurückging.Nachdem Nietzsche dort WagnersKunst als krankund Ausdruck von Wagners Krankheitbezeichnete, stellte er folgende Diagnose: „Alles zusammen stellt ein Krankheitsbild dar, das keinenZweifel lässt. Wagner est une nèvrose.“[33]Nietzsche spielt hierbei mit einem Zitat des französischen NervenarztesMoreau, der den Ausspruch tätigte: „Le génie est unenévrose.“[34]Wagners Arzt des Jahres 1873 stellteoffenbareinen ganz ähnlichen Zusammenhang her.
Darauf wird später noch einzugehen sein[35]und hängt vielleicht schließlich sogar mit der Diagnoseüber Nietzschezusammen, die Wagner gegenüberDr.OttoEiser(1834-1898)gestellt hatte: Damals–1878–gab Wagner Nietzsches angeblicher Onanie die Schuld an seinem Augen und Nervenleiden und empfahlihmdagegeneine hydrotherapeutische Kur.[36]Nietzsche erfuhr von der Diagnose später, was möglicherweise–dazu gibt es, wienochdargestellt wird, gewisse Indizien–zum Bruch der beiden beitrug.
Der ganze Sachverhalt kannerst später dargestellt werden. In diesem Zusammenhangscheint allerdingsWagnersSchilderung gegenüber Eiser, in dererdavon spricht,wie er sein eigenes Leiden durch hydrotherapeutische Maßnahmenwährendeiner Kur bei genanntenDr. Vaillant Mitte 1856letztlichdoch in den Griff bekommen habe, interessant:„Mein Arzt[genannter Dr. Vaillant]erklärte mir, ich sei nichts als nervös, versprach mir, in zwei Monaten mir mein volles Vertrauen wiederzugeben, und hielt Wort.“[37]
Nervosität, Neurasthenie, Hysterie waren damals gebräuchliche Ausdrücke für Leiden,die wir heutein vielen Fällenals Panik oder Angststörung diagnostizieren würden.Eine genaue Definition dieses Leidens gab es noch nicht.[38]Allerdingslitt Wagneraus heutiger Sichtwohlam ehestenunter einer dieser Angsterkrankungen, diekörperliche Symptomatiken schlimmer erscheinen ließ,als sie wirklich waren.Möglicherweise litt er aber bereits in den 1850er Jahren anAngina pectorisAttacken,die zu ähnlichen Symtomen führten.[39]Dagegen spricht allerdings, wie gesagt, seine damals durchaus stark ausgeprägte Fitness und,dass seine Zustände nicht während körperlicher Anstrengung auftraten, sondern häufig in Ruhe, wie so mancher Auschnitt aus Briefen, die im Folgenden zitiert werden, zeigen wird.
Wagner blieb bis zuletzt ein „Wasserfreund“;in den Jahren 1851bis1853 war er darüberhinaussogar fanatischer Anhänger einesder wichtigsten Proponenten der Hydrotherapie und späteren Naturheilkunde J. H. Rausse. Von dieser Zeit wird der erste Teil handeln. Später gab er dessen spezielles System der Wasseranwendungen und vor allem dessen eigenwillige Krankheitslehre–von der noch zu sprechen sein wird–auf, nicht allerdingsdie Hydrotherapie.
Gerade durch„Wasseranwendungen“glaubte er,von seiner Gesichtsrose geheilt worden zu sein, wollte selbst in späten Jahren seine „Unterleibsprobleme“–die bereits in 1850er Jahren zu einem seiner Hauptproblemezählten–durch Wasseranwendungen heilenund empfahl demoffenbarebenfalls„nervösen“ Nietzsche eine hydrotherapeutische Kur. Ein „sehr verständiger Hydropath“ könne Nietzsche in der Tat wohl am besten helfen, meinte er damalsgegenüber Dr. Eiser.[40]
Wagnerbliebaber nicht nur bis zuletzt „Wasserfreund“, sondernwurdein seinen letzten Lebensjahrenauchzu einem Anhänger des Vegetarismus, der in Deutschland vor allem über die Naturheilkundeund deren DunstkreisFuß fasste.Jetzt propagierte erVerordnungenwie den Alkoholverzicht, den er aufgrund seinesAnhängertumsvon J. H. Raussein den 1850er Jahrenbereits gelebt hatte, gemeinsam mit einer vegetarischen Lebensweise–die der Rausse-Nachfolger Theodor Hahn in die Naturheilkunde eingebracht hatte–und dem Tierschutz. Galt für ihn in den Jahren 1851-1853 die Hydrotherapie als wichtigste Erstmaßnahme zur Gesundung der Menschheit, setzte er ab 1879 an deren Stelle den Vegetarismus.
Der gleiche Wandel hatte sich bereits in der Geschichte der Naturheilkunde vollzogen. J. H. Rausse wollte die Menschheit durch die Hydrotherapie heilen, Theodor Hahn ab dem Ende der 1850er Jahre durch den Vegetarismus: Raussens Wasseranwendungen und später der Vegetarismus solltendas Individuumzuerst von körperlichen Krankheitenbefreien und damitletztlichden Weg frei machen für einen moralischen Neubeginn, den Wagner später „Regeneration“ nannte. Die Naturheiler verwendeten vorallem den Gegenbegriff „Degeneration“für den Zustand,in welchendie zivilisierten Menschen durch ihre falsche Lebensweiseverfallen seien unddernur durch ihre Maßnahmen–etwa den Fleischverzicht–aufzuhalten sei.[41]
Hierzu ist zu sagen, dass damaligeNaturheilerundVegetarierihre Auffassung der „Degeneration“ in keiner Weise biologistisch verstanden oder ihr gar eine Rassenideologie zugrunde legten. Sie gingen von einer „Degeneration“ durch eine falsche Lebensweise bzw. auch Ernährung aus und stellten dieser eineSebstreformentgegen. Wir werden im Laufe dieser Untersuchung nochmals davon sprechen.[42]
Wagner warzu dieser Ansicht,die„Degeneration“der Menschheit sei nur durchden Fleischverzicht aufzuhalten,1879 im Zuge seiner Beschäftigung mit dem Thema der Vivisektion gekommen.[43]Ein Jahrzehnt früherund noch 1874hatte er Nietzsche, der vorübergehend vegetarisch lebte, vor dem Vegetarismus gewarnt und ihn schließlich zum Fleischesserund Befürworter gemacht, was dieser nicht unkommentiert ließ.Darüber wird hier ebenfallsnoch zu sprechen sein.
Dochzuvor, die ganze Problematik einleitend,ein kurzer Blick auf die Strömung,der Wagner längere Zeit anhing und deren Verordnungen er teilweise bis in seine letzten Jahre anwandte;die Naturheilkunde. Zu einem Teildurch Wagners eigenen Beitrag–davon handelt in rudimentären Ansätzen das letzte Kapitel–wurde später daraus die sogenannte Lebensreform. Dabei ist Wagner sowohl Anhänger der Naturheilkunde–wovon die ersten Kapitel handeln werden –als auch ein Anhänger der„Lebensreform“bzw. sogar ein nicht zu unterschätzender Wegbereiter derselben.
Sehen wir unsim ersten Teilan, wessen Anhänger Wagner in den 1850er Jahren war. Betrachten wir einleitend dieInhaltedes Systems von J .H. Rausseund deren in viele Richtungen reichende Folgen. Kennt man sie,wird man letztlich auch den Einfluss der Rausse‘schen Hydrotherapie auf Wagnerund ihre Folgen, die in viele Bereiche von Wagners Denken und Wirken reichen, dechiffrieren können. Dabei wird die Zeit seiner Verehrung von Rausse der Ursprung seiner späterenÜbernahme wichtiger Ideen der Vegetarier.
Erzählen wir deshalb im folgenden ersten Teil die Geschichte der Naturheilkunde in der Tradition von J. H. Rausse, die in den 1850er Jahren–als Wagner durch seinen Freund Uhlig auf dessen Schriften stieß–bereits beliebt war und nach der Ausweitung zum Vegetarismus, durch seinen Schüler Theodor Hahn,wohl noch wirkungsmächtiger wurde. Wagner seinerseits war Anhänger von beidem–der Naturheilkunde ohne Vegetarismus, in dieser Weise von Rausse vertreten,und später ab 1879, nachdem er lange Zeit ein Gegner war,selbst ein Befürworter des Vegetarismus.[44]
In diesem Abschnitt wird uns auch der Begründer der Technikphilosophie,Ernst Kapp(1808-1896),beschäftigen. Kapp war wohl einer derglühendstenVerehrer von J. H. Rausse und wurde direkt nachdessenTod auch zu seinem Biographen. Er musste, gleich wie Theodor Hahn und andere Naturheiler,nach der Revolution von 1848 aus politischen Gründenemigrieren. Anders als dieser, der in die Schweiz ging, wo er auf Wagner traf, verschlug es Kapp nach Amerika.
Dort gründete er auf der Grundlage der Idee des utopischen Sozialismus, aber auch aufgrund der „hydropathischen Idee“ von J. H. Rausse,eineFreidenker-Kolonie. Sie bestand,bisdieschrecklichenEreignissedes amerikanischen Sezessionskrieges das Glück der texanischen Kolonie zerstörten: Kapp und seine Mitstreiter konnten auch in Amerika nicht von ihrem Engagement für Werte wie„Freiheit,WohlstandundBildung für alle“undihremKampf für Frauenrecht und gegen die Sklavereiablassen.
Viele dieser Maximen nahmen sie in die Satzungen ihres in ganz Texas aktiven „Freien Vereins“auf, dessen Vorsitz Ernst Kapp inne hatte.Siebüßtendafür mitbitteremLeid, das über die Kolonie hereinbrach undderenUntergangeinleitete.Trotz diesesjähenEndes war und ist das Projekt dieser Kolonie ein imposantes Beispiel für die Wirkung der „hydropathischen Idee“ J. H. Rausses und nimmt ähnliche Projekte der späteren „Lebensreform“ vorweg.
I.Die Naturheilkunde in der Tradition von J. H. Rausse(1805-1848)
„Nicht die Gesundheit des Wilden ist wahre Schönheit, sondern diejenige Gesundheit wird es sein, deren die Menschheit als einer nach einem langen Gang der Entwicklung durch das Wissen vom Guten und Bösen vermittelten teilhaftig werden wird. Wenn der Wilde und der Culturmensch ein gleich einfaches Dasein führen, so findet doch der Unterschied statt, daß jener so lebt, weil er nicht anders kann, dieser dagegen, weil er so leben will. Die aus der Freiheit des Bewußtseins sprießende Gesundheit, Kraft und Gewandtheit wird Schönheit sein, als Product der wahren von jedem Einzelnen an sich geübten Lebenskunst. Die Heilkunde wird zur allgemeinen Lebenskunst werden.“[45]
Ernst Kapp überdas Ideal eines zukünftigen Lebens
1.Einleitung:AllgemeineBemerkungen zu den Begriffen„Naturheilkunde“und „Lebensreform“
„Mag man als Naturheilverfahren bezeichnen was man mag; es bleibt ein Nichts, ein leeres Wort, solange man dahinter nicht bestimmte Begriffe aufrichtet, die aus irgendeiner Grundeinstellung zu den ärztlichen Angelegenheiten die Hauptdefinition hergeben. Eine verfestigte Meinung von der Natura rerum.“[46]
Emil Klein über das Wesen der Naturheilkunde
Heute bekannter und wohl auch besser auf ihre sozialen Implikationen untersucht ist die sogenannte „Lebensreform“,als Bewegung zum Ende des 19. Jahrhunderts groß geworden, deren Idealeallerdings im Prinzip bereits50 Jahre früherdurch die Naturheilkundepropagiert und auchverwirklicht wurden.[47]Auch die„Naturheilkunde“von J.H. Rausse erscheint dabei als „Lebensreform“ und er als einer der ersten,der gesellschaftliche und politische Probleme durch gesundheitliche Maßnahmen lösen wollte, was die spätere„Lebensreform“vielfach auszeichnete.
Die„Lebensreform“wareine aus vielen Strömungen und Einzelwegen bestehende Bewegung, die etwa im Bereich der Medizin durch die„Naturheilkunde“, im Bereich der Kunst durch „Reformkunst“, im Bereich desalltäglichen Lebens durch eine „Selbstreform“, auf gesellschaftlicher Ebene durch Protest, aber auch politisches Engagement[48]aktiv war. Was sie zusammenhielt, war der Glaube an das eschatologische Potenzial ihrer Verordnungen für das Individuum, aber auch die Menschheit.[49]
In diesem Sinne verfolgte etwa Richard Wagner mit seiner Kunst lebensreformatorische Ziele. Wagner selbst, in den 1850er Jahren ein radikaler Anhänger der Heilslehre der Wasserheilkunde von J. H. Rausse und in seinen letzten Jahren ebensobegeisterterAnhänger des Vegetarismus, wurde auch selbst bald als einer verstanden, der nicht nur durch seine Kunst zu einer „Regeneration der Gesellschaft“ beitragen wollte, sondern jene unter das Konzept einer „Lebensreform“ stellte.[50]
Ihr Anfang müsselaut Wagners Auffassungab 1879, vertreten etwa in „Religion und Kunst“(1880), in einer vegetarischen Lebensweise, begleitet von der „Mäßigkeitspflege“ (Verzicht oder Maßhalten im Umgang mitSucht und Genussmitteln) und dem Tierschutz(bzw. einemrespektvollen Umgang mit der Natur)bestehen. Gerade durch die von Wagner ab 1871 initiierten „Wagner-Vereine“ wurden nicht nur lebensreformatorische Ziele verbreitet, sondern sie wurden auchtatsächlichzu einem Ausgangspunkt der„Lebensreform“selbst. Darumwird es im Detail noch gehen.[51]
Der Begriff der„Lebensreform“taucht zuerst in den 1890er Jahren auf und bezieht sich sowohl auf ästhetische und religiöse Bereiche, auf die Philosophie[52], die Literatur, dieWissenschaft, aber auch etwa aufdie Pädagogik[53]und sei nachKrabbedurch „mannigfache Gemeinsamkeiten verknüpft“.[54]Krabbebezeichnet den Vegetarismus als „Kern der Lebensreformbewegung“.[55]Er erkennt auch bereits eine Verwandtschaft zwischen der„Lebensreformbewegung“, der„Naturheilbewegung“und der„Nacktkulturbewegung“, wobei gerade die„Naturheilbewegung“allerdingszeitlich vorausgeht, was bei Krabbe nichteindeutigklar wird.
Damitwird siem. E. zu einem Ausgangspunkt der anderen Bewegungenund später auch zum wichtigstenTrägerder gesamten „Lebensreform“, was nicht immer so gehandhabt wird.M. E. blieb die „Naturheilkunde“ wohl auch in der Zeit der Hochblüte der „Lebensreform“ um 1900 der eigentliche Träger der Bewegung. Das zeigen die Mitgliederzahlen; hatte der Dachverband der Naturheilkunde „Deutscher Bund der Vereine für naturgemäße Lebens und Heilweise“ 1913 148 000 Mitglieder[56], so versammelten sich unter der spezifischen Ausformung des Vegetarismus im Jahr 1912 insgesamt nur 5000 Mitglieder in den 25 Vegetarier-Vereinen des deutschen Kaiserreichs.[57]
Der Vegetarismus–der wie gesehen von Krabbe als „Kern der Lebensreformbewegung“ bezeichnet wird–blieb in seiner Reichweite also tatsächlich weit hinter der Naturheilkunde zurück. Da beide allerdings die gleichen Ideen verfolgten, die sie unter dem Begriff des „naturgemäßen Lebens“ zusammenfassten, scheint die Naturheilkunde, aus der ja der deutsche Vegetarismus als Sonderform der gleichenzugrunde liegenden Theoremeentstand, tatsächlich für die Verbreitung lebensreformatorischer Ideale um einiges bedeutender, als ihre Erweiterung zum Vegetarismus, der nur ein Teil der Anhänger folgte.
Selbst dieWagner-Vereine–die, wieein Teildieser Arbeit zeigt[58], die meisten Ideale des Vegetarismus (bzw. auch der Naturheilkunde) verinnerlichten und zu verbreiten suchten–hatten bereits zwischen 1883 und 1888 allein unter dem Dachverband des „Allgemeinen Richard-Wagner-Vereins“rund 8 000 Mitglieder.[59]Siescheinen damit für die Verbreitung lebensreformatorischer Idealeebenfallswichtiger als die eigentliche Vegetarismus-Bewegung, die zur gleichen Zeit (1884) lediglich 2464 Mitglieder aufweisen konnte.[60]Der bereits genannte „Deutsche Bund der Vereine für naturgemäße Lebens- und Heilweise“besaß zu dieser Zeit (1889)19 000 Mitglieder.[61]
Krabbeunterscheidetseinerseitszwischen „spezifischer Lebensreform“ als Überbegriff und der „peripheren Lebensreform“ als Umsetzung der „abstrakten Utopie“ der„spezifischen Lebensreform“. Dabei gilt ihm der Vegetarismus als eine solche „abstrakte Utopie“, die Naturheilbewegung dagegen sei eine Strömung der „spezifischen Lebensreform“, obwohl siemit dem Vegetarismus ideologisch„engstens verwandt“ sei.[62]Dabei wird der Unterschied zwischen den beiden Arten der „Lebensreform“ nicht ganz klar. Gerade für den deutschen Sprachraum scheinen beide Strömungen lange Zeit ideologisch identisch und nirgends ein Bruch feststellbar. So baute etwa der erste wichtige Proponent des Vegetarismus,Wilhelm Zimmermann,auf den Werken des Naturheilers J. H. Rausse auf[63], dessen Nachfolger Theodor Hahn später die vegetarische Lebensweise zuerst als ein Mittel des von Rausse aufgebrachten „naturgemäßen Lebens“ einführte und erst später den Vegetarismus als wichtigsten Faktor über die anderen erhob, ohne allerdings von diesen jemals abzuweichen.[64]
Deshalb scheint der Begriffdes „naturgemäßen Lebens“, denRausse von Rousseau ableitete, wichtiger als derbereits darunterfallende Begriff„Vegetarismus“und den Kern der Utopie auszumachen. Der Vegetarismus selbst ist eine Ausformung des Konzeptes, also bereits eine „spezifische Utopie“ und ein Weg zum von Rousseau abgeleiteten Ideal.Gerade dieser Aspekt kann an der Person Richard Wagner, der von der Naturheilkunde von Rausse später zum Vegetarismus kam,gut nachvollzogen werden, wie wir im Laufe dieserUntersuchungsehen werden.
Zu RechtanerkenntKrabbe,dem in dieser AnsichtauchLinsefolgt,einen „Kernbereich“ der „Lebensreform“, in welchem sie dieVegetarismus-Bewegungund dieNaturheilbewegungsehen.[65]AndereAutorenwieReinhard Farkasfavorisieren hingegen, damit wohl am Begriff der „Lebensreform“ vorbeizielend, ein sogenanntes „plurizentrisches Modell“[66]: „Das Vokabel“[67]Lebensreformverhalf laut Farkas,„unterschiedliche Leitbilder einschränkend zu definieren und spezifische Handlungshorizonte einzugrenzen“.[68]
Die zur „Selbstinterpretation“ verwendeten „Vokabeln“ [recte: Vokabel], wie „Echtheit“, „Einfachheit“ und „Wahrheit“, die mit dem sogenannten „Leitbild der Naturgemäßheit“ in Verbindung zu bringen seien, dienten lautFarkas„zur Verständigung der Mitglieder und zur Legitimation der Eliten“sowie der Legitimation „eines für gültig gehaltenen Lebensstils“ gegenüber der Öffentlichkeit.[69]Hierbei plädiertFarkasfür eine „plurizentrische“ Sichtweise. Ein zentrales Element bzw. einen Kernbereich der „Lebensreform“ anzunehmen, sei nicht angebracht. Er nennt diese Auffassung eine „konzentrische Sichtweise“ und stellt dieser sein „plurizentrisches Modell“ entgegen.[70]
Doch scheint Farkas These teuer erkauft und geht auf Kosten einer vernünftigen Abgrenzung des Begriffs „Lebensreform“ von anderen Strömungen. Bei ihm findet so ziemlich alles unter dem Begriff „Lebensreform“ Platz, was eine subversive Seite hatte, womitdie Strömung der „Lebensreform“unter seinen Voraussetzungen Gefahrläuft,bis zur Unkenntlichkeit verwässert zu werden.Denn gibt mandie Auffassung auf, es gäbe einen „Kern“, der die „Lebensreform“ auszeichne, den ich wie gesagt im Modell des „naturgemäßen Lebens“ sehe, scheint man vielfach die Absicht der „Lebensreformer“ zu verkennen und vernichtetdie Charakteristika der „Lebensreform“, die sie erst zu eineroriginärenStrömung machten.Verwirft man die These, im Zentrum des Wirkens der „Lebensreformer“ stünden ganz spezielle Hoffnungen, die sichaus dem zentralen Begriff des „naturgemäßen Lebens“ speisten, reiht man sie unter eine der vielen Alternativströmungen ein, ohne ihren Absichten gerecht werden zu können.Daher ist Farkas‘Versuchoffenbarein in jeder Hinsicht verfehltes Unternehmen, das eine Abgrenzung der „Lebensreform“ von anderen Strömungen fast unmöglich machen würde.Farkas These brächte dem Begriff „Lebensreform“ das Odium der Beliebigkeit. Unter seinen Gesichtspunkten könnte so ziemlich jede moderneLifestyle-Bewegung als „Lebensreform“ verstanden werden.Das entworfene Modell einer „plurizentrischen Sichtweise“stiftet Verwirrungund scheint den Versuch der Bestimmung des Wesens der„Lebensreform“ noch schwieriger zu machen,alses ohnehin ist.
Ähnliche Versuche gab es immer wiedervon Seitender medizinischen Forschung. Gerade der in der Zeit des Nationalsozialismuspraktizierende„Naturarzt“Alfred Brauchle[71]trat als einer der ersten gegen „lebensreformerische“ Tendenzen innerhalb der Naturheilkunde auf. In diesem Sinne meint er, die Naturheilkundehabe nichts „mit Naturphilosophieund Rousseau‘scher Naturschwärmerei“ zu tun, welche er mit der von ihm so bezeichneten „volkstümlichen sogenannten Naturheilkunde“ verbindet.[72]Er grenzte sich damit ganz bewusst von der noch in den 1930er Jahren vorhandenen Tradition einer sich auf Rousseau beziehenden Naturheilkunde ab.[73]Für diese trat etwa der wichtige jüdische NaturarztEmil Kleinein, der später den Holocaust überlebte.Kleinmeinte,in einem 1924 im „Naturarzt“ erschienen Artikel über den Zusammenhang der Philosophie von Rousseau und der Naturheilkunde, sieführe zwar „ihre Anfänge auf das Wirken eines merkwürdig begabten Mannes zurück, des Bauern Vincenz Prießnitz.“Der„geistige Inhalt der deutschen Natur-Heilbewegung“seiaber„ein Erbe aus den Vorzeiten der französischen Revolution: der Erlösungsgedanke J. J. Rousseaus“.[74]
Brauchle, der eineeigenemit völkischem Ideal harmonisierteTheorie der Naturheilkunde entwickelte[75], brach wohlin seiner auch heute noch häufig zitierten Darstellung der Geschichte der Naturheilkunde („Naturheilkunde in Lebensbildern“)[76]als einer der erstenmit derRousseau’schen Tradition, welche mit dem nationalsozialistischen Menschenbild nicht vereinbar schien.[77]
Zur ideologischen Ausrichtung der „Lebensreform“ gibt es bereits einige Studien. In diesem Sinne gehtJost Hermandin einer neueren Publikation der Frage nach, ob die „Lebensreform“ ein „Vorbote Hitlers“[78]sei.Hier geht er ganz bewusst auf jene Richtungen der „Lebensreform“ ein, die in ihrer Ausrichtung in der Tat vieles des von den Nationalsozialisten Vertretenenvorwegnahmen.
Dabei nennt er Protagonisten wieHeinrich Claß (1868-1953), der u. a. die Idee eines „großgermanischen Bauernreiches“ vertrat.[79]Deutlich aufmerksam macht er auf den Umstand, dassviele„Lebensreformer“ bereits in den Jahren der Weimarer Republik „ins ideologische Fahrwasser der völkischen bzw. präfaschistischen Strömungen gerieten“.[80]Aus der Opposition zur wilhelminischen Ära, um die es der „Lebensreform“nach Hermand eigentlich ging, dürfe auf keinenFall geschlossen werden, dass die „Lebensreformer“ ausschließlich „Wegbereiter einer natürlichen Daseinsform“ gewesen seien.[81]
Zu einem wenig befriedigenden Ergebnis kommtwiederumReinhard Farkas, dervon derZeit um 1900 von einer „multikulturellen Naturheilbewegung“als Teil der „Lebensreform“spricht.[82]Gerade das hierfür gebrachte Beispiel des Pfarrers Kneipp scheint viel zu klischeehaft und einseitig.[83]Außerdem ließ Kneipp zumindest antisemitische Äußerungen fallen. So schreibt er in „Meine Wasserkur“: „Der Rheumatismus ist wahrlich der ewige Jude unter den Krankheiten.“[84]
Als tatsächliche Stütze einer „multikulturellen“ und „multiethnischen“ Naturheilkunde[85], die er am Beispielder „Donaumonarchie“evident machen möchte, können relativhohe Zahlen von angefertigten Übersetzungen der Kneipp‘schen Werke auf keinen Fall herhalten[86]. Zumal–wie der Autor selbst herausstellt–alle unter dem 1897 gegründeten „Verband der Vereine für Gesundheitspflege und Naturheilkunde in Österreich“ zusammengeschlossenen Vereine deutsch waren.[87]
Fürdie deutschen Kneipp-Vereine der k. u. k. MonarchienenntFarkasgar keineMitgliederzahl.Über eineUntersuchungderpolitischenAusrichtung der Mitglieder der Kneipp-Vereine,von denenwirebenfallswenig wissen, erfahren wir von ihm auch nichts. Der Hinweis auf einigewenigeVereine aus anderen Teilen der Monarchie[88]kann hier nicht genügen, denn stellt Farkas bereits in der Überschrift die Frage, ob die„Lebensreform“ „deutsch oder multikulturell“gewesensei.[89]
Es wäreäußerstzynisch,die These einer völkischen bzw. auch rassistischen Ausrichtung der deutschen „Lebensreform“ allein dadurch widerlegen zu wollen, dass man zeigt, dass es auch eine „Lebensreform“ in Transleithanien gegeben hatte. Ist der Autor ernsthaft dieser Auffassung, dann bleibt er uns in seinem Aufsatzaußerdemden Nachweis schuldig, dass es einenernstzunehmendenAustausch zwischen den deutschen Kneipp-VereinenCisleithaniensund denen aus Transleithanien gegeben hat.Die Behauptung einer „multikulturellen Naturheilbewegung“ist also auf der von ihm gebrachten Grundlage alseine falsche Etikettierung zu betrachten, die auf keinem vernünftigen Nachweis beruht und niemals auf die ganze„Lebensreform“übertragen werden darf.
Neben dem katholischen Priester Kneipp, dessen Anhänger, was die Anzahl der Vereinsmitglieder für Deutschland betrifft (der „Deutsche Bund“ hatte 1913148 000 Mitglieder, wohingegen derKneipp-Bund erst in den 1930er-Jahren auf etwas mehr als 45 000 Mitglieder kam[90]), deutlich zurückblieben, gab es doch tatsächlich auch völkisch ausgerichteteund von rassistischem Gedankengut geprägteStrömungen innerhalb der „Lebensreformbewegung“, auf die etwaVolker Weißzurecht seine Aufmerksamkeit richtet[91]und auchUwe Puschnerzum Inhalt einesneueren Aufsatzes macht.[92]Daher stehen Farkas‘Ergebnissein einemauffälligenGegensatz zu dem,was die sorgfältigen Untersuchungen anderer Autoren zeigen.
Auf in diese Richtung gehende Tendenzen der „Lebensreform“ sei zumindest hingewiesen. Eine weitere Verfolgung dieser Thematik würde den zeitlichen Rahmen dieser Arbeit sprengen. Beschäftigt sie sich doch tatsächlich mit den Anfängen der Lebensreform bzw. der rousseauistischen Naturheilkunde von J. H. Rausse als wichtigemVorläufer. Um die politische Ausrichtung von Rausse sowie anderer Naturheiler wird es im Folgenden noch gehen.[93]Es soll aber bereits hier darauf verwiesenwerden, dass auch dort zumindest antisemitische Anklänge vorhanden waren. Diese sind vor allem dem Zeitgeistentsprungen, haben aber nichts mit dem Wesen und demKonzept der Naturheilkundezu tun.[94]
2.J. H. Rausse, der Begründer der rousseauistischenNaturheilkunde
„Ich nehme diese Worte [nämlich was ist, ist gut] in dem Sinne, in welchem sie zuerst der Weltweise von Genf verkündete; in jenem Sinn, in welchem der erstecitoyensie zu den Grundsteinen seiner Weltwahrheit machte. Nämlich was durch die Natur ist, das ist gut. Jede Misshandlung der Natur ist Frevel, den die Natur mit Elend und Schmerz bestraft. Später, bei Anwendung dieses Satzes auf die Wasserheilkunde, werde ich zeigen, dass die großen Heilwahrheiten vom Gräfenberg, die bereits durch viele tausend Erfahrungen zweifellos festgestellt sind, ganz genau von dem Instinkt indiciert werden, welchen die Natur dem Menschen gegeben hat.“[95]
Rausse, Miscellen
J. H. Rausse (1805-1848)
Als Begründer der noch von Emil Klein fortgesetzten Tradition,behauptetebereitsJ. H. Rausse (1805-1848)–damitsicherlichauch einWegbereiter der„Lebensreform“[96]–seine„Hydrotherapie“, die später zur„Naturheilkunde“wurde, sei der Weg zur Erlösung der Menschheit.Mit der Schöpfung der Idee, die richtige Heilkunst müsse letztlich vollkommen der Philosophie vonJean-Jacques Rousseau(1712-1778)dienen, deren Probleme sie schließlich sogar lösen könne, machte er die„Naturheilkunde“zur Erlösungslehre.
Die Idee,die rechte Methode, nämlich jene,die amdeutlichsten das von der Natur Verlangte befolge, könne beinahe allein Glück, Tugend und Gesundheit brin





























