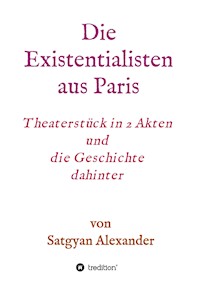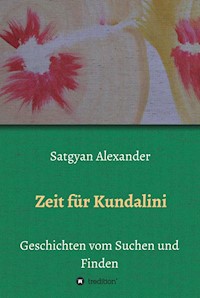3,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Biographie
- Sprache: Deutsch
Die Autobiographie erzählt in vielen kleinen Sequenzen das alltägliche Leben eines Mannes aus dem letzten Jahrhundert. Um dem Leser ein überschaubares Lesevergnügen zu bieten, wurde eine Dreiteilung des umfangreichen, im Jahr 2011 verfassten Werkes unter Berücksichtigung von abgeschlossenen Zeitabschnitten vorgenommen. Im 1. Band berichtet der Autor in lebhaften, sinnlich erfahrbaren Bildern von der Zeit des Krieges um Berlin, von der Jugendzeit, von ersten sexuellen Verführungen, der ersten Ehe und dem Alltag als angestellter Architekt in der geteilten Stadt. Im 2. Band werden die wilden 60er und 70er Jahre lebendig, Partys, die Abkehr von der Familie, eine zweite Ehe, sexuelle Affären, Canabisrausch, berufliche Herausforderungen und eine monatelange Reise nach Afghanistan im VW Bus. Der 3 Band thematisiert die persönliche Veränderung des Protagonisten durch Reisen zu spirituellen Orten in Indien und Marokko der 80er Jahre und Erfahrungen mit alternativen Therapieformen der 90er, die er als Leiter und Therapeut eines Instituts ´Centrum für bewusstes Leben´ - CBL machte. Um die Wahrnehmungen und Gefühle des Protagonisten im Verlauf der Entwicklung adäquat zu beschreiben, wählte der Autor für jeden Zeitabschnitt eine eigene Ausdrucksweise. Das Werk, AUGEN AUF UND DURCH bringt dem Leser einen Mann nahe, der, wie viele aus seiner Generation vaterlos aufwuchs und fast "ohne Eigenschaften" nach der Maxime lebte: Entscheide dich nach dem Lustprinzip.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 287
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Zu dem Buch
Die Autobiographie erzählt in vielen kleinen Sequenzen das alltägliche Leben eines Mannes aus dem letzten Jahrhundert.
Um dem Leser ein überschaubares Lesevergnügen zu bieten, wurde eine Dreiteilung des umfangreichen, im Jahr 2011 verfassten Werkes unter Berücksichtigung von abgeschlossenen Zeitabschnitten vorgenommen.
Im 1. Band berichtet der Autor in lebhaften, sinnlich erfahrbaren Bildern von der Zeit des Krieges um Berlin, von der Jugendzeit, von ersten sexuellen Verführungen, der ersten Ehe und dem Alltag als angestellter Architekt in der geteilten Stadt.
Im 2. Band werden die wilden 60er und 70er Jahre lebendig, Partys, die Abkehr von der Familie, eine zweite Ehe, sexuelle Affären, Canabisrausch, berufliche Herausforderungen und eine monatelange Reise nach Afghanistan im VW Bus.
Der 3 Band thematisiert die persönliche Veränderung des Protagonisten durch Reisen zu spirituellen Orten in Indien und Marokko der 80er Jahre und Erfahrungen mit alternativen Therapieformen der 90er, die er als Leiter und Therapeut eines Instituts ´Centrum für bewusstes Leben´ - CBL machte.
Um die Wahrnehmungen und Gefühle des Protagonisten im Verlauf der Entwicklung adäquat zu beschreiben, wählte der Autor für jeden Zeitabschnitt eine eigene Ausdrucksweise.
Das Werk, AUGEN AUF UND DURCH bringt dem Leser einen Mann nahe, der, wie viele aus seiner Generation vaterlos aufwuchs und fast “ohne Eigenschaften“ nach der Maxime lebte: Entscheide dich nach dem Lustprinzip.
AUGEN AUF UND DURCH
Biographisches von der Suche nach einem lustvollen Leben
von
Satgyan Alexander
Band 1
Teil 1-2-3
© 2018 Satgyan Alexander
Umschlaggestaltung Satgyan Alexander
Verlag und Druck: tredition GmbH, Halenreie 42, 22359 Hamburg
ISBN
Paperback:978-3-7469-1593-7
Hardcover:978-3-7469-1594-4
E-Book:978-3-7469-1595-1
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
AUGEN AUF UND DURCH
Band 1
TEIL 1 Zeitsplitter
TEIL 2 Zeitausschnitte
TEIL 3 On the sunny site
Band 2
TEIL 4 Desolater Morgen
TEIL 5 Zeitbeben
TEIL 6 Morgenlandfahrer
Band 3
TEIL 7 Wahrhaftig gelogen?
TEIL 8 Die Jahre der Provinz
TEIL 9 Anhang
Als Vorwort
Eine leere Dose poltert über die Pflastersteine. Sie fliegt mit Schwung von rechts nach links, klebt einen Moment an einem Schuh und scheppert wieder nach rechts. Sie kullert, macht leise Nachschwingungen und bleibt unbeachtet liegen. Sie hat noch ihre Form und ich ahne, sie ist ein Sinnbild meiner Existenz. Kein Fuß trifft. Beine bewegen sich wie im Scherenschnitt von rechts nach links, von links nach rechts, dunkle Hosenbeine mit nackten Füssen in Sandalen. Glatt geschliffen schimmern die Pflastersteine im Regen vom hin und her des täglichen Besorgens. Die Dose liegt geschützt in einer Vertiefung, Füße streifen sie leicht, sie wackelt, klappert, bleibt liegen. Jetzt kommen von links farbige Umhänge, aus denen Frauenfüße schauen. Eine helle Bewegung nackter Unterschenkel über den Boden, hin und her, durcheinander diagonal, schnelle Schatten werfend, bewegliche Schatten über graue Steine, vorbei an der Dose.
TEIL 1
Zeitsplitter
Das Gitterbett
Der Weihnachtsmann
Die Wendeltreppe
Der kleine Koffer
Weihnachtsbäume am Himmel
Es brennt
Schwarz auf Weiß
Menschen in der Wohnung
Schläuche unter den Füßen
Kommandantura
Lebensmittel besorgen
Panzerspähwagen
S-Bahnbrücke
Der Hausmeister
Rote Beete
Mauerziegel fliegen
Unter der Treppe
Mohrrüben
Oma im Gegenlicht
Bei Anderen
Ein Sommertag
Spielplatz Oper
Warten
An der Brandmauer
Engel, Dämonen und Fensterkunst
Vor dem Haus
Straßenkunst
Glitzern auf der Straße
Raus mit der Elektrischen
Kino, Kino
Kino, Kino Fortsetzung
Die Kartenlegerin
Anprobe
Sylvester
Hausmusik
Sonntags bei den Kleingärtnern
Die Abreibung
Das war knapp
Der Alte auf der Bank
TEIL 2 Zeitausschnitte der 50er
Die Bürgschaft
Vater, ach Vater
Die Anfänge des Kinoabiturs
Martina
Karin & Ingrid
Vater wird sechsundfünfzig
O.G. (ohne Gehör)
Jazz at the philharmonic
Suche nach dem Geheimnis
Kunstversuch
Letzte Anstrengungen
Eine Lehre
Holzplatzgeschichten
Tanzstunde
Samstags In der Wanne
Abschlussball
Fräulein Hidegard
Geheimnisse am Weg
San Franzisco Bar
Cinema Paris
Verwirrungen
Die Tür zur Verführung
Vorbei
Fasching, Partys, Nachtclubs
Leere ausfüllen
Leere ausfüllen 2
Jazz-LP Erwerbungen
Auch Vater kann einsichtig sein
Strandbad Wannsee
Das Jahr 1958
TEIL 3
On the sunny side
Neues bahnt sich an
Laterna Magica
Eine Reise mit Mutter
Schöne Zeit
Mensageschichten
Farbe und Form
Uli und Susanne
Hin-und hergerissen
Begeistert von Jutta R.
Bernd Z.
Semesterarbeit
Semesterferien
Schöne Zeit endet
Noch eine Lehre
Halbzeit
Zwischenbericht
Ende gut, alles gut?
ZEITSPLITTER
Das Gitterbett
Der Raum ist hoch, die Zimmerdecke weit über mir. Ich blicke direkt auf eine Tür, die mir riesig scheint. Sie ist eingeteilt in zwei senkrechte Füllungen oben und zwei quadratische unten, die ich nur teilweise sehen kann. Die Tür glänzt elfenbeinfarbig mit einer gold farbenden Klinke und einem länglichen Schlüsselschild in derselben Farbe. Davor läuft eine hellbraune Leiste, in der runde Stäbe stecken. Die Leiste ist auch rechts und links von mir und wenn ich den Kopf nach oben hinten drehe, sehe ich die seitlichen Leisten in eine rückwärtige enden. Hinter mir gibt es jedoch keine Stäbe mehr. Hinten ist das Gestell geschlossen. Der Abstand zwischen den seitlichen Stäben ist so breit, dass ich meine Hand durchstecken könnte, aber nicht den Kopf.
Ich könnte den Kopf gar nicht durchstecken, denn ich liege platt auf dem Rücken und kann mich nur wenig bewegen. Irgendetwas hindert mich. Meine Beine sind in einem Sack gesteckt und meine Arme unter einer Decke dicht an dem Körper gedrängt. Nur meine Hände kann ich etwas bewegen und auf meinem Körper nach oben zum Gesicht führen.
Das dünne, weiche Tuch, welches unter meinem Kinn liegt, habe ich jetzt über mein Gesicht gezogen und es bewegt sich beim Atmen. Es ist ganz weich. Sehen kann ich die Zimmerdecke nicht mehr, auch nicht die Tür, durch die sonst meine Mama kommt. Aber sie kommt nicht. Ich habe schon genug gerufen, geschrien und geweint. Niemand kommt. Um mich herum ist ein großer heller Raum und auf meinem Gesicht das Tuch, das sich auf und nieder bewegt, während ich erschöpft einschlafe und träume.
Der Weihnachtsmann
Es gibt ein Foto von mir, auf dem ich noch klein, vielleicht drei Jahre alt bin, in einem dunklen Mäntelchen mit Pelzkragen. Ich stehe auf dem Alexanderplatz neben einem großen Mann mit weißem Bart, der einem langen, roten Mantel trägt und in der Hand eine Rute und einem Sack hält. Um uns herum stehen viele Leute und schauen zu. Und jedes Mal, wenn ich das Bild betrachte, höre ich innerlich Weihnachtslieder von Kinderstimmen und im Hintergrund den Verkehrslärm. Es duftet nach gebrannten Mandeln und nach einem scharfen Gewürz. In der Luft liegt eine Ahnung von Schnee, von nasser Kälte und die Dämmerung kündigt sich durch viele Glühbirnen an, die ringsum bereits aufleuchten. Dann höre ich auch meine eigene Stimme: "Weihnachtsmann! Ich hab ihm die Hand gegeben" und als Echo höre ich diesen Satz von meiner Mutter sagen, wenn sie mit mir in den Lebensmittelladen in unserem Haus ihre Einkäufe macht und von dem Ausflug zum Weihnachtsmarkt berichtet.
“Hat er das nicht hübsch gesagt?“ Und alle Leute in dem Geschäft wollen den Satz auch noch einmal von mir hören. Ich schau die Leute an, schüttel den Kopf und die Besitzerin des Ladens bezweifelt, dass ich reden kann. “Kann er denn wirklich schon sprechen?“
Ich interessiere mich mehr für die silberne Milchmaßkanne, mit der die Frau die Milch aus einem großen Behälter in der Ladentheke herausschöpft und in die mitgebrachten Milchtöpfe füllt. Sie hat zwei Gefäße mit Henkeln. Einen größeren und einen kleineren mit denen sie die weiße Flüssigkeit in unsere Kanne schöpft. “So! Einen dreiviertel Liter, bitte schön.“
Und ich freue mich schon auf das Schüsselchen Sauermilch mit einer Haut obendrauf und viel Zucker darüber.
Die Wendeltreppe
Wir sind wieder aus dem Keller nach oben gelaufen, die erste untere Wendelung, zweimal im Oval, die Hand immer am glatten Handlauf, der so weit oben ist. Die Holzstufen auf Stahlblech sind eng gewendelt, links schmal, rechts breit, in der Mitte sind sie abgetreten, hellbraun. Das begleitende Blech an der Wand mit dem Schwung nach oben ist grau, auch das Blech in der Mitte am Treppenauge.
Es sind viele Stufen, vielleicht 25, dann ein Podest aus Holzdielen mit einer Tür, stabil aus Rahmen und Füllung gebaut, die abblätternde Farbe ist graubraun. Dort wohnen Kahls.
Und nochmal 25 Stufen. Weiter nach oben im Oval der Spirale. Wieder ein Podest und eine Tür. Das ist der hintere Eingang zu unserer Wohnung, der Kücheneingang. Endlich steckt Mutter den großen Schlüssel ins Schloss und dreht ihn, bis es Klack macht. Jetzt sind wir in Sicherheit. Aufatmen! Alles ist noch da.
Der vertraute Fliesenboden reicht bis zur Hälfte des Raumes, dahinter beginnt das Linoleum mit der abgetretenen Kante an den Fliesen. Gleich hinter der Tür steht ein gusseisernes Ungetüm mit Rankenmustern. Ein hoher Heizkörper ist mit dicken Rohren verbunden, die seit vielen Tagen kalt sind.
Der Tisch steht in der Mitte mit dem Auszugsteil zum Abwaschen und, wenn die Tür endlich geschlossen ist, sehe ich durch das Küchenfenster mit den Glasresten und der dazwischen vorgenagelten Pappe das Hinterhaus aufleuchten und den rötlich gefleckten Himmel. Das Dröhnen der Flugzeuge liegt noch in der Luft und eine brennende Hitze und stickiger Rauch.
"Kann ich jetzt wieder in mein Bett?"
Der kleine Koffer
Der kleine Koffer hat einen Ledergriff, der aus mehreren Schichten besteht. Zwei blanke Schnappverschlüsse, die durch seitliches Schieben der Schlossknöpfe aufspringen, machen dann Klack. Der Koffer birgt meine Schätze. Er liegt auf meinen Knien. Wenn ich den Deckel aufmache, dann sehe ich zuerst den Klettermax, der auf der Leiter immer abwärts saust und sich um sich selbst dreht, auf die nächste Sprosse hinunterfällt, sich wieder um sich selbst dreht bis er ganz unten in den Kofferkasten fällt. Nun nehme ich ihn wieder und stecke ihn auf die oberste Sprosse und sein Abstieg beginnt erneut. Ich kann ihn nicht deutlich sehen. Es ist nicht sehr hell hier unten in dem Raum mit den vielen Menschen. Eine kleine Glühbirne schwingt hin und her, manchmal flackert sie, zeitweise ist es dunkel. Es rumpelt, die Wände beben, Putz rieselt. Ich höre noch das Klack, Klack des Klettermaxen und dann auch das Atmen und Jammern um mich herum. „Wie lange wird es diesmal dauern?“, fragt eine Stimme.
Ganz eng sitzen wir hier auf Holzstühlen mit dem Rücken zu unverputzten Wänden aus Ziegeln, die weiß überstrichen sind. Jetzt ist das Dröhnen wieder stärker, das um uns herum wie Staub die Luft erfüllt. Das Dröhnen nimmt so zu, dass ich den Mund aufmachen muss. Jetzt wieder das Beben, dass alle Wände zittern und dazu die Dunkelheit. Mutter ist dicht bei mir und Oma auch. Den Koffer halte ich ganz fest auf meinen Knien: "Sie sind wieder weiter", sagt jemand erleichtert. Das Dröhnen nimmt ab, die Lampe flackert wieder. Die Eisentür mit den großen Griffen wird aufgemacht und Brandgeruch zieht durch den Keller. Dann das Aufrappeln, Aufatmen und Schlurfen von müden Füßen um mich herum, und ich gehe wieder an der Hand, die so vertraut ist, durch den langen, dunklen Kellergang zur Wendeltreppe. Die Kerze flackert und wirft merkwürdige Schatten. Der phosphoreszierende Anstrich an den Wanddurchgängen reflektiert schwach das Licht.
Weihnachtsbäume am Himmel
Atemlos, nachdem wir die Treppe runtergelaufen sind, blicken wir in den Nachthimmel. Das Dröhnen der Flieger, das Pfeifen, Kreischen und Wummern der abgeworfenen Bomben hat nachgelassen. Jetzt hören wir wieder die Sirenen und die Fanfaren der Feuerwehr. Prasseln und Bersten von Feuer, Knistern und Brechen von zusammenstürzenden Decken und Wänden dringen von verschiedenen Seiten auf uns ein. Über uns am Himmel, beleuchtet von Flakscheinwerfern, die noch hin und her wandern auf der Suche nach feindlichen Flugzeugen, sehe ich die Leuchtmarkierungen, die langsam nach unten schweben. Helle Lichtkaskaden lösen sich auf und sinken als einzelne Punkte wie eine Lichterkette zur Erde. In dem Ausschnitt des Himmels, den unser Hof bildet, erkenne ich mehrere sogenannte Weihnachtsbäume, die eine Fläche nördlich von uns markiert haben. Dort sind Sprengbomben und Phosphorbomben abgeworfen worden. Wir haben diesmal Glück gehabt.
Ganze Areale werden so markiert, damit die Bomber in der Nacht ihre Ziele nicht verfehlen. Systematisch zerstören sie Quartier für Quartier. Einzelne Häuser bleiben verschont und ragen wie Symbole des Widerstandes aus den Ruinen. Ich kann meine Augen gar nicht von dem himmlischen Feuerwerk lassen, aber Mutter zieht an meiner Hand. Wir müssen weiter hinunter in den Luftschutzkeller. Die nächste Angiffswelle dröhnt schon am Himmel.
Heute sind wir spät dran. Wir hätten schon längst im Keller sein müssen, wo die anderen Hausbewohner und Oma seit vielen Stunden ausharren. Aber ich wollte doch wenigstens einmal die “Weihnachtsbäume“ am Himmel sehen
Es brennt
Wir, Mutter und Ich, kommen von unten aus dem Keller, über die Wendeltreppe, durch die Küche, sehen den flackernden Himmel im Küchenfenster. Durch den kleinen Flur, der dunklen Schutz bietet, erreichen wir das Wohnzimmer, das in rotgrelle Helligkeit getaucht ist. Jetzt sehe ich die Feuerwand. Es knallt und berstet. Es riecht nach Brand, es zischt und stürmt. Ich stehe wie erstarrt. Ganz vorsichtig, Schritt für Schritt gehe ich durch die große Flügeltür in das Erkerzimmer mit den grossen Fenstern. Viel Glas ist nicht mehr vorhanden, nur noch gesprengte Reste. Die Pappen, als Glasersatz aufgenagelt, verfärben sich jetzt gelblichrot. Sie verziehen und wellen sich. Eine unglaubliche Hitze dringt wabernd in den Raum, sie nimmt mir den Atem.
Es ist eine riesige, erdrückende Feuerwand, rotgelb, an den Rändern bläulich weiß. Sie greift in den dunklen Himmel, der nicht mehr dunkel ist, weil überall die Flammen über den Häusern stehen. Der Dachstuhl des Hauses gegenüber, der mir doch seit Jahren als rotbraune Ziegelfläche so vertraut war, ist verschwunden. Es knallt und das Feuer rutscht und stürzt in die Wohnung darunter, brennt sich durch die Decken und schlägt aus den Fenstern. Die Flammen werden immer höher. Das unerträglich laute Lodern und Knacken des Feuers und das Brechen von Steinen, Balken und Möbeln, die sich aufgeben, verbinden sich mit dem Brausen all der Feuer um uns herum und mit dem Zischen des Löschwassers.
Jetzt sind Rufe von Helfern zu hören.
Ich stehe still und starre auf die Gewalt des Feuers und bin irgendwie auch fasziniert von der Schönheit und der Kraft der Veränderung, die das Feuer bringt.
Wie anders das Haus gegenüber jetzt aussieht. Und wie wird es morgen bei Tage sein?
Schwarz auf weiß
Im Herbst und Winter des Jahres 43-44 waren wir bei Onkel Ernst in Schievelbein auf seinem Landgut. Mutter hatte alle Möbel des Schlaf- und des Wohnzimmers in einer Scheune unterstellen lassen. Und wir drei, Mutter, Oma und ich waren dort einige Monate zu Gast. Viele Kinder mussten Berlin wegen der Bombenangriffe verlassen und waren bei irgendwelchen Leuten oder in Heimen untergekommen. Ich hatte Glück und konnte mit meiner Familie in das schöne Haus auf dem Land unterschlüpfen.
Das Klinkerhaus lag von Bäumen umgeben allein in der flachen Landschaft. Mutter erzählte mir, dass Onkel Ernst als Sanitätsrat bereits pensioniert wäre. Er hatte daher viel Zeit für uns und auch für seine Hunde und Pferde. Ein Pony hatte es mir besonders angetan, auf dem ich im Kreis reiten durfte. Vor den Gänsen hatte ich Angst, sie rannten mit ihren langen Hälsen auf mich los und schnappten nach mir. Aber sonst war es dort sehr schön und ruhig nach den schrecklichen Nächten in Berlin. Immer aus dem Schlaf geschreckt und an Mutters Hand durch die Wohnung taumeln, die Wendeltreppe im Dunkeln runter, durch den Keller hasten, in den Luftschutzraum hinein und warten bis die Sirenen zur Entwarnung heulten, das gab es dort nicht. Da gab es gutes Essen und gute Landluft. "Es ist wie in der Sommerfrische", meinte Mutter.
Einmal ging sie mit mir auf der Chaussee mit den großen Bäumen zur nächsten Kleinstadt. Das war ganz schön weit und das Pflaster mit dem nassen Laub rutschig. Diese endlose Weite des flachen Landes, der pfeifende Wind, der die Bäume bewegte und meine Atemwolke, die ich vor mir sah, sind noch Erinnerungen an diesen Weg zu einem Kino. Aus einem Spielfilm mit dem Titel „Schwarz auf Weiß" erinnere ich eine Szene: ein Schornsteinfeger hinterlässt mit seiner Hand auf dem Hintern der Köchin einen Abdruck, auf ihrer weißen Schürze. Den ganzen langen Weg auf der Landstraße zurück, bis in die Gegenwart, sehe ich immer noch dies Bild vor meinem inneren Auge.
Menschen in der Wohnung
Im letzten Jahr wurde es immer enger in unserer Wohnung. Gut, es ist eine Fünfzimmerwohnung mit großem Bad, Küche, Mädchenkammer und einem WC. Aber vor den Bombenangriffen hatten wir zu viert in den Räumen gelebt: Mutter, Oma, Tante Hete und ich. Vater war im Krieg und wollte auch nicht mehr zu uns zurück. Oma und ihre Schwester wohnten früher in Friedenau. Nun, in diesen schlimmen Zeiten war es besser zusammenzuziehen, sagten sie mir. Außerdem war Tante Hete schon ganz wackelig auf den Beinen. Als ich mal in die Küche rannte und sie voll Freude umklammerte, rief sie aufgeregt, "er wirft mich um, er wirft mich um!" und sie hielt sich an der Kochmaschine fest.
Seit ein paar Tagen wohnt nun eine Familie, die ausgebombt waren, mit in unserer Wohnung. Sie wurden eingewiesen. Mutter hat das Büro vom Vater ausgeräumt. Es stand sowieso nicht mehr viel darin und mein Kinderzimmer ist jetzt auch verändert. Die Zimmer sind nicht groß, aber ausreichend. Die Leute haben keine Möbel mehr. Erstmal haben sie Matratzen zum Schlafen hingelegt. Die Vorhänge hat Mutter hängen lassen. Einen alten Tisch und ein paar Stühle haben die Ausgebomten vom Dachboden geholt. Wir müssen nun leider das Badezimmer mit denen teilen. Glücklicherweise haben wir noch eine kleine Mädchentoilette neben der Küche.
Das Schlimmste ist aber, dass die Leute durch unser Wohnzimmer gehen müssen, um in die Küche zu gelangen.
"Entschuldigung, wir müssen mal heißes Wasser machen". Tür auf und Tür zu und wieder Tür auf und Tür zu. Ganz vorsichtig, um uns nicht zu stören, gehen sie auf leisen Sohlen im hinteren Teil des Wohnzimmers durch den Raum. Wir sitzen deswegen auch schon öfter im Erkerzimmer, wo wir jetzt auch schlafen. Oma und Tante Hete wohnen im alten Schlafzimmer zum Hof. Aber in keinem Zimmer sind wir richtig unbeobachtet, denn alle unsere Türen zum Flur haben Glasfelder. Mutter flüstert noch mehr als sonst schon. Den ausländischen Sender mit dem Bum, Bum, Bum hört sie so leise, dass ihr Kopf schon im Gerät steckt. "Wir wissen ja nicht, woher diese Leute kommen, vielleicht sind das PG´s." und "Wie soll das alles in der Küche aufgeteilt werden? Sollen wir ihnen einen Platz im Küchenschrank freimachen?" “Und dauernd die Störungen im Wohnzimmer“. Mutter und Oma versuchen eine Lösung zu finden. Die Garderobenschränke vom Flur und aus dem Schlafzimmer werden im Wohnzimmer parallel zur hinteren Wand aufgestellt, damit so etwas wie ein Flur entsteht. Nur der Zugang zur Küche bleibt offen. So sieht man wenigstens nur einmal die Leute beim Durchgehen. Aber man hört natürlich beide Türen schlagen. Das größere Problem werden wir im Winter bekommen, weil der kleine Kanonenofen bisher am Schornsteinanschluss an der hinteren Wand stand, wo nun der Behelfsflur ist. Aber noch ist ja Sommer.
Jahre Später:
Nach dem Tod der Tante und der Oma im Jahr 47 zog eine Anwaltspraxis in das alte Schlafzimmer. Und in meinem Kinderzimmer kam das Kreisbüro der CDU für Charlottenburg, sozusagen begann dort die Wiege der Demokratie. Jahrelang fanden dort die Besprechungen und Wahlvorbereitungen statt. Dann folgten Studenten und Studentinnen, darunter der Schriftsteller Sten Nadolny, der Jahre in dem Zimmer wohnte. In Vaters altem Büro neben dem Erkerzimmer, das nach vorne raus geht, waren immer wieder Flüchtlinge untergekommen, später dann in den 50er Jahren junge, allein stehende Damen, die daran interessiert waren, ein Zimmer direkt neben der Eingangstür mit Blick auf die Straße anzumieten. Nach der Anwaltspraxis lebte in dem alten Schlafzimmer zum Hof jahrelang ein junges Paar, das sich mit dem Kinderkriegen Zeit ließ, bis es in eine eigene Wohnung ziehen konnte. Mit dieser Familie ergab sich so etwas wie eine Wohngemeinschaft. Oft saßen wir alle in der Küche zusammen, redeten, lachten, kochten und feierten gemeinsam.
Schläuche unter den Füßen
Wenn ich vom Hof durch den kleinen Flur zur Straße gehe, vorbei an der Tür von Familie Ehrlich, der Portierschen, die auch einen Mann hat, muss ich so an die 15 Meter laufen. Unser Haus ist ziemlich tief. Im Hof ist ein großes Loch ausgehoben worden. Der Garten ist total verschwunden bis auf die ringsum laufenden Fliesengängen gibt es nur Wasser. Ein Löschteich spiegelt die Hoffassaden wieder, die Ostseite zum Nachbargrundstück ist offen, der Zaun ist fort. Alles gehört nun zusammen: Die Häuser Kantstraße Nr. 46 und 47 haben einen großen gemeinsamen Hof, nur durch ein Geländeunterschied getrennt. So können die Menschen zur Not von einem Haus ins andere fliehen, hat man mir gesagt.
Aus dem Teich, ich kann den Grund schwach erkennen, kommen Schläuche, die sich in alle Richtungen verteilen. Dicke, braungrüngraue Schläuche wie Arme eines riesigen Kraken verschwinden sie in Hausfluren, um dann auf der Straße weiter zu kriechen. Und jetzt stehe ich auf diesen Weichteilen, die bei jedem Schritt durch den Hausflur nachgeben. Es ist nicht möglich den Fußboden zu sehen. Schlauch liegt an Schlauch, die Türen lassen sich nicht mehr schließen.
Wie lange das schon so ist? Ich kann mich nicht erinnern, dass das jemals anders war. Dieses Nachgeben unter meinen Gewicht und dieses Geräusch des Knarzens und Schlurren beim Auftreten, das kenne ich seit langem sehr gut. Es ist ein Gefühl, wie auf Lebewesen zu treten und dazu der eigenartige Geruch von nassem Gummi und faulem Wasser, ziemlich schrecklich.
Aber jetzt stehe ich auf der Straße und fühle das Pflaster unter meinen Füßen. Endlich!
Kommandantura
So viele Tage und Nächte sitzen wir schon hier unten in unserem Luftschutzkeller mit den unverputzten, gekalkten Wänden. Luft kommt aus einem Kellerschacht, der außen noch durch Gitter und Bretter abgesichert ist. Es gibt eine Tür, die sogenannte Luftschutzsicherheitsschleusentür aus Eisenblech, mit großen Hebeln oben und unten, die nur der Luftschutzwart des Hauses bedienen darf. Wenn jemand nach dem Sirenenalarm nicht schnell genug hier unten seinen Platz eingenommen hat, kommt er nicht mehr rein. Dann muss er vor der Tür im normalen Kellergang warten. Das ist schon viel gefährlicher, weil die Kellerdecke nicht zusätzlich abgestützt ist, aber andererseits sind die Kellergänge sehr schmal und die Wände hier unten sehr dick. Der Raum vor der Luftschutztür führt auch direkt ins Freie, in den Hof, über eine aus Ziegelsteinen gemauerte Treppe. Von dort könnte ich die Bomber am Himmel in den Suchscheinwerfern sehen.
In den letzten Tagen war so viel Alarm, dass wir den Keller nicht mehr verlassen haben. Mutter, Oma und ich sitzen auf einfachen Küchenstühlen, die wir aus unserer Wohnung geholt haben. In Decken gehüllt und auf Sitzkissen warten wir auf das Ende. Es ist irgend ein Tag im April 45. Vielleicht ist es auch Nacht. Hier unten ist es sowieso dunkel, bis auf die eine Glühlampe, die von der Decke baumelt, oft flackernd, wenn sie überhaupt brennt. Sonst zünden sie Stearinkerzen an verschiedenen Ecken des Raumes an, der so an die 20-25 m² groß ist und mit Stühlen an den Wänden vollgestellt ist, auf denen nun alle Hausbewohner sitzen, sich unterhalten, schlafen oder nur vor sich hin stieren.
Es sind fast nur Frauen und ein paar Kinder. Die Männer, die noch hier unten sind, sind ganz alt bis auf den Luftschutzwart, der sicher auch schon über 50 Jahre alt ist. In der Mitte des Raumes tragen zwei Holzstiele zwei Balken, die auch an den Wänden unterstützt sind. Alle Holzbalken sind mit einer weißen Farbe gestrichen, es sei ein Flammenschutzanstrich hat man mir erklärt.
Es riecht nach Menschen, nach alten Leuten, nach feuchten Klamotten, nach Stearin, nach Keller und hin und wieder nach Pisse und Erbrochenem. Wenn die Angriffe direkt über uns hinweggehen und alles bebt und wackelt, höre ich Einzelne wimmern. Die Angst vor dem Tod, vorm Verschütten und Verbrennen ist dann unmittelbar spürbar.
Bisher ist unser Haus verschont geblieben, obwohl ringsum eine Schneise der Zerstörung gebombt wurde. Die Bomber sollen die Kantgarage treffen, da dort riesige Treibstofftanks im Keller liegen. Dann wäre von uns nichts mehr übrig. Bei jedem Angriff auf die Garage rieselt der Putz aus den Ziegeln der Decke über uns und unter uns bebt der Boden durch die Explosionen. Jetzt wieder ist eine Detonation direkt über uns oder im Nebenhaus? Alle fahren erschreckt mit den Köpfen hoch und der Luftschutzwart macht die Tür auf und schnell wieder hinter sich zu, um nachzusehen.
Direkt über unserem Luftschutzraum liegt der Lebensmittelladen und darüber sind die Vierzimmerwohnungen an der Brandwand zur Weimarer Straße 27. Hier im Keller ist auch ein Fluchtweg an der Brandwand markiert, die dann aufgebrochen wird, falls unser Haus getroffen und wir darunter verschüttet werden.
Der Luftschutzwart kommt erregt zurück und ruft, "Löschkommando! Eine Brandbombe hat das Dach und das vierte Geschoss getroffen und ist in die 27 rein! Also los, Löscheimer nehmen". Die Angriffswelle ist vorüber und die alten Männer und fast alle Frauen, auch Mutter, stürzen hinaus. Frische Luft kommt rein, aber auch der beißende Geruch von Verkohlten. Ich muss husten und andere mit mir. Oma streicht mir über den Kopf und sagt nichts.
Tage und Nächte vergehen mit Schlafen, Dösen und Warten. Hin und wieder essen wir trockenes Brot. Ein Löffel Ersatzhonig wäre wundervoll im Mund und liesse die Stunden erträglich sein. Zum Spielen bin ich schon viel zu müde. Wenn ich zwischendurch eingeschlafen bin, wache ich meistens durch die Detonationen und das Schießen von draußen auf.
Ich höre fremde Laute vom Hof, eine nie gehörte Sprache. Die Frauen tuscheln und verändern ihr Äußeres. Die Jüngeren verbergen sich hinter den Alten, schmieren Dreck ins Gesicht, zerreißen ihre Kleidung. Es donnert an der Tür. Mutter nimmt mich auf ihren Schoß. Immer mehr Schläge an der Tür. Es dröhnt im Keller. "Die Russen sind da!" Die Eisentür ist nur von innen zu öffnen. Der Luftschutzwart dreht endlich die Hebel auf. Die Tür fliegt auf und dunkle Gestalten mit Maschinenpistolen dringen ein. Totenstille und angehaltener Atem. Der Luftschutzwart hat sich hinter der Tür versteckt. Die Russen, sind es drei oder vier? haben Taschenlampen und leuchten uns ins Gesicht. "Frau, komm mit!". Sie greifen eine von den Hausbewohnerinnen, noch eine und ziehen sie hinter sich her. Die Schreie und das Weinen verlieren sich im Dunkeln.
Andere Russen kommen: "Uri, Uri". Sie reißen den Leuten die Uhren und den Schmuck vom Körper.
Dann kommt eine Gruppe mit einem Offizier, der etwas Deutsch kann. Er erklärt, dass wir keine Angst haben müssten. Die Russen seien ein friedliches Volk und in der Kantstraße Nr. 48 sei eine Kommandantur eingerichtet worden. Aufatmen bei allen.
Als erneut Russen in unseren Keller eindringen, rufen alle im Raum: "Kommandantura" und zeigen in die Richtung des Haues Nr.48. Die Soldaten bleiben stehen, diskutieren und ziehen sich zögernd zurück.
Immer wieder dieselben Ängste und das Aufatmen danach. Wie viele Tage wir hier noch bleiben müssen, wissen wir nicht.
Lebensmittel besorgen I
Es soll Brot geben. In der Leibnizstraße. Dort ist noch ein Bäcker tätig. Von draußen sind Schüsse, Rufe, Maschinengewehrfeuer zu hören. Wir haben schon seit Tagen kein frisches Brot mehr gegessen. Brot mit einer Kruste, das wäre schön. Nach langem Zögern entschließt sich Mutter den Weg zu wagen. Über den Hof zur Kantstraße 48, dort durch den Hausflur auf die Kantstraße, an den Ruinen der nächsten Häuser im Schutz der Schuttberge, mehr oder weniger im Zickzackkurs in Richtung Zoo gehetzt. Bis zur Leibnizstraße sind es nur 200 Meter. Es gibt aber nur noch ein Haus, das nicht zerstört wurde und den Schutz der Eingänge bietet. Um die Ecke gerannt. Dort ist das nächste Haus auf dieser Seite erhalten. Von der großen, schweren Holztür lässt sich nur ein Flügel öffnen.
Jetzt erst mal durchatmen. Es stehen noch mehr Frauen in der Toreinfahrt. Vom Hof fällt genug Licht in das Dunkel, sodass sie die angespannten Gesichter unter den Kopftüchern erkennen kann. Draußen wird schon wieder geschossen. Auf der anderen Seite, so schräg gegenüber, ist die Bäckerei durch den schmalen Spalt des angelehnten Türflügels zu erkennen. Hin und wieder drängt sich eine Frau hinaus und beginnt zu laufen. Im Laufe der Zeit kommen noch andere hinzu, die von der Nachricht gehört haben. Außer Atem springen sie in den Schatten der Einfahrt, klopfen an die Tür um Unterschlupf zu finden.
Jetzt kommt eine junge Frau mit einem Brot unter dem Arm vom Laden herüber gerannt. Es wird geschossen. Sie rennt im Zickzack auf die Hofeinfahrt zu. Auf dieser Seite der Straße ist die Durchfahrt der einzige Schutz. Der Torflügel wird einen Spalt aufgemacht um sie hereinzulassen. Geschosse schlagen in das Holz der Flügel. Einige durchschlagen die obere Füllung. Die Frauen drängen zur Wand oder werfen sich zu Boden. Mutter steht dicht an der Öffnung hinter den dicken Rahmenhölzern, die die Einschläge abfangen. Noch einen großen Schritt und die Frau ist in Sicherheit.
Plötzlich schreit sie auf, stolpert nach vorn in die Durchfahrt, fällt auf das Gesicht und das Brot liegt neben ihr auf dem Boden. Sie bewegt sich nicht mehr. Ob sie nur ohnmächtig ist? Oder tödlich getroffen? Hilfe gibt es nicht. Keinen Arzt, keinen Sanitäter. Mutter nimmt das Brot auf und wartet viele lange Minuten. Die Schießerei nimmt ab. Einige Zeit später kommen wieder Frauen mit Broten unter den Armen über die Straße gelaufen. Kein weiterer Schuss. Durch den Spalt gezwängt, wieder im Freien, tritt Mutter in Hasensprüngen den Rückweg über die Schuttlandschaft der Kantstraße an. Völlig erledigt, aber erleichtert und unverletzt gelangt sie in unseren Keller.
Lebensmittel besorgen II
Was ist denn da hinten an der Kant- Ecke Leibnizstraße los? Dort an der alten gusseisernen Pumpe liegt ein zweirädriger Karren mit den Deichseln nach vorn in Richtung Zoo unserem Blick entzogen. Deshalb können wir, Mutter und ich, auch nicht genau erkennen, was vor dem Wagen zwischen den Deichseln geschieht. Ich sehe Menschen mit Eimern in der Hand rennen. Um Wasser zu holen, muss man nicht rennen, denke ich.
Eine Traube Menschen umgibt den Karren, von dem nur die Rückfront zu sehen ist. Der Karren scheint leer zu sein. Wir beginnen nun ebenfalls zu laufen. Da ruft Mutter, “ein Pferd liegt am Boden! Geh du mal schon weiter, ich laufe schnell nach Haus einen Eimer holen“. “Wozu einen Eimer?“, grübele ich.
Beim Näherkommen sehe ich zwischen den Leuten, die vornübergebeugt wild herumfuchteln, im Sonnenlicht etwas aufblitzen. Viel kann ich noch nicht erkennen, weil viele Unentschlossene um das Geschehen herumstehen. Es riecht beim Herantreten ziemlich penetrant, ganz anders als Pferdemist, so süßlich. Durch einen Spalt der Menschentraube quetsche ich mich Stück für Stück nach vorn durch. Wirklich, ich sehe ein Pferd, es ist zusammengebrochen. Aber es ist nicht mehr vollständig.
Große Stücke aus dem Leib fehlen bereits. Der Kopf und die Unterschenkel sind noch unversehrt. Aber sonst überall das rohe, dunkelrote Fleisch und Blut fließt auf die Straße. Einige versuchen das Blut in Töpfen aufzufangen. Was ich von weitem blitzen sah, sind die Messer, die immer tiefer in den Körper dringen und schneiden. Die Augen des Tieres blicken ins Weite. Es ist fast so, als wäre es noch gar nicht tot. Es zuckt sogar noch, oder ist das Zucken durch das Schneiden und Ziehen und Stoßen der Messer verursacht? Mir wird ein bisschen schummrig vor Augen.
Die Leute sind wie im Rausch. Sie schreien von allen Seiten, “bring mir auch ein Stück! Da hinten ist noch was dran!“ Jetzt liegt das Skelett schon fast frei und immer mehr Leute kommen angerannt um ein Stück zu ergattern. Ich stehe dazwischen, wie erstarrt. Ich kann nichts tun, ich kann nicht weg. Ich muss auf dieses Tier schauen, wie es weniger und weniger wird und höre wie die anderen um mich herum anfangen zu johlen. Sie freuen sich über die unerwartete Gabe des Himmels. Dieses Pferd muss doch jemand gehört haben?
Endlich sehe ich auch Mutter zwischen den Schlachtenden und wie sie ein großes Stück Schenkelfleisch in ihren Eimer wirft. Sie macht mir Zeichen uns eilig zu entfernen, um das Erbeutete nach Hause zu bringen. Dabei sagt sie leise, “das letzte Mal sind sie übereinander hergefallen, als nichts mehr zu holen war. Also komm schnell!“
Als ich mich noch mal umblicke, sehe ich am Straßenrand auf der Bordsteinkante einen alten Mann sitzen, seinen Kopf in die Hände vergraben, schluchzend und weinend.
Panzerspähwagen
Jetzt ist der Schutt vom Bürgersteig auch weggeräumt. Unser Haus steht noch. Bis auf eine Ecke zum Nachbarhaus in der Weimarer Straße ist das große Eckhaus erhalten geblieben. Einschusslöcher und zerstörte Fensterscheiben sind überall zu sehen. Vor der Drogerie an der Ecke hat sich ein Panzerspähwagen in das Granitpflaster eingegraben. Die Reifen sind zerfetzt. Der Wagen ist nach vornüber geneigt, wie ein Stier zum Angriff hat er sich in das Pflaster eingegraben.
Natürlich ist der leer; der Krieg es schon seit Monaten vorbei. Vieles ist auch schon von Schrottsammlern im Inneren abmontiert worden. Es riecht nach Metall und Pisse. Trotzdem spielen wir gerne darin, wenn uns die großen Jungen lassen. Durch einen Schlitz vorn blicke ich auf die Straße, das kurze Kanonenrohr zielt in Richtung Ruine der gegenüberliegenden Straßenecke. Das Lenkrad lässt sich leider nicht mehr drehen, liegt bestimmt daran, dass der kleine Panzer vorn in der Erde steckt. Am schönsten ist es, sich in dem Ding zu verstecken.
Manchmal denke ich an die Menschen, die darin waren und kämpfen mussten und bin froh, dass ich den Krieg nur im Keller erlebt habe. Wie lange der kleine Panzer vor unserem Haus gestanden hat, weiß ich auch nicht mehr. Nachdem es uns langweilig wurde darin zu spielen, haben wir nicht gemerkt, wie er eines Tages abgeholt wurde. Jetzt ist das Pflaster wieder hergestellt.
Aber ich sehe ihn immer noch dort stehen, vornübergebeugt, wie eine Wildkatze zum Sprung bereit.
S-Bahnbrücke
Täglich, von Montag bis Samstag, gehe ich immer denselben Weg zur Schule. Die Kantstraße entlang, vorbei an den Ruinen gegenüber der Kant Garage, vorbei an den hohen Fassaden mit den Fensterlöchern, die den Himmel sehen lassen. Ein Haus gegenüber ist stehengeblieben mit Vorgarten und einer niedrigen Einfassungsmauer aus abgerundeten Klinkersteinen in dunkelbraun und schwarzrot. Darauf balanciere ich jeden Tag beim Vorbeigehen. Im Vorgarten steht noch ein niedriger, knochiger Baum, der rote Blüten trägt.
An der Kantstraße Ecke Leibnizstraße liegen noch immer große Schutthaufen und Reste der Brandwände ragen in die Luft, die nach oben in spitzen Zacken enden oder als Silhouette den ehemaligen Hausumriss erkennen lassen. Die Wände der Erdgeschosse und teilweise darüber sind mit Schutt ausgefüllt, der durch die Öffnungen quillt. Träger und Wellbleche liegen wüst durcheinander. Die Holzbalken und Holzfenster sind nicht mehr da. Entweder sind verkohlte Reste noch übrig oder die Öffnungen sind nackt. Das brennbare Holz hat irgendjemand bereits verheizt. Über den alten Ladenfronten hängen noch Reklamebleche, auf denen <Drogerie>, <Gemischtwaren> oder <Mode für ihn und sie> zu lesen ist, mit Einschusslöchern gesprenkelt.