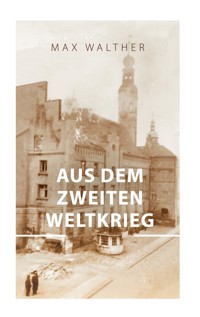
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Akten, amtliche Verlautbarungen, Zeitungsartikel und persönliche Erinnerungen bilden die Grundlage für die Kapitel dieses Werkes, das 1960 verfaßt wurde, aber ungedruckt blieb. Die Verlagerung von Industrieanlagen vor dem Bombenkrieg war bis dahin kaum erforscht. Die Dramatik der letzten Kriegsmonate mit ihren Auswirkungen auch auf den zivilen Alltag wird in der Chronologie deutlich spürbar. Die Veröffentlichung folgt der Originalvorlage.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 52
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Industrieverlagerungen in die Niederlausitz während des Zweiten Weltkrieges
Cottbus in den letzten Kriegsmonaten
Nachwort
Abbildungsverzeichnis
Register
Industrieverlagerungen in die Niederlausitz während des Zweiten Weltkrieges
Die hier wiedergegebenen Ermittlungen stützen sich auf die beim Gewerbeamt Cottbus eingegangenen Anträge auf Zulagekarten für Lang-, Nacht-, Schwer- und Schwerstarbeit, auf Anträge für Waschmittel bei derselben Stelle und Unterlagen des Kriegssachschädenamtes für Cottbus.
Im Oktober 1941 kündete Hitler eine neue Offensive in der Sowjetunion mit den Worten an: „Sie wird mithelfen, den Gegner zu zerschmettern.“ Und unter jubelndem Beifall erklärte er: „– dass dieser Gegner bereits gebrochen ist und sich nie mehr erheben wird!“ Das war, als er seine Hand nach Moskau ausstreckte und dabei den ersten gewaltigen Fehlschlag in seinem Krieg einstecken musste. Die dabei entstandenen Verluste wurden weitgehend verschwiegen. Im Jahre 1942 stand das deutsche Volk im Banne des Vorstoßes auf Stalingrad und zum Kaukasus. Als Churchill im Oktober 1942 erklärte, bei den Nachtangriffen auf Deutschland kämen tausend Flugzeuge zum Einsatz, wurde diese Mitteilung in der nationalsozialistischen Presse ironisiert und bagatellisiert. Aber der Reichswirtschaftsminister hatte bereits am 29. September 1942 eine Anordnung zum Schutz kriegswichtiger Handelsgüter, Fertigwaren und Rohstoffe erlassen. Diese sollten verlagert, Geschäftsdachböden von Waren geräumt und Büromaschinen über Nacht in den Kellern untergebracht werden. Wie sehr sich die Luftlage verändert hatte, zeigt ein Rundschreiben des Oberpräsidenten der Provinz Brandenburg vom 24. Oktober 1942 an alle Wirtschaftsämter. In ihm wurden Auslagerungsmaßnahmen angeordnet für Wittenberge, Rathenow, Brandenburg/Havel, Potsdam, Prenzlau, Angermünde und Eberswalde. Spinnstoffe, Schuhwaren, Haushaltswaren, Seifen, Waschmittel, Drogen, Arzneien und Chemikalien, wenig später auch Tabakwaren, sollten in Lagern außerhalb der bedrohten Städte oder in Stadtrandgebieten untergebracht werden.
Anfang November 1942 erfolgte die Landung der westlichen Alliierten in Nordafrika. Die Einkesselung der 6. Armee vor Stalingrad begann und endete im Februar 1943 mit der Kapitulation ihrer Reste. Diese beiden Tatsachen – besonders die Niederlage vor Stalingrad – verbreiteten ein tiefes Unbehagen, da schärfere Maßnahmen zugunsten der Rüstungsindustrie angekündigt und durchgeführt wurden – im Zeichen des „totalen Krieges“.
Im Februar 1943 wurden besondere Bevorratungsvorschriften für den Glasgroßhandel erlassen. Im April wurde der Reichswirtschaftsminister dringender. Im Mai ergingen Richtlinien für die Einsetzung von Fachbeauftragten für Fliegerschadenschutz. Diese sollten im Verein mit den Wirtschaftsämtern und der Luftschutzpolizei begutachten, ob die vorgenommenen Auslagerungen durch Einzelhandelsgeschäfte oder Grossisten zweckmäßig erfolgten. Die verlangten Verlagerungen mussten zunächst in den Gebieten westlich einer Linie Stettin – Berlin – München – Freiburg erfolgen. Betroffen waren alle Einzelhandelsbetriebe mit einem Warenlager von 50.000 RM Verkaufswert. Alle Fabriken östlich der genannten Linie durften in die gefährdeten Gebiete nur gegen Versandgenehmigung expedieren. Um die Dringlichkeit der Verlagerung zu unterstreichen, wurde abschriftlich ein Brief des Reichsluftfahrtministeriums vom 3. Mai 1943 bekanntgegeben, der wie folgt beginnt:
„Bei den Luftangriffen der letzten Zeit sind wiederum kriegswichtige Lager in wehrmachtseigenen und zivilen Betrieben in beträchtlichem Ausmaß vernichtet worden. … Die Schwierigkeiten [der Auslagerung] werden nicht verkannt, sie müssen jedoch überwunden werden, da andernfalls nicht nur der Erfolg zahlloser Arbeitsstunden zunichte gemacht wird, sondern die Fortführung der Produktion und der Nachschub der Wehrmacht , wie die Versorgung der Zivilbevölkerung schwerstens beeinträchtigt werden.“
Am 7. Juni wurde der Oberpräsident noch dringender. Die Auslagerungsmaßnahmen erstreckten sich nunmehr über die ganze Provinz. Bei ernsthaften Verstößen dagegen soll dem Reichsmarschall Mitteilung gemacht werden. Das war zu einer Zeit, als man sich etwas von Görings Kaltstellung zuraunte, weil die Luftabwehr sich als vollkommen ungenügend erwiesen hatte. Die Verlagerung – so wurde angeordnet – müsse mit größter Energie betrieben werden und bis zum 15. Juli 1943 beendet sein. Zu den bereits der Verlagerung unterliegenden Warengattungen kamen neu hinzu Holz und Holzwaren, Elektrokleinteile, Pelzwaren und Kautschuk. Die Auflockerung innerhalb der Betriebe wurde auf Schweißaggregate, Kraftfahrzeuge und Elektrokarren ausgedehnt, deren Unterbringung an zentraler Stelle bei Luftangriffen mehrfach zu erheblichen Verlusten geführt hatte.
Der Oberpräsident ließ am 8. Juni 1943 Erfahrungen aus den Luftangriffen auf Düsseldorf und Essen zirkulieren. Der Erfahrungsbericht datiert vom 22. April – man hatte sich also reichlich Zeit genommen, um die gewonnenen Erfahrungen zu verbreiten. Nach diesem Bericht wurden in einer nicht genannten Stadt die Fernsprechzentrale und der Wagenpark zerstört. Die Zusammenballung großer Geschäfte in der Innenstadt müsse vermieden werden (!). Reservelager in Kellern bieten keinen Schutz. Schuster dürfen Reparaturen nur für eine Woche annehmen; die Kundschaft muss die Ware dann sofort abholen. Die Bevölkerung soll die wichtigsten Ausweispapiere bei sich tragen.
Vom 18. bis 25. Juli 1943 erfolgten am hellen Tage schwere Luftangriffe auf Hamburg. Eine entsetzte Bevölkerung wurde – soweit sie die Stadt verlassen durfte – bis in die Niederlausitz evakuiert. Um diese Zeit forderte die britische Regierung in zahlreich abgeworfenen Flugblättern die Bevölkerung der Groß- und Industriestädte auf, diese gefährdeten Städte zu verlassen, da mit Bombardierungen zu rechnen sei. Auf den Spreewiesen zwischen Burg und Peitz wurden solche Flugblätter in großer Menge gefunden. Der Ratschlag war natürlich für den größten Teil der Bevölkerung völlig wertlos.
Der Regierungspräsident zu Frankfurt/O. verbreitete am 5. Juli 1943 die Abschrift einer Abschrift eines Göringschen Briefes, in dem von den vollzogenen Verlagerungen Kenntnis genommen wurde. Gleichzeitig erfolgte aber der Hinweis auf die noch immer hohen Materialverluste. – Der Verlagerung unterlagen im August auch Lebensmittel. Frauen wurden in verstärkter Anzahl zur Rüstungsindustrie herangezogen.
Der Oberbürgermeister von Cottbus ließ am 10. November einen Auszug aus einem Erfahrungsbericht des Oberbefehlshabers der Luftwaffe abschreiben, in dem auf die großen Verluste in wehrmachtseigenen und zivilen Betrieben durch ungenügende oder noch nicht erfolgte Auslagerung hinwiesen wurde. Auch hier ist das Datum des Erfahrungsberichtes auffallend: Er stammte nämlich vom 10. Juli! Verluste konnten demnach auch nicht mehr durch Verlagerungen vermieden werden! Nach der Bombardierung Hamburgs sah sich die Regierung gezwungen, eine teilweise Räumung Berlins von abkömmlichen Frauen mit Kindern durchzuführen. Die heftigen Bombardierungen Berlins ab 18. November 1943 richteten dort gewaltige Schäden an; zahlreiche Ausgebombte wurden auch in Cottbus untergebracht.
Industrie und Handel erhoben gegen die Auslagerungen sanfte Proteste, wie man aus einem Schreiben des Oberpräsidenten vom 3. April 1944 schließen kann. Er rechtfertigt die von den Luftgaukommandos verlangten Maßnahmen. Die Anordnungen werden als reiflich überlegt bezeichnet, sie müssen ungeachtet der bestehenden Transportschwierigkeiten, trotz Arbeiter-, Raum- und Baustoffmangel durchgeführt werden.
Das Jahr 1944 brachte für Cottbus den ersten Tagesalarm (30. Januar). Am 8. März flog bei Sonnenschein ein Geschwader über Cottbus völlig unangefochten. Dieses Ereignis erfüllte die Gemüter mit banger Ahnung eines kommenden Unheils.
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben:





























