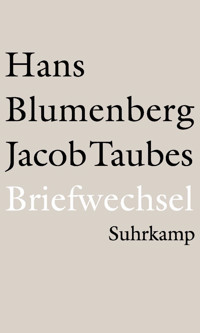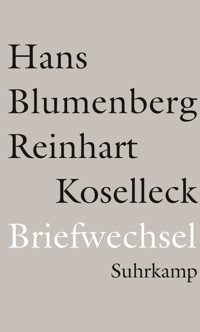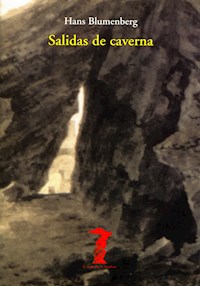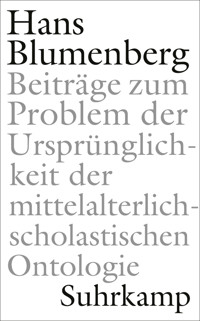35,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Hans Blumenbergs Anthropologie ist eine philosophische Entdeckung ersten Ranges. Sie setzt ein mit einer einfachen, aber überaus folgenreichen These: Weil der Mensch als einziger unter den Primaten dauerhaft aufrecht steht und geht, kann er zwei Dinge besonders gut: sehen – und gesehen werden. Die Optimierung der visuellen Wahrnehmung geht einher mit dem Risiko erhöhter Visibilität. So exponiert zu sein, formt sein Weltverhältnis und macht ihn zum Virtuosen der Selbstinszenierung, aber auch der Selbstverstellung und Selbstverhüllung. Sichtbarkeit bedeutet deshalb auch: Der Mensch ist undurchsichtig – für andere wie für sich selbst. Blumenbergs überaus materialreiche Anthropologie hat ihren theoretischen roten Faden in dieser dezidiert phänomenologischen Ausrichtung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1295
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Hans Blumenbergs Anthropologie ist eine philosophische Entdeckung ersten Ranges. Sie setzt ein mit einer einfachen, aber überaus folgenreichen These: Weil der Mensch als einziger unter den Primaten dauerhaft aufrecht steht und geht, kann er zwei Dinge besonders gut: sehen – und gesehen werden. Die Optimierung der visuellen Wahrnehmung geht einher mit dem Risiko erhöhter Visibilität. So exponiert zu sein formt sein Weltverhältnis und macht ihn zum Virtuosen der Selbstinszenierung, aber auch der Selbstverstellung und Selbstverhüllung. Sichtbarkeit bedeutet deshalb auch: Der Mensch ist undurchsichtig – für andere wie für sich selbst. Blumenbergs überaus materialreiche Anthropologie hat ihren theoretischen roten Faden in dieser dezidiert phänomenologischen Ausrichtung.
Hans Blumenberg (1920-1996) war zuletzt Professor für Philosophie an der Universität Münster. Im Suhrkamp Verlag sind zuletzt von ihm erschienen: Geistesgeschichte der Technik (2009); Quellen, Ströme, Eisberge. Beobachtungen an Metaphern (2012) sowie Hans Blumenberg/Jacob Taubes, Briefwechsel 1961-1981 (2013).
Hans Blumenberg
Beschreibung des Menschen
Aus dem Nachlaß herausgegeben von Manfred Sommer
Suhrkamp
Zur Gewährleistung der Zitierbarkeit zeigen die grau hinterlegten Ziffern die jeweiligen Seitenanfänge der Printausgabe an.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation
in der Deutschen Nationalbibliografie;
detaillierte bibliografische Daten sind im Internet
über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2014
Der vorliegende Text folgt der Erstausgabe, 2006.
© Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main 2006
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das der Übersetzung, des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.
Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.
eISBN 978-3-518-73957-0
www.suhrkamp.de
Inhalt
7Erster TeilPhänomenologie und Anthropologie
Statt zu sagen, er leugne Gott,
könnte man sagen, er leugne den Menschen.
Heine über Spinoza
9IDasein oder Bewußtsein
Wovon soll in der Philosophie die Rede sein? Im Gegensatz zu allen anderen Wissenschaften, in denen man zuerst weiß, worüber geredet werden soll, und dann allmählich klärt, wie solches Reden stattfinden soll, welcher Mittel man sich bedienen wird und in welchen Grenzen Erkenntnis gewonnen werden kann, entscheidet sich für die Philosophie, wovon in ihr die Rede sein soll, schon als eine Sache der Philosophie.
Am Ende einer langen Geschichte sieht es so aus, als hätte die Philosophie ihre einigermaßen gleichberechtigten Disziplinen und Unterdisziplinen wie andere Erkenntnisgebiete auch; unterschieden gelegentlich dadurch, daß behauptet wird, man müsse erst das eine und dann das andere tun. Aber faktisch hat sich noch kein Philosoph damit begnügt, das bloße Tableau der möglichen Gegenstände zu betrachten und in ihm von Fall zu Fall seine Wahl zu treffen. Wenn Husserl vom ›Bewußtsein‹ spricht, legt er größten Wert darauf, dies sei nicht vorzugsweise oder ausschließlich das menschliche Bewußtsein, sondern Bewußtsein überhaupt, das Bewußtsein in seinem Wesen, das Wesen von Bewußtsein. Wenn Heidegger vom ›Dasein‹ spricht, legt er größten Wert darauf, dieses sei trotz der umfassenden Analysen seines Hauptwerks keineswegs sein Hauptgegenstand, sondern nur der methodische Vorlauf oder Durchgang für das, was er wirklich wolle: die Frage nach dem Sinn von Sein zu stellen und die Antwort darauf eben bei der einzigen uns bekannten Adresse zu holen, wo sie als gegeben vorausgesetzt werden müsse.
Beide Vorgänge haben gemeinsam, daß in ihnen der unvermeidlich auftauchende Mensch sich selbst gleichsam durchsichtig und transitorisch zu machen hat, um einen anderen großen 10Aspekt freizugeben. Ist dies etwa eine Wertentscheidung zwischen den möglichen Themen der Philosophie? Wenn, dann jedenfalls nur mittelbar. Für Husserl läßt sich leicht feststellen, daß er die eigentümliche, gar nicht selbstverständliche Präferenz der Erkenntnistheoretiker für das teilt, was den höchsten und uneingeschränkten Gewißheitsgrad verspricht. Die erreichbare Qualität der Erkenntnis bestimmt, welche Gegenstände den Rang der philosophischen erhalten, gleichgültig welchen Wertbetrag sie aus der sonstigen Motivation des Erkennenden an sich ziehen können. Die Frage: Was können wir wissen? – in Kants Katalog der großen Fragen die erste – bestimmt, als im voraus entscheidbare, den gegenständlichen Horizont auch der Philosophie. Für Husserl wird man noch verschärfen müssen: Was können wir in Evidenz, in Selbstgegebenheit, als Phänomen haben? Was nicht auf diese Weise gewußt werden kann, ist der phänomenologischen Anstrengung nicht würdig. Was es aber ist, was derart in Betracht kommen wird, das entscheidet sich erst im Prozeß der Erkenntnis selbst, ausgenommen die eine Vorentscheidung, es könne jedenfalls nicht das von der kontingenten Existenz der Welt und damit des Menschen abhängige Wissensmögliche sein, das Feld positiver Wissenschaftlichkeit, das, absolut gesetzt, zu Naturalismus und Psychologismus führt.
Bei Heidegger sieht die Entscheidung etwas anders aus. Für ihn ist das Sein Thema ersten und einsamen Ranges. Alles andere steht in dessen Dienst, obwohl der Gewißheitsgrad der Aussagen, die auf die Frage nach dem Sinn von Sein gemacht werden können, keineswegs absehbar ist. Ja es ist nicht einmal absehbar, ob die ganze Anstrengung nicht vergeblich wäre, was sie durch Ausbleiben des entscheidenden Stücks von »Sein und Zeit« doch tatsächlich ist. Aber – auch dies kein zureichender Grund, sie zu unterlassen oder zu bedauern. Der Grund für diesen Vorrang liegt im Verhältnis von Sein und Seiendem selbst, also in der ontologischen Differenz: So wie das Sein allem vorhandenen Seienden Sein verleiht, so ist es, Umkehrung 11der Richtung, der allein befriedigende Endpunkt einer Anstrengung der Erkenntnis. Der Rang des Gegenstandes ist es, der die Frage nach der möglichen Evidenz nahezu vergessen läßt: Wäre es möglich, von diesem Gegenstand auch nur das Geringste in einigermaßen tragfähiger Wahrscheinlichkeit herauszubringen, so wäre dies allen anderen möglichen Ergebnissen der Philosophie in höherer Evidenz immer noch vorzuziehen.
Im Grunde ist diese Klasse der phänomenologischen Schule durch eine gründliche Änderung der Fragestellung Kants gekennzeichnet. Sie fragt nicht mehr, was wir wissen können, sondern was zu wissen uns selbst auszeichnet, als im Dasein Angelegtes allein diesem Dasein aufs höchste angemessen ist. Obwohl also vom Menschen nur die Rede sein soll, insofern er diese höchste Aufgabe in sich vorfindet, ist es eben diese höchste nur und wiederum als die seine. Die Frage nach dem Sinn von Sein erscheint indirekt als die einzige noch mögliche Entsprechung zur ursprünglichen Aufgabenstellung der Phänomenologie: nach dem Wesen der Dinge zu forschen, durch die phänomenologische Reduktion die Ausschließlichkeit dieses Forschungsgegenstandes zu gewährleisten. Es gibt noch eine Antwort auf jene ursprüngliche Frage nach dem Wesen, nämlich die nach dem Wesen des Daseins. Es ›besteht‹ darin, Seinsverständnis nicht nur zu haben, sondern es zu sein; was immer heißt: es als Inbegriff aller Verhaltensweisen zu leben, als Leben in der ›Sorge‹ um sich selbst darzustellen. Aus dieser Art von ›Wesen‹ ergibt sich, was allein diesem ›Dasein‹ als seine Handlung aufs höchste wesentlich werden kann: sein je schon besessenes Seinsverständnis sich in der Weise einer disziplinierten Gesamtheit von Aussagen zu erschließen, sich selbst vorzuführen. Nach sich selbst zu fragen hat es nur insoweit, als es in dieser Funktion geschieht.
Der Mensch ist nicht das Thema. Aber er ist die alleinige Fundstelle des Themas, der Ort nicht nur seiner Anwesenheit, sondern auch seiner Rechtfertigung. Was es bedeutet, Seinsver12ständnis zu haben, wissen wir nur von uns selbst und für uns selbst. Wir erfüllen eine Art Fatum, wenn wir daraus Philosophie machen.
Für Husserl ist Philosophie im Grunde nur das, was uns vergessen läßt, daß wir es sind, die sich diese Fragen stellen und diese Antworten finden. ›Selbstvergessenheit‹ charakterisiert den Typus und die Erfolgsbedingung des Phänomenologen. Das steckt schon am Anfang in der ersten phänomenologischen Reduktion. Sie verbietet, davon Notiz zu nehmen, daß Sachverhalte von uns nur zufällig deshalb benannt und thematisiert werden können, weil wir in einer kontingent existierenden Welt als diese Subjekte mit dieser Wahrnehmungsorganisation leben. Der Kunstgriff, dagegen erhabene Gleichgültigkeit herzustellen, besteht in der transzendentalen Reflexion auf das Cogito. Bei allem positiven Wissen konnte die Frage sein: Was können wir wissen? Beim Rückgang auf das reine Wesen dessen, der Ego Cogito sagen kann, lautet die Frage: Was und wie kann gedacht, zum Inhalt des Bewußtseins gemacht werden?
Das verdächtige ›Wir‹ ist verschwunden, das ›Ich‹ ist der bloße Ausdruck für die Identität eines Bewußtseins, das sich in der Zeit konstituiert. Die transzendentale Reflexion erschließt den einzigen Bereich, in dem absolute Gewißheit möglich ist; den Einwand, der seit Descartes gegen diese Gewißheit erhoben worden ist, sie sei punktuell und allzu dürftig, um als alleinige Befriedigung des Anspruches auf Wissen zu genügen, kann die Phänomenologie zum ersten Mal dadurch abwenden, daß sie in der transzendentalen Reflexion selbst die unabsehbare Erweiterung auf die Thematik eines reinen Bewußtseins überhaupt durchführt.
Die transzendentale Reflexion ist der Kunstgriff, der es gestattet, das Evidenzerfordernis der Wesensschau auf das schauende, denkende, erkennende Subjekt selbst anzuwenden. Sie verhilft dazu, es in Richtung seiner transzendentalen Bedingtheit zu überschreiten, die absolute Subjektivität zum Thema zu machen. Nun wird man sagen, dies sei kein für die Philosophie 13wesentlicher, notwendiger Vorgang. Es sei das Schicksal der Bewußtseinsphilosophie, des Idealismus, zugunsten seiner absoluten Ansprüche auf das Interesse des Menschen an sich selbst verzichten zu müssen. Aber selbst wenn das so ist, woher kommt die Bereitschaft zu dieser Lösung? Die Antwort kann nur sein: Es ist die Konsequenz der theoretischen Einstellung selbst.
In ihrer Gestalt der neuzeitlichen Wissenschaft beginnt sie als eine Funktion, ein ›Organ‹ des Menschen, seines Weltinteresses, seiner intellektuellen Neugierde. Aber indem sie ihn dazu zwingt, diesem Antrieb durch Objektivierung seiner eigenen Erkenntnisleistung zu genügen: durch Ausschaltung der subjektiven Anteile, durch Neutralisierung der Perspektive, durch Ersetzung der organischen Maßstäbe mittels mechanisch-quantitativer. Im Maße des Erfolgs, den die theoretische Einstellung erzielt, macht sie ihrerseits den Menschen zum Funktionär des Ziels, das er sich gesetzt hat. Diese Funktionalisierung heißt wissenschaftliche Arbeit, heißt Forschung. In ihr verschwindet das Subjekt als individuelles, um als generelles wiederaufzutauchen. Nur die Gattung kann und soll Nutznießer der Wahrheit sein.
Man sieht leicht, daß dies mit Idealismus oder transzendentaler Reflexion noch nichts zu tun hat. Das Gattungssubjekt ist ein Konstrukt, das die sonst rätselhafte Tatsache erklärt, daß Wissenschaft mehr ist als alle Leben, die sich an ihr beteiligen und deren Arbeitsertrag in sie eingeht. Die Idee der Wissenschaft enthält das eigentümliche Verschwinden des Menschen als Gestalt, als Individuum, als konkrete Figur aus der theoretischen Szene. Wo er sich an sein Selbstinteresse unter dem Schlagwort der Bildung klammert, hält ihm auch der Positivist und gerade dieser die kopernikanische Konsequenz seiner exzentrischen Unwichtigkeit vor Augen.
Ernst Mach hat am 16. April 1886 auf der Tagung des Deutschen Realschulmännervereins in Dortmund einen Vortrag »Über den relativen Bildungswert der philologischen und der 14mathematisch-naturwissenschaftlichen Unterrichtsfächer der höheren Schulen« gehalten und dabei über das Verhältnis von Selbstinteresse und Weltinteresse des Menschen gesagt: Gewiß geht den Menschen zunächst der Mensch an, aber doch nicht allein. Dieses ›Zunächst‹ verflüchtigt sich unter dem Druck der anerkannten Übermächtigkeit desjenigen Gegenstandes, der der Mensch eben nicht selbst ist, den zu durchdringen er geradezu auf sein Selbstinteresse, auf seinen Zentralwahn verzichten muß: Wenn wir den Menschen nicht als Mittelpunkt der Welt ansehen, wenn uns die Erde als ein um die Sonne geschwungener Kreisel erscheint, der mit dieser in unendliche Ferne fliegt, wenn wir in Fixsternweiten dieselben Stoffe antreffen wie auf der Erde, überall in der Natur denselben Vorgängen begegnen, von welchen das Leben des Menschen nur ein verschwindender gleichartiger Teil ist, so liegt hierin auch eine Erweiterung der Weltanschauung, auch eine Erhebung, auch eine Poesie! Vielleicht liegt hierin Größeres und Bedeutenderes als in dem Brüllen des verwundeten Ares, in der reizenden Insel der Calypso, dem Okeanos, der die Erde umfließt. Über den relativen Wert beider Gedankengebiete, beider Poesien, darf nur der sprechen, der beide kennt!
Die eigentümliche Konsequenz dieses gegen den Bildungshumanismus gerichteten Pamphlets besteht nun darin, daß die Welt nicht nur den Menschen auch beschäftigen soll, wie es in der These vorausgeschickt worden war; entscheidend wichtiger ist, daß ihm in dieser Auch-Beschäftigung das Maß eröffnet wird, in welchem er sich wichtig nehmen darf. Wir sehen den Menschen nicht als Mittelpunkt der Welt an, ist das Resultat dieses Aufblickens von den Büchern der Griechen auf das Universum. Akzeptiert, aber mit welchem Recht darf daraus gefolgert werden, dann könne oder dürfe der Mensch auch nicht der Mittelpunkt seines eigenen Interesses sein?
Hier steckt eben doch wieder die alte, oft genug bestrittene Voraussetzung, es sei dem Menschen mittels seiner Stellung in der Welt etwas vorgezeichnet und mitgeteilt, und zwar vor15zugsweise, von welchem Gewicht er sich selbst zu sein habe. Wie hat man sonst zu verstehen, daß uns die Erde, als ein um die Sonne geschwungener Kreisel, mit dieser in unendliche Ferne zu fliegen scheinen soll? Wo wir doch darauf bestehen, daß ›in unendliche Ferne fliegen‹ heißt, sich von dem Punkt, an dem wir uns befinden, in dieser Weise zu entfernen, sich von uns zu entfernen. Davon aber kann auch für unsere kosmische Erfahrung gar keine Rede sein, und es dürfte jemand durchaus sagen, diese Vorstellung sei ein Konstrukt, das ihn nichts angehe. Im Text von Mach aber wird dieses Paradox zur Metapher dafür, daß der Mensch seinen eigenen Blicken in unendlicher Ferne zu entschwinden scheint, wenn er das Universum nur gründlich genug betrachtet. Äußerste Konsequenz wäre, daß er in seinem Bild von der Welt überhaupt nicht mehr vorkommt, dann aber auch dieses Bild ihm nichts mehr zu bedeuten hat. Er wäre das Laplacesche Subjekt, das die Welt nach Bedarf erkennen kann, aber diesen Bedarf wiederum nicht hat, weil es in der ihm erkennbaren Welt selbst nicht vorkommt und nichts seiner Art ihm erkennbar wäre, selbst wenn es darin vorkäme. Ohne alle transzendentale Phraseologie wird fast zwanglos ihr identisches Ergebnis fällig, daß wir über uns schweigen: De nobis ipsis silemus.
Das Verschwinden des Menschen aus dem eigenen Bild, das er sich theoretisch von der Welt macht im Maße, in dem dieses Bild sich vervollständigt oder auch nur erweitert, hat etwas von dem großen mythischen Vorgang an sich, den Freud unter dem Titel ›Todestrieb‹ beschrieben oder erzählt hat.
Man darf diese ›Geschichte‹ nicht als die eines beschränkten psychischen Rückwegs von den Höhen des Lustprinzips sehen. Sie ist vor allem die schlechthinnige Universalgeschichte, die unter dem Druck des Zweiten Hauptsatzes der Thermodynamik geschrieben werden mußte: Alle physischen Zustände tendieren auf ihre größere Wahrscheinlichkeit, auf Nivellierung aller thermischen Ungleichheiten und damit energetischen Potentiale – also auch und vor allem das Leben, als der bei weitem 16unwahrscheinlichste Zustand physischer Systeme, am ausgeprägtesten in der thermischen Homöostase des Säugetierorganismus, dessen ganzer Stoffwechsel rigide Ausbeutung vorgespeicherter Energie ist und sein muß. Das Leben, die Seele als dessen Selbstdarstellung, können nur episodische Vorkommnisse im Universum sein, dessen Ausschöpfung im günstigsten aller Augenblicke für etwas so Außerordentliches ›gegen alle Natur‹, obwohl doch nur durch die Natur.
Erst recht für das Leben, sofern es sich die Verfeinerung der Individualität, der Person, des Je-Einzigen leistet. Denn auch dies, nicht nur gleiches unter gleichem, in den Reproduktionen einer Gattung zu sein, verschleudert Energie, wie man daran sehen kann, daß der Idee neuzeitlicher Wissenschaft unmittelbar die zentrale Formation der Epochenidee der scholastischen ›Summa‹ als Leistung eines Einzelnen vorausgegangen war. Der Erfolg der neuen Wissenschaft ist die Einebnung der Subjektivität, der Todestrieb dessen, der für sich und seinesgleichen auf der ganzen und lebenserfüllenden Wahrheit besteht, um diese wenigstens für die Gattung, das Generalsubjekt, zu retten.
Es ist eine fatale Ironie, daß eben diese Rettung durch objektive Konstitution der Erkenntnis, durch überindividuelle Methode, durch raumzeitindifferente Organisation der Institution ›Forschung‹ – daß eben dieser Versuch, die Wahrheit über die Welt zu trennen von den Bedingtheiten des Menschenlebens, zur Nivellierung auch der Gattung im Gesamtresultat solcher Erkenntnis führt. Wissenschaft ist ›Todestrieb‹ der Gattung, lange bevor sie diese ernstlich zu gefährden in die Lage kommt. Es gibt, streng genommen, keine Disziplin der positiven Wissenschaften, die es nur und speziell mit dem Menschen zu tun hätte. Die Namengebung ›Anthropologie‹ ist so dubios wie ›Ökotrophologie‹: ein Sammelsurium von einschlägigen Stücken der Biologie, von Evolutionismus, von Genetik.
In der Vollstreckung der Idee von Wissenschaft vollstreckt der Mensch an sich selbst, indem er seine Möglichkeiten in der Welt ernst nimmt, das Gesetz der Entropie: Er verliert sich als un17wahrscheinliches Ereignis im physischen Universum. Die Frage ist, ob auch die Philosophie diesem Fatum nicht entgehen, ja an seinem Vollzug nur mitwirken kann, indem sie ihre eigene Idee realisiert.
Verschweigt eine Veranstaltung oder Abhandlung gerade das, wovon zu handeln sie in ihrer Ankündigung oder ihrem Titel zugesagt hat, muß das nicht ein Anzeichen für Verwirrung beim Veranstalter oder Verfasser sein, es kann auch ein Krisensymptom bedeuten, die erste Anzeige einer Schwierigkeit, über die Klarheit bis dahin nicht bestanden hatte.
Im Juni 1931 spricht Husserl auf seiner ersten und voraussichtlich einzigen Vortragsreise in Deutschland über Frankfurt und Berlin nach Halle zum Thema »Phänomenologie und Anthropologie«.[1] Damit unternahm er eine verzweifelte und bis zur Erschöpfung gehende Anstrengung, der größten Gefährdung entgegenzutreten, die bis dahin seiner Phänomenologie erwachsen war. Er sah sie in einer sich auf den phänomenologischen Ansatz berufenden Philosophischen Anthropologie. Man erwartete wohl allerorts, daß er sich der endogenen Veränderung seines Konzepts von Philosophie nun entgegenwerfen würde. Anders ist nicht zu erklären, daß in Berlin nicht weniger als 1600 Zuhörer ins Auditorium maximum der Universität zusammenströmten. Der Berliner Börsen-Courier vom 12. Juni 1931 überschreibt seinen Bericht in jeder Hinsicht hyperbolisch: »2500 Philosophen in der Universität«. Das Berliner Tageblatt vom 11. Juni spricht von Scharen von Hörern, die umkehren mußten, und begründet eine makabre Fama späterer Zeiten über den Schauplatz mit dem journalistischen 18Schlenker, mit diesem Philosophen hätte man tatsächlich einmal den Sportpalast füllen können. Dorthin also muß die Erinnerung Husserl nicht versetzen.
Der Vortrag kann die Erwartungen der Vielen kaum erfüllt haben, das Verhältnis der Phänomenologie zu dem neuen anthropologischen Interesse zu klären oder gar diesem Bedürfnis zu genügen. Nichts von der Art von Endgültigkeit vollzog sich, wie die zwei Jahre zuvor in Davos stattgefundene Disputation zwischen Cassirer und Heidegger, die den Schlußpunkt des Neukantianismus setzte.
Seine Gegner hatte Husserl in einem Brief an Roman Ingarden vom 19. April 1931 benannt: er müsse im Hinblick auf den bevorstehenden Vortrag seine Antipoden Scheler und Heidegger genau lesen. Von Scheler war 1928 »Die Stellung des Menschen im Kosmos« erschienen, das Husserl jetzt las, wie auf dem Titelblatt des Exemplars seiner Bibliothek vermerkt ist. Unter dem noch nicht ganz so ausgreifenden Titel »Die Sonderstellung des Menschen« hatte Scheler diesen Text zuerst 1927 vorgetragen: eine Art Vorschau auf die von ihm wiederholt angekündigte »Philosophische Anthropologie«, die er nach der Vorrede zur ersten Auflage seit Jahren unter der Feder habe und die zu Anfang des Jahres 1929 erscheinen wird. Wenige Tage nur nach der Datierung dieser Vorrede war Scheler gestorben. In seinem letzten Kölner Semester – er war im Begriff, einem Ruf nach Frankfurt zu folgen – hat er als Gast Martin Heidegger, mit dem er das Verhältnis von Anthropologie und Ontologie erörtert, das durch »Sein und Zeit« eine vorher ungekannte Aktualität erhalten hatte und das für beide philosophisch entscheidend war. Heidegger hat später wissen lassen, Scheler sei einer der ganz wenigen, wenn nicht sogar der einzige gewesen, der den neuen Aspekt seines Werkes sogleich erkannt habe.[2]
19Die Kölner Koalition brauchte den Schulgründer 1931 nicht mehr zu bedrücken: Schelers verheißene Anthropologie war aus dem Nachlaß nicht zutage gekommen und sollte dort noch mehr als ein halbes Jahrhundert ruhen. Dafür war Heidegger zum alleinigen Prätendenten innerhalb der Phänomenologie geworden. Ihm gegenüber war Husserls Position dadurch geschwächt, daß er das Hauptwerk »Sein und Zeit« im »Jahrbuch für Philosophie und phänomenologische Forschung«, dem Organ seiner Schule, als Herausgeber selbst veröffentlicht hatte. Offenbar war ihm der durch eine als ›Daseinsanalytik‹ bezeichnete Anthropologie eröffnete Zugang zur Seinsfrage gar nicht bekannt geworden oder undeutlich geblieben, als er das Manuskript akzeptierte und ehe er im Sommer 1929 wirklich las, was er als ›phänomenologisch‹ approbiert hatte.
Husserls Erschrecken über dem nachträglich gelesenen Werk von Heidegger wird man nicht nur als Auslösung des Verdachts auf schulinterne Rivalität des so erfolgreichen Nachfolgers sehen dürfen. Vielmehr ist dieses Erschrecken spezifisch: Husserls Lebenswerk hatte mit der Erfahrung des Psychologismus als der Verunsicherung aller philosophischen Gewißheiten durch neurophysiologische Kausalität begonnen; diese Bedrohung abgewendet zu haben erschien nicht nur ihm selbst als der Inbegriff seiner Lebensleistung. Jetzt trat unter anderem Namen etwas hervor, was das erkennende und reflektierende Bewußtsein neuerdings an kontingente Vorgaben der menschlichen Natur und Weltstellung zu binden schien. Der Verdacht hätte auch jeden anderen und weniger auf die Schulmeisterschaft eifersüchtigen Intellekt bestürzt, der große Gegner der Frühzeit sei gar nicht überwunden, sondern ihm wüchsen die Köpfe unter neuartig faszinierenden Titeln und in schwerer erkennbaren Metamorphosen nach. Daß ausgerechnet in der Rüstung und unter dem Anrechtstitel seiner Methode die unzweifelhaft anthropologische Daseinsanalytik auftreten konnte, mußte ihn mißtrauisch nicht zuletzt gegen die Zuverlässigkeit des methodischen Instruments selbst machen.
20Doch nun klingt es eher nach Resignation als nach Kampfansage, wenn Husserl seine Vorträge in den drei Städten mit der Feststellung beginnt: Im letzten Jahrzehnt macht sich, wie bekannt, in der jüngeren philosophischen Generation Deutschlands eine schnell anwachsende Hinwendung zu einer philosophischen Anthropologie geltend. Seit zwei Jahrzehnten schon ist Dilthey tot; aber seine starke Wirkung begegnet dem lebenden Begründer der Phänomenologie noch jetzt als Anthropologie neuartiger Gestalt. Nicht nur sei, was ›phänomenologische Bewegung‹ genannt werde, von der neuen Tendenz ergriffen worden, sondern man sehe darin sogar eine notwendige Reform der ursprünglichen konstitutiven Phänomenologie. Das wahre Fundament der Philosophie werde nicht mehr auf dem Wege der Reduktion, also der Aussetzung der Weltsetzung, bei den Sachen selbst und den ihnen zugehörigen Bewußtseinsakten gesucht, sondern in Verkehrung der Reduktion als Erfassung des in der Welt existierenden konkreten ›Daseins‹ – nicht zufällig also gerade unter dem Titel dessen, was der Reduktion hatte verfallen sollen.
Obwohl bei der Vorbereitung des Vortrags zwei Antipoden im Blick gestanden hatten, zielt jedes Wort der Einleitung auf Heidegger. Dabei war dessen ›Anthropologie‹ gar nicht als eine der philosophischen Disziplinen aufgetreten; sie war bei ihm allerdings zum einzigen Zugang der einzigen großen Frage der Philosophie geworden oder wieder geworden, der nach dem ›Sinn von Sein‹. Dieser absolute Primat der ontologischen vor der anthropologischen Thematik blieb der zeitgenössischen Rezeptionsbereitschaft entzogen, aber auch in den Proportionen des Werks, soweit es vorlag, verdeckt.
Vor den erblindenden Augen Husserls und mit dem Prestige des Namens seiner Schule hatte sich die völlige Umkehrung der prinzipiellen Stellungnahme dieser Phänomenologie vollzogen. Was das hieß und wie es ihn belastete, hatte er schon im Dezember 1929 an den gewiß getreuesten seiner Schüler geschrieben: Das eingehende ›Studium von Heidegger‹? Ich kam zum 21Resultat, daß ich das Werk nicht dem Rahmen meiner Phänomenologie einordnen kann, leider aber auch, daß ich es methodisch ganz und gar und im wesentlichen auch sachlich ablehnen muß.[3] Trifft die gewiß nicht unwahrscheinliche Notiz von Karl Jaspers zu, Malvine Husserl habe Heidegger ›das phänomenologische Kind‹ genannt, so war Edmund Husserl das Schicksal der Väter nicht erspart geblieben.
Genauer besehen war dies nicht nur ein Schulfiasko. Es war eine Katastrophe der Philosophie selbst, deren teleologisch endgültige Gestalt in der Phänomenologie aufgetreten sein sollte. Husserl hatte schon früh eine hochgreifende Vorstellung von der Wissenschaftlichkeit der Philosophie und ihrer Einheit entwickelt: Diese, wenn überhaupt eine der theoretischen Disziplinen, durfte in ihrem Fortgang das Nebeneinander von Schulen, den Zerfall des homogenen Arbeitsprozesses der Forschung nicht zulassen. Er hatte den Zerfall der Brentano-Schule vor sich, aus der er selbst herkam; und als er 1897 eine Abhandlung des Schulgenossen Anton Marty rezensierte, schrieb er ahnungsvoll: Freilich ist es schwer einzusehen, wie sich die Philosophie dem Ideal der Einigkeit nähern und in die Bahn eines festen Fortschrittes kommen soll, wenn die einzelnen Forscher umeinander unbekümmert, sozusagen aneinander vorbeiphilosophieren und, statt kritische Ausgleichung zu suchen, ihr vielmehr ängstlich aus dem Wege gehen.[4]
Fragt man sich, wann Husserl die neue Gefährdung der Phänomenologie durch einen vermeintlichen oder wirklichen Anthropologismus aus ihrem eigenen Schoß hätte kommen sehen können, so wird man weit über das anthropologische Jahrzehnt der zwanziger Jahre hinaus zurückverwiesen auf das Datum der Begründung des Schulorgans, eben des »Jahrbuchs«, auf seine Eröffnung durch Husserls »Ideen zu einer reinen Phä22nomenologie und phänomenologischen Philosophie«, die Proklamation der transzendentalen Wendung. Die »Ideen« – auch sie nur mit einem ersten, eher programmatischen Teil, der erfüllende Leistungen der Phänomenologie nur versprach, aber nicht vorlegte – waren die Proklamation einer für die Göttinger ›Schule‹ überraschenden Wendung: das Zurück zu den Sachen! sollte sich in einem transzendentalen Idealismus vollstrecken, der nicht ohne Folgerichtigkeit aus den ›konstitutiven‹ Analysen der entstehenden Phänomenologie, zumal aus denen des Zeitbewußtseins, hervorgegangen war.
Zugleich war die transzendentale Wendung eine nochmalige Distanzlegung zu jedem Naturalismus, Physikalismus, Psychologismus und Anthropologismus. Gerade deshalb hätte Husserl auffallen können und müssen, daß in demselben Jahr 1913 der zugleich mit ihm im ersten Band des »Jahrbuchs« und damit an der Spitze der Schule mit seiner Materialen Wertethik erscheinende Scheler beim Hausverleger ein weiteres Werk »Zur Phänomenologie und Theorie der Sympathiegefühle und von Liebe und Haß« vorlegte, das in einem Anhang »Über den Grund zur Annahme der Existenz des fremden Ich« handelte, also über das Lebensthema Husserls: von der Intersubjektivität. In diesem Werk Schelers war zum ersten Mal die Verbindung von Ontologie und Anthropologie als ein nicht mehr erkenntnistheoretisch ansetzender ›Realismus‹ hergestellt.
Auf das Jahr 1913 also geht der Rückverweis, und damit auf eine Gleichzeitigkeit, die zu wenig, wie ich meine, beachtet worden ist.[5] Schelers Buch, das in den zwanziger Jahren drei 23Neuauflagen erfuhr, inaugurierte unvermerkt die anthropologische Wendung der phänomenologischen Methode. Vor allem aber erschloß es eine elementare Weltbeziehung unterhalb der theoretischen Subjekt-Objekt-Differenzierung, die Husserls ›klassische‹ erkenntnistheoretische Schwierigkeiten anthropologisch unterlaufen konnte: am Menschen zeigt sich, wie allen intentionalen Beziehungen eine emotionale Außengewißheit zugrunde liegt. Die Faszination, die von solcher elementaren Vor-Objektivität ausging, bestimmt auch die Wirkung von Heideggers Konzeption der Einheit des In-der-Welt-Seins.
Mit diesen Ausstrahlungen hatte es Husserl zu tun, als ihm die anthropologische Gefährdung seiner Phänomenologie aufging; mit ihnen hätte er es auf der Vortragsreise des Jahres 1931 endlich aufnehmen müssen.
Aber nichts davon. Der Text des Vortrags dokumentiert Verachtung und Verschweigung gegenüber dem, was die jüngere Philosophengeneration in jener ›schnell anwachsenden Hinwendung zu einer philosophischen Anthropologie‹ bewegte und was sie das Interesse am Vorrang von Erkenntnistheorie hatte verlieren lassen. Husserl sah nur die Metamorphose des Psychologismus vor sich. Er bestand darauf, daß die ursprüngliche Phänomenologie, als transzendentale ausgereift, jeder wie immer gearteten Wissenschaft vom Menschen die Beteiligung an der Fundamentierung der Philosophie versagt und alle darauf bezüglichen Versuche als Anthropologismus und Psychologismus bekämpft. Husserl dekretiert nicht nur, wovon in der Philosophie zu reden und woran nicht zu denken sei. Denn das Wesen der Philosophie sei selbst etwas, was in der Methode der Phänomenologie evident gemacht wird. Man brauche daher nur immer wieder die Position der Phänomenologie zu beziehen, um alle Mißverständnisse von der Art des anthropologischen von selbst hinfällig zu machen. Deshalb bietet Husserl den anderthalbtausend seiner Hörer nicht das, was diese erwarten durften, indem er nicht nur auf den Ergebnissen seiner Methode besteht, sondern einfach bei dieser Methode selbst 24bleibt. Man spürt plötzlich, wieviel Rücksichtslosigkeit, wieviel Starrsinn höchsten Ranges an einer Evidenz hängen, die das Postulat gestattet und erzwingt, alle Probleme müßten sich lösen lassen durch genaue Beschreibung. Husserl beschreibt die Evidenz von Philosophie, wie er sie hat, denn hier hängt alles am wirklichen Besitz der zur prinzipiellen Entscheidung vorausgesetzten Einsichten. Weshalb sollte da von Anthropologie noch weiter die Rede sein müssen? Von einer so späten und nebenher aufgetretenen Sache, daß Plato und Descartes von ihr nicht einmal den Namen kannten.
Von einer Rücksichtslosigkeit solcher Art hatte Husserl selbst in der Vorbemerkung gesprochen, die er dem deutschen Abdruck seines Nachworts zur englischen Ausgabe der »Ideen I« im »Jahrbuch« von 1930 beigegeben hatte. Wenn im Geiste radikalster Wissenschaftlichkeit … alle erdenklichen Probleme der Philosophie stufenweise zur ursprungsechten Formulierung und Lösung kommen sollen, dann könne allerdings nicht Rücksicht genommen werden auf die spezielle Situation der deutschen Philosophie mit der in ihr um Vorherrschaft ringenden Lebensphilosophie, mit ihrer neuen Anthropologie, ihrer Philosophie der ›Existenz‹. [6] Es sei also ›nicht Rücksicht genommen‹ auf die Vorwürfe des Rationalismus und Intellektualismus, die von den genannten Positionen her gegen die Phänomenologie erhoben worden seien und die sehr eng mit seiner Fassung des Begriffs der Philosophie zusammenhingen. Denn in diesem, so Husserl, restituiere ich die ursprünglichste Idee der Philosophie, die, seit ihrer ersten festen Formulierung durch Plato, unserer europäischen Philosophie und Wissenschaft zugrunde liegt und für sie eine unverlierbare Aufgabe bezeichnet. Diese ursprünglichste Idee lasse sich auch deshalb nicht verändern oder eliminieren, weil sie noch in den positiven Wissenschaften nachwirke, auch wenn diese sich solcher Grundlegung 25weder bewußt seien noch ihr zu genügen bereit fänden. Schon deshalb sei es die große Aufgabe der Zeit, in einer radikalen Besinnung auf die Zusammenhänge den echten Sinn dieser Idee Philosophie intentional auszulegen und die Möglichkeit ihrer Verwirklichung nachzuweisen. Um zu entscheiden, was philosophisch notwendig und fällig ist, darf nicht auf die Aktualität einer Gefälligkeit geachtet werden. Die Zurückweisung besteht in Insistenz.
In welchem Maße das geschichtsphilosophische Konzept der um fünf Jahre späteren »Krisis«-Abhandlung hier schon vorliegt, wird am Verfahren der Auseinandersetzung deutlich. Freilich ist die theoretische Aufgabe noch nicht die dringend therapeutische einer in der kurzen Zeitspanne radikal geänderten Zeitlage. Aber dort wie hier gibt es nichts anderes als die Idee der Philosophie an ihrer Geschichte und aus ihren Ursprüngen zu eruieren und daran die Phänomenologie als deren Erfüllung auszuweisen. Rückwirkend macht die Erfüllung erst erkennbar, welche Verfehlungen der genuinen Intention eintreten mußten und eingetreten waren, um die ›Krise des europäischen Menschentums‹ auch nur zuzulassen.
Dann ist es keine Willkür, keine Nachlässigkeit und kein Ausweichen, wenn in dem Dreistädtevortrag die Auseinandersetzung mit den Antipoden ausbleibt. Der Krisis genügt Kritik nicht: Die Phänomenologie muß sich selbst zeigen. Da gibt es eine Konvergenz mit Heideggers ›Ausweisung‹ als einem ›Die Karte zeigen‹ des Logos vor der Sache. Husserl erklärt nur, er könne seinen Widersachern und ihren Bestreitungen des Anspruchs der Phänomenologie keinerlei Berechtigung zuerkennen. Denn das alles beruhe letztlich darauf, daß man die Phänomenologie auf das Niveau zurück deutet, das zu überwinden ihren ganzen Sinn ausmacht. Dabei bleibt es ausdrücklich gleich, ob die alternative Anthropologie empirisch oder apriorisch sei. Sie erreiche so und so noch gar nicht den spezifisch philosophischen Boden. Derartiges überhaupt für Philosophie anzusehen, sei ein Verfall in ›transzen26dentalen Anthropologismus‹ und darin gleichbedeutend mit ›Psychologismus‹.
Beunruhigend war ja nicht oder nicht vor allem, daß der Psychologismus nicht landauf landab in allen Spielarten durch die Großtat der »Logischen Untersuchungen« ausgerodet worden war, sondern daß er innerhalb der Phänomenologie selbst keineswegs unmöglich gemacht zu sein schien. Weshalb würde es jetzt nochmals eine eigene große Abhandlung erfordern, um im einzelnen nachzuweisen, daß auch die Philosophie der ›Existenz‹, ihre Thematisierung der ursprünglich-konkreten Subjektivität als einer praktisch-besorgten, auf das für überwunden Gehaltene zurückfiel? Im Gegensatz zu den weitschweifigen Einlassungen des Frühwerks verfährt Husserl nun ganz im Stil der Phänomenologie, indem er alles auf Verdeutlichung der Sache selbst setzt – da steht der Dreistädtevortrag in eigentümlicher Dissonanz zwischen dem, was er proklamiert, und dem, was er unterläßt. Es war nötig, die Phänomenologie zu ihren immanenten Möglichkeiten voranzutreiben, nicht sie in Flankenschutzgefechte mit ihren Dissidenten zu verwickeln. Weshalb aber stellte sich Husserl in die Arena, wenn er seinem Vertrauen auf die Überzeugungskraft der schon geleisteten, vor allem aber der noch zu leistenden phänomenologischen Arbeit mit der Erklärung Ausdruck geben konnte, daß es in Sachen der Wissenschaft weniger auf Kritik denn auf getane Arbeit ankommt?
Die neue Anthropologie hatte einen rhetorischen Effekt, der sich an die nahezu triviale Interessenlage wenden konnte, daß der Mensch sich selbst am nächsten, die Welt ihm am fernsten liegt. Husserl hatte nie erwähnt, daß in seiner deskriptiven Unterscheidung von Nah- und Fernraum den spezifisch haptischen und optischen Distanzen auch lebensweltliche Konzentrizitäten der Aufmerksamkeit und Gewichtung entsprechen. Es war der Beginn aller Theorie, der theoretischen Einstellung selbst gewesen, als dem milesischen Protophilosophen von seiner Magd lachend vorgehalten werden konnte, er sehe nicht, 27was vor seinen Füßen liege und ihn stürzen lasse, indem seine ganze Aufmerksamkeit durch die absolut fernsten Gegenstände, die des Himmels, gefesselt werde. Husserls Reisevortrag hat den Tenor, Philosophie als Wissenschaft vom All der Realitäten habe nicht vorzugsweise und nicht grundlegend vom Menschen zu handeln. Das deskriptive Verfahren homogenisiert die Welt zur Indifferenz von Nah und Fern, Eigen und Fremd, Relevant und Irrelevant, Eigentlich und Alltäglich. Solche homogene Universalität steht jeder Form von Anthropozentrik im Wege. Mehr noch: Das Bewußtsein, in dem sich das All der Realitäten soll konstituieren können, würde, sich als menschliches nehmend, schon die Weltgeltung voraussetzen müssen und sich eo ipso zum Grundakt der Reduktion unfähig machen. Erst was in der phänomenologischen Reduktion ausgesetzt worden ist, kann im Durchgang durch die Analysen seiner intersubjektiven Bedingtheit durchsichtig gemacht, als Selbstverständliches zum Verständlichen re-konstituiert werden. Sofern die Methode der Phänomenologie überhaupt ein System ihrer Resultate vorzeichnet, kann der Mensch nur ein spätes, mit den Weltsachen ›unter anderem‹ aufgenommenes Thema sein. Eben diese Folgerung fällt unter die Kennzeichnung, die Husserl in jenem Vortrag seiner Methode insgesamt gegeben hat: sie sei eine tolle Zumutung.
Worin besteht die Tollheit der Zumutung? Nicht allein in der Verweigerung gegenüber einem Bedürfnis, zuerst und vor allem vom Menschen gehandelt zu sehen. Das könnte immer noch methodische Unumgänglichkeit sein wie bei Descartes, der in seinem Programm der neuzeitlichen Wissenschaft die Vollendung der Physik als notwendige Vorstufe zur Gewinnung einer definitiven Moral und der Medizin eingesetzt hatte, zweier Letztdisziplinen also, deren humane Exklusivität unzweifelhaft war. Bei Husserl ist es nicht ein theoretisches Interim, das schließlich doch auf den Menschen hinauszulaufen verspricht. Vielmehr bringt sich das reine Pathos des Vorrangs der Welt in einer universalen apriorischen Welterkenntnis vor 28jeder Thematisierung des Menschen zur Geltung. Die letzte und unüberbietbare Begründung dafür steht noch aus: die Welt als der einer transzendentalen Subjektivität unabdingbare Gegenstand ihrer Selbstkonstitution, den sie sich nur im Verbund einer transzendentalen Intersubjektivität und deren Verleiblichung verschaffen kann. Ein absolutes Subjekt ohne Objekt wäre ein spekulatives Konstrukt, das aus einer deskriptiven Philosophie nicht hervorgehen kann. Husserls letzte Metaphysik wird die transzendentale Begründung für den Vorrang der Weltthematik geben. Was uns der Nachlaß darüber aus den dreißiger Jahren erschließt, konnte wohl kaum Gegenstand einer öffentlichen Mitteilung werden: das absolute Weltbedürfnis der transzendentalen Subjektivität als Rangvorgabe für das systematische Kapitel ›Welt‹ ohne Rücksicht auf deren faktischen Bestand, zu dem eben erst und auch das Faktum Mensch gehört.
Husserl konzediert, die zeitgeistige Entwicklung tendiere gegen die Idee, den Wissenschaften von allem Faktischen in der Welt, also auch vom Menschen, voranzustellen die universale Erkenntnis der Wesensmöglichkeiten, ohne die eine Welt überhaupt, also auch die faktische, nicht gedacht werden könnte als seiend. Beim Vollzug der Frage, was das Wesen einer Welt ohne Rücksicht auf deren Existenz ausmacht, fällt der Mensch gleichsam aus dem systematischen Rahmen heraus oder, wenn man so will, durch ihn hindurch. Dies ist nicht erst eine Fragestellung aus der transzendentalen Wendung heraus, sondern dem Ansatz nach schon eine der ersten Reduktion aufs Eidetische, sofern sie über den Katalog klassischer Gegenstände der Erkenntnistheorie, wie Wahrnehmung, Ding, Raum und Zeit, hinausgelangen wollte. Vom ›Wesen einer Welt‹ zu reden wäre ausgeschlossen worden durch das Verlangen, dazu müsse allemal und zuerst der Mensch gehören und gehört werden, wie ein ›Bewußtsein überhaupt‹ dazu gehört.
Das Wesen Mensch gehört nicht zum Wesen Welt. Welche Wendungen auch die Phänomenologie sonst hätte nehmen 29können, mit der Zulassung von ›Welt‹ als einem ihrer genuinen Themen ist der Zwang schon ausgelöst, statt vom Menschen als einem kontingenten Weltwesen, von dem einem letzten Horizont aller Gegenstände korrespondierenden ›Bewußtsein überhaupt‹ als dem konstitutiven Subjekt jeder möglichen Welt zu sprechen. Ob für eine ›objektive Welt‹ diese Voraussetzung genügt, ist das Thema des Nexus von ›Welt‹ und ›Intersubjektivität‹, zugleich die Unausbleiblichkeit der Frage, ob der Mensch als Mandatar der letzten Objektivität doch wesensnotwendig werden könnte.
An dieser Stelle ist mir die einmütige Empörung derjenigen sicher, die in dem großen Thema der Intersubjektivität die sicherste Verankerung einer Anthropologie im Denken Husserls erblicken; auch gegen seine Abwehr und Verweigerung. Um mir diese Empörung nicht stärker und länger als notwendig zuzuziehen, schicke ich allem anderen voraus, daß nach den in vollem Umfang vorliegenden Resultaten der Analysen über Fremderfahrung alle Intersubjektivität zwar gebunden ist an die Appräsentation eines anderen Ich durch die Erscheinung eines dem meinen ähnlichen Leibkörpers, aber gerade diese Prämisse es gleichgültig werden läßt, ob die Ähnlichkeitsbeziehung auf ein spezifisch so gestaltetes Gebilde wie den Organismus des homo sapiens sapiens aufstrukturiert ist. Fremderfahrung erfordert nur, daß es für ein Eigenleibbewußtsein seinesgleichen gibt. Die darauf angesetzte Hypothese, für mich werde sich das einmal über seine Leiberscheinung ausgemachte leibhaftige ›Meinesgleichen‹ verhaltenskorrelativ bewähren, ist die Voraussetzung dafür, daß die ›Welt‹ – als Inbegriff der Bedingungen solcher äußeren Einsichtigkeit von Verhalten gegenüber seinen Umständen – als ›objektiv‹ gleiche für mich und meinesgleichen existiert. Nichts anderes heißt, daß sie ›unabhängig von mir‹, ohne Rücksicht auf diese meine subjektive Kontingenz, existiert. Aber ich bitte, im Auge zu behalten, daß auch eine Billardkugel, ausgestattet gedacht mit Bewußtsein und Wahrnehmung, die andere Billardkugel angesichts ihrer 30spezifischen Gleichheit für ›eine Andere‹ halten würde und diese primäre Hypothese über alles Maß bestätigt fände, wenn diese, von ihr gestoßen, in schönster Verhaltenskorrelation den unter gegebenen Umständen sachgemäßen Weg einschlüge, den der Stoß ihr ›zugedacht‹ hatte. Die Folgerung wäre, daß man es in dieser gemeinsamen ›Welt‹ der Stöße, Banden und Wege weiterhin miteinander als bekannten Größen zu tun haben würde, alles andere als eine bloße ›Sache‹ zu sein sich zuzubilligen hätte.
Diese Dissoziation der Themenkomplexe ›Intersubjektivität‹ und ›Anthropologie‹ muß zur Vermeidung unnötiger Erregung des Lesers über die These der anthropologischen Exklusivität der Phänomenologie hier vorweggenommen werden, auch auf die Gefahr unvermeidlicher Wiederholung hin.
Alles kommt darauf an zu sehen, daß Husserls Entscheidung gegen Anthropologien kein misanthropischer Akt der Willkür oder Leichtfertigkeit gegenüber der Menschlichkeit der Ansprüche an die Philosophie ist. Man könnte genauso gut sagen, dies sei ein Korrektiv: der Mensch ist sich immer schon wichtig genug. Es gehe um anderes, nun wirklich nicht erst zu Vergessendes, sondern schon Vergessenes, um diejenige Verborgenheit, die in ihrer naheliegenden Sicherheit nicht überboten werden kann: die der Selbstverständlichkeit. Nichts Größeres hat die Phänomenologie zu leisten auf sich genommen und weithin auch geleistet als das, was im Berliner Vortrag auf die Formel gebracht ist: … aus der Selbstverständlichkeit wird ein großes Rätsel.
Für Husserl ist Philosophische Anthropologie eine philosophische Untertreibung. Seine Voraussetzung ist, daß die Philosophie als Phänomenologie mehr leisten kann. Sie muß imstande sein, eine Theorie von jeder möglichen Art von Bewußtsein und Vernunft, von Gegenstand und Welt, auch von Intersubjektivität zu geben. Darin hätte er mit Heidegger, bei genauerer Verständigung, ganz einig sein können.
31Nur mit diesem Anspruch würde Philosophie mehr sein können, als was sie je gewesen ist und durch die Entstehung der Einzelwissenschaften nicht bleiben konnte, nämlich eine Art präsumtiver Platzhalterin positiver Erkenntnis, für die spezifische Methoden noch nicht ausgebildet waren und solange sie dies noch nicht waren. Man darf nicht übersehen, daß die geschichtliche Funktion der Phänomenologie ein Prozeß der definitiven Absetzung der philosophischen Wissenschaftlichkeit von den positiven Wissenschaften und deren Positivismus gewesen ist. Der Mensch als philosophisches Thema – das ist Preisgabe der so gewonnenen Distanz. Was phänomenologisch gilt und gesichert ist, gilt auch für den Menschen, aber eben nur ›auch‹.
Husserls Vorbehalte gegenüber einer Philosophischen Anthropologie sind also von der entgegengesetzten Art zu denen, die unter neomarxistischen Prämissen erhoben worden sind. Diese richten sich gegen die Zuschreibung eines ›Wesens‹ an den Menschen als Festschreibung vermeintlich konstanter Eigenschaften, die unmöglich machen könnte, Menschen derart an einen Wendepunkt ihrer Entwicklung zu bringen, daß alles Vorherige sich im Nachherigen nicht mehr wiederfindet.
Die ganze Differenz ist wie eine Wiederholung des alten theologischen Gnadenstreits in formaler Reduktion und ohne jeden Verdacht der Säkularisierung. Es handelt sich offenbar um eine Grundfrage des menschlichen Selbstverständnisses, die sich ebenso theologisch wie daseinsanalytisch präsentieren kann. Es ist nicht schlechter gefragt, wenn man fragt, ob die menschliche Natur durch den adamitischen Sündenfall so tief entstellt und verderbt werden konnte, daß ihre Wiederherstellung unter Weltbedingungen nicht mehr möglich ist – also nur erhofft, nicht erfahren werden kann –, oder ob sie kraft Schöpfung substantiell derart unantastbar geblieben sein muß, daß auch die Urschuld ihr nur peripher Eintrag tun konnte.
Es ist nur eine andere Sprache, keine andere Sache, wenn wir diese Alternative als den Kern der Frage nach der Geschicht32lichkeit des Menschen ausgeben. Sind die geschichtlichen Zustände des Menschen Modifikationen einer konstanten Natur, dann kann ihn keine Bedingungskonstellation so verformt haben, daß die mit ihrem Zustand radikal Unzufriedenen erwarten dürften, jemals durch wie immer geartete Änderung der äußeren Faktoren eine andere Menschlichkeit des Menschen herzustellen, ihm eine unverhoffte Wohlbefindlichkeit zu sichern. Es ist ganz plausibel, daß die existentialistische Absage an anthropologische Konstanten sogar noch ihre Sprache aus der antipelagianischen, augustinisch-lutherischen, auch mystischen Option im Gnadenstreit hergeleitet hat. Natürlich wußte Heidegger genau und authentisch, in welcher Tradition er stand, während Husserl wohl kaum Verständnis gezeigt hätte, wenn die eidetische Phänomenologie als unausweichlich pelagianisch bezeichnet worden wäre.
Die alten wie die neuen Formeln umschreiben den Spielraum im Selbstverständnis. Die Fragen werden nicht entschieden oder nur auf Zeit entschieden; aber es werden die Fluchtwege markiert, auf denen aus Verfestigungen und Verkrustungen von Vorentscheidungen entkommen werden kann. Wem ›Spielraum‹ zu wenig und zu beliebig ist, der möge nicht übersehen, daß wir uns nie auf dem Nullpunkt des Wahlverhaltens vor solchen Angeboten befinden, sondern immer schon in ›überforderten Situationen‹: Die absolute Selbstsetzung des Individuums in Spielarten des Existentialismus, lockend für eine in Systemen eingezwängte Generation, wurde von der nächsten als gerade die Last empfunden, die an die Gesellschaft zu delegieren und deren geschichtlicher Verantwortung anheimzugeben als Befreiung erschien. Die von Menschen gelenkte Geschichte sollte können, was der einzelne mit sich selbst zu können resigniert hatte, obwohl ihm dies nicht nur philosophisch zugesagt, sondern auch modisch vorgemacht worden war. Von beiden Seiten her, von denen, die zu viel an ›Wesen‹ befürchten, als daß der Mensch je verändert werden könnte, wie von denen, die zu wenig an ›Wesen‹ vorfinden, weil sie nur darin den Wi33derstand gegen willkürlichen Umgang mit dem Menschlichen erwarten – von beiden Seiten also wird eine Philosophische Anthropologie philosophisch nicht hingenommen. Hier wie dort wird, höhere Ansprüche zu stellen, für möglich gehalten. Husserl hält den Standard dessen, was ›Wesen‹ als philosophisches Thema einhalten muß, für höher als das, was von einer philosophischen Anthropologie je geleistet werden könnte. Vernunft macht zwar den Menschen aus, aber sie wird nicht von ihm gemacht.
Vernunft ist nicht möglich, wenn sie ausschließlich unter den Bedingungen einer faktischen Welt und einer in ihr existierenden organischen Physis steht. Dieses zuzugestehen, muß nicht gleich in die Theologie stürzen. Aristoteles hatte sich genauso vor dem Problem der Unabhängigkeit der Vernunft von der Individualität ihres Auftretens im Menschen gesehen, weil ihr Anspruch auf Allgemeingültigkeit jede ihrer Realisierungen überschreitet; er hatte sich mit der Annahme eines von außen hinzutretenden und gegenüber der Pluralität der konkreten Vernunftsubjekte singulären Prinzips beholfen. Dessen nicht mehr recht verstandene Begründung wurde in den scholastischen Streitigkeiten um die Einheit des intellectus agens von heterogenen Argumenten abgelöst. Bei Descartes tritt an diese Stelle der Allgemeingültigkeit die absolute Evidenz des Selbstbewußtseins. Das sich seines Daseins im Akt apodiktisch selbstgewisse Cogito begreift dessen Differenz zu allen Möglichkeiten sonstiger Gewißheit, die ihm in seinem Weltdasein vorgegeben sind. Für Descartes hatte sich das begrifflich so ausgelegt, daß im Bewußtsein der eigenen Endlichkeit die Negation einer Idee von Unendlichkeit, als des nur faktisch sprachlichen, aber nicht logischen Negats, beschlossen liegt. Diese Idee konnte das seiner begrenzten Potenz bewußte Ich – nach dem scholastischen Grundsatz von der formalen Äquivalenz zwischen Ursache und Wirkung – unmöglich aus sich hervorgebracht haben; sie mußte Außenwirkung der formal-äquivalenten Ursache, also: des ens infinitum, sein.
34Bei Kant ist die Vernunft zwar unmöglich Faktum, weil es sonst keine Gerechtigkeit für das sittliche Wesen Mensch geben könnte, wohl aber das Durchschlagen der reinen praktischen Vernunft auf das ›Ich-soll‹, welches allein ein mittelbares Bewußtsein des absoluten Grundes der Freiheit verschafft; insofern gibt es das Faktum der Vernunft, obwohl die Vernunft kein Faktum sein kann. Schließlich durfte jene Mittelbarkeit des Bewußtseins von Freiheit als der unbedingten Verantwortlichkeit für Handlungen nicht der prekären Zuverlässigkeit eines faktischen Weltorgans überliefert sein.
Die Phänomenologie hat diese Doppeldeutigkeit der Vernunft im Bewußtsein nicht zur Geltung kommen lassen. Sonst hätte sie bemerken müssen, daß zwar absolute Gewißheit im Akt der Reflexion des Cogito liegt, dieser Akt selbst aber nicht mit der zwingenden Allgegenwart eines Bestandsstücks der Vernunft – etwa wie die logischen Operationen der Schlußfolgerung – im Bewußtsein auftrete. Zu denken ist ohne das Hindernis der Vernunft selbst, also ohne Widerspruch, ein Bewußtsein ohne den Akt, der zur absoluten Selbstgewißheit führt, wie auch nach Kant zwar jenes ›Ich-denke‹ alle meine Vorstellungen muß begleiten können – indem eben diese so sein müssen, daß sie an diesem Kriterium bestehen –, aber nichts verlangt jemals, ausdrücklich dieses ›Ich-denke‹ zu vollziehen, bis es in einer geschichtlich-faktischen Zwangslage weit vorangetriebener intellektueller Systemschwierigkeiten einen Ausweg aus diesen zu bieten scheint. Darauf beruht, daß eine Geschichte der Philosophie zwar immanent nach Prinzipien der Vernunft verläuft und keine beliebigen Überraschungen hervorbringt, aber diese Geschichte im ganzen ein Faktum ist, welches in der übrigen Geschichte der Menschheit auch ausgeblieben sein könnte. Eine philosophische Geschichte der Philosophie ist selber nicht historisch oder empirisch sondern rational d.i. a priori möglich. Denn ob sie gleich Facta der Vernunft aufstellt so entlehnt sie solche nicht von der Geschichtserzählung sondern sie zieht sie aus der Na35tur der menschlichen Vernunft als philosophische Archäologie.[7]
In der »Krisis«-Abhandlung sieht es so aus, als sei Husserl an diese Auffassung von der faktischen Geschichtlichkeit der Vernunft nahe herangekommen, indem er die Wendung zur theoretischen Einstellung als kontingentes Urereignis der Geschichte des europäischen Menschentums ansieht, dessen Krise folglich als Abirrung von einem einmal eingeschlagenen Weg und dem damit gestifteten Ursprungssinn. Aber die ganze Fülle dessen, was aus dem Nachlaß zutage gekommen ist zur transzendentalen Deduktion der Intersubjektivität als einer den Menschen und seine Geschichte erzwingenden Seinsvoraussetzung, läßt an der Eindeutigkeit der letzten Richtungnahme zweifeln. Der Absolutismus der Selbstgewißheit begründet nicht nur die Anwartschaft auf andere Gewißheiten gleichen Ranges aus der Analyse der Anschauung, sondern reflektiert sich auch auf den ganzen Zusammenhang der Menschheitsgeschichte, in welchem er als scheinbare Episode auftritt und seine irreversiblen Folgen hat.
Der Cartesianer Husserl konnte den Gedankengang nicht mehr nachvollziehen, daß das Auftreten der Idee von Unendlichkeit im Bewußtsein der eigenen Endlichkeit eine andere Begründung erfordert als die der eigenen Begriffsfähigkeit und ihrer anschaulichen Grundlage in der inneren Erfahrung. Obwohl er sich mit dem Postulat der Reduktion aller Begriffe auf Anschauungen und der darin liegenden Kritik am Unendlichkeitsbegriff zumindest in der Mathematik einem neuen Äquivalenzprinzip genähert hatte, konnte er die erratische Anwesenheit absoluter Evidenz in einem Bewußtsein von im übrigen fakti36scher Kontingenz nur als dessen transzendentale Dimension erklären. Das Grundphänomen reflexiver Gewißheit führt zur Überschreitung der eidetischen durch die konstitutiv-genetische Analyse. Sie verbietet, das Ich der inneren Selbsterfahrung mit dem Ich der absoluten Gewißheit schlechthin zu identifizieren. Auch Husserls Lösung ist also: Wenn das mundane Ich in seiner Faktizität die Notwendigkeit der Selbstgewißheit nicht tragen kann, muß dieses Ich es in einer möglichen Unweltlichkeit, dasselbe als Nicht-dasselbe. Dieses Identifizierungsverbot ist schon der Ausschluß der Anthropologie aus der Phänomenologie; nicht nur als des ihr Ungemäßen, sondern als des sie unausbleiblich Irreführenden.
Ist es dann etwa richtig zu sagen, daß man sich von der anthropologischen Fragestellung, was der Mensch sei und wie er existieren könne, um so mehr entfernt, je genauer man sich auf die Frage einläßt, was die Vernunft sei und was sie könne? Selbst die Aufklärung, die dem Menschen alle Chancen der Vernunft eröffnen, erweitern oder wenigstens erhalten wollte, lebte mit der Vorstellung eines Weltalls, in welchem Wesen verschiedener physischer und organischer Beschaffenheit die Gestirne bewohnten und ganz selbstverständlich die Vernunft in höherer Ausprägung und Reinheit als der Mensch besaßen und darstellten. Bei gegebener Gelegenheit würden sie den Torheiten des Menschen eine mitleidige, aber kaum nachsichtige Betrachtung widmen. Wollte man dagegen die Tendenz jeder gegenwärtig noch oder wieder möglichen Philosophischen Anthropologie beschreiben, könnte man dies kaum anders zustande bringen, als davon auszugehen, daß sie, was Vernunft ist, ausschließlich durch die Existenz des Menschen darzustellen und aus deren Schwierigkeiten und Selbsthilfen zu erklären für möglich hält. Götter und Siriusbewohner mögen glückliche Wesen sein; es gibt keinen Grund, sie dies kraft ihrer Vernunft sein zu lassen, auch wenn die antik-christliche Tradition das Glück des Gottes wie das der an ihm selig Werdenden allem voran im Wahrheitsbesitz gesehen hatte. Viel37leicht nur in der Verlegenheit, das Hinwegsein über den Tod und das Freisein von Todesfurcht nicht als Langeweile vorstellen zu müssen.
Nun ist Vernunft zwar das, was für alle möglichen Welten zutreffen muß, aber damit doch nicht auch schon das, was in allen möglichen Welten vonnöten ist, um überall dort existieren zu können und dabei sich auch noch wohl zu befinden. Der Zusammenhang von Wahrheit und Wohlbefinden ist nur einsichtig, wenn Erkenntnis die Voraussetzung für Glück sein muß, weil nur sie das den Bedingungen und Umständen des Daseins in einer eigengesetzlichen Datum-Welt angemessene Verhalten ermöglicht, auch wenn dies noch nicht ›sittlich‹ genannt werden darf. Denn sittlich ist erst die von allen realen Umständen unabhängige Verallgemeinerung eines Grundsatzes dieses Verhaltens, und solche Verallgemeinerung zu leisten gebietet und ermöglicht die Vernunft. Wer aber glücklich wäre, bedürfte gar nicht erst solcher Handlungen, deren Grundsätze verallgemeinerungsfähig wären, und käme nicht in die Verlegenheit, vernünftig sein zu müssen.
Da wir aber von Bewohnern des Sirius nichts, von Göttern nur sehr wenig wissen, müssen wir uns an die uns bekannte tellurische Natur halten. In ihr spricht das quantitative und qualitative Übergewicht der pflanzlichen und tierischen Welt über die menschliche gegen den Vorzug der Vernunft als eine der zentralen oder auch nur typischen Lösungen, die die Natur für ihre Probleme gefunden hätte. Sie ist vielmehr eine höchst spezielle und exzentrische Lösung eines ihrer Probleme.
Die Vernunft ist unser Organ für das, was abwesend ist, terminal für das Ganze, das wir nie haben können. Dann auch zu denken, was möglich ist und als solches nicht wirklich sein muß, oder den Inbegriff der Faktoren zu bestimmen, die auf das uns Gegenwärtige einwirken und an ihm rückschließend erfaßbar werden. Zugleich aber ist Vernunft das Organ der Disziplinierung dieser Erweiterungen unserer unmittelbaren Gegenwärtigkeit nach Raum und Zeit, insofern der Disziplinierung 38ihres eigenen Dranges auf Überschreitung des Horizontes der Natur-Welt als des Inbegriffs möglicher Erfahrung. Daß die Vernunft sich auf sich selbst anwenden läßt, ist nur ein Spezialfall dessen, daß Bewußtsein sich auf sich selbst zu richten vermag. Reflexivität ist damit der paradigmatische Fall für etwas, was nicht dadurch enträtselt wird, daß man es dem Wesen der Vernunft zuschreibt. Die Vernunft ist das Organ der Disziplinierung ihrer selbst, weil sie zur Selbstanwendung gefundener Grundformen des Denkens, zur Iteration also, überhaupt, und darin letzte Instanz zu sein, fähig ist. Bevor sie die auf die Vernunft angewandte Vernunft wird, ist sie schon der auf den Verstand angewandte Verstand als das Vermögen der Synthesis von Synthesen. Vor allem aber ist es die Vernunft, die die Erwartungen des Verstandes zugleich erweckt und enttäuscht, seiner Richtigkeit durch ihre Gründlichkeit – wie Kant unterschieden hätte – begegnet.
Daß es eine Pathologie der Vernunft gibt, wissen wir erst seit Kant; aber nicht dies war seine schreckliche Entdeckung, sondern daß es weit und breit keinen anderen Therapeuten für sie gibt als sie selbst. Die Dialektik der Vernunft ist die erste aller iatrogenen Erkrankungen. Man muß, mit der Blickrichtung auf die Möglichkeit einer Anthropologie in der Phänomenologie, dieses Grundschema studieren, weil es in und an der Phänomenologie wiederkehrt: als Merkmal ihrer insgesamt reflexiven Methode. Die transzendentale Problematik begreift man nicht, wenn man nicht zuvor begriffen hat, daß jeder Versuch, auf den festen Punkt eines Zuschauers gegenüber dem Bewußtsein und seinen konstitutiven Leistungen zu gelangen, ein prinzipiell für diese Anstrengung selbst wiederholbarer Versuch sein muß. Auch dies fällt in die Pathologie der Vernunft, weil es, ganz formal und allgemein betrachtet, eine Erweiterung der Erfahrung zu sein beansprucht. Nur wenn diese Erweiterung legitim ist, wird die Exstirpation der Anthropologie aus der Phänomenologie gerechtfertigt; andererseits könnte die Anthropologie dann den transzendentalen Erweiterungen der Phäno39menologie nur entgegentreten, sofern sie die Reflexion selbst als anthropologisches Faktum und nicht als ureigenstes Vernunftgesetz für alle möglichen Welten vorstellig machen könnte. Die Reflexion reizt die Theorie nur als Faktum der Vernunft, sogar als pathologisches.
Die Pathologie der Vernunft produziert und entdeckt ständig neue Krankheitsbilder, wie die instrumentelle Vernunft, die formale Vernunft, die unvernünftige Vernunft, die bürgerliche Vernunft. In diesen Syndromen wird sie rechnerisch, wird sie despotisch, wenn und weil sie sieht, wie wenig wir uns leisten können, wenn es um Selbsterhaltung geht. Alle Probleme des geschichtlichen Selbstbewußtseins der Aufklärung für die ihr unentbehrliche geschichtliche Pathologie der Vernunft bestehen in dem Paradox: Die Vernunft hat immer existiert, nur nicht immer in der vernünftigen Form.[8] Tritt eine neue Gestalt der Philosophie in Erscheinung, die noch dazu mit der Selbstbestimmung ihrer Konzeption von Vernunft erkennbare Schwierigkeiten hat, wird sie sich darauf befragen und untersuchen lassen müssen, ob nicht alte pathologische Bekannte unter neuen Namen in ihr auftreten oder an ihr beteiligt sind.
Was an der Phänomenologie bedenklich macht, ist das Maß ihrer geschichtlichen Gutgläubigkeit, ihres Mangels an Auswertung der Erfahrung mit ihren Normen der Evidenz, ihrer Berufung auf Anschauung, ihrer Unbedenklichkeit gegenüber der Drohung des unendlichen Regresses der Reflexion. Um es kürzer zu fassen: Die Phänomenologie kommt nicht an das Faktum heran, daß sich die Vernunft als der Disziplinierung bedürftig erwiesen hat. Liegt es daran, daß sie selbst eine Gestalt der undisziplinierten Vernunft ist?
Es ist der Vernunft wesentlich, die Dinge zu betrachten insofern 40sie notwendig, nicht insofern sie zufällig sind.[9] Diese Definition Spinozas wäre auch die Husserls, ohne daß ihm je in den Sinn gekommen sein müßte, die im lateinischen Text unbekannte Ambiguität von ›Notwendigkeit‹ nicht nur im Sinne des Gegensatzes zur Zufälligkeit, sondern auch in dem der Wendung und Abwendung von Not zu nehmen. Als solche hat sie zwar die Phänomenologie gegen den Psychologismus und Naturalismus zur Bedingung ihres Entstehens um die Jahrhundertwende, aber eben nicht zur dauerhaften Konstitution ihres Selbstverständnisses, so naheliegend dies wieder an der Wende zu den dreißiger Jahren und im Vorfeld der »Krisis«-Abhandlung gewesen wäre. Denn zweifellos hat Husserl einen ausgeprägten Begriff von Lagen intellektueller Not, deren Wendung nur Vernunft durch Anschauung besorgen kann. Nicht nur, daß die Phänomenologie im ganzen und nach außen gegen solche Nöte wie Historismus, Naturalismus, Positivismus und Anthropologismus angetreten war; sie hatte auch im Inneren konstitutive Nöte, die durch den Rückgang auf die Immanenz des Bewußtseins entstehen und sich im Schlagwort des ›Solipsismus‹ zusammendrängen. War es die strikte Anforderung der Evidenz, um Philosophie als ›strenge Wissenschaft‹ zu ermöglichen, was das reine Bewußtsein zum alleinigen Feld der reinen Gegenstände machen ließ, so war es wiederum die Sicherung von Objektivität, die dem reinen Bewußtsein das Bewußtsein der anderen durch eine Evidenz sui generis zu sichern zwang: Ein Bewußtsein ohne Weltgewißheit wäre nicht nur ein verarmtes, aber dafür von Zweifel ungeplagtes Bewußtsein gewesen, sondern ein seines letzten Sinnes und damit seines Selbstwertes verlustig gegangenes. Aber ein doch noch mögliches, obwohl der Theorie unfähiges? Nur in diesem Verstande wird Fremderfahrung zur Notwendigkeit der Vernunft selbst. Dies aber nicht in einem der Ableitung Kants äquivalenten Sinne, 41daß das ›Ich-denke‹ ohne die synthetische Einheit der Erfahrung so wenig möglich wäre wie diese ohne ihre Meßbarkeit an der Identität eines ›Ich-denke‹. Nur so verstanden, ist Vernunft die Abwendung von Not in ihrer schlechthin absoluten Gestalt: der der Vernichtung. Deshalb gilt, in der kürzesten Formel Kants, als der Grundsatz der Vernunft: ihre Selbsterhaltung.[10]
Aber weshalb bedarf es eines ›Grundsatzes‹, wenn die Vernunft nicht ihrer Erhaltung bedürftig und dazu sie allein dieser Erhaltung fähig wäre? Man darf nicht sagen, Konsequenz allein sei schon diese Erhaltung, der Grundsatz also nichts anderes als Abwehr aller Widersprüche, aller Widerstimmigkeiten; denn konsequent, einstimmig mit sich selbst, ist die Vernunft gerade, wenn sie ihre Grenzen überschreitet, wenn sie ihre elementare Selbsterfahrung auswertet als transzendentales Indiz. Was tut der Phänomenologe, wenn er das innere Zeitbewußtsein beschreibt? Er widersetzt sich der vordergründigen Richtigkeit, die Gegenwart des Bewußtseins sei momentan und bleibe unmittelbar neben dem Gegenwärtigkeitsmoment schon auf Erinnerung und Erwartung angewiesen; dann gäbe es die Vernunft nicht, insofern sie auf zuverlässige Identität des Bewußtseins im Vollzug diskursiver Operationen – selbst der kürzesten Verbindung zwischen den beiden logischen Punkten Subjekt und Prädikat, selbst der kürzesten verkürzten Schlüsse – angewiesen ist. Jede Erinnerung bezieht sich dadurch auf Zeit, daß sie schon einmal preisgegeben haben muß, worauf sie zurückkommend sich muß verlassen können, wenn im Resultat Evidenz noch zu erreichen sein soll.
Aber Evidenz macht nicht das Subjekt nach Sein oder Nichtsein aus. Es ist ein Bewußtsein denkbar, das mit geringeren Graden der Zuverlässigkeit auskommen muß, auch wenn dies biologisch noch so unwahrscheinlich sein mag. Bei der phä42nomenologischen Analyse des Zeitbewußtseins wird der kantische Grundsatz von der Selbsterhaltung der Vernunft also nicht im selben Sinne angewendet werden können wie das notwendige und unerläßliche Prinzip der Möglichkeit eines Subjekts überhaupt, jede seiner Vorstellungen müsse vom Ich-denke begleitet werden können. Das gilt noch für die schwächste Gegebenheit. Doch kann die Vernunft selbst, in ihrer philosophischen Aktion, sich nicht schon darin widersprechen, die Bedingungen ihrer eigenen Möglichkeit zu leugnen oder leichtfertig aufs Spiel zu setzen. Also wird Kants Grundsatz von der Selbsterhaltung der Vernunft immer so gewendet sein, daß notwendig ist, was Vernunft möglich werden und bleiben läßt. Für die Thematik der Zeit heißt das, daß Vernunft nicht sein könnte, wenn Zeit nur die Bezugsform der Erinnerung zuließe. Wenn Vernunft nicht nicht sein können soll, kann Zeit nicht sein, was eben nur Erinnerung zuläßt. Insofern steht die phänomenologische Analyse der Zeitanschauung unter dem theoretischen Verdacht, nur vordergründig Deskription, tatsächlich Deduktion zu sein: Erweiterung dessen, was in der Sache liegt und vorliegt. Diese Feststellung ist für die Stichhaltigkeit der Phänomenologie so schwerwiegend, daß man ihr Zweifel an ihr wünschen möchte. Denn von ihr hängt ab, wie es mit der Möglichkeit von Evidenz im Reflexionsverhältnis des Bewußtseins bestellt ist – also mit dem tatsächlichen Anschauungsrang der Phänomenologie selbst.
Daraus folgt nun schon der überraschende Sachverhalt, daß das Zeitbewußtsein, wie es die Phänomenologie thematisiert, nicht das Faktum eines endlichen Bewußtseins, sondern nur die wesensnotwendige Bestimmung eines Bewußtseins überhaupt zu sein hat, insofern in ihm Evidenz, also erfüllte Intentionalität, also Vernunft, soll möglich sein. Diese Folgerung entqualifiziert das Zeitbewußtsein als mögliches anthropologisches Spezifikum. Als Wesensnotwendigkeit muß darin ›vergessen‹ sein, daß es die Vernunft in der Dimension der Zeit mit einer Art der ihr eigenen Not zu tun haben könnte. Not insofern, als zwar die 43lebendige Gegenwart des Bewußtseins alle seine Inhalte erzeugt und fundiert, diese aber nur der schmale Grat zwischen Vergangenheit und Zukunft ist und immer schon von solcher lebendigen Gegenwärtigkeit im Stich gelassen ist, wenn darauf Begründetes aufgebaut werden soll.
Man sieht leicht, wie die Zeit schon der anthropologischen Zuständigkeit entzogen ist und nur als Horizont der ›Sorge‹, also der Unselbstverständlichkeit von Selbsterhaltung, zurückkehren kann – bei Heidegger auch dann mit dem von Husserl übernommenen Ausschluß des anthropologischen Interesses. Die Abweisung der neuen Anthropologen durch Husserl selbst beruht, wie man ebenfalls leicht sieht, darauf, daß die Phänomenologie ihnen die wesentlichen Themen ihres Einzugsbereichs längst vorweggenommen zu haben glaubt und daher nur sich weggenommen glauben kann. Zeit gehört bei Husserl zum Bewußtsein wie bei Heidegger zum Sein – dann aber nicht spezifisch zum Menschsein, auch wenn dieses einzig und einsam ›verstehen‹ können sollte, wie Zeit zum Sein gehört.
Indem die Phänomenologie das Zeitbewußtsein dem ›Bewußtsein überhaupt‹ zuspricht, macht sie Selbsterhaltung zu seiner eigenen konstitutiven Leistung und damit, wie jeder Idealismus, das Subjekt sich selbst zum fraglosen Besitz. Das Zeitbewußtsein ist die unvermeidliche Form der Intentionalität, insofern diese das Bewußtsein als angewiesen auf Mannigfaltigkeiten von Daten ausweist. So notwendig, wie es zeithaft strukturiert ist, so notwendig ist es auf eine Form der Vermeidung der Nachteile dieser Struktur angewiesen, auf etwas, was man die Dennoch-Gleichzeitigkeit – nicht nur und erst in der Zeit, sondern konstitutives Moment der Zeit selbst – nennen kann. Eben dies ist die Retention.
Durch diese von Brentano eingeleitete Entdeckung – also durch die Ausweitung des Gegenwartsmoments zum Gegenwartshof, die ›Gleichzeitigkeit‹ einer sachgeleiteten Synthesis von Impressionsreihen – wird das noch nicht zur Vergangenheit hin abgerissene Zeitquantum ›Gegenwart‹ der Selbstgewißheit des 44Cogito