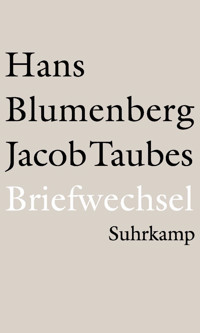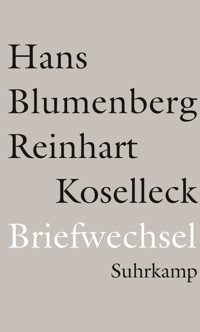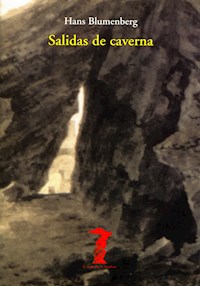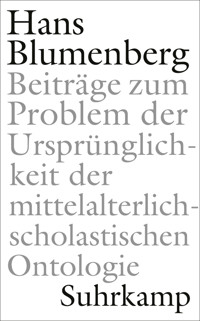39,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Am 27. April 1988, dem 50. Todestag Edmund Husserls, notiert Hans Blumenberg: »Das nun überhastet zu Ende gehende Jahrhundert wird im Rückblick von Philosophiehistorikern als ›Jahrhundert‹ der Phänomenologie bezeichnet werden.« Diese Prognose ist auch ein Hinweis auf das eigene philosophische Vermächtnis: eine phänomenologische Anthropologie, wie sie Blumenberg in lebenslanger Auseinandersetzung mit der Philosophie Husserls entwickelt hat. Eine höchst produktive Phase dieser Auseinandersetzung setzt Anfang der 1980er Jahre ein, nachdem Blumenberg seine großen Studien zu Metaphern und Mythen zum Abschluss gebracht hat und beginnt, sich intensiv anthropologischen Fragen zu widmen.
Die Schriften in diesem Band, die allesamt zum ersten Mal publiziert werden, dokumentieren diese Phase in umfassender Weise. Zwei große Themen lassen sich erkennen: zum einen Blumenbergs stetige Verfeinerung von Husserls Methode, zum anderen die Entwicklung einer phänomenologisch grundierten Beschreibung des Menschen, die, wie wir heute wissen, in der Philosophie des 20. Jahrhunderts ihresgleichen sucht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 787
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
3Hans Blumenberg
Phänomenologische Schriften 1981-1988
Herausgegeben von Nicola Zambon
Suhrkamp
Übersicht
Cover
Titel
Inhalt
Informationen zum Buch
Impressum
Hinweise zum eBook
5Inhalt
Cover
Titel
Inhalt
Erster Teil Kontingente Rationalität
I
Das Laboratorium, oder: Was wäre eine Phänomenologie der Geschichte?
II
Das Bewußtsein als Selbstreparaturbetrieb
I
.
II
.
III
.
III
Kontingente Rationalität
IV
Konstanzprinzip als Voraussetzung der Phänomenologie
V
Das Elementarerlebnis der Überraschung
VI
Beschreibung und Deduktion
VII
Gewinn und Verlust am Ende der Reflexion
VIII
Eine Randbemerkung
Husserl
s zu
Heidegger
s »Sein und Zeit«
IX
Wirklichkeit als Grenzbegriff
Zweiter Teil Subjektivität, Fremderfahrung, Intersubjektivität
I
[Die Reinigung des Subjekts]
II
Objekte ohne Subjekt
III
Exkurs: Anfang und Ende des ›Ich bin‹
IV
Okkasionalität und Monadologie
V
Exkurs zur Bedeutung von ›Ich‹
VI
Gelegenheitsbedeutungen
VII
Vorform und Muster der Intersubjektivität
VIII
[Ein nützliches Gedankenexperiment]
IX
Nichtobjektivierende Intersubjektivität
X
Intersubjektivität als Allgegenwartsersatz?
XI
Transzendentaler Pluralismus
XII
Husserl
‒ ein Averroist?
XIII
Unerfülltes Versprechen einer Ontologie?
Dritter Teil Phänomenologische Reflexion und Lebenswelt
I
Einfühlung und Einlebung
II
Widerstand und Wende
III
Grenzen der Reduktion
IV
Die unbedrohliche Drohung
V
Rückblick von der Lebenswelt auf die Reduktion
VI
Durchstreichung und Hohlform
VII
Die Negation
VIII
Der Lebensweltboden
IX
Metaphorik: Boden und Grundbuch
X
Wurzeln im Leben der Menschheit
XI
Ausgänge aus der Lebenswelt
XII
Eine phänomenologische Eschatologie
Vierter Teil Zur Phänomenologie des Zeitbewußtseins
I
Das andere Ich und der Fremde
II
›Intermittenz‹
III
Vollkommenheit der Erinnerung als Gesundheit des Geistes
IV
Horizont der Erinnerung
V
Beschreibung des Lesens
VI
Wirklichkeitsbewußtsein und Vergessen
VII
Die Erwartung
Fünfter Teil Sichtbarkeit, Sachlichkeit, Sagbarkeit
I
Sichtbarkeit
II
Undurchschaubarkeit
III
Undurchsichtigkeit
IV
Der Spiegel und die Undurchsichtigkeit
V
Selbstkenntnis und Spiegelung
VI
Nähe und Ferne
VII
Doppelhändigkeit
VIII
Selbstberührung
IX
Kraftprobe der Subjektivität
X
Das Ding sehen und dem Ding etwas ansehen
XI
Sachlichkeit
XII
Einstimmigkeit und Übereinstimmung
XIII
Intention und Reduktion: Nach der Suppe nichts mehr
XIV
Ein letzter Wunsch und das Hindernis seiner Erfüllung
Nachwort des Herausgebers
Zur Edition
Eine kurze Chronologie der phänomenologischen Bände
Der Weg zur »Beschreibung des Menschen«
Die phänomenologischen Schriften der 1980er Jahre
Fußnoten
Informationen zum Buch
Impressum
Hinweise zum eBook
3
5
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
249
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
369
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
435
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
9Erster Teil Kontingente Rationalität
I
11Das Laboratorium, oder: Was wäre eine Phänomenologie der Geschichte?
Für die Philosophie ist die Geschichte das einzige Laboratorium, in dem sie ihre Versuche machen und deren Ausgang abwarten kann ‒ sogar mit dem schrecklichen Risiko, daß ›Falsifikationen‹ Hekatomben von Opfern […] kosten.1 Der Satz wird diejenigen erschrecken, die an der sofortigen oder jedenfalls kurzfristig diskursiv erreichbaren Sicherung philosophischer Wahrheiten festhalten und dafür die martialisch so benannten ›Strategien‹ anbieten. Aber nichts spricht dafür, daß einer dieser Versuche seit Platos Ideenlehre auch nur ein paar untriviale Schritte vorangekommen wäre. Es ist auch nicht einzusehen, weshalb wir gerade auf dem Gebiet, das uns tiefere Aufschlüsse über die Welt und uns selbst gewähren könnte, in den Besitz ewiger Wahrheiten gelangen sollten, während wir uns sonst mit überholbaren Erkenntnissen begnügen müssen und auch überwiegend nicht unzufrieden zu sein brauchen. Das Bild finsterer Verzweiflung, das die historische Selbstbetrachtung der Wissenschaft für ihre Anfänge gezeichnet hat, trifft nicht zu: Man hat sich immer mit dem arrangiert, was man zu wissen glaubte, und wäre nur daran verzweifelt, den Grad der Unwissenheit zu kennen, den die Späteren jenen Früheren zuzuschreiben instand gesetzt wurden. Nur, nicht wissen zu dürfen, um wissen zu sollen, wo man wissen zu können meinte ‒ das war unerträglich.
Wenn jemand sagt, er halte Kant für die klarste und differenzierteste Realisierung dessen, was Philosophie bisher zu leisten vermochte, so kann und darf dies nicht gleichgesetzt werden mit der Behauptung, dort seien endgültige und fernerhin schulfähige Wahrheiten niedergelegt worden, so daß man als ›Kantianer‹ nur noch dies und jenes am Rande zu ergänzen, durch hermeneutische Anstrengung noch diese und jene Dunkelstelle aufzuhellen hätte. Kants größte Leistung war, uns klarer sehen zu lassen, welches die Probleme sind, die wir uns nicht 12willkürlich stellen oder bei Überdruß an ihrem Lösungsverzug abschalten können. Er hat uns, erstaunlicherweise auch unabhängig von seiner schulmäßigen Terminologie, eine Sprache für diese Problemfassungen zur Verfügung gestellt, mit der sich arbeiten läßt. Er hat uns in Gestalt der transzendentalen Deduktion sehen lassen, wie eine Theorie der Einheit unseres Bewußtseins aussehen müßte, auch wenn diese Theorie bei ihm gänzlich mißlungen wäre und eine solche niemals gelingen sollte. Es ist doch nicht der einzige Fall, daß wir es in unserer theoretischen Mühsal mit Gegenständen zu tun haben, von denen wir zumindest das eine mit Sicherheit voraussagen können, daß eine letzte Theorie von ihnen niemals zu haben sein werde, weil die vorherigen Erkenntnisse störende Fakten niemals ausgeschlossen werden können.
Gerade dieser Offenhaltung der inhaltlichen Seite der Philosophie bedarf es aber ständig. Deshalb muß auch einer, der die philosophische Form der Lehre Kants für maßstäblich hält ‒ was nicht identisch ist mit ihrer literarischen Form ‒, alles tun, um die deskriptiven Grundlagen des philosophischen Denkens als das eigentliche Feld einer ›unendlichen Arbeit‹, die durch das Ideal einer Deduktion nicht abgeschlossen werden kann, in Kultur zu nehmen und zu halten. Deshalb muß der, aus Verlegenheit von ihm geforderter Zuordnung, sich so nennende ›Kantianer‹ nicht nur zusätzlich, sondern in demselben Range seiner Anstrengungen ›Phänomenologe‹ sein.
Phänomenologie ist eine elastische Methode der Beschreibung. Sie hat die Krisen ihrer bald jahrhundertlangen Geschichte besser überstanden als andere philosophische Ansätze, obwohl ihr solche Krisen in den Augen ihres Gründers fast tödlich zugesetzt haben, vor allem die durch Heidegger bewirkte. Allmählich beginnen wir zu sehen, daß diese Krise harmlos war, weil die Hyperbeln des ontologischen Anspruchs von Heidegger uns zunehmend weniger interessieren, dafür um so mehr die überragenden Leistungen, die er deskriptiv erbracht hat.
Zu vermuten ist, daß Heidegger in einer weiteren Zukunft dem Rückblick als der Phänomenologie reintegriert erscheinen wird, also der Freiburger Heidegger hinter dem Marburger verschwinden mag. Dieser Satz wird vielen an der Schulentzweiung noch beteiligten und von ihrer Tiefe durchdrungenen Zeitgenossen ärgerlich sein. Ihn auszusprechen muß dennoch riskiert werden. Nicht zufällig ist der Marburger 13Heidegger auch und immer wieder ein Interpret Kants; vielleicht trotz historischer Unhaltbarkeiten der bedeutendste. Darin hat er das schwerstwiegende Versäumnis Husserls wettgemacht, das die Phänomenologie sonst nicht hätte verwinden können, Kant ‒ trotz der Jubiläumsrede von 1924 ‒ nur sehr ungenau wahrzunehmen.
Die Philosophie hat nicht nur Geschichte, sie ist ihre Geschichte. Anders ausgedrückt: Jede ihrer Realisierungen in der Zeit ist konkurrenzfähig mit jeder anderen, obwohl es keine Renaissancen im strengen Sinne in ihr geben kann, weil zugleich jedes philosophische Wort auch an das Welt- und Selbstverständnis seiner Zeitstelle gebunden bleibt. Es kann nicht nur darum gehen, durch Hermeneutik jene Konkurrenzfähigkeit zu aktualisieren, also gleichsam das Moment der Zeitstelle als kontingentes durch eine Art von ›Übersetzung‹ aufzulösen, jede vergangene Philosophie zur Metapher der gegenwärtig möglichen Aussagen zu machen. Vielmehr wird es eine erst in den Anfängen sichtbar gewordene Aufgabe der Phänomenologie sein, ihre Theorie dieser Geschichte zu entwickeln, was Husserl erst fast im letzten Augenblick seines Lebens als Anspruch an sich erkannt und dann mit zu geringer historischer Einsicht realisiert hat. Seine ›Krisis‹-Abhandlung macht uns schwer, den therapeutischen Ton von der deskriptiven Bestandaufnahme zu trennen. Eine Phänomenologie der Geschichte darf nicht in die deduktiv-spekulative Versuchung zurückfallen, der sich Husserl von seiner Theorie der transzendentalen Intersubjektivität her genähert hat: den Menschen und seine Handlungsgesamtheit in der Welt als bloße Funktion der höheren Bedürfnisse der absoluten Subjektivität bei ihrer Selbstverwirklichung zu sehen. Vielmehr muß eine Phänomenologie der Geschichte darauf aus sein, die Ausbildung von Totalität epochaler Selbst- und Weltverständnisse in ihrem unablässigen Zusammenstoß, Ausgleich und ihrer schließlich destruktiven Unversöhnlichkeit mit konkreten Ereignissen, Ergebnissen, Erzeugnissen wahrzunehmen. Dieses ist, was der Geschichte so etwas wie ein ›Wesen‹ gibt, nicht Restauration des ›Weltgeistes‹, sondern Freilegung des Arsenals an Formen, in denen sich Geschichte vollzieht, das ihre Strukturen unabhängig von der Kontingenz ihrer Fakten, wenn auch nur durch diese, verstehen läßt.
Und diese zu verstehen ist nicht nur Sache einer beliebig absetzbaren 14Disziplin, eines Schulfachs im Wechselspiel der Reformen und Konservationen, sondern etwas, was mit der unabdingbaren Nötigung, um nicht zu sagen: Pflicht, zusammenhängt, uns mit uns selbst ins reine, oder wenigstens: ins klarere, zu bringen. Dies auszusprechen ist das Risiko der Geringschätzung der Fachgenossen allemal wert.
II
15Das Bewußtsein als Selbstreparaturbetrieb
I.
Eine der berüchtigtsten Examensfragen über Kant ‒ zugleich eine der brauchbarsten, um Kenntnisse erkennen zu lassen ‒ ist die, wer denn in der »Kritik der reinen Vernunft« eigentlich wen kritisiere. Die Antwort darf auf die Doppeldeutigkeit des Genetivs gestützt sein, sich aber nicht darin erschöpfen. Denn diese beim Wort genommene Selbstspaltung der Vernunft, zum Objekt und Subjekt der Kritik, steigert eher den destruktiven Anschein des ganzen Unternehmens, eine subtile Paradoxie zu sein, die die Vernunft genau das tun läßt, was sich zu verbieten geradezu ihr Wesen ausmachen sollte.
Die Kritik der Vernunft an der Vernunft ist nicht nur ein diagnostisches Unternehmen, nicht nur eine prophylaktische Verwarnung wegen Grenzüberschreitung und vor weiteren solchen ‒ sie ist auch von therapeutischem Pathos: Selbstheilung der Vernunft. Die allzu kurz geratene ›Methodenlehre‹ der ersten Kritik wirkt wie ein pflichtschuldiger Appendix und darf es doch nicht sein. Sie arbeitet mit der Suggestivität quantitativer Mißverhältnisse auf jene Verkennung der dem Asklepios geweihten Gesinnung des Werkes hin, eher die Unerbittlichkeit der Vernunft weiter zu erhärten, als ihr Wesen in ihrer Regenerationsfähigkeit sehen zu lassen. Kritik der Vernunft heißt, sie reif und kräftig zur Selbstreparatur ihrer Selbstdepravation zu machen.
Die Vernunft ist nach ihrer schulgerechten Bestimmung das Vermögen der Widerspruchsfreiheit. Als solche legt sie ihr Regelwerk in der Disziplin der Logik auseinander und ordnet es. Vermögen der Widerspruchsfreiheit bleibt die Vernunft auch in ihrer Kritik im Doppelsinn. Sie wird es sogar in potenzierter Weise: Die Widersprüche, mit deren Vermeidung sie es als ›kritische‹ zu tun hat, sind die von ihr selbst hergestellten ‒ und zwar nicht faktisch irrend hergestellten, sondern kraft der ›Vernünftigkeit‹ ihrer letzten Ansprüche unvermiedenen, wenn nicht unvermeidlichen.
16Die Dialektik der reinen Vernunft ist die Disziplin ihrer ›wesensgemäßen‹ Irrtümer, die sich ihr anzeigen mit dem einzigen Indikator, den sie gelten läßt und ernst zu nehmen hat: mit dem Widerspruch. Er ist als Verstoß der Vernunft gegen die von ihr geschuldete Qualität ihrer Resultate nichts Geringeres als Selbstzerstörung. Mit schönster Konsequenz erzwingt dann die Kritik der Vernunft an der Vernunft, anhand der Indikationen ihrer Dialektik, nichts Geringeres als ihre Selbsterhaltung. Der Weg von jener Drohung zu dieser Medikation ist Anwendung von Reparaturmitteln der äußersten Ökonomie, der minimalen Nebenfolgen, der erleidbarsten Verluste an Besitztümern, die vorerst noch unentbehrlich erscheinen, ein anderes Mal aber zum Preis der wahren Freiheit werden.
Eine der Amputationen am ehrwürdigsten Besitzstand des Erkenntnisideals ist das Zugeständnis, daß es der Verstand bei den Gegenständen der Erfahrung, mit der ganzen ›Natur‹ also, nur mit ›Erscheinungen‹ zu tun habe. Jede Gegenwehr gegen diesen chirurgischen Eingriff birgt die tödliche Gefahr in sich, in die Antinomien eines Weltbegriffes zu geraten, der die Welt das ›Ding an sich‹ sein zu lassen verlangt.
Der phänomenologische Leser der »Kritik der reinen Vernunft« teilt in einer Hinsicht Kants operativen Eingriff: Daß das uns Gegebene ›Erscheinung‹ ist, erspart auch ihm eine lange Wegstrecke erkenntnistheoretischer Verwicklungen, von denen er sicher ist, daß sie in einer Sackgasse enden. Doch macht der Phänomenologe, seinem Namen gerecht werdend, nicht mit, daß dem Heilmittel der ›Erscheinungen‹ das Wörtchen ›nur‹ vorangesetzt wird. Was sollten sie sonst sein? Was sonst, wenn schon das Cogito, jene unmittelbarste und schlechthin evidente Selbstgegebenheit und der Maßstab aller anderen, klar und deutlich ein ›Phänomen‹ ist. Beweis: Es ist beschreibbar wie jedes andere, obwohl unfehlbarer als jedes andere. Daraus folgt, was auch Kant mit dem ›nur‹ versehen gesagt hatte: das Subjekt ist sich selbst als ›Erscheinung‹ gegeben ‒ Kant: die innere Erfahrung hat nicht andere Erscheinungen zu ihrem Gegenstand als die äußere. Auch sie kann sich so wenig wie die äußere mit den Antinomien ihrer kosmologischen Exekution die Widersprüche aus der Hypostasierung ihres Gegenstandes leisten, die in der Dialektik als ›Paralogismen‹ rubriziert sind.
Was für den Phänomenologen bei seiner Kantlektüre Verdacht erregt, 17ist die eigentümliche Tatsache, daß die Vernunft als unkritisierte sich bis auf Kant doch all das ›geleistet‹ hat, was sie sich nicht hätte leisten dürfen, ohne sich selbst zu zerstören, am Widerspruch zu scheitern. Die ›Kritik‹ der Vernunft an der Vernunft ist ein geschichtliches Faktum. Anders gesagt: Ohne den Glücksfall Kant hätte sie ausbleiben können (womit nicht gesagt sein darf, daß nicht auch ein anderer die Bereinigung hätte vornehmen können). Dieser verblüffende Sachverhalt der nicht nur ›wild‹, sondern in philosophischer Manier und Zucht überlebenden Vernunft bei ständiger impliziter Produktion der ihr höchst eigentümlichen Dialektik ‒ also des Ferments ihrer Selbstzerstörung ‒, dieser Sachverhalt findet implizite schon im Titel der ersten ›Kritik‹ und seinem Doppelsinn eine ungesuchte, obgleich ›mitgelieferte‹ Erklärung. Bedroht von toxischer Eigenproduktion an Antinomien und Paralogismen ist die kritisierte Vernunft, nicht die kritisierende. Diese ist eine sich im Zuge der Aufklärung ‒ vermutungsweise: des entdeckten Cogito ‒ erhebende, selbstdefinierte, selbstkonstituierte Instanz: das Subjekt der Kritik, die Vernunft als dieses. Alles, was fatal hätte werden können, das Potential der Selbstzerstörung, liegt nun ›unter ihr‹, ist der Wildwuchs der Vernunft als ihres Objekts. Die Vernunft als nunmehr kritisch gewordenes Subjekt sieht sich selbst als dem, was sie schon immer unkritisch gewesen ist, zu und gibt ihr eine neue heilsame Disziplin, die es ihr gestatten soll und gestatten wird, sich in Preisgabe des Doppelsinns im Genetiv ›Kritik der Vernunft‹ wieder mit der disziplinierten, also endgültig ›vernünftig gewordenen‹ Vernunft zu vereinigen, obwohl die Kritik klarstellt, daß Ideale der reinen Vernunft dann definitiv unerreichbar, obwohl als solche fortbestehend, inhärent bleiben.
Da liegt die Differenz, die sich der Phänomenologe nicht ersparen kann. Indem sie an der Strenge des Evidenzideals festhält, überträgt sie es auf ihre ›Erscheinungen‹ und macht die Differenz von Subjekt und Objekt in der Vernunft selbst unmöglich (obwohl das reflektierende Subjekt dem reflektierten in gefährlicher Ähnlichkeit zugeordnet ist). Anders ausgedrückt: In der Phänomenologie gibt es keine Dialektik der Vernunft. Was in Widersprüche führt, liegt außerhalb jeder Selbstinduktion der Vernunft als des Subjekts; es dürfte auch gar nicht in diesem liegen, weil nun jeder Bruch im Selbstvollzug des Subjekts strikt letal 18wäre ‒ also auch vor jeder Kritik, vor jeder Philosophie, in aller Geschichte, bei jeder Gattung von Subjekten, immer schon und überall tödlich gewesen wäre. Die Gnadenfrist der Geschichte vor der Phänomenologie gibt es nicht.
Dann aber folgt, daß die Vernunft, soweit sie von Zerstörung bedroht ist, immer schon und wesentlich die Apotropaia gegen jene schon enthält, vielleicht nichts anderes ist als deren Inbegriff. Immanent ist der Vernunft also nicht der Vollständigkeits- und Erklärungszwang ihrer Dialektik, wie bei Kant, sondern das Instrumentarium zur Reparatur des Unvermiedenen. Die zwar nicht harmlose, aber doch bei Unterwerfung auskömmliche Symbiose von kritischer und kritisierter Vernunft bei Kant ist phänomenologisch durch Ausschluß des Duals gar nicht das Problem; wäre es jedoch statthaft, so zu dissoziieren, dann hätte die Phänomenologie zum Thema nicht die kritisierte, sondern die kritische Vernunft, und deren Gefährdung wäre eine solche, die immer schon behoben sein müßte, bevor irgend etwas wie ihre ›Kritik‹ zustande kommen könnte. Heil muß sein, was heilend sein soll. Dann muß alle Heilung in beinahe paradoxer Weise prophylaktisch sein: Das Heilmittel greift zugleich mit der Gefährdung ein. Deshalb gibt es hierfür keine ›Vorschrift‹ und keine Rezeptur, sondern nur die Deskription dessen, was schon geschieht. Darin liegt der Grund für Husserls ständiges Aufbegehren gegen eine Logik, die sich als Technik des Denkens, als Gesetzgebung für dessen Rechtmäßigkeit, ausgibt; für ihn ist Logik das ›Wesen‹ der Vernunft, das dieser nicht erst durch Präzeptoren beigebracht zu werden braucht, weil auch gar nicht so verspätet erst beigebracht werden könnte. Mit der Logik wäre es immer schon ›zu spät‹, wäre sie eine Technologie des Denkens. Denn für die Etablierung einer solchen Technologie bedürfte es immer schon dessen, was sie herbeischafft, wie es für die Kritik der Vernunft immer schon dessen bedürfte, daß die Vernunft sich kritisiert hätte.
Daher ist Husserls Logik in Konsequenz eine ›genetische‹, was sie ausdrücklich erst 1920 wurde. Daß diese eine ›transzendentale‹ sein muß, versteht sich hieran besser als irgendwo sonst in der Phänomenologie dieses Attributs: Die Genesis, die sie darzustellen hat, darf kein Stück der reellen Weltgeschichte des Menschen sein, sondern das, was jederzeit schon stattgefunden hat, damit dem Subjekt nichts Endgültiges 19zustoßen konnte. Das Faktum des seiner selbst gewiß werdenden Subjekts erfordert, die genetischen Bedingungen seines ›Überlebens‹, seines ›Nochdaseins‹ wie seines ›Dableibens‹ als den Besitz der vollständigen Abwehr gegen jede erdenkliche Fatalität darzustellen. Der erste Augenblick, wann immer, muß genügt haben, jene Genesis zu durchlaufen, um allen weiteren gewachsen zu sein. Das behindert die Deskription des bei jenem Durchlauf Erforderlichen nicht im geringsten; der Zeitverbrauch ist für Wesenssachverhalte unwesentlich. Die ›Genetische Logik‹ beschreibt etwas, was Gleichzeitigkeit erfordert und im strengsten Sinne doch nicht haben konnte: die Selbstrestitution des Bewußtseins. Etwa des Bewußtseins, das über die Negation noch nicht verfügt hätte, um mit einem mißlungenen Vorgriff seiner Protention durch Streichung und Ersetzung einer Fehldeutung fertig zu werden, ohne daran seine Selbsteinstimmigkeit zu verlieren; etwa des Bewußtseins, das bei verdichteten ›Erfahrungen‹ solcher Art zugunsten der Stabilität seiner ›Welt‹ davon abläßt, sich auf alles Gegebene als solches immer festzulegen, und statt dessen die Modalität wechselt, in Möglichkeiten und Bedingtheiten statt in Wirklichkeiten zu verfahren lernt. Man sieht sogleich, daß die ›momentane Dringlichkeit‹ bei Qualität und Modalität der vorprädikativen Zustimmungen nicht gleich ist: Bei der Modalität wäre auch ein verzögertes Verfahren der ›Einübung‹ noch zuträglich, bei der Qualität nur, wenn ›frühe Enttäuschungen‹ der Position ausgeschlossen werden könnten (wofür es präkulturelle Vorkehrungen geben mag).
Auch wenn uns die ›Genetische Logik‹ Husserls am einleuchtendsten belehrt, was das ›Transzendentale‹ an der Phänomenologie werden konnte, läßt sich doch die Idiosynkrasie des Meisters gegen jede anthropologische ›Zutat‹, gegen jedes dessen verdächtige Element, nicht zwingend nachvollziehen. Denn der Übergang zur Anthropologie ist ja identisch mit dem zum genetischen Zeitverbrauch und darin zum Selbsterhaltungskriterium: Was erwerbbar und erlernbar ist, nicht zwingend des momentanen Durchlaufs seiner Genesis bedarf, kann anthropologische Bedingtheit haben ‒ und diese schließt keineswegs eine Relativierung ein, deren Erzfeind jede Phänomenologie sein wollte. Warum sollte sich nicht selektiv als lebensdienlich erweisen, was doch als ›das Wesentliche‹ auch das Zuträgliche sein mußte? Könnte nicht 20das Resultat der Anthropogenese geradezu ‒ wenn vielleicht auch überflüssigerweise für den ›Wesensschauer‹ ‒ die Bestätigung sein für das, was ohnehin Genese hätte sein müssen, auch unter den reineren Bedingungen eines selektionsfreien Empyreums? Für den, der aus anderen Quellen wissen zu können glaubt, ist diese Erwägung redundant. Aber nicht alle haben sich den strengen Exerzitien der phänomenologischen Reduktion zu unterziehen vermocht und würden dann eine ›phänomenologische Anthropologie‹ begrüßen, die ihnen wenigstens dabei hilft zu verstehen, was andere aus besseren Quellen haben mögen.
Doch ist nicht nur didaktischer Sukkurs gewonnen. Auch Freiheit, sich mit gelockerter Disziplin in weiterem Horizont umzusehen: Hilfen zu empfangen und vielleicht zu geben. Der wichtigste Austausch wäre, so meine ich, das Phänomen Bewußtsein an das Phänomen Leben ›anzuschließen‹. Grob gesagt: Bewußtsein als Leben mit anderen Mitteln zu verstehen ‒ dann aber im Grunde mit demselben Grundproblem, dem der Selbsterhaltung. Wer die Logik als eine Art Selbstbekränzung ‒ wenn nicht Krönung ‒ des Bewußtseins versteht, zugleich aber des legitimen Gebrauchs jeder Teleologie beraubt ist ‒, wird die Degradierung zum Arsenal der Selbsterhaltung nicht zu billigen haben.
Auch als Beschreibung eines Statuts der ›Normalität‹ wird die Logik aus ihrem genetischen Aspekt verfehlt: Störungen des stabil geregelten Denkens wären dann Verstöße gegen das Reglement, endogene Ordnungswidrigkeiten oder exogene Eingriffe ins gesunde Geistesleben. Tatsächlich enthielte es keinen Widerspruch, eine so regelrechte und regelmäßige Normalität zu denken, daß sie der Zuständlichkeit nahekäme. So hatte sich die Weltgesundheitsorganisation (WHO) in euphorischen Anfängen einmal ihren Leitbegriff einer der Welt zu bescherenden ›Gesundheit‹ definiert als den Zustand vollkommenen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens. Ein witziger Mediziner hatte die Gegenbestimmung getroffen: Gesundheit ist ein prekärer Zustand, der nichts Gutes erwarten läßt. Die kurze Geschichte der aus der WHO-Definition erwachsenen Erwartungen und Ansprüche hat eher die Tendenz zur humoristischen Verfremdung vorgelegt, und es ist nicht von der Hand zu weisen, daß man auch den Bewußtseinsoptimismus ‒ als die Annahme eines auf Erweiterung und Intensivierung angelegten Weltorgans ‒ in Analogie zur Begriffsgeschichte von ›Ge21sundheit‹ ansehen darf. Wie Gesundheit ist auch Bewußtsein vor allem die Fähigkeit, trotz und mit Störungen zu leben. Wäre das beschworene In-der-Welt-sein ein stabiles Ein- und Anpassungsverhältnis, bedürfte es einer solchen offenbaren Überflüssigkeit wie der Feststellung und der Negation von Sachverhalten oder deren bloßer Disponierbarkeit als möglicher, deren Zusicherungssteigerungen bis zu notwendigen hin nicht ‒ also der ganzen Logik auch dann nicht, wenn man sie als ein System ihrerseits möglicher ›Formen‹ erfinden und so auf ihre ›Idealität‹ stoßen könnte. Die ›Genetische Logik‹ impliziert ein Weltverhältnis der Enttäuschungen, Irrtümer, des Zweifels und sogar der systematischen Krisen. Darin liegt die Berechtigung, das ›Wesen‹ des Daseins existentialanalytisch als ›Sorge‹ zu umfassen.
Darin liegt das Verbot, eine Art Äquivalenz von Bewußtsein und Wohlbefinden herzustellen, im Rückschluß aus der alten schönen Gleichung von Theoria und Eudaimonia der Griechen. Das andere Extrem ist, von der Angst her das Bewußtsein als die Fähigkeit jederzeitigen Alarms für das organische System zu sehen, auch wenn es sich nicht gerade auf der höchsten Stufe dieser ›Aufmerksamkeit‹ für seine Gefährdung befindet. Korrelat der Angst ist, was die Logik in ihrer Genesis angesichts des Widerspruchs gelehrt hat und was nichts schwerer gemacht hat als die etwa von Wittgenstein provokant an den Tag gelegte Unbefangenheit gegenüber dieser größtmöglichen Störung des Denkbefindens mit Namen ›Paradox‹, bezogen auf die präsumtive Sicherung von Kalkülen hinsichtlich ihrer Widerspruchsfreiheit. Diese präsumtive Sicherung ist zwar Logik in Reinkultur ‒ deren tiefste Enttäuschung ein Theorem über die nichterweisbare Widerspruchsfreiheit ‒, aber zugleich auch die weiteste Entfernung der Logik von ihrer genetischen Funktion, im gegebenen Fall mit der Störung fertig zu werden und ihr zum Trotz denkend zu überleben. Dieses Phänomen ist es, was mehr als im Verdacht steht, einer anthropologischen Interpretation zu bedürfen, um es eben nicht als das Selbstverständliche einer ›Lebenswelt‹ zu nehmen.
Von ›Selbsterhaltung‹ in diesem Zusammenhang zu sprechen sieht nach bloß metaphorischem Behelf aus. Dafür hat gesorgt, daß sie als ›Trieb‹ qualifiziert worden war und als solcher zuerst in der Stoa auch nur metaphorisch, etwa auf den Erdkörper und seinen tonos, angewen22det werden konnte. Das Wesentliche des Triebs aber war so etwas wie Mehrwert, Zugewinn, Bereicherung, Vermehrung, Wachstum ‒ also das am Organismus und seinem Verhalten Sichtbare: die Gier der Einverleibung und der Ausdehnung, der Hortung und Vermehrung, der Herrschaft und Vernichtung. Aber das alles sind Erscheinungsformen eines Prinzips, das jedes materielle System durch bloße Trägheit erfüllt, indem es die Krafteinwirkung im Maße seiner Masse von anderem erfordert, soll es seinen Zustand zu ändern ›bereit‹ sein. Dabei fehlt es am Sichtbaren als Äquivalent eines ›Triebs‹ der Selbsterhaltung, nicht einmal von der Gravitation als der ›inneren‹ Kraft eines materiellen Systems muß schon die Rede sein, um dessen Beständigkeit zu begründen als das, was geschieht, wenn nichts geschieht. Dies jedoch ist die schlechthin ökonomische Form der Selbsterhaltung: Nichts geschieht, wenn nichts geschieht. Man könnte es auch das ›Ideal‹ aller Varianten von ›Selbsterhaltung‹ nennen: Innere Kraft kostet sie nur, wenn äußere Kraft ins Spiel kommt. Und solche ›sekundäre‹ innere Kraft eines (organischen) Systems ist es, was die Sichtbarkeiten der Selbsterhaltung, ihre triebförmige Erscheinungsweise produziert: Drohgebärden, Angriffshandlungen, Beuteprozeduren, Revierdominanz, Paarungsbewerbung. Ein Tier, das ein anderes verschlingt, ›gewinnt‹ nichts hinzu, es bleibt nur, was es ist; und das auch dann, wenn es noch Größenwachstum zeigt, sich vermehrt. Nichts tendiert auf den Übermenschen, es sei denn, als Mensch könnte der Mensch nicht bleiben, was er ist.
Das Phänomenale also täuscht den ›Trieb‹ vor. Deshalb ist der Rückgang vom Morphem aufs Genom überall die Grundregel. Banalisiert: Das Huhn ist nur das Organ des Eis, wieder zum Ei zu kommen. Allgemeiner: Die ausgereifte organische Form ist nur das Mittel der Selbsterhaltung des formierenden Codes, der genetischen Substruktur. Sie bedient sich, wie der Parasit, einer Art von ›Zwischenwirt‹, um nur dorthin zurückzukehren, woher sie gekommen ist: ein Umweg, um den Weg nicht zu verlieren. Das alles ist geläufig, fast landläufig, ›Bildungsware‹ ‒ und dennoch verblaßt es vor der Gewalttätigkeit des Sichtbaren, vor dem Fressen und Gefressenwerden als der Phänotypik aller Lebendigkeit. Daher dann der Verruf, in den gerät, wer von Selbsterhaltung als einem konstitutiven Element von Rationalität spricht, noch bevor er sich dabei ›darwinistisch‹ gebärdet hätte.
23Die Herrschsucht der Selbsterhaltung ist das Mittel in einem Feld, in dem das Einwirken fremder Kräfte so selbstverständlich ist wie die Ubiquität der Gravitation im Universum, seit es in diesem mehr als eine Masse gibt. Das Genom schafft sich die Gestalt des Organismus, der es erhält, und insofern erhält es sich selbst. Die Unbeständigkeit des Organismus erzwingt, ihm die Eigenschaft der Vermehrungsfähigkeit zu imprägnieren, die eben ›Vermehrung‹ doch nur im Anschein zum Effekt hat. Und das gilt, wie sich noch zeigen wird, ebenso für die Evolution: Das Morphem muß variiert werden, wenn es dem Anspruch der Erhaltung des Invarianten nicht zu genügen vermag oder wenn es ein Potential für mögliche und künftige Anforderungen ausbildet. Wo der Bezugspunkt des ›Egoismus‹ liegt, der diesen Prozeß zu bestimmen scheint, steht zur spekulativen Bestimmung frei: ›Das Leben‹ ist in dieser Funktion so handlich wie ›das Sein‹ oder ›das Bewußtsein‹. Vom Sein zu sprechen ist so abwegig nicht, wenn man sich daran erinnert, daß eine ganze Fundamentalontologie sich daran orientieren sollte, die ›Sorge‹ des Daseins zum Inbegriff seines Selbstverständnisses aus seinem Seinsverständnis heraus zu machen ‒ und diese ›Sorge‹ der Existentialanalytik war doch nichts anderes als eine von allem ›Triebhaften‹ abgelöste Verhaltensform der Selbsterhaltung. Die Sorge läßt das Sein verstehen und versteht sich aus dem Sein, weil dieses wesentlich ›das Bleibende‹ ‒ bei Augustin schon: manentia ‒ ist.
Nun könnte man sagen, der Weg von der Trägheit eines materiellen Systems zur Sorge des Daseins um sich selbst sei zu weit, um mehr als bloße Analogie zu erzeugen, ebenso zu weit wie der Weg von der Anziehungskraft der Massen zur Erotik der Liebenden, wie er doch in Schopenhauers Theorem von der Einheit des ›Willens‹ übersprungen werden sollte und unter dem Hohn aller ›ernsthaften‹ Theoretiker durch Analogien und Metaphern überbrückt wurde. Der Vergleich ist nicht zulässig, weil die Rationalität der Selbsterhaltung die ›Zwischenräume‹ ihrer Präsumtion ständig der ›ernsthaften‹ Theorie zur Aufgabe macht ‒ und das nicht als ein Nachschieben und Lochflicken hier und da, um die Maschen des Netzes zu verengen, sondern als zunehmende genetische Gründlichkeit. Dafür gilt meine These: Je näher man ontogenetisch dem Genom kommt, um so genauer wird die Bezie24hung, in der sich das Bewußtsein als ›Reindarstellung‹ des Lebens zur Anschauung bringt.
Immer deutlicher wird für die mikrobiologische und biochemische Forschung, daß der genetische Apparat nicht nur eine Trägheitsresistenz gegen Einflüsse von energiereicher Strahlung besitzt, wie es sich für ein materielles System ohnehin gehört, sondern darüber hinaus zur Selbstrestitution bei Schädigungen ausgerüstet ist. Brüche im Strang und Doppelstrang der DNS wie Ausfälle und Veränderungen ihrer Bausteine, der Nukleotidbasen, werden mit ebenso im Genom fixierten Restitutionsverfahren ›geheilt‹. Im Genom ist ›Selbsterhaltung‹ ein ständig ablaufender und in der Disposition bereiter Vorgang. So bewirkt eine ausgiebige UV-Bestrahlung in den Zellen der Haut Noxen am genetischen Material in der Größenordnung von 105, die mit Eigenmitteln der Zellen behoben werden: Das Genom kommt für sich auch im Schadensfall auf, weil es genetisch die Mittel der Selbstreparatur erworben hat, das Überlebende die Organe seines Überlebens konserviert, der Erfolg das Geheimnis des Erfolges thesauriert. Der Rauch einer einzigen Zigarette verursacht in den Alveolarzellen der Lunge Noxen in der Größenordnung von 104, und im Verhältnis dazu ist der onkogene Effekt die ungeheuer unwahrscheinliche Ausnahme des Versagens der Selbstreparatur. Wobei die meisten Fälle des Versagens mit dem bloßen Absterben der Einzelzelle enden, das Umgekehrte ‒ die Tumorbildung ‒ also der groteske gegenläufige Fall ist: das Überleben bei Heilungsmißerfolg durch Tumeszenz. Von diesem Typus ist die Evolution.
II.
Der Begriff der Entwicklung kann nicht durch den Vergleich eines angenommenen Ausgangszustands mit einem beliebigen Folgezustand oder einem wiederum angenommenen Endzustand gewonnen werden, gleichgültig, ob man die Differenz dieser Zustände im Komplikationsgrad, in größerer Bestimmtheit oder Leistungsfähigkeit sehen will. Wäre es so, ließe sich sagen, der Grad der genommenen ›Entwicklung‹ ließe sich ermessen am Abbau von Entwicklungsbedürftigkeit. Diese 25Sichtweise widerlegt sich leicht am Menschen: Wenn irgendein Lebewesen, so ist dieses im Maße seiner rein zeitlichen und faktischen Endstellung erst recht entwicklungsbedürftig. Seine nahezu omnipotente Leistungsfähigkeit läßt die Lücke an Regulativen, an Bestimmtheiten gattungsbedrohlich aufklaffen.
Entwicklung läßt sich begreifen als komplementärer Sachverhalt dazu, daß es störungsfreie organische Systeme nicht gibt. Ganz elementar beruht das auf der Eigenschaft des Metabolismus, des Stoffwechsels, der die Energie zur Selbststabilisierung des Systems, individuell wie spezifisch, liefert: Je erfolgreicher das System damit ist, sich zu erhalten, um so instabiler wird seine ›Versorgung‹ mit dem Bedarf an Wechselstoff. Ein Weltmeer, angefüllt mit siegreichen Protozoen, die kein anderes Muster ihrer Propagation als sich selbst hätten, wäre der Untergang schon der frühesten Lebensformation gewesen. Entwicklung ist ein Inbegriff von Notlösungen für solche Lagen, der Vermeidung von Aussichtslosigkeit, der Auswege aus Engpässen, die dadurch nicht zu Sackgassen werden. Nur ist der Preis für die Ausschaltung letaler Störungen die Steigerung der Störanfälligkeit des ›verbesserten‹ Systems, damit zugleich die Erhöhung des Bedarfs an Vorkehrungen zu dessen Selbstabschirmung bis hin zu seiner Selbstreparatur. Entwicklung ist der Verbund von Vorkehrungen gegen die Nebenfolgen von Vorkehrungen zur Selbsterhaltung, die nicht als Inbegriff von Stabilität aufgefaßt werden darf, sondern so etwas wie authentische ›Resurrektion‹ einschließt: Auferstehung aus dem Grenzzustand der Hinfälligkeit, der Fastverlorenheit. Krank sein zu können, ohne schon gestorben zu sein, ist in diesem Sinne eine der großen Errungenschaften, die allem protozoischen Leben fehlt. Aber eine Krankheit oder Verletzung oder Amputation ist eben als Leistung des Überlebenkönnens zugleich auch immer ein Syndrom von Leistungsbedürfnissen, die sowohl die Funktion des Überlebens bereithalten als auch deren Nebenfolgen zu entschärfen haben. Man denke an das segensreiche wie verhängnisvolle Ineinander der Gerinnungsfähigkeit des Blutes, das in höchstem Grade ein ubiquitäres Medium der Selbstreparatur des organischen Systems wie ein Störfaktor ersten Ranges seiner Beständigkeit ist. Sollte der Mensch ein Endpunkt des evolutionären Prozesses sein, aus welchen Gründen immer, so wäre seine Unüberbietbarkeit nicht nur die seiner Eigen26schaften und Leistungen, sondern zugleich die seiner Bedürftigkeiten ‒ und am genauesten: die jener als der bloß gewendeten Aspekte dieser. Das ist noch gar nicht die spezielle Rede der Anthropologie von ihm als ›Mängelwesen‹ des besonderen Typs der Entblößung von Ausstattung. Die Formel wäre keine andere, könnte vom ›Füllewesen‹ die Rede sein.
Stoffwechsel ist nicht so sehr die durchgängige Bestimmung lebendiger Systeme, er ist auch das ›Muster‹, nach dem das Leben als Gesamterscheinung seine Probleme löst. Zwar sind die Substrate nicht gleichgültig, die in den Stoffwechsel eingehen und die Einheit der organischen Gestalt im Spielraum einiger Differenz der Mittel bewahren können; aber die rekonstitutive Leistung des Lebens besteht im Ausgleich des Mangels an dem einen durch das andere. Der Aufbau von Indifferenz gegen die Substrate des Metabolismus ‒ nicht nur und primär also dieser selbst ‒ ist die Grundleistung des Lebens, deren Schema hindurchzieht durch die ›Evolution‹ bis zum Bewußtsein und seinem ›Substrat‹ aus Affektionen. Insofern ist Bewußtsein im Lebenszuge und -vollzuge ›nichts Besonderes‹, auch wenn wir nichts darüber wissen, was es denn nur ist. Dieses ›Ignorabimus‹ hat an Bedeutung verloren.
Das Bewußtsein fungiert, als sei es Leben in Reindarstellung: Es nimmt auf aus seiner Umwelt, was sich ihm anbietet, sortiert und verarbeitet zur ›Gestalt‹ des affektiven Materials, und es korrigiert seine Fehler, füllt seine Lücken, interpoliert und extrapoliert mit den Gegebenen aufs Ungegebene, kassiert Urteile, sistiert Entscheidungen, stellt Bedingungen ‒ es ist Selbstresurrektion auf der Ebene des Umgangs mit Repräsentanten. Dieses System beharrt nicht durch bloße Zustandsträgheit, kann es nicht, da es nichts anderes als Zulassung aller Einwirkungen von außen und innen ist, ohne deren Risiko es nicht die geballte Leistung der Selbstäußerlichkeit erbringen könnte, aus der die Gewinne der räumlichen Distanz und der zeitlichen Prävention des vor-sorglichen Handelns gezogen werden.
Doch auch jede Leistung des Bewußtseins impliziert die Erzeugung neuen Leistungsbedarfs. Gerade das ist es, was Husserl in der genetischen Phänomenologie als das Hervorgehen der prädikativen aus den vorprädikativen Erlebnissen beschrieben hat. Aber gerade für den ge27netischen Aspekt der Bewußtseinstheorie gilt, daß die Genesis dieses ›Lebens‹ ‒ emphatisch so von Husserl für den Inbegriff der Bewußtseinswirklichkeit gebraucht ‒ nichts anderes ist als die Aufbringung der Voraussetzungen für ›Selbsterhaltung‹ im strengsten Sinne der Unzerstörbarkeit. Das Bewußtsein kann jede seiner Positionen opfern, um sich nicht brechen zu lassen; sein ganzes Leistungsrepertoire von der Negation über die Modifikation zur ›Reduktion‹ der Welt als solcher und im ganzen steht im Dienst einer letzten Unanfechtbarkeit durch ›Rückzug‹. Zwar ist die Intentionalität als Grundzug des Bewußtseins zugreifend, aggressiv; doch nur so weit, wie es in dieser Möglichkeit nicht auf dem Spiel steht; dann erweist sich Bewußtsein als ein Inbegriff von Fluchtvorrichtungen auf das Minimum des Haltbaren vom Typus ›Es muß die Welt nicht geben!‹, denn nur und gerade dann ist das ›Ich bin‹ das einzige, was es geben muß, und damit das Sicherste im Rückhalt dessen, was das Bewußtsein selbst ist. Es rettet sich, wenn es sein muß ‒ unter Umständen sogar, wenn es nicht einmal sein muß ‒, um den Preis alles anderen. Es ist Daseinswille im unbedingten Sinne.
Daß dieses Bewußtsein Selbsterhaltungsschwierigkeiten hat, hängt zusammen mit der Lebenskonsequenz, die es darstellt. Die Selbsterhaltung jedes organischen Systems ist bedingt durch die Auswertung der Informationen über den ›Zustand‹ seiner Umwelt und seines Selbst in ihrem Bedürfniszusammenhang ‒ warum nicht gleich ›Bewandtniszusammenhang‹. Als unmittelbare Auswertung der Information durch Verhalten ist dies die vertraute Entsprechung von Reiz und Reaktion, von Afferenz und Efferenz, das Ideal der physiologischen Stimmigkeit, solange Deutlichkeit und Eindeutigkeit der Information vorausgesetzt werden können, die den Reiz zum ›Auslöser‹ determinieren, ihn als solchen determinieren lassen. Für jede Minderung dieser Qualität springt ein Nachsicherungssystem ein, das in der festen Kombination von Reizen zum Auslöser ‒ also: des Plurals zum Singular ‒ besteht. Dies ist so etwas wie die ›Urform‹ der Intentionalität als der Zuordnung von Merkmalen zu ›Gegenständen‹, die genuin auch ›Auslöser‹ für Handhabungen, Gebrauch, Verwendung, Bewertung, Tauschangebot, schließlich: Erkenntnis sind. Als intentionales ist das Bewußtsein die Leistungsfähigkeit, Mannigfaltigkeiten zu Einheiten zusammenzufassen. 28Es wird ›synthetisch‹ in seinem Grunde. Der Gegenstand als Datenkomplex von notwendigem Verbund ist wegen der Unwahrscheinlichkeit seiner Wiederholung wichtigstes Element eines Sicherungssystems zur Vermeidung letaler Irrungen. Das Bewußtsein ist das Organ zur Herstellung von Mittelbarkeit der Koppelung von Reiz und Reaktion, Affektion und Effektion, insofern jedes affektive Element nur über seine intentionale Zuordnung zum Synthesepol wirksam werden kann. Das Eintreffen jedes Elements für sich beim Rezeptor bewirkt nichts anderes als die Disposition und Determination, bestimmte weitere Elemente als stimmig zu akzeptieren, aber auch nur diese. Die Protention als Faktor der Intentionalität ist die Einschränkung der Beliebigkeit der Affektionen auf einen mit jedem weiteren Element restringierten Set: Es geht immer weniger, und daraus folgt, daß die Orientierung immer sicherer wird. Diese Sicherheit bedeutet vor allem die Potenzierung des Selbstresurrektionsvermögens des Bewußtseins mit Hilfe seines als ›Logik‹ zu betitelnden Repertoires. Es mag sich respektlos ausnehmen, wenn ich sage, Logik sei der autonomisierte Komplex derjenigen Vorkehrungen, mit deren Hilfe schon der zerstückelte Wurm aus jedem seiner Stücke heraus die Läsion überwinden und das Ganze restituieren konnte. Ich sage nicht, die Logik als ehrwürdiges Mitglied des Ternars der genuinen philosophischen Disziplinen habe diese Funktion und nichts als deren (wahrlich nicht verächtliche) Würde; was ich sage, ist, daß genetisch ‒ dem ›Sitz im Leben‹ nach ‒ diese Funktion das Bewußtsein überhaupt erst in den Besitz solcher Operationsmittel gebracht hat, die sich ungeachtet und unbeachtlich deren Herkunft ›theoretisieren‹ ließen. Diese genetische Annahme entwürdigt den Gegenstand der Disziplin so wenig, daß sich sogar die platonisierende Auffassung ihrer Inhalte damit vereinbaren ließe, sofern man es für erheblich hielte, dies auszumachen ‒ schließlich muß man doch an das Problem herankommen, wie ein platonisierender Logiker von unübertrefflicher Entschiedenheit gegen jeden Naturalismus und Anthropologismus, wie Husserl es war, in knapp zwei Jahrzehnten zu einer ›genetischen Logik‹ als Obligation der phänomenologischen Arbeit kommen konnte, ohne mit dem Projekt den Triumph gefährdet zu sehen. Husserl hat allerdings nicht daran gedacht, die Intentionalität des Bewußtseins als solche der genetischen Reduktion für zugänglich zu halten. Dazu wäre die de29skriptive Auswertung des Sachverhalts zureichend, aber auch nötig gewesen, daß jede Affektion die konstitutive Leistung der Gegenstandsformation ›auslöst‹, indem sie in eine Art von ›Warteposition‹ auf weitere Rezeptionen versetzt (Protention), die nicht mehr von derselben Kontingenz wie die erstgedachte sein können. Die Toleranz des Bewußtseins für das jeweils nächste ›Element‹ einer Gegenstandskonstitution verengt sich im Maße der ›Bestätigung‹ (Erfüllung), die das Wesen der Intentionalität ist. Das ändert am faktischen ›Anfall‹ der Impressionen nichts und nichts an der immanenten Zeitkonstitution durch diese, die nur hinsichtlich des Umfangs der Retention ‒ nicht dieser selbst als eines Trägheitsphänomens ‒ von der Intention abhängig ist. Wie sich schon heraushören läßt, ist der Bewußtseinsstrom nicht identisch mit der Bewußtseinsintentionalität, obwohl diese den Strom kanalisieren muß, um ›erfolgreich‹ zu sein ‒ und das heißt: sich so einzustellen, daß der Zufluß an Affektionen sich dem Selektionsdruck der Intention konformiert. Man mag sagen, die Position des isolierten Observators, die Technik des Affektion reduzierenden Experimentators, seien Konvergenzverfahren von Affektion und Intention: Das, was in der Zeit erscheint, identisch werden zu lassen mit dem, was als Zeit erscheint.
Verdichtung der gegenstandskonstitutiven Impressionen im Bewußtseinsstrom ist die ständige ›Arbeit‹ unter dem Zieldruck der Intentionalität. Im Maße ihres Erfolgs aber befähigt sie zu einer Gegentendenz: Einsparung von Erfüllungen, Aussparung von Füllungen, Reduktion auf gesicherte und sichernde Merkmale, Anzeichen, Symbole. Ohne diese Gegenläufigkeit auf Nutzung des Gesicherten zur Auslassung des Sichernden wäre das Bewußtsein von Erstickung am eigenen Zielerfolg bedroht. Verkürzung seiner Ansprüche nach deren vormaliger, halbwegiger, annähernder, kreditierter Erfüllung ist nicht die Nachlässigkeitssünde der Galileinachfolger oder -vorgänger; es ist die Lebensbedingung des Bewußtseins, insofern dieses vom ›Leben‹ stammt, ›Leben‹ ist und leben läßt. Symbolisierung ist Verzicht auf Komplettierung und insofern Raumschaffung unter der Vorgabe, daß der die ›Gegenstände‹ übergreifende Verbund, das Korrelat der Erfahrung, eine ›Welt‹ ist, die ihren eigenen intentionalen ›Anspruch‹ stellt, dessen Unerfüllbarkeit nicht bloße Analogie zu der der Gegenstände ist. Das Nachlas30sen gegenüber dem Gegenstand ist zwar Versagen, aber darin nicht Enttäuschung, Verlust nur im Hinblick auf den Standard der Gattungsarbeit ‒ das Nachlassen gegenüber der Welt greift nur dem Verlassen vor und ist die Enttäuschung des Lebens selbst, die sich in die vielen Einzelakte umsetzt, in denen es eine Bedeutung hat, daß die Welt Zeit kostet und man sich diese Zeit ständig zu ›schaffen‹ hat. Deshalb läßt sich die Gegentendenz des Bewußtseins gegen seinen Erfüllungstrieb ‒ der ihm von der Sache her kommt ‒ als anthropologisches Phänomen, ja Grundphänomen begreifen. Die Einfungierung eines Merkmals zum Symbol, zum Merkmal, zum Reizsurrogat, beruht auf der bewährten und bewährbaren Voraussetzung, andere und unbemerkt wie unbefragt bleibende Merkmale würden unter anderen Aspekten demselben Gegenstand von dieser Spezifität zugehören, ließe man es nur darauf ankommen. Es nicht darauf ankommen zu lassen, darauf beruht die anthropologische Distanzierung zum Erfahrbaren in der Gegenrichtung zur theoretischen Annäherung. Im Hinblick auf die ›Welt‹, von der die Rede war, daß sie Zeit kostet und in ihrer Unerreichbarkeit die Enttäuschung des Lebens selbst ist, fällt auch die Distanzierung in einem erweiterten Sinn unter die Intentionalität des Bewußtseins, das sich darin zu sich selbst und seiner Sache freistellt. Dieser Rückbildungsprozeß ist, sieht man es so, kein Bewußtseinsverlust, wenn auch nur Gewinn als Bedingung seiner Gewinne.
Nennt man die ›Distanzierung‹ den anthropologischen Aspekt der Intentionalität, so fällt eine funktionale Analogie ins Auge, die von größter Bedeutung für die Frage nach der Möglichkeit einer phänomenologischen Anthropologie ‒ wenn nicht schon ein Zentralstück ihrer Wirklichkeit ‒ ist: in der intentional distanzierten Vertretbarkeit der Sache durch eines ihrer Stücke für die Wahrnehmung vollzieht sich etwas, was sich als Delegation der Sache selbst an diesen ihren Repräsentanten beschreiben ließe, eingeschlossen die Nötigung der Wahrnehmung, dieses ›Angebot‹ der pars pro toto, des Leibhaftigkeits- und Anwesenheitsverzichts, zu eigenen Gunsten zu akzeptieren; als ›Delegation‹ ist dies die Darstellung eines Kunstgriffs ›von der Sache her‹, den der Mensch wegen seiner Unfähigkeit zur authentischen Ubiquität, zur ›Mitwirkung‹ allenthalben, ständig und von Urzeiten her vollziehen muß, sich derart vertreten zu lassen, als sei er es selbst, der anwesend 31fungiere ‒ und dies aus demselben lebensförmigen Urgrund der Formel ›Die Welt kostet Zeit‹. Dabei bleibt das Drängen auf ›Vollpräsenz‹ ‒ der leibhaftigen Sache selbst dort, des leibhaftigen autonomen Subjekts hier ‒ immer mitgegenwärtig als der Vorbehalt, der irgendwann und irgendwo, wenn es darauf ankommen sollte, geltend gemacht würde und dem gleichsam vorzuarbeiten alle intermediären Intentionsverzichte überhaupt nur ausgeübt, geduldet, ertragen und verfeinert werden. So tief ist die Unzufriedenheit, nicht alles selbst zu sein und selbst zu bestimmen, in der Verfassung des Bewußtseins selbst als Intentionalität verwurzelt, so unausrottbar hängt alles mit diesem Lebensorgan zusammen, was die Subjekte nötigt, sich aufzugeben, um sich zu gewinnen ‒ die Sache nicht selbst zu sein und nicht erfüllend zu haben, um überhaupt mit mehr als einer Sache, nämlich mit einer Welt, im Lebensumgang zurechtzukommen.
Der Antagonismus des Bewußtseins ist das Risiko des Lebens selbst, sobald es sich in der ›Reinkultur‹ seines absurden Leistungsprinzips darstellt. Man würde es und könnte es niemals wünschen, wenn nicht schon das Wünschen fatales Symptom seines Daseins wäre und damit seiner einzigen absoluten Insistenz, bei diesem Dasein zu bleiben. So kann es wünschen, nie gewesen zu sein ‒ und wird dies wohl gar wünschen müssen ‒, nicht aber wünschen, im nächsten Augenblick nicht mehr zu sein, was es in diesem Augenblick ist. Auch das ist nichts anderes als Beschreibung dessen, was ›Bewußtsein‹ heißt. Es ist ein Selbstprolongationsorgan, und es ist innerhalb dieser Bestimmung im Besitz der Mittel, sogar mit seinen Fehlleistungen fertig zu werden, die zumeist mit seiner intentionalen Distanzierung zu tun haben, oder seine Vermeidungsfähigkeit für solche Fehlleistungen zu steigern.
III.
Das erfolgreiche Monstrum ›Bewußtsein‹ wird im Maße seines Erfolges als Organ der conservatio sui zum Feind seiner selbst: Es gewinnt oder lastet sich auf, je nach Aspekt, die bei der nackten Selbsterhaltung noch ausgeschlossene, aber durch sie möglich werdende freie Wahl der conversatio cum se ipso. Das liegt schon in seiner Leistungsform als In32tentionalität; denn diese schließt ein, daß zwar jedes affizierende Datum zu einem Gegenstand gehört, indem es zu diesem beiträgt und wird, ihn ›konstituiert‹, doch die Retentionsstruktur kein zwingendes ›Programm‹, keinen ›Kausalnexus‹ unter den Elementen der Sedimentation enthält. Dann nämlich wäre jede Verfehlung der normierten Sequenz schon das Mißlingen jener Konstitution, zugleich der funktionalen Zuordnung ihres Erfolges zur Selbsterhaltung. Die wie immer minimale ›Katastrophe‹ könnte bereits in der Nichterfüllung einer Reihennorm liegen. Gerade das aber hieße, das Bewußtsein als Intentionalität wäre überanfällig durch seine Rigidität für sein Scheitern, und das Gegenteil davon trägt den ebenso schönen wie gefährlich weichen Titel des ›Sinnes‹: Indem das Bewußtsein durch Gegenstandssinn geregelt ist, besitzt es den hohen Grad seiner Elastizität, seiner Strapazierfähigkeit für das Einlaufen bzw. Ausbleiben der intentionalen Teilstücke, Elemente, offenstehenden Debita und Desiderata zur klärenden Endgültigkeit des Gegenstandsbesitzes. Dies ist primär zwar eine Sache der Affektion, des Ausgeliefertseins an den Input der Urimpressionen, sekundär jedoch und zunehmend eine Sache der regelnden Herbeiführung von Daten durch Bezug von Positionen, Einstellung von observatorischen Mitteln, schließlich Anstellung von Experimenten bis hin zum höchsten Grad solcher Disponibilität in der phänomenologischen ›freien Variation‹. Die sieht nun gar nicht mehr nach Gebrauch des Organs der nackten Selbsterhaltung aus, eher wie dessen Mißbrauch zum Zweck der übermütigen Selbstbeanspruchung, des Luxus, der riskanten Gipfelstürmerei. Aber das ist nur der eine Aspekt, denn indem diese Abwandlungsfreiheit am gegebenen Material angelegt ist auf den Gewinn der härtesten Kernbestände an Gegenständlichkeit ‒ und nichts anderes kann heißen: ›Wesensbestimmung‹ ‒, verschafft sie dem Bewußtsein einen neuen und definitiven Bereich seiner Unanfechtbarkeit. Hier wird es gleichgültig gegen die Zufälligkeiten seiner Rezeptivität; hier tendiert sein Selbstreparaturbedarf gegen null, müßte auf das Nullniveau schon reduziert sein, könnte es sich seine Versprechungen an sich selbst auch so einhalten wie machen.
Nun ist diese Gewinn- wie Verlustbeschreibung der Monstrosität des Bewußtseins im Maße seines Erfolgs nichts anderes als die Umschreibung des Spielraums seiner ›Subjektivierung‹, seines Ausbrechens aus 33den Regulationszwängen der Gattungszugehörigkeit. Was geschichtlich erst spät zu Gesicht und gar Programm geworden ist, die Individuation oder Individualisierung, steckt im variablen Sinnreglement der Intentionalität in nuce: sich im einzelnen ›aussuchen können‹, was im ganzen keine Willkür und keine Mechanik der bloßen Assoziation duldet. Dadurch werden die Subjekte zu anderem und mehr als bloßen Funktionären der Objektivität, bekommen und haben ihre Art, die Dinge zu sehen. Das ist im Wortsinne ›herrlich‹ wie im Sachsinne gefährlich. Denn, formal betrachtet, ist es die Produktion von ›Widersprüchen‹ durch ein Organ, welches gerade zu deren Vermeidung und Ausschließung sich formiert hätte. Widersprüche deshalb, weil jedes Subjekt gegenüber jedem anderen auch dadurch zu einem ›fremden‹ wird, daß es dessen Gegenstandsbestimmungen nicht teilt, ihm zu ›widersprechen‹ ständig auf dem Sprunge ist. Nur daß dieser Widerspruch seine ›domestizierte‹ Form längst angenommen hat: Ich sehe dasselbe, aber anders. Das ist nichts als die ›Anwendung‹ der Intentionalität in ihrem erhabensten Prinzip Alles an Einem! vom subjektiven auf den intersubjektiven Nexus. Denn auch innersubjektiv besteht doch Intentionalität in ebendiesem Dasselbe in Anderem: ein anderes Datum von der einen und selben Sache. Das Rettungsverfahren im Umgang des Bewußtseins mit einer Welt, die ihm eindeutige Verhaltens- und Anpassungssignale schuldig bleibt, bei Verlust möglicher Vollständigkeitskriterien wird übertragen auf den als solchen immer zufälligen, in seinen Fremdheitsgraden unregulierbaren Verbund der Subjekte von Fall zu Fall, also von Zufall zu Zufall. Die Fremdheit der Subjekte gegeneinander in ihrer unausschöpfbaren Bedingtheit übersteigt noch bei härtester Disziplinierung durch Einschwörungen auf Fach- und Orthosprachen alles an ›Faktizität‹ und ›Fatalität‹, was schon im rezeptiven Abgrund des Bewußtseins vor seinen Impressionen liegt. Deshalb ist auch das Risiko von ›Widersprüchen‹ potenziert, der ›Bruch‹ der Intersubjektivität eine reelle Gefahr, die ihre eigenen Salvierungsmittel ‒ als Appellationsverfahren an nächsthöhere Instanzen ‒ impliziert.
Das ist nun ein Thema, das im Reflex nochmals verdeutlicht, was mit der Rede vom Bewußtsein als Organ seiner Selbsterhaltung näherhin gemeint sein muß und was auch hier und erst recht Teilstück jener von 34Husserl doch nur eingeleiteten ›Genetisierung‹ der Logik zu sein hat: ständiger Rückgewinn der Identität des Subjekts aus seinem Nahezu-Scheitern. Diese Redeform darf nichts mithören lassen von der Existentialisierungsverherrlichung des Scheiterns, obwohl dessen Riskanz doch der Produktionszwang all dieser schönen logischen Mittel ist, zu deren Besitz sich das Bewußtsein in Gestalt seiner Äußerungsform namens Philosophie so inständig beglückwünscht hat. Ebensowenig aber darf das Gegenteil an diesem Punkt die Problematik verwischen und verstellen: das Schwelgen in der Bewußtseinsteleologie des Konsenses. Es geht nicht nur darum, daß die Subjekte ihr Ideal des Consensus bedauerlicherweise und aus fatalen Rücksichten und Interessen ›vorläufig noch‹ und immer wieder verfehlen. Dieses Ideal, aus den Vielen nichts als Eines sich zusammenraufen und konvergieren zu lassen, ist wegen seiner heimlichen oder offenen Teleologizität bedrohlich: Im Maße des Erfolges auf den schönsten Konsens hin wird sich das Bewußtsein in gegenläufiger Richtung zu seiner primären Monstrosität sekundär zum Feind: Es dementiert die Berechtigung des Faktums, mehr als eines ‒ und damit immer: jetzt und hier gerade dieses ‒ zu sein. Nochmals gilt: Es muß seine ›Störungen‹ kultivieren, um mit ihnen zu leben und sogar durch sie zu leben. Gesundheit, nochmals, ist nicht das vollkommene Wohlbefinden eines nur virtuellen Patienten.
Der ehrwürdige stoische Grundsatz, im consensus omnium verhelfe sich die Natur selbst zur Durchsetzung ihrer Wahrheiten, gerät schnell, sobald er in Praxis umgesetzt werden soll, zur Parodie auf die Sterilität der Voraussetzung, viele könnten sicherer gehen als wenige, einige mehr als einer. Das ist für die allermeisten Fälle, in denen Konsens faktisch erzielt wird, schlichtweg falsch: Die Zustimmung irgendeiner Menge von Subjekten, die darum befragt worden sind, macht für Sätze der Logik oder Mathematik sowenig aus wie etwa für den Grundsatz suum cuique oder omnibus omnia ‒ und dies nicht einmal aus gleichermaßen guten Gründen. Die Muster der Erreichbarkeit von Konsens sind bis tief in die Philosophie hinein demagogisch, weil sie vorführen, wie nichts gewonnen werden kann durch den consensus omnium, indem durch das Ausscheren eines oder mehrerer sowenig geändert würde wie durch das Hinzutreten weiterer. Wo er darin besteht, das gleiche über dasselbe zu sagen oder zu beanspruchen, macht sich der Beitrag eo 35ipso wertlos. Deshalb auch ist es ganz und gar nicht immanent final, daß die Phänomenologie zu einer Theorie der Intersubjektivität hinfand; ihre genuinen Evidenzen, gewonnen durch Wesensschau als apodiktische Erkenntnisse, implizierten zwar den Konsens der zur Prozedur befähigten Subjekte, ließen ihm aber keine Bedeutung: Wer sich der beanspruchten Wesensschau widersetzte, hatte sie eben nicht!
Je ›idealer‹ (unerlaubt!) die Gegenständlichkeit, um so überflüssiger (unerlaubt!) der intersubjektive Vollzug. Sowenig erlernt werden kann, was man als Evidenz nicht erfährt, so wenig kann hinzugewonnen werden, sobald es als Evidenz erfahren worden ist. Wer von Idealitäten sagt, er sehe das anders, sieht entweder etwas anderes, oder er sieht gar nichts und behauptet es nur. Das wird erst anders, als die Phänomenologie die Subjektivität selbst zum Thema macht; denn zu ihrer ›Idealität‹ gehört, daß sie als je dieses selbstgewisse Cogito nicht überflüssig wie ein Kropf sein kann: Teilnahme an der transzendentalen Identität ist in umgekehrter Blickrichtung Rechtfertigung dessen, daß es eben Teilnahme und nicht Indifferenz ist. Das Subjekt der Intersubjektivität wird schließlich aus diesem Grunde seiner Rechtfertigung für den transzendentalen Absolutismus selbst zur transzendentalen Monade, zur Intersubjektivität auf höherem als dem Niveau der mundanen Faktizität seiner Vielheit. Diese Vielheit ist notwendig geworden und darin die Differenz jedes der Vielen eine unentbehrliche. Deshalb gilt, daß die intersubjektive Weltkonstitution nicht auf einem Consensus strikter Deckung beruht. Widerspruch von Subjekt gegen Subjekt ist logisch von derselben Art wie die Negation unter der Bedingung des Fortbestandes einer generelleren Position bis hin zu der der Welt, die unentbehrlich ist, damit überhaupt Negationen noch ein ›Umfeld‹ behalten, innerhalb dessen sie Korrekturen und nicht Vernichtungen sind. Die Welt ist der Grenzwert des Unreparierbaren, weil in jeder Reparatur Durchzuhaltenden, des schlechthinnigen Hintergrundes aller logischen Operationen als wesentlich partieller. Deshalb wird die Intersubjektivität in der Gesamtheit ihrer Inkongruenzen doch zu einer einzigen Konvergenz: der der Weltkonstitution als der Errettung der Welt aus dem nur vermeintlichen Risiko der primären Reduktion.
Daß das Resultat der intersubjektiven Prozesse ›Welt‹ heißt, besagt phänomenal vor allem dies: Die Widersprüche der Subjekte im intersubjek36tiven Verbund werden nicht exstirpiert, sie werden im Gegenteil fixiert durch das Verfahren, jede ihnen inhärente Differenz aus der Differenz der Weltpositionen der Subjekte, ihrer Individuationen als ihrer Verweltlichungen, zu begreifen. Welt ist der Inbegriff der Begreiflichkeit von intersubjektiven Differenzen. Die Welt ist das letzte und unübersteigbare Mittel der Selbsterhaltung jedes Bewußtseins gegen die Bedrohung durch die Fremdheit aller anderen. Insofern bestimmt sie in der Gesamtheit der ihr inbegriffenen ›Horizonte‹ die Toleranzen, innerhalb deren ohne Katastrophe von demselben festgestellt werden kann, man sehe es anders. Wer würde es über die Winkelsumme im Dreieck zu sagen wagen, von deren Evidenz einmal alles hatte sein sollen, was des Phänomenologen und seiner Mühewaltung wert und würdig sein sollte? Die Toleranz, etwas anders zu sehen, beruht auf der Distanz, die der Andere zu mir hat und die den Blickwinkel auf die Sache so verändert, daß er etwas an ihr sieht, was ich nicht sehe, sie also sieht, wie ich sie nicht sehe, ohne daß sie dadurch aufhört, dieselbe Sache zu sein. Diesen Satz kann man beim Wort nehmen für die ›Dinge‹ der Wahrnehmung; man kann ihn metaphorisch nehmen für alles, was zwischen Wahrnehmung und ›Idealität‹ liegt, für die es keine Distanzen und Blickwinkel gibt: Das Dreieck der Geometrie hat keine Entfernung zum Subjekt und keine Aspekte für dieses; auch dann nicht, wenn ein Subjekt nicht alle Fragen kennt, die über Dreiecke gestellt werden können, aber genau weiß, daß auch auf die ihm nicht bekannten Fragen nur identische Antworten ›herauskommen‹ können, weshalb es nicht sehr dringlich ist, sich an solcher Beantwortung zu beteiligen. Zur ›Optik‹ der Sachen rechne ich auch alles, was die Intensität der Aufmerksamkeit für sie, den Auflösungsgrad ihrer Gegebenheit, die Ausgrenzung von anderen Sachen betrifft. Worauf es intersubjektiv ankommen kann, ist das schlichte Wartenkönnen darauf, daß einer die günstigere Position zur Sache erreicht, sich ihm die Atmosphärik zur Klarheit hin enttrübt, seine Aufmerksamkeit durch Zeigehandlungen und Beschreibungsverbesserungen auf Übersehenes ‒ auf Mängel seiner Konzentration ‒ gelenkt werden kann, so daß er daraufhin sieht, wovon er zuvor geleugnet hatte, daß es überhaupt zu sehen sei. Auch die phänomenologisch ausgezeichnete Zugangsweise der ›Beschreibung‹ ist eines jener Reparaturmittel, mit denen nun intersubjektiv die Zusammenbrüche 37der Konsistenz vermieden werden, die andernfalls zwar nicht die Innersubjektivität bedrohen, wohl aber die Gewißheit, in einer Welt zu leben ‒ und sei es im Grenzfall moderner Dissoziationen eine ›Welt von Welten‹. Diese Formel verschärft nur alarmierend die harmlosere, die Welt selbst und als eine sei ›Horizont von Horizonten‹.
Beschreibung ist keine Rhetorik. Wer anderes sieht, weil ein Anderes sieht, braucht nicht überredet zu werden, seinen Gegenstand zu wechseln. Wer dasselbe anders sieht und darauf besteht, kann durch Beschreibung für die phänomenologische Situation ›neutralisiert‹ werden: Er sieht am selben nicht das gleiche, aber er hält für möglich, noch nicht genau genug und unter zureichenden Sichtbedingungen zu sehen. Er sieht noch nicht das gleiche, aber auch nicht mehr das ungleiche. Für die Selbsterhaltung des Subjektverbundes in der Krise genügt das als Reparaturleistung: Die Ausgangslage ist entschärft, die Modalität angehoben, das logische Instrumentarium nun auch der Prädikativität einsetzbar geworden.
Man kann sich das durchaus für Fälle exakter empirischer Theorie vergegenwärtigen, indem man zur Vorsicht beim Begriff der ›Falsifikation‹ kommt. Die Irregularität an dem Umlauf des Merkur-Perihels und seiner gesetzlichen Periodik nach Newtons Himmelsmechanik ist nicht die Entscheidung gegen diese Mechanik, denn sie wird durch einen in Newtons System gar nicht vorkommenden Zusatzfaktor, eine ›Überlagerung‹ mit Werten verfeinerter Messungen, erklärt. Die in ihren Vorhersagen nicht vollends eingelöste Theorie ist nicht widerlegt, der Identitätsbruch im wissenschaftlichen ›Generalsubjekt‹ nicht eingetreten; im Gegenteil hat sich durch ihre Resistenz gegen vermeintliche Falsifikation die ältere Theorie behauptet, indem sie die Operation des aufgetretenen Fehlwertes überlebt hat: Ihre Toleranz ist groß genug, um bei verschleierter Deutlichkeit die Grundwerte noch durchscheinen zu lassen. Der zum Fallissement drängende Widerspruch verfehlt sein zulässiges Ziel, indem er das Gegenteil erreicht, zum verifikatorischen Faktor durch Erschwerung der Beweislast zu werden. Das wäre vergleichbar durch Anhäufung von Zustimmungen ‒ also von immer mehr bestätigenden Daten bei unzureichender Verfeinerung der Meßgenauigkeiten ‒ nicht zu erreichen gewesen. Selbst auf die verrufene Physik des Aristoteles blicken wir nach den Erfahrungen mit 38Newtons ›Endgültigkeit‹ anders als zuvor: Für den Erfahrungshorizont, innerhalb dessen Aristoteles