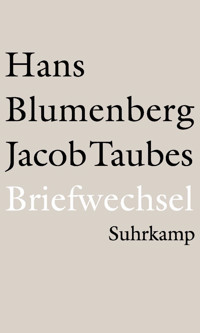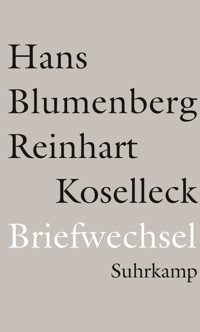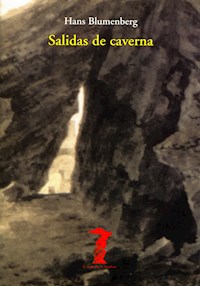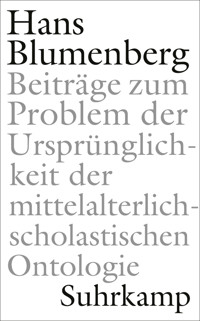17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Hans Blumenberg schwebte in den 1950er und 1960er Jahren eine Verbindung von Technik- und Zeitphilosophie vor, auf die bis heute nur selten Bezug genommen wird. Das mag daran liegen, dass er nie eine »Philosophie der Technik« geschrieben hat – allerdings findet sich in seinem Nachlass eine Reihe von kleineren Schriften, in denen er seine Überlegungen zu diesem Thema pointiert entfaltet. Standen diese zunächst noch unter dem Eindruck einer klaren Differenz von Natur und Technik, distanziert er sich im Umfeld der Legitimität der Neuzeit zunehmend von ihr, und die Konzepte der Selbsterhaltung und Selbstbehauptung treten in den Vordergrund. Der Band stellt erstmals sämtliche Beiträge Blumenbergs aus diesem Kontext zusammen und macht seine Philosophie der Technik greifbar.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 489
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Hans Blumenberg schwebte in den 1950er und 1960er Jahren eine Verbindung von Technik- und Zeitphilosophie vor, auf die bis heute nur selten Bezug genommen wird. Das mag daran liegen, dass er nie eine »Philosophie der Technik« geschrieben hat – allerdings findet sich in seinem Nachlass eine Reihe von kleineren Schriften, in denen er seine Überlegungen zu diesem Thema pointiert entfaltet. Standen diese zunächst noch unter dem Eindruck einer klaren Differenz von Natur und Technik, distanziert er sich im Umfeld der Legitimität der Neuzeit zunehmend von ihr, und die Konzepte der Selbsterhaltung und Selbstbehauptung treten in den Vordergrund. Der Band stellt erstmals sämtliche Beiträge Blumenbergs aus diesem Kontext zusammen und macht seine Philosophie der Technik greifbar.
Hans Blumenberg (1920-1996) war zuletzt Professor für Philosophie an der Universität Münster. Sein Werk erscheint im Suhrkamp Verlag.
Alexander Schmitz ist Wissenschaftslektor der Konstanz University Press. Im Suhrkamp Verlag sind erschienen: Jurij Lotman, Kultur und Explosion sowie Die Innenwelt des Denkens (beide hg. zus. mit Susi K. Frank und Cornelia Ruhe, stw 1896 und stw 1944).
Bernd Stiegler ist Professor für Neuere Deutsche Literatur mit Schwerpunkt Literatur des 20.Jahrhunderts im medialen Kontext an der Universität Konstanz. Im Suhrkamp Verlag gab er zuletzt heraus: Siegfried Kracauer, Werke, Bd.2.2: Studien zu Massenmedien und Propaganda (2012) sowie Siegfried Kracauer, Totalitäre Propaganda (stw 2083).
Hans Blumenberg
Schriften zur Technik
Herausgegeben von Alexander Schmitz und Bernd Stiegler
Suhrkamp
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2015
Der folgende Text folgt der 1. Auflage der Ausgabe des suhrkamp taschenbuch wissenschaft 2141.
© Suhrkamp Verlag Berlin 2015
© Bettina Blumenberg
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das der Übersetzung, des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.
Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.
eISBN 978-3-518-74012-5
www.suhrkamp.de
Inhalt
1. Atommoral – Ein Gegenstück zur Atomstrategie
2. Das Verhältnis von Natur und Technik als philosophisches Problem
3. Hat die Wissenschaft versagt? Was wiegt schwerer: Gewinn an Wahrheit oder Verlust an Glück? – Antwort eines Philosophen auf eine ketzerische Frage
4. Das menschliche Männchen. Über Glanz und Elend des Fragebogens – Der verhängnisvolle Trick
5. Die Rechnung ohne den Wirt. Von der Unsicherheit im Umgang mit der Technik
6. Technik und Wahrheit
7. Reisen durch die präparierte Welt
8. Vom Unbehagen in der Natur. Gedanken beim Vorüberfliegen eines unsichtbaren Kometen
9. Der Glaube an das »Und-so-weiter«. Ist die Gedankenles-Maschine unvermeidlich?
10. Der kopernikanische Umsturz und die Weltstellung des Menschen. Eine Studie zum Zusammenhang von Naturwissenschaft und Geistesgeschichte
11. ›Nachahmung der Natur‹. Zur Vorgeschichte der Idee des schöpferischen Menschen
12. Weltbilder und Weltmodelle
13. Ordnungsschwund und Selbstbehauptung. Über Weltverstehen und Weltverhalten im Werden der technischen Epoche
14. Lebenswelt und Technisierung unter Aspekten der Phänomenologie
15. Einige Schwierigkeiten, eine Geistesgeschichte der Technik zu schreiben
16. Methodologische Probleme einer Geistesgeschichte der Technik
17. Zusammenfassung des Vortrags »Methodologische Probleme einer Geistesgeschichte der Technik«
18. Dogmatische und rationale Analyse von Motivationen des technischen Fortschritts
Nachweise
Editorische Notiz
Nachwort
Namenregister
1. Atommoral – Ein Gegenstück zur Atomstrategie
Als im Hochsommer 1945 über der japanischen Stadt Hiroschima die apokalyptische Uraufführung des Atomkrieges erfolgt war, kam in der Bedrängnis der eigenen deutschen Nöte nur wenigen unter uns das deutliche Bewußtsein, mit welch knappem und gnädigem Vorsprung wir gerade den Bereich dieser Gefährdung verlassen hatten. Die weltweite Entfernung und innere Fremdheit des Schauplatzes machte das Ereignis selbst zu etwas für uns Unwirklichem, wie einem exotischen Mythus Zugehörigen. Solche Verdeckung der nur durch den Abstand eines Vierteljahres aufgehobenen realen Drohung, daß unser eigenes Land die Szene hätte abgeben können, brachte es mit sich, daß die geistige Auseinandersetzung mit dieser neuen Welttatsache über ein neugierig-oberflächliches Interesse nicht hinausgelangte. Vielleicht nahmen auch nur allzu viele die Meldung mit dem Gefühl der Enttäuschung auf, darin nichts als die nun von anderer Seite genutzte Chance eigenen Machttriumphes sehen zu müssen. Jedenfalls wurde der Rauchpilz von Hiroschima am Horizont unserer Weltwirklichkeit nicht klar gesichtet.
Der Verlauf eines Jahres hat gezeigt, daß die Atomwaffe nicht nur den großen Krieg zum klaren Ende führen half. Das Denken der Völker, zum mindesten das politische und militärische Denken, ist durch dieses Faktum entscheidend bestimmt worden. Das Wort »Atomstrategie« ist gefallen und an sehr konkreten Überlegungen in Kurs gesetzt worden; mag das Wort »Atompolitik« auch noch nicht ausgesprochen sein – es kann doch kein Zweifel bestehen, daß die Weltpolitik heute von der Realität der Atomwaffe starke Impulse empfängt, mag es mit den Argumenten, die solche Politik begründen sollen, in Wirklichkeit stehen, wie es will. Die Politiker und Strategen haben die neue Gewalt – sei es in realer Verfügbarkeit oder in hypothetischer Gewärtigung – in ihr Denken und ihr Weltbild bereits eingefügt. Technik und Wirtschaft haben Möglichkeiten und Grenzen vorzuzeichnen versucht. Ja, es hatte den Anschein, als seien die Physiker und Forscher, die in Verfolgung ihrer wissenschaftlichen Probleme zum Teil ganz unversehens den Zugang zu so vernichtungswilligen Kräften freigelegt hatten, in Äußerungen gewissensinnerer Betroffenheit vor den mit einem Schlage hereinbrechenden Konsequenzen zurückgewichen. In diesem Erschrecken kündigte sich das überwältigende moralische Problem der Sache zwar an; aber es kann kein Zweifel sein, daß die geistige Auseinandersetzung mit demselben gegenüber dem Gewicht strategischer, politischer und wirtschaftlicher Denkmotive bisher nicht nennenswert sich durchsetzen konnte.
Mit der Durchbrechung der klassischen Mechanik und der Erschließung eines elementaren Bereichs physikalischer Vorgänge hat die Physik der letzten Jahrzehnte dem menschlichen Erkennen eine neue Dimension der Wirklichkeit eröffnet. Die Naturphilosophie, sich nur langsam lösend von ihren »klassischen« Vorstellungen kausaler Gesetzlichkeit und Determination, ist diesem Vordringen der Forschung nur zögernd gefolgt und steht noch heute vor der Masse der ihr zur Bewältigung aufgegebenen Tatsachen. In dieser Situation nun vollzog sich etwas Einzigartiges in der Geschichte des Menschengeistes: im Kulminationspunkt der Entwicklung einer theoretischen Leistung schlug diese gleichsam um in reale Wirklichkeit von weltverwandelnder Macht. Hinter den undurchdringlichen Schleiern des Zweiten Weltkrieges und aus seinen unmittelbaren Antrieben heraus setzte sich die abstrakteste und diffizilste Denkleistung der Gegenwart, die theoretische Physik, um in die geballteste und gedrängteste Wirkkraft, in die universalste Gefährdung, die der Menschheit bisher entstanden ist und wohl überhaupt entstehen konnte. Aus dem physikalischen Forschen und Denken ist physikalisches Handeln, physikalische Machtausübung geworden. Damit aber spricht die Entwicklung der modernen Physik nicht mehr nur die Erkenntnistheorie und Naturphilosophie an; die Problematik hat auf dem philosophischen Feld eine bedeutende Verlagerung ihres Schwergewichts erfahren, sie ist eine wesentlich moralphilosophische geworden.
Gegenstand der Moralphilosophie ist der Mensch in seiner handelnden Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit der Welt; ihr Ziel ist die Gewinnung der Normen und Richtwerte dieses Handelns von der Struktur der Wirklichkeit her. Das »richtige« Handeln ist das an dieser Wirklichkeit gerichtete, das aus unverstellter und unverfälschter Einsicht in die Sachverhalte bestimmte Handeln. Soll also die revolutionierende Welttatsache des Handelns mittels der elementaren Gewalten des Atominnern zum Gegenstand moralphilosophischer Überlegung werden, dann muß dieses Faktum selbst in den Zusammenhang der Wirklichkeit, und zwar der besonderen Kategorien und Schichten des Wirklichen, denen es zugehört, eingeordnet werden. Erst nach dieser Vorarbeit wird das normative Moment aller moralphilosophischen Bemühung zutage treten können.
Atomare Energie ist als Instrument des Handelns im wesentlichen bestimmt durch die Zugehörigkeit zu drei Schichten der Wirklichkeit: die Schicht der elementaren Natur, die Schicht der technischen Gebilde und die Schicht der Mittel der Macht.
Zum ersten Male überhaupt in der Geschichte der Dienstbarmachung der Natur durch den Menschen ist hier auf einen Bereich ausgegriffen, der sich jener Wohlberechenbarkeit und Gebundenheit an eindeutige Formeln entzieht, die das Merkmal aller Mechanik sind. Und das nicht aus einem vorläufigen Ungenügen unserer Erkenntnis und unserer Begriffe heraus, sondern aus dem unaufhebbar jenseits mechanischer Faßlichkeit gelegenen Wesen der berührten Wirklichkeitsschicht selbst. Die Schicht des physikalisch Elementaren, das Reich des Atominnern, steht nicht unter der absoluten kausalen Determination, die nach den festen Beziehungen von Ursache und Wirkung unsere ganze natürliche und technische Welt uns so übersichtlich in Formel und Berechnung verfügbar machte. Solange wir dessen nur in theoretischer Erwägung, in ungewöhnlichen Begriffen und unanschaulichen Denkoperationen inne wurden, konnte uns wohl Erstaunen über die Beständigkeit einer auf solchem Grunde erbauten Welt befallen; jetzt, wo wir den Menschen im Wagnis des Herrschaftsanspruches auch über diesen äußersten Bezirk der Natur begriffen sehen, kommt uns erschauernd das Wort von der »physikalischen Unterwelt« zu Bewußtsein, das ein deutscher Physiker geprägt hat. Wir glauben einem physikalischen Zauberlehrling zuzuschauen, dessen herbeizitierten Geistern auch der Meister kein wirksames Bannungswort entgegenzurufen weiß. Die angesichts des Hochstandes unserer Wissenschaft befremdliche Unsicherheit in der Prognose der an kosmische Dimensionen heranreichenden Wirkungen ausgelöster Atomkräfte, wie sie in den Erörterungen über die erste Verwendung und über geplante Versuche zum Ausdruck kam, sind deutliche Anzeichen der »unterweltlichen« Elementarschicht, die hier ins Spiel kommt. Das entscheidend Neue ist also nicht so sehr die vielmalige Potenzierung der bisher verfügbaren Kräfte, es ist vielmehr die Erschließung einer ganz andersartigen und unseren bisherigen Weltbegriff transzendierenden Herkunftszone solcher Kräfte. In dieser Eigengesetzlichkeit, in diesem unaufhebbaren Widerstand gegen Objektivierung und Form kündigt sich zumindest die Möglichkeit dessen an, was sich von unserer Welt als »Dämonie« abhebt. Und mag es dem Menschengeist auch gelingen, die elementaren Kräfte zum Dienst zu unterwerfen – er wird sich ihrer unterweltlichen Gesetzfeindlichkeit immer gegenübersehen. Damit zeichnet sich schon hier die Eigenart eines moralphilosophischen Problems ab, das es in neuer Weise und Tragweite mit dem Sinn von Verantwortung aufzunehmen hat.
Die ganze Last seiner Uneinfügbarkeit in rechnerisch gesicherte Ordnungen bringt das atomare Kraftpotential mit ein in seine Vergegenständlichung innerhalb der Schicht der technischen Gebilde, in der es die laufende wissenschaftliche Entwicklung beheimatet. Dieser Bezirk menschlicher Leistungen ist zwar gekennzeichnet durch seinen hohen Grad rationaler Verfügbarkeit, durch sein Aufgehen in mathematischen Formulierungen und Gesetzen. In seiner Funktion innerhalb der menschlichen Gesellschaft aber zeigt das technische Gebilde eine schon viel bemerkte, im Maße seiner Verfeinerung wachsende Tendenz auf Ablösung und Autonomie gegenüber der Verfügung durch den Menschen. Ursprünglich stellt der Mensch das technische Produkt her und stellt es unter die volle Abhängigkeit von seinen vorher entworfenen Zwecken und Absichten; es ist im weitesten Sinne Werkzeug seiner Hand, in seinen Bedingtheiten voll eingesehen von dem, der es macht; das Dienstverhältnis scheint unumkehrbar zu sein. Der qualitative und quantitative Fortschritt der technischen Produktion jedoch führt zu jener wachsenden Differenzierung und Aufspaltung des Planungs- und Fertigungsprozesses, wobei die klare Ausrichtung auf vorhergegebene Zwecke und Absichten, die volle Einsicht in den Gesamtzusammenhang der Einzelerzeugung verlorengeht. Die Impulse und Forderungen gehen nun nicht mehr von den menschlichen und gesellschaftlichen Vorgegebenheiten aus, sondern vom technischen Produkt seinerseits, das darin von der verwandten auf Autonomie gerichteten Struktur der Wirtschaft mächtig unterstützt wird. Es tritt aus seinem Dienstverhältnis heraus und stellt umgekehrt den Menschen als Techniker, Unternehmer und Arbeiter in seinen Dienst; ja, es diktiert der ganzen menschlichen Gesellschaft Bedürfnisse und Zwecke auf, die ganz und gar nicht mehr vorgegeben sind. Hier nun liegen die tieferen Gründe für die Rede von der »Dämonie der Technik«, die wir indes nicht ohne weiteres mitmachen wollen. Denn erst indem sich das technische Gebilde der Leidenschaft und Verführbarkeit des Menschen anbietet, gewinnt es so etwas wie »Dämonie« – aber es ist die Dämonie seines Erzeugers. Nun hat die Autonomie der technischen Gebilde, wie sie hier aufgefaßt wurde, ihre Grenzen in den natürlichen Quellen und Mitteln, aus denen der technische Prozeß gespeist wird. Rohstoff und Arbeitskraft schränken als nur langsam bzw. gar nicht wachsende Größen den Fortschritt dieses Prozesses ein. Die Freimachung der atomaren Energien legt diese Schranke nieder; die Quellen der technischen Erzeugung scheinen plötzlich ins Unerschöpfliche gesteigert und jeder Anpassung an die Erfordernisse eines ungehemmten Progresses fähig zu sein. Das bedeutet ein Ausmaß und eine Endgültigkeit, ja Absolutheit der technischen Autonomie, die auch das lebendigste und konsequenteste Vorstellungsvermögen übersteigt und unausweichliche Einwirkungen auf die Gestalt der Gesellschaft und Wirtschaft, auf die Stellung und Geltung der Einzelperson haben muß. Die Verpflichtung alles sozial wirksamen Handelns an das personal freie Individuum und seine konstitutiven Grundrechte aber ist das gültigste moralische Problem der Gegenwart. Die sichere Gewärtigung von Wirkungen einzigartiger Intensität einer auf der Basis der Atomkräfte begründeten Autonomie der technischen Gebilde in diesen personalen Bezirk hinein gibt der moralphilosophischen Aufnahme des Atomproblems weitere unabweisbare Dringlichkeit.
Noch wenn das technische Gebilde in die Sphäre der Mittel der Macht bereits einbezogen ist und dort seine starke Beziehung auf menschliche Leidenschaft und Triebergebenheit gewinnt, ist es gar nicht sicher auszumachen, ob hier der Mensch die Technik wirklich zu »seinem Mittel« machen konnte oder ob er nicht selbst nur im Gebote der technischen Autonomie zu handeln vermag. Diese Unsicherheit zeigt, wie weitgehend die echte Entelechie des Menschlichen ihren Primat in der technischen Wirklichkeit gefährdet sehen muß. Ist die ungeheure Steigerung menschlicher Machtausübung in letzter Instanz auf den Machttrieb des Menschen zurückzuführen oder steht dieser selbst nur im Dienste der Autonomie des Technischen? Gewiß ist eines, daß nämlich die Möglichkeiten zur Gewinnung und Ausübung von Macht durch die Verbindung mit der Technik sich vielfach potenziert haben. Suchen wir dafür nach einem absoluten Maßstab, so bietet sich der uralte theologische Begriff der Omnipotentia Dei, der Allmacht Gottes dar; jedoch sind diesem unabtrennbar und aus innerer Notwendigkeit zugeordnet die Begriffe der göttlichen Weisheit und Güte. Wie stände es um eine Allmacht, zu der Weisheit und Güte nur in zufälliger und loser Verbindung stehen, wie es die Annäherung menschlicher Macht an absolute Maße bedeuten müßte? Ausdruck der göttlichen Allmacht ist in traditioneller Formulierung die Creatio ex nihilo, die Schöpfung aus dem Nichts; würde einer absoluten Macht des Menschen nicht so etwas wie eine Destructio in nihilum, eine Zerstörung ins Nichts zurück, entsprechen müssen? Es sei denn, daß dem allgemeinen Fortschritt auch eine ethische Perfektion gleichlaufen oder folgen könnte. Die akute Schärfe dieser Frage wird grell sichtbar, wenn wir sie uns in folgender Formulierung zur Besinnung stellen: In welchem Verhältnis steht das Maß äußerer Macht zu der Aussicht humanistischer und moralischer Faktoren, ihren Gebrauch wirksam zu beeinflussen? Die Antwort kann nicht zweifelhaft sein.
Die ganze Fülle der Beziehungen der technischen Sphäre zu Möglichkeiten und Gebrauch der Macht und ihre letzte Zuspitzung im Verfügbarwerden der atomaren Energiebasis kann hier nicht aufgerollt werden. Zwei Momente treten als wesentlich hervor: die auslösende Funktion des Politikers in der Verwaltung der Machtmittel und die immanente Tendenz jedes Machtpotentials auf seine Aktualisierung hin.
Die Bedeutung, die im Übergang der Verwaltung der Atomkräfte aus dem Bezirk der Wissenschaft in die Hände der Politiker beschlossen ist, scheint in ihrer Tragweite von führenden Forschern erkannt worden zu sein. Eine programmatische Forderung, wie die eines allgemeinen Streiks der Physiker in der weiteren Ausarbeitung der atomaren Energiegewinnung, verrät das Bewußtsein, daß diese Gewalt in den Händen der Politiker nicht jenes Maß von Immunität gegen die Versuchungen der Macht und die volle Höhe menschheitlicher Verantwortung verbürgt, die für das Forschergewissen Bedingung der »Übergabe« zu sein scheinen. Das wache Wissen um die »unterweltlichen« Verwurzelungen der Atomkraft, das wissenschaftlichem Geiste unverlierbar sein muß, könnte dem Politiker – als eine Größe unter anderen, seiner Weltsicht näher gelegenen – nur zu leicht verdeckt werden. Dem echten Forscher sind menschheitliche Kategorien seines Denkens und seiner Verantwortung in seinem wissenschaftlichen Ethos fest begründet; der Politiker ist zuerst Exponent nationaler Interessen und wird bestenfalls um die Gewinnung universaler Maßstäbe bemüht sein. So zeigt sich die Schärfe der Krise, die sich im Übergang über die Grenze zwischen wissenschaftlichem und politischem Bereich ergeben muß. Auf dieser Grenze wird das moralische Problem der Atomkraft wesentlich ausgetragen werden; auf dieser Grenze allein können moralische Faktoren in Kraft treten.
Das Machtmittel im Verfügungsfeld des Politikers hat eine spezifische Eigengesetzlichkeit, die als immanente Aktualisierungstendenz gekennzeichnet werden kann. So wie das technische Gebrauchsprodukt Bedarf zu erzeugen vermag, so schafft das technische Machtmittel mit eigenartiger Automatie auslösende Situationen. Die gefährliche Atmosphäre von Mißtrauen, wirklicher und vermeintlicher Bedrohung, die aus dem bloßen Vorhandensein großer Machtpotentiale entsteht, beweist das. Mächtige Impulse empfängt diese Tendenz der Aktualisierung auch aus den Investitionen großer wirtschaftlicher Werte für die Schaffung solcher Machtfaktoren, wobei der Druck gegen bloße »Lagerung«, gegen die »Ruhestellung« von der eigentümlichen Dynamik eben des wirtschaftlichen Bereichs herkommt, dessen oberstes Prinzip »Funktion« ist. Die Analyse dieser Phänomengruppe ließe sich wohl noch vertiefen; hier mag der Hinweis genügen.
Gemäß unserer einleitenden Bestimmung, daß alles moralphilosophische Bemühen seine Einsichten an der Erhellung der in der Handlung einbezogenen und betroffenen Wirklichkeit zu gewinnen habe, ist der Realitätszusammenhang der neuen Weltkraft »Atomenergie« von uns in einer ganz vorläufigen Überschau und Gliederung ausgebreitet worden. Der Problemkreis »Atommoral« ist ja als solcher überhaupt erst zu umreißen und der methodische Ansatz seiner Behandlung als unaufschiebbare Aufgabe philosophischer Klärung aufzuweisen. Diese entwurfhafte Natur unserer Überlegungen wird nun noch deutlicher, wenn die Forderung einer normativen Entfaltung der gewonnenen Ergebnisse aufgenommen wird.
Das menschliche Handeln in der Welt und an der Welt – unter methodischem Absehen von seinen transzendenten Bezügen – läßt sich wohl unter einem allgemeinen normativen Begriff zusammenfassen, dem Begriff der Kultur. Dieser Begriff hebt sich von der anderen Richtung ethischer Verpflichtung, dem Bilden des Einzelnen an sich selbst, zunächst durch sein konstitutives Moment der Gerichtetheit auf menschliche Gemeinschaft ab. Kultur ist ein Inbegriff des weltbezogenen Handelns von und in menschlichen Gemeinschaften. Soll gemeinschaftsgebundenes Handeln sinnvoll sein, so muß es in der Gemeinverbindlichkeit von Richtwerten und deren Setzung als Ziele des Handelns begründet sein. Die Weltbezogenheit des gemeinschaftlichen Handelns wiederum kann nur einen Grundzug haben: nämlich die herrschaftliche Stellung des Menschen zu aller natürlichen Gegebenheit, die in dem Gottesauftrag der Genesis »Macht euch die Erde untertan und herrschet!« ihre volle Prägnanz gefunden hat. Können wir an diesem Punkte eine wirklich konkrete Ausarbeitung der beiden Elemente »herrschaftliche Stellung« und »natürliche Gegebenheit« gewinnen, so ließe sich aus dem Kulturbegriff der Rahmen für die moralphilosophisch-normative Durchdringung der hier aufgegebenen Probleme entfalten. Das kann hier freilich nur andeutend geschehen.
Zunächst muß der volle Umfang von »natürlicher Gegebenheit« bezeichnet werden. Diese ist keineswegs mit stofflicher Gegebenheit zu identifizieren. Sie umfaßt diese ebenso wie die Eigenbezirke des Lebendigen und des Geistes, und sie schließt auch die ganze trieblich, emotional und rational bestimmte Wirklichkeit des Menschen selbst mit ein. Das ist die für unsere Besinnung entscheidende Integration des Begriffes »Natur«: er meint hier keineswegs nur die außermenschliche Wirklichkeit, die dem Menschen gegenüberstehende, sondern schließt das ganze Feld des Menschlichen ein. »Herrschaft« weiterhin gilt hier als etwas anderes als ein Niederhalten, Unterdrücken, Ausschalten, Nicht-zur-Geltung-kommen-lassen; Herrschaft vollzieht sich vom Menschen her in der geistigen Durchdringung und Erhellung, in der Einsichtnahme in die Gründe und Bedingungen, aber auch in der künstlerischen Entdeckung der Symbolgehalte der Weltwirklichkeit. Hier gemeinte »Herrschaft« kann auch nicht in der Verkennung oder trotzigen Ableugnung der Bindungen und Relationen ihrer selbst gelten.
Unsere Entfaltung des Kulturbegriffes gelangt so zu einer Konzeption von »Beherrschung der Natur«, in der solche Beherrschung als das aus Welterhellung und Selbsterhellung geleitete Bewältigen der natürlichen Wirklichkeit aufscheint, die ihrerseits von der stofflichen Außenwelt bis in die Untergründe des Menschlichen reicht. Die Krise des Kulturbegriffs verschiebt sich damit von der bloßen Verfügbarmachung oder Gestaltung äußerer Natur weg auf die Beherrschung der menschlichen Natur selbst in allen ihren Dimensionen. Daß diese Beherrschung niemals ein zwischenmenschlicher oder gar institutionell-staatlicher Akt sein kann, sondern nur freie Souveränität aller Einzelnen über sich selbst, das bedarf im Angesicht der geschichtlichen Erfahrungen unserer Zeit keines Wortes.
Vor dem nun aufgerollten, gleichsam »normativen Horizont« wäre unsere zuvor umrissene Analyse der atomaren Machttechnik aufzustellen. Die weiterhin leitenden Fragen ließen sich so formulieren: Ist die aus dem Kulturbegriff als normativ entwickelte Gestalt von Naturbeherrschung im Bereich der Atomtechnik mit ihrem wesenhaften Auseinanderklaffen von realer Handhabung und geistiger Bewältigung überhaupt zu verwirklichen? Und: einen Fortschritt in der wirklichen Beherrschung der atomaren Natur vorausgesetzt, wird die Selbstbeherrschung der menschlichen Natur ein entsprechendes Maß gewinnen können oder wird sie im Gegenteil in einem Zerreißen des Zusammenhangs dieser beiden Herrschaftsbereiche der personalen Souveränität endgültig gefährdet werden?
Die Überführung der elementaren Energie in die technische Realität bedeutet eine Krise der ethischen Kraft der Menschheit. Die Atomtechnik ist ein eminentes Problem, an dem sich die moralphilosophische Besinnung der Gegenwart zu bewähren hat. Diese Besinnung setzt voraus eine eindringliche Analyse der einbezogenen Schichten der Wirklichkeit und die Aufstellung eines umfassenden normativen Horizonts. In der Konfrontierung beider entwickelt sich die Dialektik der »Atommoral«.
Freilich ist das so entworfene Problem ein Problem der Grenze, nicht nur der Grenze von Erkenntnis und Praxis. Indem wir den Kulturbegriff zum Ansatz einer auf Normgewinnung zielenden Überlegung machten, schalteten wir, wie ausdrücklich vermerkt wurde, transzendente Bezüge des Themas methodisch aus. Vielleicht liegt aber das Schwergewicht der ganzen Frage jenseits dieser Abgrenzung, im transzendenten Bereich? Das würde – in prägnanter Fassung – bedeuten, daß die Besinnung auf die Moral der Atomtechnik letztlich eine theologische zu sein hätte. Diese Grenzziehung könnte nur dem als müßig erscheinen, der die weittragenden Folgerungen aus der Entscheidung dieser letzten Frage übersieht. Wenn wir zur Gewinnung der normativen Richtung dieser Überlegungen einen Kulturbegriff aufgeboten haben, der sich an Weite und Intensität als das menschliche Weltverhältnis schlechthin – wobei im »Menschlichen« das eigentliche Maß liegt – darstellt, so haben wir auch schon die Grenze philosophischer Normsetzung erreicht. Das aber heißt doch: das bindende und verpflichtende Moment solcher Norm kann nicht mehr überboten werden. Und damit sehen wir uns der akuten Formulierung des neuen moralischen Weltproblems gegenüber: Kann das »Menschliche« über Verhalten und Handeln in unserer Gegenwart seine vollgewichtige normative Geltung behaupten oder neu gewinnen? Je nachdem wir uns zur Beantwortung dieser Frage gedrängt sehen, werden wir uns entscheiden können, entweder im hier umgrenzten Raum moralphilosophischer Besinnung weitere Vertiefung und einen tragfähigen Boden zu erstreben oder jene Grenze zu überschreiten und alles auf die Unterwerfung unter ein göttliches Gebot, einen absoluten Anspruch und ein verheißenes Gericht zu setzen.
2. Das Verhältnis von Natur und Technik als philosophisches Problem
Nicht nur vor unseren Augen, sondern auch unter unseren Händen entsteht und besteht die technische Welt. An ihr ist nichts, was wir als gegeben hinzunehmen und erkennend erst zu durchdringen hätten. Die technische Realität ist derart, daß sie erst aufgrund und kraft erlangter Erkenntnis und durchgeführter Berechnung in Wirklichkeit umgesetzt ist. Wenn wir dennoch bei dieser durch und durch nachrechenbaren Sache unserer gegenwärtigen Welt vor einem Problem stehen, und zwar einem der dunkelsten und dringlichsten der Zeit, so muß es auf einer anderen Ebene liegen als der, in welcher die Bedingungen der Funktion technischer Gebilde ausgemacht werden können. Nun sind wir aber trotz des klaren Bewußtseins der sich hier immer drängender zusammenballenden Problematik weit davon entfernt, die leitende Fragestellung auch nur annähernd formulieren zu können; wir wissen noch nicht einmal, in welchem spezifischen Bereich möglicher Fragen eben diese entfaltet und angegangen werden kann.
1. Die gegenwärtige Problemlage
Zunächst scheint die Gesamtheit der hier überhaupt möglichen Fragen selbstverständlich einen Filialbereich der Naturwissenschaft zu bilden. Die Technik hat sich historisch als angewandte Naturwissenschaft konstituiert, als konstruktive Verlängerung der Natur, und diese strukturelle Kontinuität scheint auch Charakter und Methodik ihrer Probleme endgültig zu bestimmen.
Die geschichtliche Wirklichkeit des menschlichen Lebens mit der Technik hat jedoch diese Grundauffassung nicht bestätigt. Die Technik, als gegenständlicher Bezirk der modernen Welt, hat sich immer sichtbarer aus der funktionalen Kontinuität zur Natur gelöst und ist in neue, eigengeartete, ja gegensätzliche Konstellationen zur natürlichen Wirklichkeit getreten. Vom bloßen Gebrauch der Natur im Dienste der Lebensfristung über die sich mehr und mehr steigernde Ausbeutung der Natur als eines Energie- und Rohstoffreservoirs geht die Entwicklung des technischen Bewußtseins und Willens bis zum Anspruch auf radikale und totale Umwandlung der Natur als der bloßen materia prima der Machtausübung des Menschen.
Folgerichtig erscheint in der Einsicht dieser Zusammenhänge der Mensch als das Prinzip, in dem das Verhältnis von Natur und Technik als willentliche Setzung gegründet ist. Als ein Wesen; dem seine Existenz nicht durch organische Anpassung an die natürliche Umwelt gewährleistet ist, das daher in den Daseinsmodus der Selbstbehauptung und Selbstproduktion seiner Lebensbedingungen hineingezwungen ist, bringt der Mensch die Technik als Antwort auf seine spezifische Seinsproblematik hervor. Der Mensch ist ein technisches Wesen: die technische Realität ist das Äquivalent eines Mangels seiner natürlichen Ausstattung. Die moderne Technik ist daher nicht eine einzigartige Erscheinung der menschlichen Geschichte, sondern nur das ins Bewußtsein gerückte, willentlich ergriffene Durchvollziehen einer im Wesen des Menschen verwurzelten Notwendigkeit.
Aber auch dieser anthropologische Ansatz erweist sich vor dem Phänomen der Technik als unzureichend. Als Grundzug der technischen Sphäre enthüllt sich mehr und mehr ihre Autonomie, die zunehmende Unverfügbarkeit für den Menschen, das Überspielen seiner Entschlüsse, Wünsche, Bedürfnisse durch eine Dynamik der Sache, die dem gesamten Leben der Epoche einen unverkennbaren homogenen Stil aufprägt. Die äußere und innere Herrschaft, die die Technik über den gegenwärtigen Menschen erlangt hat, schlägt sich in der gängigen Metapher von der ›Dämonie der Technik‹ nieder, die gerade den ungeklärten Stand der Problematik aufs deutlichste bekundet. Die Rede von der Autonomie und Dämonie der Technik, von ihrer unentrinnbaren Perfektion, bereitet vor und rechtfertigt die unmittelbar drohende Kapitulation vor einer vermeintlichen Notwendigkeit. Sie verfestigt das resignierte Genügen an der Aporie, der Verlegenheit, und schneidet den eigentlich philosophischen Weg ab, der von der Aporie zur Problemstellung führt. Wenn aber die Philosophie sich hier ihren Anspruch nicht verkürzen läßt durch vorgreifende Absolutsetzung, dann vermag sie zumindest das Bewußtsein offenzuhalten für die Fraglichkeit der gängigen Formeln, in denen das lähmende Gift der Resignation eingenommen wird.
Wie man die Möglichkeiten der Philosophie in dieser Situation einschätzen soll, das ist eine Frage, die nur in einem umfassenderen geschichtlichen Horizont an Profil gewinnt.
2. Natürliches und verfertigtes Seiendes in der griechischen Metaphysik
Für das Seinsverständnis der Griechen sind Sein und Natur, οὐσία und φύσις, fast gleichbedeutende Begriffe. Was das Seiende als Seiendes ausmacht, ist dies, daß es auf sich selbst ruht, aus sich selbst – und nicht durch Hinzukommendes, Eingreifendes – das ist, was es seinem Wesen nach ist, sein Charakter des Sich-selbst-Tragens (οὐσία). Dieser Grundzug des Seienden als Seienden aber ist abgelesen am Wesen der Natur: das Natur-Seiende hat das Prinzip seines Seins und Werdens (ἐντελέχεια) in sich selbst. Pflanze und Tier werden und sind, was sie werden und sein können, im genetischen Naturzusammenhang aus sich selbst. Dieser genetische Zusammenhang ist selbstgenugsam, bedarf keines äußeren Zuschusses: immer wieder entstammt jedes Seiende einem solchen des gleichen spezifischen Gepräges (εῖδος). Die Einheit der Natur als eines solchen genetischen Zusammenhanges konstanter Grundgestalten bedarf nicht der Frage nach einem Anfang, sie ist aus sich selbst verstehbar gerade und nur als Einheit eines zeitlich unendlichen Zusammenhanges: ἐξ ὄντος γίγνεται πάντα.[1] Der Begriff der ›Natur‹ deckt und erfüllt den Begriff des Seins.
Auf dieser Auslegung des Verhältnisses von Natur und Technik, die geleitet ist von einem bestimmten Verständnis des Seienden als des in sich selbst Begründeten, ruht die antike Sicht der Rangordnung des menschlichen Verhaltens auf: die ϑεωρία ist der πρᾶξις; nicht nur als instrumentale Bedingung vorgeordnet und übergeordnet, sondern die Theorie ermöglicht die Praxis erst dadurch, daß sie zum Sein den eigentlichen und wesentlichen Zugang hat und so alle werkhafte Entlehnung und Ableitung der Praxis erst fundiert, die pure Gewaltsamkeit aber ausschließt. Damit ist auch der Freiheit ihr Rang und Spielraum klar zugewiesen.
3. Die Umkehrung des Verhältnisses von natura und ars durch den Schöpfungsgedanken
Selbstverständnis des Menschen als Glied des homogenen Naturzusammenhanges, Sinngebung der Freiheit aus dem Spielraum der gegebenen Weltgestalt, Fundierung der τέχνη auf den im Logos versammelten Kosmos – das waren die einander korrespondierenden Aspekte des antiken Seinsverstehens, das als ›Sein‹ im genauen Sinne nur die aus sich selbst unendlich sich gestaltende Natur im genetischen Zusammenhang ihrer konstanten Gestaltbildung gelten läßt, während das werkhaft Seiende als Seiendes nur in Herleitung aus diesem Sinnbezirk verstanden werden kann. Eine radikal neue Sicht des Verhältnisses von Natur und Technik, und damit die Freigabe eines ungleich erweiterten Spielraums der technischen Freiheit, wird sich folgerichtig nur aus einem Wandel des Seinsverstehens von Grund auf entfalten können.
Was macht die Radikalität dieses Wandels, die Eröffnung neuer Möglichkeiten des Denkens und Handelns aus? Vorgreifend läßt sich sagen: die Selbstgenugsamkeit der Natur und ihres Wirkzusammenhanges als der fundamentalen ontologischen Dimension wird aufgebrochen. Prägnantester Ausdruck dessen ist, daß der Naturzusammenhang nun als ein zeitlich endlicher begriffen werden muß und die Frage nach den Prinzipien und Strukturen seines immanenten Verlaufes überboten wird durch die Frage nach dem Anfang, eine Frage, die ihren Sinn und ihre Dringlichkeit erst dadurch erhält, daß Kosmos und Sein nicht mehr kongruieren, der Kosmos das ϑεῖον ὄν nicht mehr selbst ist oder es enthält, sondern nur von einem anderen seiner selbst her in seinem Sein begriffen werden kann und seinen Ursprung hat. Das Sein des Seienden geht nicht mehr auf und begründet sich nicht mehr hinreichend in seinem genetischen Zusammenhang; vielmehr ist die Natur als eine Einheit der φύσει ὄντα jetzt ihrerseits ein τέχνῃ ὄν. Die Genesis der Natur, herleitend verfolgt, bricht ab im Nichts als der Unmöglichkeit ihrer selbstgenugsamen Begründung, der sie die göttliche Gewalttat der ›creatio ex nihilo‹ entriß, ein im genauen Sinne ›technischer‹ Urakt, der radikalste Sprung, den das Denken nur noch als Limes seiner rationalen Möglichkeit zu begreifen vermag. Hier entspringt zugleich die scharfe Umkehrung des Verhältnisses von Natur und Technik, die als Inbegriff der ›Bekehrung‹ (conversio) der antiken Ontologie angesehen werden muß. Die Freiheit empfängt ihren Sinn nicht mehr vom gegebenen Sein als Natur, sondern umgekehrt hat die Natur ihren Sinn durch die urgründende göttliche Freiheit, durch das nicht weiter befragbare ›Quia voluit‹ des Schöpfungsentschlusses.[3]
Wie aber steht der Mensch in diesem neuen Verhältnis von Natur und Technik? Der Mensch ist nicht mehr aus seiner Gliedschaft im genetischen Naturzusammenhang heraus zu begreifen, er ist nicht mehr einfachhin ›Natur‹ und in seinem Wesen auf den Boden der Natur angewiesen. Seine Einzigartigkeit liegt nun aber keineswegs erst – wie zumeist allein beachtet wird – in seiner Erwählung und Heilsbestimmung, die ihn auch aus einer ursprünglichen Einwurzelung im Naturganzen herausheben könnte, sondern schon in seiner Herkunft, die nicht mit der des Ganzen der Schöpfung einfach zusammenfällt, sondern den einzelnen Menschen im Kern seines Wesens als je einziges, originäres und unmittelbares Geschöpf der göttlichen Macht uranfänglich beginnen läßt. Daß die Seele des individuellen Menschen nicht im natürlichen Zeugungszusammenhang entspringt, sondern durch einen je einzigen Schöpfungsakt aus der Hand Gottes hervorgeht, bedeutet nichts Geringeres als das Fundament der radikalen Eigenwüchsigkeit und Autonomie des Menschen im Ganzen der Natur, dem er doch phänomenal eingewurzelt ist. Daß der Mensch seinem Wesen nach in Gegensatz und Auseinandersetzung mit der Natur und in ein Macht- und Vergewaltigungsverhältnis zur Natur treten kann, ist erst im Horizont der christlichen Ontologie als Möglichkeit verstehbar. Die Differenz des christlichen Kreationismus zum antiken Generationismus hinsichtlich des Seelenursprunges ist von unabsehbaren latenten Konsequenzen für das künftige Weltverhältnis des Menschen im Abendlande. Erst der Mensch, der nicht seinem Sein nach aus der Natur hervorgeht, sondern in sie hineingestellt ist und damit nicht eine ›natürliche‹ und darum fraglose Vorzeichnung seiner Existenz in ihr vorfindet, ist ein potentiell ›technischer‹ Mensch, der in der Auseinandersetzung mit der Natur zu leben hat.
4. Die theologische Verschärfung der Differenz zwischen Natur und menschlicher Existenz
Die Heterogeneität von Mensch und Natur verschärft sich nun auf dem Boden des christlichen Seinsverstehens zum tragischen Hiatus durch das die christliche Existenz tief durchdringende Bewußtsein von einer Urentscheidung des Menschen, die das Verfehlen seines ursprünglichen Seinsollens zum Grundzug seines Daseins machte. Der Mensch, der seine Freiheit gegen das gottgewollte Sein gesetzt hat, vermag sich dennoch nicht der Notwendigkeit zu entziehen, mit und aus diesem Sein sein Leben zu fristen. Die Ursünde macht die Natur zum Widerpart seines Selbstbesitzes; sein Leben ist, wie schon das 3. Kapitel des 1. Buches Mosis zeigt, daher geprägt von der Mühe, Härte und Arbeit des Und doch seines Lebenmüssens in der Natur, die ihm nicht mehr tragender Daseinsboden und bereite Lebensquelle ist, in die er vielmehr als ein Verstoßener geworfen ist. Die unversöhnbare Differenz von Freiheit und Notwendigkeit, die aus der Sünde entspringt, bestimmt ihn zu einem Dasein, das wesentlich Mühe, Arbeit, Kraftaufgebot, Gewalt, also ein ›technisches‹ ist und seinem Willen das unerreichbare, aber zugleich unaufgebbare Ziel setzt, Existenz und Natur, Müssen und Können, Freiheit und Notwendigkeit dennoch zu ›mühelosem‹ Einklang zu bringen. Nicht zufällig wird am Ursprung der Neuzeit nicht nur der Aufstieg des naturwissenschaftlichen Denkens als des Instrumentes technischer Realisierung, sondern auch die reformatorische Verschärfung des Sündenbewußtseins und damit des Hiatus von Existenz und Natur stehen. Die moderne Technik ist zwar ›Anwendung‹ der modernen Naturerkenntnis; aber daß es zu solcher dynamischen Transposition der Erkenntnis ins Reale kommt, hat seinen hinreichenden Grund nicht in diesem inneren Zusammenhang zwischen Wissenschaft und Technik selbst, sondern in der Konsequenz jenes Verständnisses der Stellung der Existenz in der Natur. Für die Entstehung der spezifischen modernen Wirtschaftsform ist man diesen Zusammenhängen intensiv nachgegangen; für die Technik fehlt es noch an einer Analyse des geistesgeschichtlichen Hintergrundes ihrer Ursprünge.
5. Die Aufhebung der mittelalterlichen Scheidung von Gebrauch und Genuß
Gegen diese Darstellung läßt sich nun ein schwerwiegender Einwand geltend machen: wie konnte trotz dieser fundamentalen Voraussetzungen das Mittelalter als der historische Raum einer christlichen Ontologie ein phänomenal so untechnisches Zeitalter sein? Gegen diesen Einwand wird man nicht nur ins Treffen zu führen haben, daß die genuinen christlichen Antriebe im Mittelalter entscheidend durch die kaum zu überschätzende Rezeption der antiken Metaphysik überdeckt und latent gehalten wurden, sondern auch, daß einer dynamischen Realisierung dieser Antriebe die Eigenart des Mittelalters entgegenstand, die Dringlichkeiten der Welt und des diesseitigen Daseins ›sub specie aeternitatis‹ zu depotenzieren. Die augustinische Formel, die das Verhältnis zur Welt auf das uti, den Gebrauch, beschränkte, das frui, den Genuß, aber der jenseitigen Seinserfüllung als dem absoluten Ziel vorbehielt, charakterisiert diese Sicht aufs deutlichste. Die Bedeutung dieses Vorbehalts für die Latenthaltung der die Technik innervierenden Antriebe bestätigte sich vom Ausgang des Mittelalters her: zu den entscheidenden Voraussetzungen der spezifischen technischen und ökonomischen Entwicklung der Neuzeit gehört die Aufhebung der Differenz von uti und frui, von Gebrauch und Genuß. Der notwendige Gebrauch der Natur erfüllt sich als freier und in sich Genüge findender Genuß.
Immer deutlicher zeigt sich, daß die Bestimmung der Technik als Anwendung der modernen Wissenschaft nicht als Erklärung ihrer Stellung im Bild der Neuzeit genügt. Denn daß Erkenntnis nicht sich selbst genügt und in sich beruhen kann, sondern über sich hinaus auf Anwendung drängt, ist ganz und gar nicht selbstverständlich. Die Antike sah in der Erkenntnis und dem durch sie erlangten Wissen das Höchste und den Inbegriff menschlichen Strebens, wie der Anfang der aristotelischen Metaphysik zeigt. Weshalb das Wissen am Beginn der Neuzeit sich nicht mehr zu genügen beginnt, läßt sich also nicht damit begreifbar machen, daß man sagt, es dränge zur Anwendung. Vielmehr zeichnet sich jetzt die Deutung ab, daß die moderne Wissenschaft durch das geschichtliche Selbst- und Weltverständnis geradezu zu ihrer instrumentalen Funktion herausgefordert worden ist, ja daß ihr eigener Aufstieg durch das Voraussein des technischen Willens entscheidend provoziert worden ist. In einer philosophischen Betrachtungsweise kehrt sich die landläufige Auffassung des Folgeverhältnisses von Wissenschaft und Technik um.
Die Aufhebung der fundamentalen mittelalterlichen Differenz von Gebrauch und Genuß ist unabsehbar in ihren Konsequenzen. Der auf eine jenseitige Erfüllung hin instrumentale Gebrauch der Welt ist seinem Wesen nach endlich, der Weltgenuß dagegen, der den bloßen Gebrauch absorbiert, unendlich. Die Ablösung des endlichen Weltbildes durch ein unendliches, die überhaupt die Epochenschwelle zur Neuzeit charakterisiert, markiert auch diese historische Linie. Im Prinzip ist schon hier – mögen die Konsequenzen auch erst viel später sichtbar zutage treten – der entscheidende Übergang vollzogen, der vom Gebrauch der Natur und der Anwendung ihrer Gesetze zu ihrer rückhaltlosen Ausbeutung und Eroberung als sich selbst sinngebender Dynamik der Technik führt. Der innere Widerspruch einer Grundlegung, die auf Genuß zielt und Arbeit zur Voraussetzung hat, wird erst am Ende der technischen Entwicklung zu voller Schärfe aufbrechen.
6. Die Einheit des Ursprunges von Wissenschaft, Technik, Kunst und Macht am Beginn der Neuzeit
Die dargestellten ontologischen Zusammenhänge werden noch bestimmter bestätigt, wenn man auf die zumeist vernachlässigte Einheit der Voraussetzungen achtet, die den Ursprung der modernen Kunst mit dem der modernen Technik verbindet. Das lateinische Wort ›ars‹ ist der Erbe der Bedeutungen, die griechisch mit τέχνη bezeichnet wurden: Kunst und Technik im heutigen Sprachgebrauch, sind Entfaltungen der ursprünglichen ›ars‹ des Menschen, einer ›Kunst‹, die sich als die Einheit des werkgestaltenden Könnens des Menschen verstehen läßt. Das gemeinsame Neue der neuzeitlichen Kunst und Technik ist die Auffassung, die der Mensch sich von den Möglichkeiten seines Könnens im Hinblick auf die Verwirklichung seines Genußwillens gebildet hat. Das Moment des Genusses macht den einen Grundzug der neuzeitlichen Ästhetik aus, das der schöpferischen Macht des Künstlers den anderen. Die neue Sicht, in der dem Menschen sein eigenes Können erscheint, läßt sich nur auf dem Hintergrund der geistesgeschichtlichen Situation des ausgehenden Mittelalters verstehen, die durch den Nominalismus bestimmt wird.
Hier wird aus wesentlich theologischen Motiven heraus das Vertrauen des Hochmittelalters in die Erkenntniskraft der Vernunft radikal erschüttert; der Zugang zum Wesen des Seienden, das der unendlichen Freiheit des göttlichen Schöpfers entsprungen ist, ist der endlichen Vernunft des Menschen verwehrt. Die Gesamtheit unserer Erkenntnis ist nur in der Praxis der Weltorientierung und Wirklichkeitsbewältigung als ›richtige‹ bestätigt und gerechtfertigt. So sind die Begriffe nur ›nomina‹, nicht ›conceptus‹, und ›richtig‹ und ›falsch‹ drücken nur die ökonomische Funktion des innerweltlichen Sich-Einrichtens und Sich-Zurechtfindens aus. Damit aber hat unser gesamtes Erkenntnisvermögen von vornherein einen Charakter erhalten, den man getrost als ›technischen‹ ansprechen kann: es ist nicht vernehmend hingegeben an das Seiende, das ihm doch verschlossen ist, sondern es ist originär schöpferisch, eine ganz und gar menschliche, nur auf die menschliche Weltaufgabe hingeordnete Einheit von Begriffen und Gesetzen produzierend. Unsere Erkenntnis ist ihrem Wesen nach schon Kunst und Technik in eins, die ›ars humana‹, die sich erst sekundär aufspaltet in die Ausdrucks- und Werkformen der ›Kunst‹ und ›Technik‹ im neuzeitlichen Sinne. Erstmals zeigt sich die menschliche Autonomie als der Grundzug der heraufziehenden Epoche; aber ihr Ursprung ist nicht Selbsterhebung und Selbstüberhebung des Menschen, sondern die Antwort auf die Not der wesenhaften Fremdheit in dieser Welt und der Verfehlung ihrer gottgegründeten Wahrheit. Nicht der Kraftüberschuß und -überschwang ist primär, sondern die der Notwendigkeit sich unterwerfende Kraftentfaltung. Da die gottgeschaffene Welt dem Menschen nicht zu eigen werden kann, ist der Mensch in die Not gestürzt, seine eigene Welt aus eigener Kraft zu bilden.
Die gegebene Natur aber, verborgen in ihrem Wesen und nur als ›res extensa‹ in den wissenschaftlichen Quantitätsformeln zu befassen, wird zum bloßen Rohstoff der ›ars humana‹. Der Stil des Weltverhältnisses, dessen Grundlegung dargestellt wurde, ist so tief in den Geist der Neuzeit eingegangen, daß er selbst heute noch die in Ost und West gespaltene Welt überspannt: die Unterwerfung der Natur unter den Willen des Menschen ist hier wie dort das immer ausdrücklicher formulierte Programm. Was der Techniker im amerikanischen Laboratorium vom Sinn seiner Arbeit sagt, das spricht auch aus den Projekten, die der Osten propagiert: Hier wird die Welt zum zweitenmal geschaffen! Wie verborgen diese Selbstformulierung des technischen Willens noch vor kurzem war und wie ausdrücklich sie heute geworden ist, zeigt sehr augenfällig die Geschichte jener ›Ersatzstoffe‹, die, zunächst der Natur mühsam nachgemacht, heute einen ungeheuren Komplex der Technik repräsentieren, in dem der Natur etwas ›vorausgemacht‹ wird oder werden wird.
Die gewonnenen Einsichten über den geschichtlichen Zusammenhang, aus dem diese moderne Technik als ein unvergleichliches Phänomen hervorgegangen ist, bestätigen sich, wenn man versucht, den weiteren Umkreis der Vorstellungen und Begriffe, die den Beginn der Neuzeit markieren, als Sinneinheit zu verstehen. Hierher gehört der Streit der Renaissance um das Wesen der Kunst als imitatio oder inventio; der Begriff der Erfindung, später ein Specificum des technischen Bereiches, wird zuerst in diesem Zusammenhang bedeutsam. Eine Schlüsselgestalt der beginnenden Neuzeit wie Leonardo, der nicht zufällig Künstler und Techniker zugleich war, bestätigt die Einheit des Ursprunges. Auch wird man die Heraufkunft des Begriffes der politischen Macht als Anspruch auf rational-technische Verfügbarkeit des öffentlichen Geschicks auf dieselben Fundamente begründen müssen.
Die Theologie versucht, die menschliche Autonomie als göttlichen Auftrag in christlicher Bindung zu halten; so sagt Nikolausvon Cues, zugleich einer der Begründer des Experiments, nämlich des Versuches, die Natur unter die Bedingungen der menschlichen Erkenntnis zu bringen: ODomine … posuisti in libertate mea ut sim, si voluero, mei ipsius. Hinc nisi sim mei ipsius, tu non es meus …[4] In diesen Zusammenhang fällt auch der vielschichtige Programmbegriff der ›reformatio‹. Marsilio Ficino, der ihn proklamiert, will ihn universal-kosmisch verstanden und exemplarisch in der Kunst verwirklicht sehen:[5] der göttlichen ›formatio‹ der Natur korrespondiert die menschliche ›re-formatio‹, die dadurch zum Anliegen des Menschen wird, daß er in die erste Schöpfung nicht selbstverständlich und wie in sein Eigentum eingewurzelt ist. Immer ist die Distanz von Existenz und Natur das ontologische Fundament. Descartes erhebt die Forderung des jetter par terre alles historisch und naturhaft Vorgegebenen (prévention), das den Raum für den radikalen, gleichsam ›ex nihilo‹ ansetzenden Entwurf der Wissenschaft und Moral freilegt; die Auffassung der Einheit der Wissenschaft als Entwurf ist in ihrem Wesen ›technisch‹. Giambattista Vico gebraucht nur eine andere Vokabel, wenn er alle Arten menschlichen Handelns und Wirkens als poietisch zu begreifen sucht; erstmals bezieht er dabei die Geschichte in den Bereich der ›ars humana‹ ein.
So werden die Umrisse einer Interpretation sichtbar, die die Signaturen der Neuzeit, Wissenschaft, Technik, Kunst und Macht aus der Einheit ihres Ursprunges in der geschichtlichen Sinngebung des Seins zu verstehen sucht. Das Problem der Technik läßt sich aus dieser Einheit nicht als ein für sich zu formulierendes oder zu lösendes herausreißen.
7. Die ›zweite Natur‹ der Maschinenwelt als Konsequenz des technischen Willens
Nun ist gegen die Auffassung der Geschichte der modernen Technik als konsequenter Entfaltung eines inneren Prinzips ein gewichtiger Einwand erhoben worden. Ortega y Gasset hat in seinen deskriptiv wertvollen, ontologisch aber unzureichend fundierten »Betrachtungen über die Technik« auf wesentliche Differenz hingewiesen, die innerhalb des technischen Bereiches selbst zwischen ›Werkzeug‹ und ›Maschine‹ gesehen werden müsse.
Kann diese nicht zu übersehende Differenz noch aus der ungebrochenen Vollstreckung der bisher aufgewiesenen ontologischen Fundamente her ausgelegt werden oder hebt hier etwas radikal Neues an? Es hat sich gezeigt, daß der Mensch der Neuzeit in die Not und Notwendigkeit der technischen Weltbildung hineingestellt ist, eine Not, die erst aus dem Kraftbewußtsein ihrer Bewältigung zur ›Tugend‹, nämlich zu Würde, Stolz und Hybris der menschlichen Autonomie und Autarkie, gewendet wurde. Es liegt in der inneren Dynamik des Vollzuges dieser Weltaufgabe, daß die anfängliche Notlösung sich zum unbedingten Rang einer ›zweiten Schöpfung‹ erhebt, die sich in einem Geschaffenen manifestiert, das dem der ersten Schöpfung nicht wesentlich nachsteht. Wenn also das Geschaffene der ersten Schöpfung wiederum als ›Natur‹, als in sich begründetes Aus-sich-Selbst des Gestaltens und Wirkens, begriffen wird, dann muß der ›zweiten Schöpfung‹ die innere Tendenz auf eben diesen seinsmäßigen Rang hin innewohnen, das heißt: sie kann sich nur in einer ›zweiten Natur‹ erfüllen. Die Charakteristik des natürlichen Seins, daß es das Prinzip seiner Gestaltung und seiner Funktion in sich trägt, wird folgerichtig in den Bereich des technischen Werkes transponiert. Hier liegen die Antriebe zur Herausgestaltung des Automaten, der Maschine, der ›aus sich selbst‹ funktionierenden Gebilde der modernen Welt, die der ›ersten Natur‹ um so adäquater erscheinen konnten, je mehr es gelang, diese selbst nach dem Schema eines ›Weltautomaten‹ zu begreifen. Dieses Schema der Naturdeutung entspringt nicht primär dem Ausdehnungsdrang der Grundvorstellungen des technischen Menschen, sondern es ermöglichte seinerseits erst die Konzeption der Maschine als einer technischen Transposition des Naturbegriffes.
Daß die Maschine ›produziert‹, daß sie industriell nutzbar zu machen ist, ist demgegenüber erst ein später und sekundärer Zug, so daß man den wesentlichen Einschnitt nicht erst bei der Erfindung der Industriemaschine (1825: mechanischer Webstuhl) ansetzen darf, sondern auf die barocke ›Spiel‹welt der Automaten auf den Traum vom ›Perpetuum mobile‹, dem absoluten technischen Aus-sich-Selbst, zurückgehen muß. Das Schlüsselwort aber dieser wesenhaften Tendenz der technischen Welthaltung auf die ›zweite Natur‹ hin ist der Unbegriff der ›Organisation‹, der das Organische als Produkt einer Konstruktion voraussetzt.
Aber stehen wir mit dem Begriff der ›zweiten Natur‹ schon am Ende der möglichen Konsequenzen, die das Seinsverständnis der Neuzeit impliziert? Ist der Anspruch der ›unbedingten Herstellung‹, wie Heidegger den technischen Willen genannt hat,[6] in der ›zweiten Natur‹ einer perfektionierten Maschinenwelt ausgetragen oder liegt es im Zuge solcher Unbedingtheit, daß sie nichts anderes neben sich duldet, das heißt: daß die ›zweite Natur‹ nicht nur die Potenz zur Aufhebung der ›ersten Natur‹ bereitgestellt hat, sondern auch aus ihrem Wesen heraus auf die Vollstreckung derselben hindrängt? Die Erfahrungen des Menschen mit dieser letzten Phase möglicher technischer Realisierung stehen erst im Beginn.
3. Hat die Wissenschaft versagt? Was wiegt schwerer: Gewinn an Wahrheit oder Verlust an Glück? – Antwort eines Philosophen auf eine ketzerische Frage
Lieber Herr Blumenberg,
Sie wissen, daß mich seit langem die Frage beschäftigt, was eine sehr späte Geschichtsschreibung aus gehörigem Abstand an unserem gegenwärtigen Zeitalter am meisten in Erstaunen versetzen wird. Für einen Mann der Zeitung, der dem täglichen Andrang des Aktuellen gegenübersteht, doch wohl eine verständliche Frage, nicht wahr? Jetzt ging es mir plötzlich auf, als ich folgende Zeitungsnotiz meiner Frau vorlas: es sei amerikanischen Wissenschaftlern gelungen, die Kloake der Großstädte in proteinhaltige Nahrungsmittel umzuwandeln. Meine Frau reagierte empört: Darf man so etwas überhaupt erforschen und erfinden? Gibt es denn keine Grenze, an der die Wissenschaft haltmachen muß?
Und in diesem Augenblick wurde mir klar, daß die erstaunlichste Tatsache unseres Zeitalters die Geduld des Menschen mit der Wissenschaft ist – mit der Wissenschaft, die seinen Unterdrückern die Mittel der Macht, der Drangsalierung und Vernichtung in die Hand gibt. Nie hat man davon gehört, daß einem der Entdecker und Erfinder dieser wissenschaftlich exakten Mittel und Praktiken auch nur ein Schmähruf entgegengeschollen wäre – und das in einer Zeit, in der die Massen sich der Demonstration, des Streiks, des Meinungsdrucks gegen alles, was ihnen unangenehm und unbequem ist, mit Meisterschaft bedienen. Wäre nicht die Rebellion der Menschheit gegen die Wissenschaft einer der noch unbegangenen Wege ihrer Friedenssuche? Und besteht nicht Hoffnung, daß der Wissenschaftler selbst seine Schlüsselstellung für den Bestand und die Regung moderner Macht endlich benutzt, um eine Wendung der Dinge zu erzwingen, um den Gebrauch des Werkzeuges »Wissenschaft« auf das Menschenwürdige und Menschendienliche zu beschränken? So stelle ich Ihnen, dem Wissenschaftler, die nackte Frage: Hat die Wissenschaft nicht versagt? Hat sie dem Menschen das Mehr an Wahrheit und das Mehr an Glück gebracht, das in ihrem Ursprung und in ihrem Siegeszug durch die Neuzeit verheißen worden war?
Trotzdem: unverändert herzlich
Ihr
Alfons Neukirchen*
Lieber Herr Neukirchen,
vorausgesetzt, Sie hätten das Zeug zum Rebellen gegen die Wissenschaft, zum Anstifter des Massensturms auf Laboratorien und Institute – Ihr Stichwort zur Revolte käme dennoch um ein gutes Jahrhundert zu spät. Nicht nur, daß die Völker ihre Unfähigkeit zu einer wirksamen Rebellion für den Frieden vielfältig unter Beweis gestellt haben; es fehlt den Massen heute der Glaube an ihre eigene Kraft, an die Revolution als ein Mittel, sich von ihren Bedrückern zu befreien. Dieser Glaube an die Revolution ist erdrückt worden von den Erfahrungen des Versagens aller revolutionären Versuche seit der Französischen Revolution, die letzten Endes immer nur zur Immunisierung der Macht gegen jede Art des Widerstandes geführt haben.
Und die Wissenschaftler selbst? fragen Sie. Man kann nicht übersehen, daß ihnen die Problematik ihrer Errungenschaften heute sehr zu schaffen macht; aber man darf auch nicht übersehen, daß sie in einem Konflikt stehen, der ihre Entschlußkraft lähmt und sie hier und dort zu dienstbaren Figuren im Feld der Mächte werden ließ – ich meine den Konflikt zwischen der verpflichtenden Idee aller Wissenschaft, der Wahrheit zu dienen, und der Drohung der Konsequenzen, die aus den Ergebnissen dieses Dienstes an der Wahrheit entspringen können. So sieht der Wissenschaftler sich in seinem eigenen Ethos gefangen: er hat der reinen Erkenntnis sich verschworen, aber die Wahrheit, zu der sie ihn führen soll, ist dem Menschen nichts schuldig, sie herrscht über den Menschen hinweg mit der Gleichgültigkeit einer fremden und furchtbaren Gottheit.
Sehen Sie, das ist eine geschichtliche Erfahrung, die niemand hätte voraussehen können, überraschend und deshalb noch längst nicht überall geglaubt: das Mehr an Wahrheit, das uns die Wissenschaft gebracht hat, ist nicht selbstverständlich auch ein Mehr an Glück, an Frieden und Zufriedenheit, an Bewältigung der uns gestellten Lebensfragen. Und nun muß ich sagen: für den Wissenschaftler ist es fast unmöglich, ist es Selbstaufgabe und Eidbruch, diese furchtbare Differenz, sagen wir: zwischen Wahrheit und Menschlichkeit einzusehen und einzugestehen. Es wiederholt sich auf höherer Ebene der wohl typische Konflikt der bewußten Persönlichkeit in der Gegenwart, die Unschlüssigkeit zwischen Fahneneid und Moralität. Welches Unmaß an Verwüstung ist nötig – wir wissen es nur zu gut –, um eine Epoche, ein Volk zur Preisgabe einer Idee zu zwingen, an die sie ihre Existenz gebunden haben! Nein, lieber Freund, der Wissenschaftler wird nicht einsehen, daß die Triumphe seiner Erkenntnis zugleich Niederlagen des Menschen in seiner Existenz sein können. Die Wissenschaft ist selbst ein gewaltiges Experiment, das nicht auf halbem Wege abgebrochen werden kann. Und wir können uns keineswegs darüber sicher sein, wie es ausgeht – darin liegt Hoffnung.
Sie fahren schwerstes Geschütz auf gegen die Wissenschaft, lieber Herr N., die Wasserstoffbombe und die Kloake, das überdimensional Schreckliche und das unterdimensional Unappetitliche. Darf die Wissenschaft, so fragen Sie, in die Kloake hinabsteigen, um uns die Nahrung der Zukunft heraufzureichen? Ach, das ist eine hinterhältige Frage – sie birgt einen Hinterhalt nicht nur für mich, sondern auch für Sie, mein Lieber. Enthält Ihre Frage nicht das Zugeständnis, daß dieselbe, Wissenschaft, die die Mittel zur Vernichtung von Millionen bereitstellt, sich zugleich verzweifelt müht, das Leben von vielmals so vielen Millionen zu ermöglichen? »Die Naturwissenschaften und die Technik ermöglichen wohl etwa ein bis eineinhalb Milliarden Menschen das Leben, die sonst nicht leben würden. Diese Zahl liegt größenordnungsmäßig hundertmal höher als die Verluste der letzten Kriege«, zitiere ich aus einer gründlichen Untersuchung zu dieser Frage.
Und da sehe ich Sie abwehrend die Hände heben. Nein, ich denke nicht daran, mir dieses Argument zueigen zu machen; es ist ein gut wissenschaftliches, nämlich ein statistisches Argument – und zugleich ein unmenschliches. Man kann die Menschen, die ohne Wissenschaft und Technik nicht geboren oder der feindlichen Natur zum Opfer gefallen wären, nicht aufrechnen gegen die, die durch Wissenschaft und Technik dem Zugriff menschlicher Willkür und Bosheit erliegen konnten. Die Hundert, die da mehr geboren oder erhalten sind, haben kein »existenzielles« Gewicht gegenüber dem Schmerz um den einen, der sinnlos aus dem Leben gerissen wurde durch einen Tod, der nicht mehr als Gesetz der Natur oder als Schicksal begriffen werden kann. Aber die Wahrheit scheint gleichgültig zu sein gegen diese unüberbrückbare Differenz, so wie sie gleichgültig dagegen ist, ob sie im grünen Waldesdom oder in der Kloake gefunden wird – das Schreckliche und das Unappetitliche, eben das Menschliche sind ihre Maße nicht. Und daß sie ausgemünzt werden kann, daß sie der Transformation in Nutzen, Geschäft, Macht und Tod fähig ist, das berührt die Wahrheit selbst nicht.
So sicher es ist, daß nur die rechte Zuordnung des Wahren und des Guten es unmöglich machen kann, daß die Wahrheit gleichgültig über Hekatomben von Menschenopfern hinwegschreitet – so gewiß ist auch, daß die Geschichte nicht in den Rückwärtsgang umgeschaltet werden kann. Was uns bleibt, ist, uns den Blick zu schärfen für die Möglichkeiten, die sich im Feld der Zukunft für eine neue Einheit des Wahren und des Guten, der Erkenntnis und der Menschlichkeit zeigen mögen.
Müssen wir also zugeben, daß die Wissenschaft versagt hat? Die Antwort auf diese Frage hängt von der Stellungnahme zu der anderen Frage ab, was uns die Wahrheit der Wissenschaft wert ist. Und diese Frage ist eine ganz und gar »existenzielle«. Was das bedeutet, will ich Ihnen an zwei Beispielen verdeutlichen. Der Dichter Franz Kafka schilderte einmal einem Freund einen Besuch bei Johannes Schlaf in Weimar, der intensiv damit beschäftigt war, die bestehende Theorie des Sonnensystems umzustoßen und die Erde in den Mittelpunkt des Kosmos zurückzuversetzen. »Er führte uns zum Fenster seiner Kleinbürgerwohnung und zeigte uns die Sonne mit Hilfe eines alten Schülerfernrohres.« – »Ihr habt alle gelacht?« – »Woher! Die Tatsache, daß er es wagte, mit diesem lächerlichen Gegenstand aus der Verlassenschaft einer alten Zeit gegen Wissenschaft und Kosmos auszuziehen, das war so komisch und rührend gleichzeitig, daß wir ihm fast Glauben geschenkt hätten.« – Und zum zweiten eine Kanonade gegen die Gleichgültigkeit des Richtigen aus der Feder Léon Bloys aus dem Roman-Pamphlet »La femme pauvre«: »Bevor die wissenschaftliche Idiotie uns vergiftet hat, wußten die Kinder, daß das Grab des Erlösers der Mittelpunkt des Weltalls, die Angel und das Herz der Welten ist. Die Erde mag sich, so lange sie will, um die Sonne drehen. Ich habe nichts dagegen, aber nur unter der Bedingung, daß dieses Gestirn, das von unseren astronomischen Gesetzen keine Ahnung hat, ruhig seine Drehung um diesen unscheinbaren Punkt fortsetzt … Die unvorstellbaren Himmel haben keine andere Aufgabe, als den Platz eines alten Steines zu bezeichnen, unter dem Jesus drei Tage lang geschlafen hat.«
So wenig ist dem Künstler und dem Religiösen die wissenschaftliche Wahrheit wert. Was sie uns wert ist, müssen wir aus unserem eigensten Lebensgrunde heraus zu beantworten suchen – es kann sein, daß wir die Antwort mit diesem Leben selbst bezahlen müssen.
Ihr ergebener
Hans Blumenberg
4. Das menschliche Männchen Über Glanz und Elend des Fragebogens – Der verhängnisvolle Trick
»Die Tiere sind wie die Menschen!«, hört man nicht nur heute im Zoo vor dem Felsen der Pinguine oder vor dem Gehege der Schimpansen; dieses Motiv erklingt von den Fabeln des Aesop bis zum »Tierstaat« von George Orwell immer wieder in der Geschichte der Literatur. Jeder einzelne Faden aus dem Gewebe der Eigen- und Leidenschaften, die einen Menschen ausmachen, scheint irgendwo im Tierreich schon einmal in grotesker Isolierung dagewesen zu sein. Oder ist es nur das Vergnügen, uns in der Natur zu spiegeln, die Vielfalt des Lebens in uns zusammengefaßt zu wissen, was uns zu solchen Projektionen verlockt?
»Die Menschen sind wie Tiere!« Das ist nicht nur eine spielerische Umkehrung des ersten Satzes, es ist eine böse, versucherische Wendung seines Sinnes. Diese Wendung ist modern. Der Mensch ist sich zu »menschlich« geworden. Er ist weit aus der Natur herausgetreten, hat sich zu ihrem Herrn und Meister erhoben und fühlt nun die Last der Verantwortung, die es bedeutet, ein Mensch zu sein. Verstohlen und verhohlen lebt auf dem Grunde des modernen Bewußtseins die Sehnsucht, sich durch ein Hinterpförtchen wieder in den Schoß der Natur hineinzumogeln, wieder Naturwesen unter Naturwesen zu sein und ohne Scham sich seiner Nacktheit zu freuen.
Mächtige Helfer sind dieser Sehnsucht erstanden. Der neuzeitlichen Wissenschaft mußte die Exklusivität des Menschen gegenüber den anderen Wesen ein Ärger sein. Wie sollte sie das Unvergleichbare fassen, das Einzigartige klassifizieren? Linné, der Vater des wohlgegliederten Systems der Pflanzen und Tiere, das wir aus der Schule in quälender Erinnerung haben, katalogisierte den Menschen kurzerhand mit den ihm ähnlichen Affen unter dem Namen »Primaten«. Das war der entscheidende Schritt: der Mensch war, wenn auch als »Primus«, wieder ein Tier unter Tieren. Freilich bedurfte es noch vieler Mühe, ihm selbst das auch glaubhaft zu machen. »Das Tier etwas anheben, den Menschen etwas herunterdrücken, vielleicht noch ein Zwischenglied finden – und wir haben die Zoologie beieinander!« Das war das Rezept.
Und es fehlt ja leider nie an Gelegenheit, den Menschen »etwas herunterzudrücken«. Und es fehlt auch nicht an einem so ausgezeichneten Schimpansen, wie Koehlers weltberühmter »Sultan« es war, der im Raffinement der Beschaffung von Bananen nicht leicht von irgendjemand übertroffen werden kann. Und es sollte schließlich nicht an Zwischengliedern fehlen: man konstruierte sich den »edlen Wilden«, der noch so wild wie ein Tier und doch schon so edel wie ein Mensch (oder umgekehrt?) zu sein hatte, und mit etwas Gips und Phantasie »erschloß« man aus ausgegrabenen Zähnen und Hirnschalenfragmenten sinnfällige Ahnenporträts der Menschheit. Als Darwin 1871 den Ahnenpaß des Menschen der Öffentlichkeit übergab, ergriff ein unvorstellbarer Taumel die Zeitgenossen: die Entpflichtung des Menschen von der Menschlichkeit hatte begonnen.
Es war bezeichnenderweise der Schwerindustrielle Krupp, der 1899 einen hohen Preis für die beste Antwort auf die Frage »Welche Folgen ergeben sich, wenn man den Menschen wie ein Naturobjekt behandelt?« aussetzte. Wer auch den Preis bekommen haben mag, er hat ihn nicht verdient. Dieser Preis gebührt der Geschichte, die uns innerhalb eines halben Jahrhunderts das vollkommenste und konsequenteste Exposé zu dieser Frage geliefert hat.