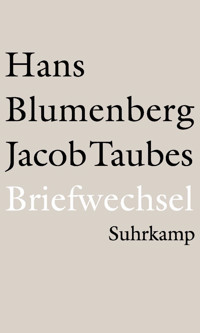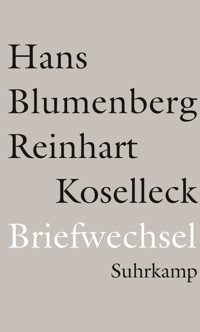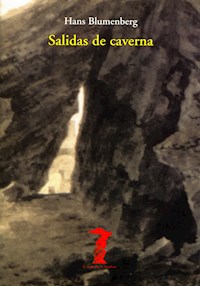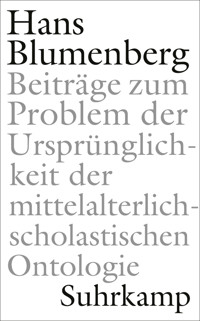25,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Was meinen wir, wenn wir von Realität sprechen? Was bedeutet Realismus im Denken? Wie tritt der Mensch in Kontakt mit der Wirklichkeit und bildet ein Bewusstsein von ihr aus? Diese Grundfragen der Philosophie haben Hans Blumenberg zeit seines Lebens beschäftigt und sind als wichtige Unterströmung in vielen seiner Bücher präsent. Eine eigene Monographie zum Thema hat er nie publiziert, er hat sie aber projektiert, wie aus seinem Nachlass hervorgeht. Dort findet sich unter dem Kürzel REA ein umfangreiches Konvolut druckreifer Texte aus den 1970er Jahren, und auch einen Buchtitel hatte sich Blumenberg schon notiert: »Realität und Realismus«.
In intensiver Auseinandersetzung mit dem Wirklichkeitsbegriff, und zwar sowohl in systematischer als auch in historischer Hinsicht, arbeitet Blumenberg meisterhaft dessen historische, anthropologische und kulturelle Dimensionen heraus. Er zeigt unter anderem, dass die Thematisierung dessen, was wir Wirklichkeit nennen, auf Umwegen geschieht und auch erst dann, wenn wir durch eine Störung gezwungen werden, unseren selbstverständlichen Weltzugang zu hinterfragen. Realismus und Realität ist ein Glanzstück und entscheidender Baustein von Blumenbergs Theorie der Lebenswelt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 359
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
3Hans Blumenberg
Realität und Realismus
Herausgegeben von Nicola Zambon
Suhrkamp
7Was heißt ›etwas sei wirklich‹?
Eike von Savigny, Philosophie der normalen Sprache
Übersicht
Cover
Titel
Widmung
Inhalt
Informationen zum Buch
Impressum
Hinweise zum eBook
5Inhalt
Cover
Titel
Widmung
Inhalt
I
Antiker und neuzeitlicher Wirklichkeitsbegriff
II
Antiker und mittelalterlicher Wirklichkeitsbegriff
III
[Zum Wirklichkeitsbegriff der Neuzeit]
IV
[Illusion und Realität]
V
[Zum Welt- und Wirklichkeitsbegriff der Phänomenologie]
VI
Die Realität des Eigenleibes
VII
Die Wirklichkeit des Unsichtbaren
VIII
Zur Anthropologie des Realisten
1. Ein Wesen, das auch als Nichtrealist existieren kann
a. Rückbildung der Kollision bis zur Negation
b. Realismus ist Ausnahmezustand, zum Beispiel als Lachen, Enttäuschung, Verlegenheit
2. Das Gedankenexperiment ›Paradies‹
3. Distanz als Faktor von Realismus: Zeit als Bedingung für die Wahrnehmung von Realitäten, die nicht momentan sind
4. Was real ist, hängt auch von quantitativen Bedingungen ab: Die Zeitabhängigkeit der Realität und die ›Länge des spezifischen Moments‹ (das Gedankenexperiment des Karl Ernst von Baer)
5. Dingrealität und Prozeßrealität – am Beispiel ›Fortschritt‹
a. Die Überdistanz des ›tertiären Bereichs‹ und seine Realitätsentfremdung
b. Quantitative Bedingungen für den Realitätszugang im Nahbereich: Vier Beispiele aus der Ethnomethodologie
IX
Der Realist als Indexfigur für Realismus
1. Was für den Historiker und was für den Physiker ›Tatsache‹ ist: Einzigkeit und Wiederholung als Antithesen
2. Realität abhängig vom Grad der Unabhängigkeit vom Subjekt
a. Fallstudie: Messianischer Traum und Judas-Realismus
b. Realismus als Phänomen der Rhetorik
3. Der ästhetische Realist
Nachwort des Herausgebers
Namenregister
Fußnoten
Informationen zum Buch
Impressum
Hinweise zum eBook
3
7
5
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
153
154
155
156
157
159
160
161
162
163
164
165
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
9IAntiker und neuzeitlicher Wirklichkeitsbegriff
Ich muß vielleicht zunächst sagen, was ich meine, wenn ich vom Begriff der Wirklichkeit spreche. Ich gebrauche diesen Ausdruck mit der Absicht, deutlich werden zu lassen, daß mein Thema nicht ontologisch im gegenwärtigen philosophischen Gebrauchssinn des Wortes ist. Ich spreche nicht vom Sein, nicht vom Seienden als dem Seienden, und ich spreche nicht von der veritas ontologica der Tradition, deren Begriff begründen will, weshalb Seiendes für uns Erkennbarkeit besitzt. Ich spreche auch nicht von dem elementaren Faktum des philosophischen Staunens, daß überhaupt etwas und nicht viel mehr nichts ist. Der Begriff der Wirklichkeit, wie ich ihn gebrauchen möchte, hat nicht so sehr einen theoretischen als vielmehr einen pragmatischen Sinn. Er meint jenen Charakter von Verbindlichkeit, der den Menschen in seinem Verhalten bestimmt. Er meint jene Art der Vorgegebenheit, auf die und mit der der Mensch rechnet, auf die er sich verläßt und auf die er sich beruft.
Wenn gesagt werden kann, daß in der Maxwellschen Theorie … die Kraftfelder denselben Grad von Wirklichkeit wie die Körper in Newtons Theorie erworben hatten,[1] so bedeutet das freilich zunächst eine physikalisch-theoretische Aussage, aber der hier verwendete Wirklichkeitsbegriff bezeichnet zugleich den geistesgeschichtlichen Sachverhalt, daß das aktuelle Bewußtsein von Wirklichkeit sich verändern mußte: mit der Anerkennung der Möglichkeit von Fernwirkungen zwischen den Körpern, mit der Aufhebung der eigentümlichen Irrealität oder Quasi-Realität des Raumes wird die Vorstellung einer neuen Konsistenz der uns gegebenen Welt provoziert, die im Horizont menschlicher Erwartungen und Verflechtungsbezüge eine neue Struktur geben mußte. Man kann diesen Sachverhalt mit einiger Vorsicht in der Sprache klassischer philosophischer Systeme ausdrücken. Im Zusammenhang der platonischen Ideenlehre formuliert, wäre Wirklichkeit mit jener dem Ideenkosmos noch transzendenten Idee des Guten zu ver10gleichen, die den Ideen nicht nur den Grund ihres Daseins und ihrer Erkennbarkeit gibt, sondern die sie zu Formen des Sollens macht, ihnen die eigentliche Verbindlichkeit imprägniert, deren Ausstrahlung im »Timaios« den Demiurgen zu seinem Werk das Motiv gibt und die der Ideenlehre ihren unaufschiebbaren systematischen Zusammenhang mit der Ethik verbürgt. Mit Kant gesprochen, dürften wir nicht von einem Begriff der Wirklichkeit reden, sondern müßten den Ausdruck der ›regulativen Idee‹ bevorzugen, ohne freilich die Vernunft als das Organ dieser Idee in dem statisch-absoluten Sinne fassen zu dürfen, wie es Kant getan hat. Also, um ein Beispiel zu geben, wohl jene Natur, die dem Menschen in der Welt seinen Ort anweist, die ihm seinen Lebensbereich und die Möglichkeiten seines sachgemäßen Handelns anweist, aber nicht jene andere Natur, die der Mensch nur beherrscht und bearbeitet, die der Inbegriff der materiellen Substrate seiner demiurgisch-technischen Wirksamkeit ist.
Worum es geht, hat d'Alembert in seinem »Discours préliminaire« eindringlich dargestellt, wenn er die cartesische Zweifelsfrage der Existenz der physischen Außenwelt erörtert und ihre rationale Unlösbarkeit zugibt. Die Mächtigkeit des Eindruckes und die bestimmende Wirkung auf das menschliche Verhalten haben aber mit dieser theoretischen Beweisbarkeit gar nichts zu tun. Wie auch immer die Argumente lauten und welches Gewicht sie haben mögen, dem Menschen ist eine unüberwindliche Neigung zu eigen, eine Art von Instinkt, wie d'Alembert sagt, der viel sicherer ist als die Vernunft selbst und den theoretischen Zweifel gar nicht in die Sphäre unseres Umganges mit der Welt eindringen läßt. D'Alembert macht das Gedankenexperiment, daß die hypothetische Unterbrechung der Existenz der Außenwelt unser Bewußtsein so wenig bestimmen würde, daß wir beim Wiedereinsetzen der realen Gegebenheit gar keine Änderung unseres Bewußtseinszustandes konstatieren würden. Der Wirklichkeitsbezug des Menschen ist praktisch entschieden, und kein theoretischer Gedankengang kann ihn unterbrechen. Wenn sich zum Beispiel hinsichtlich der Solidität der Körper unsere Sinne täuschen, so wäre das, wie d'Alembert sagt, ein so metaphysischer Irrtum, daß unsere Existenz und unsere Selbsterhaltung davon nichts zu fürchten hätten.
Aber unsere Fragestellung geht über diese Aussagemöglichkeit hinaus. 11Sie fragt nicht nach einem ontologischen, erkenntnistheoretischen oder anthropologischen Phänomen, sondern nach einem geschichtlichen. Sie möchte herausarbeiten, ob dieser Wirklichkeitsbegriff seinerseits Geschichte hat und ob in seiner Geschichtlichkeit die Komplexionen geschichtlicher Phänomene der großen Epochen ihren gemeinsamen Grund und ihre verstehbare Sinneinheit haben. Vom Wirklichkeitsbegriff der großen Geschichtsepochen zu sprechen, bedeutet etwas anderes, als eine Begriffsgeschichte, zum Beispiel die des Raumbegriffs, darzustellen. Begriffsgeschichte stützt sich auf die historischen Dokumente, in denen der jeweils thematische Begriff vorkommt, sich definiert findet, umschrieben wird oder sonst belegbar eine Rolle spielt. Dieses Verfahren versagt, wenn man etwas über die Geschichte des Wirklichkeitsbegriffs ausmachen will. Der Wirklichkeitsbegriff einer Epoche bleibt in ihren Zeugnissen in eigentümlicher Weise stumm, und das nicht zufällig, sondern aufgrund der eigentümlichen Selbstverständlichkeit, mit der eine Epoche sich an das hält, was ihr für wirklich gilt. Von ihrem Wirklichkeitsbegriff macht eine Epoche Gebrauch, aber sie redet nicht von ihm, sie kann von ihm gar nicht reden, und in diesem Sinne ›hat‹ sie ihren Wirklichkeitsbegriff nicht. Nur dadurch, daß das Verständnis von Wirklichkeit selbst Geschichte hat, daß es abgelöst werden kann durch ein neues Verhältnis zur Wirklichkeit und diese Ablösung sich gerade als Kritik am Wirklichkeitsverständnis der Vergangenheit formuliert, nur auf diese indirekte Weise gewinnen wir einen Zugang zur Geschichte des Wirklichkeitsbegriffs.
Das Wirkliche ist das, worauf man sich beruft. Es ist die letzte Instanz für den Gebrauch der Sprache. Verliert die Sprache diesen Bezug, so degeneriert sie zu dem, was mit dem Ausdruck ›bloße Worte‹ in Verruf getan wird. Die Geschichte im Wandel ihres Wirklichkeitsverständnisses läßt sich geradezu am Indiz des Vorwurfes erfassen, es seien bis dahin bloße Worte gemacht worden und die Verführung der Sprache habe gesiegt, und demzufolge wird die Notwendigkeit betont und der Aufruf formuliert, nun endlich ›zu den Sachen selbst‹ zu kommen. Die Unterscheidung von Worten und Fakten, ta epē und ta pragmata, verba und res, ist nicht nur so alt wie die Geschichte der Philosophie, sondern so alt wie die für uns nachweisbare Geschichte der geschichtlichen Erfahrung selbst.
12Die Vernunft, die wir als das Organ der Geschichte der Philosophie ansehen, läßt sich verstehen als das Ausdrücklichwerden des in der Geschichte erfahrenen Wandels dessen, was als das Wirkliche gilt. Diese Aussage bedeutet nicht, daß von Anfang an Philosophie Reflexion auf den geschichtlichen Prozeß gewesen sei. Aber was als Geschichte primär erfahrbar geworden ist, formuliert sich in Urteilen, deren Leistung wir im Inbegriff als Kritik bezeichnen würden: Kritik immer wieder an allen möglichen Arten von Schein und Prätention, an Vorurteilen und Vorwänden, an leer gewordenen Formen und Formeln, an Kategorien, die sich nicht mehr bewähren. Ob wir die frühe philosophische Kritik am Mythos, ob wir Descartes' und Bacons Absetzung von den Vorurteilen der Tradition oder ob wir Husserls Ruf ›zu den Sachen selbst‹ oder die positivistische Sprachkritik als Beispiele betrachten – immer geht es im Grunde um den geschichtlichen Verlust des Substrates der Worte, die so lange etwas Reales bedeutet hatten, einen Verlust, der in seiner Geschichtlichkeit freilich unbemerkt bleibt und sich im Gesamt der systematischen Kritik ausspricht, einer Kritik, die sich allemal gegen eine unlebendig gewordene Sprachwelt richtet, die sich unter dem Titel ›Scholastik‹ nicht nur für den geschichtlichen Spezialfall des endenden Mittelalters begreifen läßt. Daß man wieder in Kontakt mit der Wirklichkeit kommen müsse, wird zuerst erfahren an der Unglaubhaftigkeit des Überlebten, Überwundenen oder zu Überwindenden. Wirklichkeit ist ein Kontrastbegriff. Erlebt und ausdrücklich gemacht wird das jeweils Unwirkliche, das, was durchschaut und durchstoßen, entzaubert und bloßgestellt werden muß. Unwirklichkeit gehört zu den akuten geschichtlichen Krisenerfahrungen, die sich allemal dessen nicht bewußt werden können, daß in solcher Erfahrung ein gewandelter Begriff von Wirklichkeit als Implikation enthalten ist und sich zur Geltung bringt.
Man muß nur einmal daran denken, welche akute Erfahrung von Unwirklichkeit in der sokratischen und platonischen Philosophie steckt. Es ist ja nicht so, daß Plato durch seine Philosophie (gewissermaßen im Versuch der Anwendung ihrer Prinzipien) zu seiner Kritik an der Sophistik und ihrer Aufhebung des Unterschiedes zwischen dem Wirklichen und dem Unwirklichen gekommen wäre; sondern die Erfahrung des im hermetischen Abschluß der griechischen Polis aufgeweichten, 13manipulierbar gewordenen, schwebend gewordenen Wirklichkeitsgehaltes hat überhaupt erst das Bedürfnis geweckt, das Ungenügen an diesem durch die Rhetorik getragenen Zustand zur Explikation zu bringen, seine Motive zu formulieren. Die Erfahrung der Macht der Rhetorik ist aus den Fundamenten der Geschichte der Philosophie nicht wegzudenken; sie wird zur ersten für uns voll faßbaren Erfahrung von Unwirklichkeit als Symptom eines geschichtlichen Wandels des Wirklichkeitsbegriffs.
Aber die platonische Philosophie ist nicht nur die erste große Formulierung einer solchen geschichtlichen Erfahrung der Unwirklichkeit dessen, was als das Wirkliche gilt oder gegolten hat; sie ist zugleich der erste Versuch zu verstehen, wie dieses Mißverständnis, diese Wirklichkeitsillusion zustande gekommen ist, und sie bietet uns gleich eine ganze Reihe einschlägiger Erklärungen. Es wäre also nicht methodisch zulässig, die platonische Philosophie oder eine andere systematische Form der antiken Philosophie als Ausdruck des antiken Wirklichkeitsbegriffs zu nehmen und in ihnen bloß die exakteste, ausgesprochenste Form dieses Wirklichkeitsbegriffs der Epoche zu sehen. Vielmehr findet sich der Wirklichkeitsbegriff der Epoche sehr viel eher in dem, was diese Philosophie kritisiert und verwirft, wovon sie sich distanziert und was sie überwinden will, als in ihren positiv-systematischen Formulierungen. Der Wirklichkeitsbegriff der griechischen Polis wird durch Platos Philosophie nicht repräsentiert, sondern reflektiert, im verschärften Kontrastbild der Kritik herauspräpariert. Aber es ist bezeichnend für die ganze Rolle der Philosophie, daß das erst in einem Augenblick geschieht, in dem dieser Wirklichkeitsbegriff bereits dabei ist, Schiffbruch zu erleiden und die von ihm getragene (oder auch ihn ermöglichende) Polis mit sich in den Prozeß der geschichtlichen Vernichtung zu reißen.
Wirklichkeit ist also einerseits das, was sich von selbst versteht, aber andererseits auch das, was nie als dieses Selbstverständliche verstanden ist bzw. mit geschichtlicher Unausbleiblichkeit zu spät verstanden wird, also erst in einem Augenblick, in dem sich die Selbstverständlichkeit als verhängnisvoll oder steril erwiesen hat. Ludwig Wittgenstein hat einmal den Philosophen mit einem Menschen verglichen, der sich in einem Zimmer befindet und einer Wand gegenübersteht, auf der eine 14Anzahl von Türen aufgemalt sind. Er versucht nacheinander, diese Türen zu öffnen, um durch sie aus dem Zimmer ins Freie zu gelangen; aber natürlich vergebens. Die Tür, die wirklich ins Freie führt und die sich mühelos öffnen ließe, liegt im Rücken dieses Menschen, aber er weiß nichts von ihr. Er brauchte sich nur umzudrehen, nur den Blick von den aufgemalten Scheintüren abzuwenden, und der Weg zum Wirklichen wäre für ihn geöffnet. Aber eben das ist das Schwerste. Wenn wir einen Augenblick bei diesem Bilde verweilen – weshalb wendet sich dieser Mensch nicht um zu der Wirklichkeit, die in seinem Rücken liegt? Wittgensteins Parabel scheint diese Frage nicht zu beantworten, vielleicht nicht zufällig, sondern deshalb, weil es ihm für zu selbstverständlich gilt, daß diese Möglichkeit nicht ergriffen wird.
Sehen wir uns nach einer antiken Entsprechung um, so bietet sich uns sofort das Höhlengleichnis im siebten Buch des platonischen »Staates« an,[2] jenes Wunderwerk eines philosophischen Modells, das den Geist der Tradition zu immer neuer Kommentierung und Vertiefung angeregt hat. Auf den ersten Blick ergibt sich ein ganz wesentlicher Unterschied zu Wittgensteins Parabel: Plato sagt von den Insassen seiner Höhle, daß sie im Nacken gefesselt waren und deshalb den Blick nicht von den Schatten auf der Höhlenwand auf die realen Vorgänge in ihrem Rücken umwenden konnten.
Was bedeutet dieser Unterschied? In ihm ist schon etwas über die Geschichte gesagt. Vielleicht läßt es sich so ausdrücken: Es gibt so etwas wie ein Moment der Trägheit im Wirklichkeitsbezug des Menschen, eine vordergründige Beharrung, die aller Tradition die Doppeldeutigkeit von Bewahren und Festklammern gibt. Vernunft ist der Widerpart dieser Trägheit, in einem Gegenspiel, das deshalb nie zur Ruhe kommt, weil der Wirklichkeitsbegriff, der die eigentliche Instanz der kritischen Funktion der Vernunft ist, Geschichte hat.
Die Wendung, die die Vernunft zur Wirklichkeit, zu den Sachen selbst vollzieht, ist immer wieder in der Metapher der Bekehrung, der epistrophē, der conversio formuliert worden. Dabei ist es gleichgültig, ob diese Erfahrung als religiöse, als philosophische oder als ästhetische beschrieben wurde. Die Grundstruktur der Umwendung aus der trägen 15Verlorenheit an das nächstliegende Vorgegebene, an die Unmittelbarkeit des ersten Blickes ist immer dieselbe. Die Philosophie beginnt weniger mit dem Erstaunen über das, was ist, als mit dem Verdacht, wir könnten es in dem uns unmittelbar Gegebenen und Vertrauten nur mit etwas Scheinhaftem zu tun haben. Philosophie in dieser Ursprünglichkeit ist ein elementarer Akt der Aufmerksamkeit, der sich aus der dumpfen Genügsamkeit des Selbstverständlichen aufrafft. Die griechische Philosophie hat zwischen Schein und Wirklichkeit keinen absoluten Dualismus angenommen. Das, was uns als Wirklichkeit erscheint, ist nicht ein radikal anderes gegenüber dem, was wirklich ist. Schon im Lehrgedicht des Parmenides ist der zweite Teil, der von der Scheinwelt der Doxa handelt, nur sinnvoll interpretierbar, wenn dieser Schein in einem Begründungszusammenhang mit der im ersten Teil dargestellten Wahrheit gesehen werden kann.
Beim frühen Plato ist die Welt der Erscheinungen immerhin fähig, die Erinnerung an die Welt der Ideen zu erwecken; sie verhalten sich wie Abbild und Urbild zueinander, und das heißt: noch der Schein kommt letztlich von der Sache selbst her. Anders im Höhlengleichnis: Die Schatten auf der Höhlenwand rühren zwar von den Artefakten her, die hinter einer Rampe zwischen Feuer und Wand vorbeigetragen werden; diese wiederum sind Darstellungen von Dingen der Naturwelt außerhalb der Höhle. Aber man sieht den Schatten nicht mehr an, daß sie Schatten sind. Dazu bedarf es der Entfesselung und der Umwendung. Deshalb trifft der Vorwurf der Irrealität, der Ablenkung vom Wahren, das Bildliche gerade in diesem Sinne des Abbildlichen.
Problematisch ist im griechischen Nachdenken an den Bildern also nicht das, was sie darstellen, sondern das formale Faktum, daß sie eben Bilder, daß sie nicht die Sache selbst sind, die sich in ihnen präsentiert. Ich brauche nicht besonders auf das zehnte Buch des »Staates« hinzuweisen, wo Plato die künstlerische Nachbildung deshalb verwirft, weil sie Gegenstände darstellt, die ihrerseits bereits Nachbildungen – nämlich von Ideen – seien. Bild eines Bildes zu sein, ist hier die äußerste metaphysische Diskriminierung. Aber die Umwendung zur Wirklichkeit ist nur im frühplatonischen Modell dadurch noch naheliegend und geradezu vorgezeichnet, daß uns Bilder nicht nur das vorenthalten, was sie darstellen, sondern zugleich auf das verweisen, an das erinnern, was 16in ihnen vorgestellt wird. Später ist hierzu eine Vermittlung notwendig, die besondere Rolle, die Plato dem Philosophen zugedacht hat. Die in der Höhle Eingeschlossenen und Gefesselten würden nie erfahren, daß sie nur Schattenbilder sehen, wenn nicht einer von ihnen die wahre Wirklichkeit erleben dürfte und zu ihnen zurückkehrte, um sie zu belehren.
Es ist Sache der Philosophie, uns nicht bei unseren Bildern zu lassen, uns die Selbstverständlichkeit der Bilder zu entfremden und dadurch ihren Verweisungssinn aufzudecken. Aber gerade diese Eigenheit des platonischen Höhlengleichnisses, daß nur einer der Gefesselten die primäre Erfahrung machen darf und kann, ist für den dahinterstehenden Wirklichkeitsbegriff überaus aufschlußreich. Schon die Höhlensituation selbst ist ja durchaus solipsistisch beschrieben: Plato schließt es ausdrücklich aus, daß einer der in der Höhle Gefesselten eine unmittelbare Wahrnehmung von seinen Schicksalsgenossen hat oder in einem Kontakt der Verständigung mit ihnen steht, denn er kennt von ihnen allen, ja sogar von seiner eigenen Gestalt, nur die Schatten an der Höhlenwand.[3] Die Menschen sind dadurch nivelliert auf die Erscheinungsweise der Gegenstände, die ihnen da vorgeführt werden, sie sind sich selbst als Schatten unter Schatten präsent. Der Mitmensch ist nicht ausgezeichnet als ein Partner, den man auf die Artung der da gegebenen vermeintlichen Wirklichkeit ansprechen könnte.[4] Der sokratische Dialog findet in der Höhle nicht statt und kann in ihr nicht stattfinden. Erst der Zurückgekehrte wird zum Lehrer. Dieses Moment des Gleichnisses ist für das Verständnis des zugrundeliegenden Wirklichkeitsbegriffs wesentlich: Der einzelne Gefangene, dem die Fesseln gelöst werden, erfährt, gewaltsam ins Helle geschleift, geblendet und sprachlos, was Wirklichkeit im Grunde ist. Und dies ist ein Erlebnis von der Art der optischen Erfahrung.[5] Wirklichkeit ist etwas unmittelbar und an sich selbst Einleuchtendes, eine unwiderstehlich Zustimmung ernötigende Gegebenheit.
Die Antike hat sich niemals Sorge darum gemacht, ob und wie man das Absolute, das Göttliche, wenn man ihm begegnete, als solches erken17nen könne. Seine Evidenz ist seine bloße offene Präsenz, sein Selbstanwesendsein.
Alle Offenbarungsvorstellungen und apokalyptischen Erwartungen, auch der biblischen Zeugnisse, beruhen auf dieser Implikation einer absoluten, in sich selbst gegebenen und durch sich selbst sich ausweisenden Wirklichkeit. Der antike Wirklichkeitsbegriff enthält selbst die Voraussetzung dafür, daß Götter oder ein Gott erscheinen können und im Erscheinen evident werden, daß Offenbarung stattfinden kann und ihre Legitimation mit sich führt. Das gilt für den Mythos genauso wie für die platonischen Ideen: Man sieht es dem Gegebenen an, daß es das ist, als was es sich gibt, das Seiende in seiner Selbstgegebenheit. Es steckt in diesem Wirklichkeitsbegriff eine Metapher: das Wirkliche stellt sich uns vor mit einer Art von impliziter Behauptung, das Vorgestellte auch wirklich zu sein, nicht von einer anderen Instanz her ins Unrecht gesetzt werden zu können. Diese Behauptungsimplikation im Wirklichkeitsbegriff der Tradition seit der Antike steht noch im Hintergrund des Begriffs des genius malignus bei Descartes, denn die uns gegebene Welt wird ja erst dadurch im strengen Sinne zum Betruge, daß in ihr ein Anspruch darauf wahrgenommen wird, das zu sein, als was sie uns erscheint. Gerade auf dieses Moment werden wir achten müssen.
Der Entfesselte im Höhlengleichnis wird aber nicht sofort nach seiner Befreiung von den Höhlenschatten in die Welt des vollen Tageslichtes gebracht, sondern zuerst durchschreitet er innerhalb der Höhle ein Zwischenreich, von dem man modernisierend sagen könnte, es enthalte die Projektionseinrichtungen der Höhlen-Lichtspiele. Diese Dinge sind zwar μᾶλλονὄντα [Mehr-Seiende], aber sie überzeugen noch nicht an sich selbst von ihrer größeren Wirklichkeit; noch glaubt der Entfesselte, die Schatten seien ἀληθέστεραἢτὰνῦνδεικνύμενα [wirklicher, als was ihm jetzt gezeigt wurde].[6] Hier sind die Machinatoren am Werk, die die künstlichen Gebilde in Bewegung versetzen und die ›Vertonung‹ der Schattenaktionen besorgen. Diesen Akteuren wird im Höhlengleichnis selbst keine weitere Beachtung geschenkt. Sie scheinen nur da zu sein, damit der Gleichnisprozeß überhaupt funktioniert. Aber es läßt sich nicht erkennen, daß sie irgendein Interesse dazu treibt, die 18Gefangenen mit Bildern zu füttern, sie in der Unkenntnis ihrer Situation zu halten und sie dadurch zu beherrschen.
Cornford[7] hat darauf hingewiesen, daß Plato im »Sophistes« eine unverkennbare Anspielung auf das Höhlengleichnis macht, und zwar auf eben jene Akteure in der Szene, die er nun offenbar als Sophisten verstanden wissen will – als jene Leute also, die von sich behaupten, im Besitz der Mittel zu sein, mit denen man Menschen im politischen Gemeinwesen beherrscht. Die Bedingtheit dieser Herrschaftstechnik der Sophisten durch die Schwäche des Wirklichkeitsbewußtseins der Menschen in der Polis wäre dann der kritische Sinn des Höhlengleichnisses und seines politischen Bezuges innerhalb der Schrift über den Staat.[8] Politische Verführbarkeit wäre dann ein Mangel des Bezuges zur eigentlichen Realität, und die Funktion der Philosophie die Aufweisung eines neuen Wirklichkeitsbegriffs. Plato charakterisiert die Sophisten, indem er sagt, sie seien Erzeuger von Bildern, mit deren Hilfe sie Irreales für Realität ausgäben, wobei sie sich selbst im Dunkel des Hintergrundes hielten, um sich ganz auf die Faszination ihrer rhetorischen Mittel zu verlassen. Das rhetorische Wort rückt von der Seite des Logos auf die Seite der Bilder, was schon im Sprachgebrauch dadurch zum Ausdruck kommt, daß das griechische Wort eidolon sowohl die verführerischen Produkte der Sophistik in diesem Dialog als auch die Schattenbilder im Höhlengleichnis bezeichnet.
Das Höhlengleichnis ist mehrschichtig konstruiert. Damit hängt zusammen, daß Plato vom Wirklichkeitscharakter des Gegebenen im Komparativ sprechen kann: Es gibt hier das μᾶλλονὄν, das ›Mehr-Seiende‹. Plato hat diesen ›ontologischen Komparativ‹, wie Bröcker ihn genannt hat, zuerst gebraucht und reiche Nachfolge gefunden. Plato hat dabei nicht spekulativer Willkür Raum gegeben. Sein Problem war hier, im »Sophistes«, die Technik der manipulierten Wirklichkeit der Sophisten ins Unrecht zu setzen und zu entkräften, die Härte der Begegnung mit der Wirklichkeit, das μεταβάλλειντὰςτότεγενομέναςδόξας, metaphysisch zu begründen.[9]
19Die Sophisten hatten sich zu ihrer philosophischen Abschirmung auf Parmenides und die eleatische Metaphysik berufen, um das Recht der Unterscheidung von Schein und Sein überhaupt zu leugnen und dadurch den rhetorisch-politischen Bereich von jedem Kriterium der Wahrheit und Sachgemäßheit frei zu stellen: Wenn es nur das eine und reine Sein des Parmenides gäbe und sonst nichts, dann müßten sich alle nur möglichen positiven Aussagen auf eben dieses Sein beziehen; also gäbe es die Differenz von Realität und Bild, von Erscheinung und Schein, von Faktum und Fiktum überhaupt nicht; also gäbe es keine Instanz, von der her sich der schrankenlose Gebrauch rhetorisch-politischer Mittel kritisch in Frage stellen ließ.
Sprache evoziert Wirklichkeit, und darin liegt das Potential von Macht als Verfügung über Wirklichkeit. Dieser Konzeption stellt Plato seinen ontologischen Komparativ entgegen, und das bedeutet: Es gibt kein Sich-Begnügen mit dem Weniger-Seienden, weil es auf das ihm Grund-Gebende, Urbildliche, auf die höhere Wirklichkeit verweist. Aber, so muß man doch wohl fragen, könnte dieser Zusammenhang der Verweisung nicht in einer unabgeschlossenen Reihe von Steigerungen ontologischer Komparative weitergehen? Könnte nicht jede überbietende Wirklichkeit ihrerseits überboten werden?
Aus diesem Einwand erhellt sich, daß die ganze Konzeption ihre Zweckbestimmung nur erfüllen kann im Zusammenhang mit einem Wirklichkeitsbegriff, der eine letztverbindliche, unübersteigbare Gegebenheit in der unmittelbaren Evidenz ihrer Unüberbietbarkeit zuläßt. Können wir über diese formale Feststellung hinaus noch weiter fragen? Was ist es, das an dieser letzten und eigentlichen Wirklichkeit aufleuchtet und einleuchtet, um sie als letzte erfahrbar zu machen? Und was ist damit gesagt, daß diese eigentliche Wirklichkeit als die der ›Ideen‹ beschrieben wird? Dieses Urwirkliche ist nicht deshalb ideal, urbildlich, weil es faktisch nachgebildet worden ist, weil es Bilder und Schatten von ihm gibt, sondern es ist deshalb Urbild, weil es das Sein-Sollen unmittelbar ausstrahlt,[10] weil es als die Gegebenheit sich präsentiert, die sein soll, indem sie ist und wie sie ist. Das ist der Sinn der platonischen Aussage, daß noch über der Welt der Ideen die Überwirklichkeit des 20Guten als die allem anderen seinen Grund gebende Lichtquelle steht. Das Gute gibt den Ideen nicht nur die Verbindlichkeit einer hypothetischen Regel, einer Vorlage für etwaige Verwirklichungen, sondern es gibt ihnen den Charakter des kategorischen Gebotes solcher Verwirklichung selbst. Deshalb kann im Demiurgen-Mythos des »Timaios« die bloße Anschauung der Ideenwelt den Demiurgen schon zu seinem Werk bestimmen, nicht nur dazu, wie er dieses Werk gestalten soll, sondern schon dazu, daß er es überhaupt in Angriff nimmt. Die Leibniz-Frage, die Frage aller Fragen, cur potius aliquid quam nihil, weshalb überhaupt etwas und nicht vielmehr nichts da sei, kann hier sinnvoll nicht gestellt werden. Das Sein wird aus dem Sein-Sollen gerechtfertigt, aber das Sein-Sollen seinerseits bedarf keiner Begründung. Nur eine Zusatzannahme muß im Mythos vom Demiurgen noch gemacht werden, nämlich eine das Verhältnis von Abbild und Urbild in seiner Getreulichkeit verbürgende Qualität. Für Plato genügt es bezeichnenderweise zu sagen, daß der Welt-Urheber diese Getreulichkeit durch seine ›handwerkliche Tüchtigkeit‹[11] gewährleistet; nach seiner Gesinnung, wir würden sagen: nach seiner Moral, braucht nicht gefragt zu werden, weil die Evidenz der Ideen, die Ausstrahlung ihrer Verbindlichkeit gleichsam schon selbst[12] sich vollstreckt.
Dennoch ist hier eine Konzeption des Wirklichkeitsproblems angelegt, die ich als das ›Schema der dritten Position‹ bezeichnen möchte. Die Wirklichkeit leuchtet als solche nicht mehr in unmittelbarer Evidenz ein, sondern ihre Gegebenheit bedarf eines Bürgen, eines absoluten Zeugen, dem Subjekt und Objekt gleichermaßen offen vorliegen und der die unüberbrückbare Distanz zwischen ihnen mit der Klammer seiner Gewährleistung überspannt. Man könnte den Wirklichkeitsbegriff des Mittelalters unter diesem Gesichtspunkt der Berufung auf den absoluten Zeugen darstellen. Ich kann und will das hier nicht tun, sondern nur darauf hinweisen, daß Descartes auch in diesem Punkte noch zum Mittelalter gehört, indem seine Überwindung des Zweifelsversuches auf eben diesem Schema der dritten Position beruht.
21Die cartesische Konzeption ist, ich sagte es, mittelalterlich und hat daher im ursprünglichen Ansatz auf die Neuzeit nicht überzeugend wirken können. Aber formal steckt dieses Schema doch auch noch im Wirklichkeitsbegriff der Neuzeit, wenn auch in einer entscheidend modifizierten Gestalt. Im Begriff der Objektivität steckt ein verborgener Rest dieses Schemas: der absolute Zeuge ist nicht mehr Gott, sondern die Einheit der erkennenden, forschenden, experimentierenden Subjekte, die Implikation des Appells an jedes andere erkennende Subjekt in jeder wissenschaftlichen Aussage. Die cartesische Methode hat ja darin ihre Bedeutung für die Struktur des neuzeitlichen Erkenntnisprozesses, daß sie diesen Appell möglich macht, indem sie die Einheit der erkenntnisvollziehenden Subjekte zu einer Instanz gegenseitiger Bezeugung und unablässiger kommunikativer Verifikation konstituiert.
Es ist nicht zufällig, daß wir den neuen Wirklichkeitsbegriff gerade dort zu erfassen vermögen, wo die Kritik an Descartes ihren scharfsinnigsten und radikalsten Ausdruck gefunden hat, nämlich bei Leibniz. In einer Niederschrift, die spätestens 1692 abgeschlossen gewesen sein muß, hat Leibniz Randbemerkungen zu den cartesischen »Prinzipien der Philosophie« niedergelegt. Der Hauptwiderspruch, den Leibniz herausarbeitet, scheint auf den ersten Blick nur ein solcher der Formulierung zu sein: Descartes hatte gefordert, an jedem Satze so lange zu zweifeln und ihn für falsch zu halten, bis der Beweis seiner Wahrheit mit Evidenz erbracht sei. Leibniz will dieses Prinzip anders formuliert wissen, und zwar so, daß es nicht wie ein generelles Vorurteil aussieht, das an Stelle jener Vorurteile getreten sei, denen doch Descartes den Kampf angesagt hatte. Das Prinzip soll jetzt fordern, daß man zu jedem theoretischen Satz seine Begründung beibringen müsse. Was bedeutet diese Differenz? Leibniz ist der cartesische Zweifel als Ausgangspunkt des Philosophierens suspekt. Für ihn bedeutet solcher Zweifel gerade nicht den voraussetzungslosen Anfang des Denkens, sondern den Ausdruck eines vorgreifenden Glaubens hinsichtlich dessen, was sich jenseits des Zweifels als stichhaltig und solide, als Wirklichkeit erweisen und bewähren muß. Der Anspruch, den Descartes mit seinem Wirklichkeitsbegriff an das stellt, was sich gegenüber dem radikalen Zweifel schließlich behaupten können soll, erscheint Leibniz als überspannt. 22Und Leibniz richtet seine Kritik gerade auf das Element am cartesischen Gedankengang, das ich vorhin als Ausdruck des Schemas der dritten Position bezeichnet habe, nämlich auf die Funktion Gottes sowohl im Zweifel als auch in der Konzeption seiner Überwindung. Das radikalste Motiv des cartesischen Zweifels war die Überlegung, die sich unter dem Titel des deus fallax, des dieu trompeur bei ihm findet. Descartes hatte sich dieses Argument nicht willkürlich vorgeworfen und nicht nur methodisch konstruiert: Der Gott, der keine Gewähr dafür bot, daß die Vorstellungen des Menschen von der Welt nicht bloße Bilder ohne Realitätsbezug sein könnten, war der Gott des ausgehenden Mittelalters und dabei wiederum eine Umbildung jenes Systems der dritten Position, mit dem ich den Wirklichkeitsbegriff des Mittelalters kurz anzudeuten versuchte.
Unter den Versuchen, die Descartes gemacht hat, um aus dem Abgrund dieser Zweifelssituation herauszukommen, bezieht sich Leibniz nur auf den letzten in den »Prinzipien« (I, 6). Descartes zieht hier eine Urteilstheorie heran, die von der stoischen sachlich und wohl auch historisch abhängig ist. Danach ist der Mensch auch in seinen theoretischen Akten frei und kann nicht in eine Täuschung hineingezwungen werden. Die Stoiker hatten in jedem Urteil einen gegenüber dem Sachgehalt der Aussage selbständigen Akt der Zustimmung angenommen, die das Subjekt auch verweigern bzw. auf die es auch verzichten könne (epoché). Die Möglichkeit des Zustimmungsverzichtes macht das Subjekt unerreichbar für den Eingriff auch einer trügerischen Allmacht: das freie Vernunftwesen kann zum Irrtum nicht gezwungen werden. Bei Descartes hängt dieser Schutzmechanismus gegen die Möglichkeit einer trügerischen Infektion mit seinem Dualismus von Vernunft und Freiheit systematisch zusammen.
Leibniz bestreitet eben diese logisch-psychologische Voraussetzung. Den freien Willen hätten wir nicht hinsichtlich der Gegebenheit der Gegenstände, sondern nur im Handeln – nicht als theoretische, sondern nur als praktische Vernunftwesen. Im theoretischen Bereich würden wir determiniert durch die Intensität unserer Bewußtseinsgegebenheit; nur die Schärfe und Anspannung der Aufmerksamkeit unterlägen der willentlichen Kontrolle, so daß es gegen den Irrtum nur die Anstrengung und die Konzentration, nicht aber neue Kriterien und Mit23tel zur Gewährleistung der Evidenz gäbe.[13] Diese Ablehnung der voluntaristischen Logik des Descartes bedeutet nun nicht nur, daß Leibniz die cartesische Behebung des Argumentes vom betrügerischen Geist für nicht stichhaltig hält, sondern weit radikaler, daß er jenes Argument, das er als eine exotica fictio bezeichnet, als überhaupt nicht widerlegbar und damit als einen unausschaltbaren Unsicherheitsfaktor ansieht. Aber die Geschichte läßt sich nicht umkehren oder zurückspulen, das Argument war einmal ausgesprochen, und zwar historisch motiviert und unumkehrbar ausgesprochen, und die Einsicht in seine Unwiderlegbarkeit war ein Faktum, mit dem man sich nur noch arrangieren konnte.
Leibniz setzt dazu an, indem er fragt: Was bedeutet es überhaupt, daß in dem cartesischen Zweifelselement von einem Betruge gesprochen wird? Er antwortet: Gott könnte aus schwerwiegenden Gründen (ob graves quasdam rationes), die wir nicht kennen und uns auch nicht vorstellen können, zulassen, daß unsere Vorstellungen von einer bewußtseinsunabhängigen Natur keine Fundierung in der Existenz ihrer Gegenstände hätte. Dann aber wäre dieser göttliche Ratschluß sine nota deceptoris, er machte Gott nicht zum Betrüger am Menschen. Aber was bliebe dann für uns übrig, wenn die in unseren Vorstellungen gemeinte Wirklichkeit nicht das wäre, als was wir sie uns nur vorstellen können? Leibniz macht geltend, daß es zur Beantwortung dieser Frage ganz gleichgültig sei, was unseren Vorstellungen jenseits ihrer selbst entspricht, was dieser Immanenz ihr notwendig vermeintes transzendentes Korrelat gibt. Unser Wirklichkeitsbewußtsein sei nämlich gar nicht auf diese transzendente Implikation gestützt und angewiesen. Hier treibt Leibniz so etwas wie Phänomenologie. Er beschreibt einfach dieses Wirklichkeitsbewußtsein und führt dessen transzendente Implikation auf dessen immanente Struktur zurück. Die Einstimmigkeit der Gegebenheiten untereinander, ihr gleichsam horizontaler Konnex, die Konstitution eines lückenlosen, sprungfreien, nicht in Enttäuschung zerbrechenden Prospektes gibt uns jene kategorische Gewißheit, mit einer Realität konfrontiert zu sein. Mehr als diese eindimensionale 24Konsistenz dürften weder die Skeptiker fordern noch die Dogmatiker versprechen. Und dies ist nun der Punkt, an dem Leibniz uns den Zusammenhang unserer Überlegungen selbst anbietet: Er macht eine ausdrückliche Anspielung auf das platonische Höhlengleichnis, und zwar in einer eigentümlichen, mit der Traumhöhle des Morpheus bei Ovid zusammengewachsenen Gestalt.[14]
Als Beispiel für die schwerwiegenden Gründe, die Gott gehabt haben könnte, dem Menschen nicht das zugänglich zu machen, was an sich ist, führt Leibniz die neuplatonische Weiterführung des Höhlengleichnisses an, in der eine Ätiologie für den Aufenthalt der Gefangenen in der Höhle versucht worden ist, die Plato dem Gleichnis nicht mitgegeben hat: Die Seelen könnten, so sagt Leibniz, durch eine eigene frühe Schuld verdient haben, in dieses Leben voller Täuschung verbannt zu werden, ubi umbras pro rebus captent, a quo Platonici non videntur abhorruisse, quibus haec vita velut in antro Morphei somnio similis visa est … Aber das Interesse Leibnizens ist nicht auf die Vorgeschichte dieses Zustandes gerichtet, sondern auf dessen immanente Struktur. Und da ist nun das Entscheidende, daß der zur Definition des Betruges notwendige Schaden für die Insassen der Traumhöhle keine Bedeutung hat, ja, daß ein eigentlicher Schaden erst dadurch entstehen würde, daß sie aus der Illusion herausgerissen würden: cum potius ingratum nobis futurum sit non falli. In der druckfertigen Vorlage des Textes, der freilich zu Lebzeiten Leibnizens niemals gedruckt werden sollte, hat Leibniz dieses non falli abgeschwächt in ein: nunc quidem res aliter videre, eine für Leibniz sehr charakteristische Korrektur.
Was bedeutet nun diese Anspielung? Nicht mehr und nicht weniger, wie ich meine, als eine deutliche Kritik an der paideutischen Konsequenz des Höhlengleichnisses, an der in ihm von Plato entwickelten Forderung der Blickwendung und des Höhlenaustritts, letztlich am Absolutismus des von Plato gegen die Sophistik zur Bewältigung der sophistischen Erfahrung gesetzten Wirklichkeitsbegriffs. Das in einer bruchlos-einstimmigen Sphäre von Bildern lebende Bewußtsein be25sitzt das, was ihm als Wirklichkeit genügen kann, es widerstrebt der Durchbrechung des Prospektes, vor dem es existiert, es widersetzt sich der Enttäuschung, und es würde durch einen denkbaren äußeren – und sei es auch göttlichen – Eingriff in diese seine Welt erst jene irreparable Schädigung erfahren, die nach Leibniz zum Betruge gehört.
Weshalb wäre aber dies, was bei Plato noch Befreiung zur endgültigen Wahrheit war, ein irreparabler Schaden? Weil es für Leibniz zwar vielleicht in diesem hypothetischen einen ontologischen Komparativ geben könnte, aber nicht den platonischen ontologischen Superlativ, die unmittelbar ansichtige Evidenz der Wirklichkeit in letzter Instanz. Noch 1714 hat Leibniz im Entwurf eines Briefes an Rémond, den er freilich wegen der Schärfe der dort gewählten Formulierungen nie aus der Hand gegeben hat, diesen Wirklichkeitsbegriff in Verbindung mit Plato gebracht. Die Erscheinungen der Körperwelt sind Wirklichkeit – in seiner Sprache: sind wohlbegründet –, insofern sie einen einstimmigen Zusammenhang bieten: cette apparence a de la vérité en tant que ces phénomenes sont fondés, c'est-à-dire consentans. Diese Einstimmigkeit, dieses Miteinander-bestehen-Können, macht die Erscheinungswelt äquivalent einer Sphäre des exakten und in keinem Erwachen abgebrochenen Träumens: comme des songes exactes et perseverans.[15] Von diesem Sachverhalt habe Plato schon etwas gesehen, stellt Leibniz ausdrücklich fest.
Die materielle Wirklichkeit ist ein Schatten, schreibt Leibniz 1716 an Masson, und sie sei, obgleich nur Phänomen, doch keine Täuschung, schreibt er in demselben Jahr an Dangicourt. Die Spuren der Sprache des platonischen Gleichnisses sind bei Leibniz unübersehbar. Aber die Berufung auf Plato treibt die Differenz der Wirklichkeitsbegriffe nur um so schärfer heraus. Wenn Leibniz von der materia imaginum spricht, so sind nicht mehr Bilder gemeint, die als Abbilder auf Urbilder verweisen und damit aus der Sphäre des Bildes auf das in ihm Repräsentierte zurückwerfen. Leibnizens Rede vom Bild meint etwas Originäres, Autonomes, eine Sphäre, hinter die man nicht zurückgehen kann, 26ohne sich im ganz und gar Heterogenen zu verlieren; seine Bilderwelt ist eine Welt von Symbolen, nicht von Darstellungen, und wenn man für diese Symbole etwas anderes einsetzte, so erhielte man wiederum nur eine Sphäre, die allein durch ihre widerspruchslose Einstimmigkeit Wirklichkeitscharakter haben könnte. Compatibilitas ist die einzige ratio existendi, nicht nur in dem zumeist beachteten vordergründigen Sinne, daß die Widerspruchslosigkeit des Weltsystems das Kriterium der Wahl des göttlichen Schöpfers aus der Unendlichkeit des Möglichen war, sondern auch und logisch primär in dem Sinne, daß die Verträglichkeit der Erscheinungen untereinander der einzige zureichende Grund für den Menschen ist, ihnen Wirklichkeit zuzusprechen, sich von ihnen verbindlich und unüberschreitbar affizieren zu lassen. Nirgendwo hat hier das Bedürfnis eines Betrogenen, eines in Illusionen Eingewiegten Platz, nach Aufklärung, höherer Wahrheit, Befreiung vom Vorläufigen zu verlangen. Für die nackte Zugänglichkeit einer ›Wirklichkeit an sich‹ gibt es nicht nur keinen zureichenden Grund, sondern nicht einmal die Möglichkeit, sich diesen höheren Grad der Gegebenheit formal zu definieren. Für Leibniz ist verständlich geworden, daß der Gefangene der platonischen Höhle nicht ohne Gewaltsamkeit in die höhere Welt des reinen Lichtes geführt werden kann – und diese Gewaltsamkeit wird ins Unrecht gesetzt.[16]
Die Dinge nicht so zu sehen, nicht so sehen zu können, wie sie von einem absoluten Standpunkt aus sich darbieten könnten, hat für Leibniz keinen Schrecken bei sich. Und nicht nur für Leibniz, sondern auch für sein Zeitalter, eine Epoche, die in ihrer ersten großen Selbstgestaltung, im Barock, die Welt als Traum, die Welt als Theater sehen konnte. Diese Metaphern des Zeitalters sind nicht mit negativen Implikationen geladen, sie haben nichts mehr an sich von der nominalistischen Krudität des Gedankens, daß die Schrecken und Täuschungen der Welt die Freuden eines unbegreiflichen göttlichen Zuschauers sein könnten. Von hier aus wird deutlich, weshalb das Höhlenhafte und Verschlossene der fensterlosen Monade für das Zeitalter kein negatives Vorzeichen tragen konnte. Für Leibniz steht hinter der Vorstellung von der immanenten 27Spontaneität und imaginativen Produktivität der Monade das Modell des Menschen, der in seinem Zimmer, ja mit geschlossenen Augen, die Zeichenwelten der Arithmetik und Geometrie aus sich zu erzeugen vermag (se fabriquer … dans son cabinet).[17] Daß Leibniz für die Entwicklung der deutschen Ästhetik des achtzehnten Jahrhunderts eine so große Bedeutung bekommen konnte, obwohl er selbst unter dem unübersehbaren Vielen, das seiner Aufmerksamkeit gewürdigt wurde, der Kunst keinen erkennbaren Platz einräumte, läßt sich nur im Zusammenhang dieses Wirklichkeitsbegriffs verstehen. Die Einsicht, daß wir das Bild nicht überschreiten können, daß das Zurückschieben des einen Prospektes nur unendliche Tiefen neuer Prospekte eröffnen würde, die man durchschreiten würde, ohne daß je eine Szenerie sich als letzte und hintergrundlose ausweisen könnte, die Einsicht, daß Bilder ihre Evidenz haben können, ohne je letzte Substanzialität zu geben, hat der Kunst ihre nie zuvor gekannte metaphysische Dignität zugeführt.
Leibniz konnte sagen, und er hat es wiederholt und in verschiedenen Zusammenhängen gesagt, daß Erkenntnis sich auch im Traume gewinnen lasse. Zu diesem Punkt ist dann wieder Husserl gelangt, und zwar von ganz anderen Voraussetzungen ausgehend, als er die freie Variation, den Gebrauch der Imagination, zur Erkenntnisquelle phänomenologischer Evidenz erhob. Zwei kurze begriffsgeschichtliche Hinweise gehören in diesen Zusammenhang. Leibniz definiert realitas durch logische Konsistenz (compatibilitas): Das plurimum realitatis ist identisch mit dem plurimum possibilitatis. Realitas bedeutet nicht Existenz, Sein als gegenständlich zusprechbares Prädikat, sondern existere posse. Leibniz hat immer wieder eine Theorie der Wahrscheinlichkeit, eine logica probabilium, gefordert, und wir verstehen jetzt, in welchem systematischen Kontext das steht. In der antiken Metaphysik, wie wir sie an Plato vorgeführt haben, hat jedes Seiende seine eigene, in seiner Wesensgestalt beschlossene und begründete Legitimität. Bei Leibniz läßt sich dieser Aspekt nur für das ganze Universum, für den totalen Ereignisverband einer Welt gewinnen. Realität ist Ausdruck der formalen 28Bestimmtheit eines Systems, nicht eine Quasi-Qualität, die jedem Seienden für sich zugesprochen werden könnte. Dazu gehört eine zweite begriffsgeschichtliche Notiz. Leibniz hat eine neue und eigentümliche Definition für den Begriff der Evidenz gegeben, und zwar sagt er: ea per se evidentia esse, quibus sublatis omnibus sublata est veritas.[18] Das bedeutet, daß nicht Wahrheiten als solche in Evidenz gegeben sein können, sondern daß Evidenz die Bedingung der Möglichkeit von Wahrheiten ist. Die Wahrheit konstituiert sich nicht aus Evidenzen, Evidenz ist nicht so etwas wie ein Merkmal des Wahren, sondern ist ein systematisch funktionaler Inbegriff von Bedingungen, unter denen Wirklichkeit bestehen, anerkannt werden und in Wahrheiten erfaßt werden kann. Die optische Metaphorik, in der sich der antike Wirklichkeitsbegriff niederschlug, ist aus der sprachlichen Erfassung des Umganges mit Wirklichkeit verbannt.
Aber ist, so könnte man fragen, das Leibnizsche consentement[19] nicht im Grunde dasselbe, was Newton gemeint hat mit seinem berühmten Satz: natura est semper sobi consona, die Natur ist immer mit sich selbst in Übereinstimmung? Dieser Einwand verhilft uns vielleicht noch zu einer letzten Verschärfung unseres Verständnisses des Wirklichkeitsbegriffs von Leibniz. Denn hier besteht eine ganz entscheidende Differenz. Newtons Satz ist ein metaphysischer Satz, der besagt, daß die Natur dieses Merkmal der immanenten Einstimmigkeit mit sich selbst hat. Und worauf es für Newton ankommt, ist die erkenntnistheoretische Konsequenz, die aus dieser Aussage gezogen werden kann, daß nämlich die Gesetzlichkeit der Natur als der eigentliche Gegenstand von Naturforschung verbürgt sei im Sein der Natur selbst und dadurch dem Menschen die niemals voll zu legitimierende Verallgemeinerung seiner Naturerfahrung gestattet. Für Leibniz bedeutet dieselbe Aussage die phänomenologische Beschreibung derjenigen Voraussetzung, unter der wir Natur überhaupt erst als uns gegeben erkennen können, die Bedingung dafür, daß ein Bewußtsein von verläßlicher Wirklichkeit über29haupt entstehen kann. Wir werden uns nun fragen müssen, ob die Wendung, die Leibniz dem Wirklichkeitsbegriff gegeben hat und die sich in seiner Kritik an dem platonischen Höhlenmodell uns dargestellt hat, genügt, um für den Wirklichkeitsbegriff der ganzen Epoche einzustehen.
Leibniz scheint an einem Punkt des Höhlengleichnisses keinen Anstoß genommen zu haben, auf den ich schon hingewiesen habe, nämlich an der Einsamkeit der dort als möglich angenommenen letzten Wirklichkeitserfahrung. Der aus der Höhle befreite Gefangene ist im Anblick der Lichtwelt des Wirklichen genauso einsam, so monadisch, wie er in der Höhle angesichts der Schatten war. Das ist dort kein Mangel, denn diese Wirklichkeit bedarf nur des einen Auges, der einen