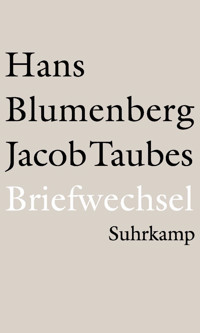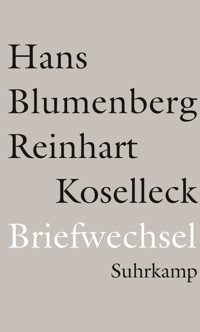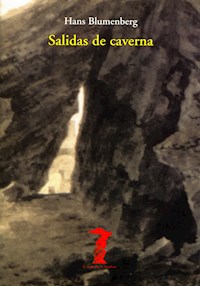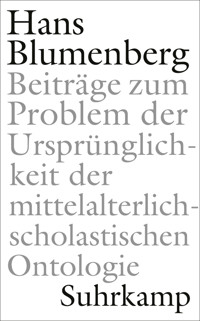36,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
»Der Unterzeichnete hat, obwohl ihm die Gesetzgebung der letzten zwölf Jahre jede publizistische Äußerung wie den Abschluß seines philosophischen Universitätsstudiums unmöglich machte, nicht den Ehrgeiz, um jeden Preis sich gedruckt zu sehen.« Dies schrieb der 25-jährige Hans Blumenberg im November 1945 an den Insel Verlag und fügte einen Aufsatz zu Dostojewskis Novelle »Die Sanfte« bei, deren Veröffentlichung er anregte. Zu der Publikation kam es seinerzeit nicht und auch der Aufsatz blieb ungedruckt. Nun eröffnet er eine Sammlung mit Blumenbergs frühen Texten zur Literatur.
In Rezensionen, Reden und Vorträgen erkundet er die zumeist zeitgenössische deutschsprachige und internationale Literatur, schreibt aber auch über die damals neue Mode der Taschenbücher, Ratgeber und Comics. Seine subtilen Lektüren verfolgen oft Randgänge zwischen Literatur und Philosophie und thematisieren existentielle Fragen. Es sind Texte von zeitloser Brillanz, die zugleich die Nachkriegszeit wie in einem Vergrößerungsglas ansichtig werden lassen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 563
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
»Der Unterzeichnete hat, obwohl ihm die Gesetzgebung der letzten zwölf Jahre jede publizistische Äußerung wie den Abschluß seines philosophischen Universitätsstudiums unmöglich machte, nicht den Ehrgeiz, um jeden Preis sich gedruckt zu sehen.« Dies schrieb der 25jährige Hans Blumenberg im November 1945 an den Insel Verlag und fügte einen Aufsatz zu Dostojewskis Novelle »Die Sanfte« bei, deren Veröffentlichung er anregte. Zu der Publikation kam es seinerzeit nicht, und auch der Aufsatz blieb ungedruckt. Nun eröffnet er eine Sammlung mit Blumenbergs frühen Texten zur Literatur.
In Rezensionen, Reden und Vorträgen erkundet er die zumeist zeitgenössische deutschsprachige und internationale Literatur, schreibt aber auch über die damals neue Mode der Taschenbücher, Ratgeber und Comics. Seine subtilen Lektüren verfolgen oft Randgänge zwischen Literatur und Philosophie und thematisieren existentielle Fragen. Es sind Texte von zeitloser Brillanz, die zugleich die Nachkriegszeit wie in einem Vergrößerungsglas sichtbar werden lassen.
Hans Blumenberg (1920-1996) war Professor für Philosophie an der Universität Münster. Sein Werk erscheint im Suhrkamp Verlag. Zuletzt erschienen: Präfiguration. Arbeit am politischen Mythos (2014), Rigorismus der Wahrheit. »Moses der Ägypter« und weitere Texte zu Freud und Arendt (2015) sowie Schriften zur Technik
Hans Blumenberg
Schriften zur Literatur
1945-1958
Herausgegebenvon Alexander Schmitz und Bernd Stiegler
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet
über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2017
Der vorliegende Text folgt der Erstausgabe, 2017.
© Suhrkamp Verlag Berlin 2017
© Bettina Blumenberg, Alexander Schmitz, Bernd Stiegler
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das der Übersetzung, des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.
Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.
Umschlaggestaltung: Hermann Michels und Regina Göllner
eISBN 978-3-518-75102-2
Inhalt
1945
Über Dostojewskis Novelle »Die Sanfte«
1949
Jean-Paul Sartre, »Die Fliegen«
Ernst Jünger als geistige Gestalt
1950
Paul Claudel, »Der seidene Schuh«
Das Problem des Nihilismus in der deutschen Literatur der Gegenwart [Vortragsankündigung]
Das Problem des Nihilismus in der deutschen Literatur der Gegenwart [Vortrag]
1951
Die Krise des Faustischen im Werk Franz Kafkas
Graham Greene oder die Zweideutigkeit der Gnade
Graham Greene, »Der Ausgangspunkt«. Roman
Sartre oder Der Absolutismus der Freiheit
1952
Der absolute Vater [Zeitungsartikel]
1953
Der absolute Vater [Aufsatz]
Utopien – hinterher gelesen
Der Antipode des Faust. Zum 70. Geburtstag von Franz Kafka am 3. Juli 1953
Ballade der kleinen Gerechtigkeit. Zum 60. Geburtstag von Hans Fallada am 21. Juli
Rebell gegen die Endlichkeit. Über Gestalt und Werk Thomas Wolfes
Vollsynthetische Bilderwelt. Von Macht und Ohnmacht der »Comic-Strips«
Eschatologische Ironie. Über die Romane Evelyn Waughs
1954
Faust – heute
Der selbstgemachte Mensch. Oder: Die Literatur des großen »Wie«
Der Mann, der das Gegenteil war. Zum 80. Geburtstag von G. K. Chesterton am 29. Mai
Parodie auf den Zerfall? Das neue Buch: Becketts »Molloy«
Glanz und Elend des Zuschauers. Das Problem der Freiheit im Theater
Raub, der Zeit wieder entrissen. Zum 2. Band der deutschen Ausgabe des Werkes von Marcel Proust
Vier Negerromane: Die Schwelle zwischen Schwarz und Weiß
C. S. Lewis, Die böse Macht. Ein Roman
1955
Des Kontrastes wegen. Über Romane von Alain Robbe-Grillet und Henry Green
Vier Zehntel Gramm Meskalin. Eine Droge macht den Alltagsmenschen zum Bruder des Genies – Über einen Versuch des Dichters Aldous Huxley
Wollt ihr »Was ihr wollt«?
Überholt oder modern? Zum 50. Todestag von Jules Verne am 24. März
Ernst Jünger – ein Fazit. Zu seinem 60. Geburtstag am 29. März 1955
Faulkners amerikanische Mythologie
Ins Nichts verstrickt. Wird man in zehn Jahren noch von Sartre sprechen?
Ein Ruck an der Leine. Über den Roman »Wiedersehen mit Brideshead« von Evelyn Waugh
Ironie der Weltverbesserung. Zu Henry James' »Prinzessin Casamassima«
Zauberberg und geteilte Welt. Zum 80. Geburtstag von Thomas Mann am 6. Juni
Die endgültig verlorene Zeit. Zum dritten Band der deutschen Proust-Ausgabe
Das Buch als Markenartikel. Wohltat und Plage der Taschenbuch-Reihen – Das »Vollbuch« stirbt nicht aus
1956
Die Peripetie des Mannes. Über das Werk Ernest Hemingways
Rose und Feuer. Lyrik, Kritik und Drama T. S. Eliots
1958
Mythos und Ethos Amerikas im Werk William Faulkners
Anhang
1938
Hans Carossa
Nachweise
Editorische Notiz
Namenregister
Über Dostojewskis Novelle »Die Sanfte«
Dostojewskis Novelle »Die Sanfte« hat die Gestalt eines Gewissensgespräches, in dem ein Mann, dessen Name so unwesentlich ist, daß wir ihn nicht erfahren, am Totenlager seiner Frau, die sich wenige Stunden zuvor durch einen Sturz aus dem Fenster entleibt hatte, sich innere Rechenschaft zu geben sucht über die Quellgründe des furchtbaren Ereignisses. Die Form dieses Selbstgerichtes ist in hohem Maße dialektisch, steht in der zum Widerspruch gesteigerten Spannung von Bezichtigung und Rechtfertigung. Er, der als adliger Offizier eines Ehrenhandels wegen den Dienst hatte quittieren müssen und fortan als Pfandleiher eine Existenz außerhalb der Gesellschaft lebte und erstrebte, hat das elternlose junge Mädchen aus einer sozial verzweifelten Lage heraus zu seiner Frau gemacht, gerade in dem Augenblick, als es von zwei geldgierigen Pflegetanten an einen widerlichen Krämer verhandelt werden sollte. Der Pfandleiher hatte sich in die Rolle des sozialen Befreiers und Wohltäters hineingespielt und darin die Aufwertung seines verletzten Selbstgefühls gesucht. Die Antwort seiner Frau ist ein unerwarteter Widerstand in der Ehe, vom schweigenden Stolz und lächelnder Ironie bis zur offenen Revolte. Seine entehrte Vergangenheit wird für sie zum Angelpunkt, das von ihm gesuchte und gestaltete Gefälle des Verhältnisses zu verkehren. Der Pfandleiher erfährt, daß seine Frau sich mit einem Offizier namens Jefimowitsch zu treffen beabsichtigt, der in seiner eigenen Lebensgeschichte eine zerstörerische Rolle gespielt hatte; er macht sich zum Lauscher der Zusammenkunft und muß erleben, daß der Stolz und die Reinheit seiner Frau über jeden Zugriff und jeden Verdacht erhaben sind. Doch auch für ihn kommt eine Gelegenheit, das Mal der Niedrigkeit und Feigheit vor seiner Frau zu löschen; als er am Morgen nach jener belauschten Zusammenkunft erwacht, sieht er seine Frau mit seinem Revolver in der Hand vor seinem Lager stehen, gibt sich aber schlafend, besteht die Bedrohung der eisernen Mündung an seiner Schläfe und wird so, als die Tat ausbleibt, über die Frau, die den Entschluß, mit dem sie gespielt hat, nicht auszulösen vermag, Sieger. Er spielt den Sieg aus, indem er sie aus seinem Verhalten entnehmen läßt, daß er Zeu10ge ihrer Absicht und ihres Versagens war und daß er der Stärkere blieb. In der Befriedigung dieses »Sieges« scheint er seiner Vergangenheit endgültig Herr zu werden. Aber die Antwort seiner Frau ist wiederum nicht Unterwerfung, nicht Anerkennung, ist vielmehr Schweigen, Verachtung – ja ist – er erfährt es plötzlich, als sie einmal wie trotz seiner Gegenwart in völligem Alleinsein zu singen beginnt – Vergessen seiner Zugehörigkeit zu ihrem Leben. Diese Einsicht nun vernichtet ihn, wirft ihn nieder zu ihren Füßen, läßt ihn sie um ihre Beachtung bestürmen, zwingt ihn zur Aufgabe jedes Anspruches an sie. Das aber ist das Ende. Als er am nächsten Tage von einem Ausgang heimkommt, steht vor dem Hause ein Menschenauflauf um den entseelten Leib seiner Frau. »Nur eine Handvoll Blut« ist aus ihrem Munde geflossen.
Die »Handvoll Blut« aus dem Munde der Entleibten ist das symbolische Fazit eines tödlichen Ringens, das der Dichter zwischen Mann und Weib sich vollziehen läßt; und worin er in gültiger Gestaltung dem menschheitlichen Problem der dialektischen Geschlechtlichkeit überhaupt gegenübertritt.
Denn im Zusammentreffen der Geschlechter waltet eine urhafte, letzte Grausamkeit. Dabei scheinen Wesensbereiche beteiligt zu sein, die sich der Kontrolle des gemäßigt-gesitteten Bewußtseins entziehen. Es werden Mittel in diese Dialektik einbezogen, die, aus ihrer eigentlichen Indifferenz herausgenommen, erst in dieser Sphäre ihre verletzende, ja vernichtende Bedeutung bekommen können. Es sei nur daran erinnert, welche grausame Stoßkraft in Dostojewskis Erzählung der Gesang des Weibes annimmt; annimmt aus einer untergründigen Treffsicherheit des dem Manne entgegentretenden Weibtums. Es ist hier, als seien Mann und Weib nur die zufälligen Instrumente, die das Ringen einer weit universaleren Polarität höheren Bewußtseinsgrades blind vollziehen.
Die Novelle bringt die Frage nicht zum Ausdruck, aber sie wirft sie auf in der Forderung ihres Verständnisses: wo nämlich der Urgrund dieser feindlichen Polarität der Geschlechter zu suchen sein könne. Jede Antwort muß metaphysischer Versuch bleiben. Aber ist es nicht so, daß im Anspruch des Geschlechtstriebes eine menschliche Totalität bezielt ist, eine Erfüllung gesichtet wird, die das geschlechtlich Zweiheitliche aufheben würde in einer letzten menschlichen Wesensganzheit? Und weist nicht diese unaufhebbar auf Einheit zielende Gespanntheit auf eine ur11gesetzte Eigentlichkeit hin als schöpferischen Grund der menschlichen Gestalt? Hat sich wohl dieser ideeliche Ganzheitsanspruch an jener unergründlichen, dem Stoffe eigenen chthonischen Widersetzlichkeit allem Gestaltenden gegenüber gebrochen und gespalten? So daß der Mensch nun in der geschlechtlichen Daseinsform immer gleichsam nur Fragment sein kann, ohne in der wirklichen Lebenssituation je den Anspruch der individuell-einmalig zugehörigen Ergänzung verwirklichen zu dürfen? Denn die urbestimmte Einheit wäre in der Natur aufgesprengt in zwei Individuen, die sich im Vollzuge nie begegnen. Und weiter: Ist nicht der Trieb in seiner überwältigenden Kraft ein Kunstgriff der Natur, um das wesenhaft niemals Zugehörige doch zum Gehorsam gegen die arterhaltende Notwendigkeit zu zwingen? Eine Überrumpelung des personalen Bewußtseins, das stets nur auf die ideale Absolutheit der Erfüllung – die de facto unerreichbare – ausgespannt sein muß? Der Trieb schmiedet aneinander in seiner Glut, was sich im Umriß nicht fügen kann; er bindet mit Blindnis, was Klarheit trennt. Ist aber dem Ziel und Willen der Natur Genüge getan, dann versagt diese Kraft der Bindung; die aufeinander Verwiesenen stehen, Leib an Leib, in der ganzen Widersprüchlichkeit der geschlechtlichen Existenz.
Die sexuelle Dialektik ist wesentlich zweistufig, sie hat eine voreheliche (nicht außereheliche, denn dieser Zustand ist überhaupt nicht dialektisch!) und eine eheliche Form. In Dostojewskis Erzählung ist das voreheliche Stadium gestaltet von der sozialen Situation her. Und es ist tief erfaßt, wie diese Gestalt des Verhältnisses in der Ehe selbst schlagartig jede Bedeutung verliert. Wesensanlage und soziale Ordnung in unserer Gesellschaftsform sind einer Oberhändigkeit des Weibes denkbar ungünstig, so ist die von Dostojewski gegebene Situation, daß der Mann das Weib buchstäblich aus einer sozialen Verlorenheit zu sich empornimmt, durchaus symbolwertig und wesentlich. Mit aller erzählerischen Präzision ersteht die voreheliche Bestimmtheit des Verhältnisses: Das sozial hilflose Weib ist ausgeliefert, es ist Sklavin seiner Pflegetanten, es muß sich von ihrer Geldgier an einen Krämer verhandeln lassen; der Mann spielt sich auf diese Lage ein: als Pfandleiher (welches Symbol übrigens für seine innerste Wahrheit!) gibt er der Hilfesuchenden, wie er will; sie muß nehmen, was und wie er ihr gibt; er ist höflich und 12streng, er lächelt über sie, ist gereizt, verletzend, er prüft sie. Der »strenge Ton« ist das Cachet seiner Rolle – »der strenge Ton riß mich förmlich hin«. Der Tenor des Verhältnisses ist für ihn: »Sie kam zu mir, sie kam wieder, sie muß wieder kommen!« Es geht ihm um die kleinen Triumphe seiner Rolle – »Als sie schon fort war, fragte ich mich plötzlich: war denn dieser Triumph über sie zwei Rubel wert?« Sie kommt zu ihm unter dem Zwang ihrer Lage; er transponiert das fälschlich ins Menschliche. Er sieht seine selbstgewählte Rolle, in der er »als ein Wesen aus einer höheren Welt« erscheinen kann, als vom Wesentlichen herkommende Gestalt der Geschlechterbegegnung; die soziale Gültigkeit des Befreiers, des Wohltäters, des Überrangigen wird ihm zur unumstößlich menschlichen Gültigkeit.
So schließt er die Ehe, ohne zu ahnen, daß die Dialektik hier erst ihren eigentlichen Spielraum gewinnt. Der Schritt erscheint ihm nur als formale Wandlung einer festgestellten wesenhaften Ordnung. Er übersieht alle Zeichen des schon zuvor sich bäumenden Weibwesens; das »Blitzen« ihrer Augen, ihren Stolz, ihre einmalige »Revolte« nimmt er hin mit der selbstsicheren Wendung: »Sie ist also stolz! Gut! Ich bevorzuge sogar die Stolzen. Die Stolzen sind sogar besonders schön, wenn … nun, wenn man an seiner Macht über sie nicht mehr zweifeln kann.«
Das Wort »Macht« ist gefallen. Der Geschlechterkampf ist ein Machtkampf. »Machtgefühl ist mehr als Wollust«, formuliert Strindberg im »Buch der Liebe«. Bei Dostojewski ist es genauer ein volles Ineinander von Macht und Lust: Machtgefühl ist Wollust. Hier spricht der Mann von seiner Macht »über sie« als von der »nackten Wahrheit« in seiner Hand; diese Macht ist das eigentlich Sexuelle, die Wahrheit – seine Wahrheit – ist »nackt« in einem höchst wollüstigen Sinne. Als »Befreier« der »Sklavin«, als »Wesen aus einer höheren Welt« ist er auf dem Gipfel der ihm möglichen Lust. Macht als Lust ist der Zielgegenstand der männlichen Geschlechtsrolle. »Dieses Gefühl der Ungleichheit nahm mich ganz gefangen; es war ein so süßes, wollüstiges Gefühl.« Und – »die Hauptsache ist, daß ich […] an meiner Macht über sie nicht mehr zweifelte. Wissen Sie, es ist ein ganz wunderbares, wollüstiges Gefühl, wenn man nicht mehr zweifelt!«
Die Ehe ist in diesem Machtkampf der Akt, in dem der Mann selbst das Weib überhaupt erst in seine dialektische Möglichkeit einsetzt. Vorehe13lich fehlt dem Weibe der Ansatz der Selbstbehauptung. Das gesellschaftlich oder religiös sanktionierte Institut der Ehe ist der Raum der freien geschlechtlichen Aussprache, schafft ein echtes Gegenüber. Also ein Gegenüber nicht in der sozialen Verkleidung, sondern in der wesensmäßigen Nacktheit, im Nur-Mann-Sein und Nur-Weib-Sein. Die voreheliche Existenz des Weibes ist objekthaft; der ehelichende Akt des Mannes ist die unantastbare Freigabe ihres Subjektseins.
Noch ihr Jawort ist ihm »selbstverständlich« aus der vorehelichen Situation heraus; seine Sicherheit macht ihn salopp: »Na, wie meinen Sie?« Doch es verwundert ihn schon, daß sie sich überhaupt in einem eigentlichen Sinne entschließt. Als sie zögert – »Warten Sie, ich überlege es mir noch« – erscheint ihm das geradezu unwahrscheinlich – »Schwankt sie denn wirklich?« Schon in dieser Werbungsszene ist die ganze Dynamik des weiteren Verlaufes gespannt – »Selbstverständlich gab sie mir noch unten vor dem Tore ihr Jawort; doch … doch ich muß hinzufügen: dort unten vor dem Tore dachte sie erst lange nach, ehe sie mir das Jawort gab. Sie dachte so lange, so unendlich lange nach […].« In dem Ja des Weibes liegt bereits der Ausdruck seiner echten Freiheit; dieses Jawort ist, obwohl aus der Situation des sozialen Zwanges äußerlich bedingt, doch in einem echten Sinne auch subjektiver Entschluß.
Das Lächeln, mit dem sie als Ehefrau in sein Haus tritt, ist die Kündigung der sozialen Situation. Er bemerkt nicht den Widerspruch in seiner Überlegung: »[…] mit diesem Lächeln trat sie in mein Haus. Aber es ist ja wahr, wohin hätte sie denn sonst gehen können?« Das Wesentliche, daß der Eintritt in sein Haus für sie der Schritt in die personale Freiheit ist, entgeht ihm. Instinktiv folgt er der Tendenz jeder Machtausübung, den mechanisch-gewalttätigen Zustand in den einsichtig-gesinnungswilliger Unterordnung zu überführen; die ihm sozial zugefallene Hochstellung dem Weib gegenüber sucht er künstlich in eine menschlich-wesenhafte zu wandeln. »Strenge«, »austreiben«, »anerziehen«, »einimpfen« – lautet seine gynagogische Terminologie. Sein Kunstgriff ist – »als ein Rätsel erscheinen zu können!« Weiter: er ist bestrebt, den Schwerpunkt des Verhältnisses beim Materiellen zu halten, wo es seinen einseitigen Ausgang nahm, beim Geld. Den gesamten Tribut an Bestätigung und Anerkennung, den die Gesellschaft dem Entehrten und Ausgestoßenen versagt, versucht er, beim Weibe zu erheben. Der 14Besitz des Weibes bedeutet ihm die Geltung der Fiktion seines ethischen Selbstbildnisses.
Aber – »die Sanfte revoltiert«. Das vorehelich sozial-zwangsmäßig gesänftigte, in seiner Subjektivität unentfaltete Weib hat die Ebene der geschlechtlichen Dialektik betreten. Die Geltung des Mannes beginnt, sich von der Sphäre seiner sozialen Hochstellung in die seiner menschlich-wertmäßigen Niedrigkeit zu verschieben. Sie kann nun an seine Vergangenheit rühren, nach seiner Ehre fragen, ihn erproben, ja beleidigen. Sie nimmt dasselbe Schema an, in dem sie als sozial Verlorene ihm unterworfen war; und in dem ihr jetzt der Mann ausgeliefert ist, der seine Ehre verlor. Er ist dem Zugriff ihrer Fragen hilflos preisgegeben.
Seine Erniedrigung kulminiert, als er die Zusammenkunft seiner Frau mit Jefimowitsch belauscht. Er erfährt nun, wie das Weib in der Freiheit und Sicherheit, die ihr die eheliche Stellung gewährt, sich dem Zugriff des Mannes gegenüber verhält. Die Werbung des Verführers ist eine Doppelung seiner eigenen Werbung, aber nicht mehr unter dem sozialen Vorzeichen. In Jefimowitsch sieht er selbst sich von der Freiheit des Weibes abgewiesen. Der ganze unbezwingliche Stolz, den sie zeigt, erhellt ihm seine eigene Stellung zu ihr. Daß jenes früher so vielfach bemerkte, aber in seiner Bedeutung übersehene »Blitzen« ihrer Augen und ihr ganzes Auftreten vor dem Pfandleiher nur die erste, gezwungen verhaltene Phase ihrer Auflehnung war, die Drohung des dialektischen Gegenspiels in sich enthaltend, spürt er erst jetzt, als er sie Jefimowitsch entgegentreten sieht. Er erlebt sein eigenes Gericht. Nur so kann ihm die Szene, die er belauscht, aus einer intuitiven Klarheit heraus als »das Wohlbekannte«, gleichsam »Wiedergefundene« erscheinen.
In einzigartiger dichterischer Steigerung folgt die Revolverszene. Es ist eine furchtbare Kraftprobe, ein keuchendes Gegeneinander der entzweiten Wesenheiten. Da »fühlte ich mit der ganzen Kraft meiner Seele, daß zwischen uns in diesem Augenblick ein Kampf entbrannt war, ein schrecklicher Zweikampf auf Leben und Tod […]«. Indem es ihm gelingt, dem Weib seine Festigkeit, ja Gleichgültigkeit gegen die Bedrohung zu zeigen, gewinnt er einen »Sieg«. Zunächst über seine eigene Vergangenheit mit dem Mal der Feigheit; in der Revolverszene schlägt er dem Weib die Waffe seines unterwertigen Vorlebens endgültig aus der Hand. Es ist aber auch ein »Sieg« über das Weib als die Triumphierende der Jefimo15witsch-Begegnung; ihre Schwäche ist in dem Versagen zu dem mörderischen Entschluß vor ihm entblößt. Bei diesem Versagen ist entscheidend nicht das Zurückscheuen vor der verbrecherischen Tat als solcher, sondern das klare Indizium der inneren Zwiespältigkeit und Haltlosigkeit ihrer ganzen Auflehnung gegen die männliche Geltung.
Aber schon darin, daß er diesen »Sieg« absolut setzt, daß er die Dialektik verkennt, die jede Phase der sexuellen Konstellation in die nächste hinüberreißt – »ich hatte gesiegt und sie war für immer besiegt« –, schon darin verspielt er das Ertrotzte. Er lebt nun in dieser vermeinten Endgültigkeit und hat aus ihr volles Genügen – »Indem ich dem gegen mich gerichteten Revolver standhielt, rächte ich meine ganze finstere Vergangenheit; und wenn es auch kein anderer Mensch erfuhr, so erfuhr es doch sie; das bedeutete für mich alles […].«
Daß aber die Bestätigung des Mannes so ganz »bei ihr« liegt, daß er »vor ihr« bestehend überhaupt seinen Geltungsanspruch erfüllt sieht, daß sein Sieg »über sie« so absolute Bedeutung für ihn gewinnen kann – das setzt das Weib in eine Stellung ein, von der aus jeder Machtgriff zur Aufhebung seiner Geltung gelingen muß. Wenn sie notwendiger »Katalysator« seiner Selbstwertung, Gewähr seiner Geltungssicherheit ist, so verbirgt sich darin eine Bedeutungsmächtigkeit des Weibes, die zu gegebener Stunde als vernichtende Dynamik des Geschlechterringens aufbrechen kann. Die Relativität des männlichen Selbstbewußtseins auf die Stellungnahme des Weibes hin ist dessen archimedischer Punkt im Fortgang der Dialektik.
Nach der Revolverszene steht der Mann in der Verblendung seines »Sieges«. Der Tenor seiner anfänglichen Haltung – gleichsam sein Pfandleihermotiv – klingt wieder voll durch: »›Nein, warte nur, […] sie wird einmal plötzlich selbst zu dir kommen.‹« Und wieder ist es »der Gedanke an unsere Ungleichheit, der mich so reizte«. Aber diese Sicherheit ist bedroht, ist trügerisch, ihr Bestand ist von Gnaden des Weibes; ist eine blitzende Waffe in ihrer Hand in dem Augenblick, in dem er bemerken muß, daß sie nicht mehr bestätigend zu ihm aufblickt, daß sein Wertbewußtsein in der Leere steht, weil sie ihn gleichsam aus dem Blick verloren hat. Der vorherige dialektische Ausschlag zum Manne hin wird zurückgerissen im Erlöschen der wertenden Beachtung durch das Weib. Das schmerzhafte Aufzucken dieser Erfahrung, das Zusammenbrechen 16der männlichen Geltungsfiktion, die bestürzende Blendung durch die volle Wahrheit seiner Lage, der Niederschlag der daraus folgenden Hoffnungslosigkeit ist von Dostojewski in einer dichterisch einmaligen Konzeption gestaltet: im Singen des Weibes. Im Gesang, der das Schweigen aufbricht, das trügerisch wie Beständigkeit zwischen ihnen stand, das in Wahrheit aber die absolute Form der Entzweiung war, zu der jedes streitende Wort noch wie Vermittlung gewesen wäre. Im Gesang, der das Vergessenhaben, das völlige Alleinsein, das in sich selbst Zurückgekehrtsein des Weibes ausspricht. »Sie singt, und dazu noch in meiner Gegenwart! Hat sie mich etwa vergessen?« Er ist aus ihrem Bewußtsein gleichsam gelöscht, und darin liegt die Vernichtung seines Wertgefühls, das eben nur relativ auf das dabeiseiende Bewußtsein des Weibes hin Bestand hatte. »Wenn sie in meiner Gegenwart zu singen begonnen hatte, so hatte sie mich vergessen – das war es, was ich plötzlich so klar vor Augen sah und was mich so erschreckte.« Und es bestätigt sich sogleich in anderer Weise, was in der langen Zeit des Schweigens in ihr zerrissen war: »Sie streifte mich mit einem gleichgültigen Blick; es war eigentlich kein Blick, sondern eine rein mechanische Geste, so wie wenn irgendein Gleichgültiger ins Zimmer tritt.«
Sogleich vollzieht sich der volle dialektische Umschlag. Der hoffnungslos Vernichtete liegt zu den Füßen des Weibes, bettelt um die Zuwendung ihres verlorenen Blickes. Und es ist eine erzählerische Feinheit, daß jetzt am Weibe der Index der absoluten Oberhändigkeit – gleichsam ein musikalisches Leitmotiv – wiederkehrt, den der Pfandleiher für die Verzweifelte trug: der Ausdruck der »Strenge«. Es ist der volle Triumph des Weibes, nicht errungen aus der zufälligen Situation, sondern in einem wesenhaften Aufeinandertreffen – denn die Niederlage des Mannes ist die Niederlage seiner Wertrealität. Die Dialektik hat ein Stadium erreicht, in dem ihre äußerlichen Momente, ihre sozialen Bedingtheiten und situationellen Verkleidungen abgestreift sind und ein reines, unverstelltes Gegenüber der Geschlechter in Wert und Wertung, Anspruch und Erkennung statthat.
Die Totalität des Sieges liegt in dem »Erstaunen« ausgedrückt, mit dem das Weib den aus dem Bewußtsein Verlorenen gewaltsam wieder in ihr Blickfeld eindringen sieht, als Bittenden und Unterworfenen freilich – »Und ich hatte schon gedacht, Sie würden mich ganz in Ruhe lassen«. 17Die Bedingungslosigkeit seiner Unterwerfung liegt in der vollen Blöße, in der er ihr seine innerste Wirklichkeit, seine Wertwahrheit enthüllt. »Ich sagte ihr solche Dinge, die ich auch vor mir mein Leben lang verheimlicht hatte.«
Es ist bezeichnend für das Weib, daß es zwar die Inferiorität nicht erträgt, daß es aus jeder Abgeltung und Unfreiheit ausbricht, aber verhält in der errungenen Freiheit, ohne dem Lustrausch der Macht verschrieben zu sein wie der Mann. Die weibliche Haltung im Dialog ist im Grunde nichts anderes als die Entgegnung auf den von innen heraus nichtigen Geltungs- und Machtanspruch des Mannes. So sind die Situationen der weiblichen Triumphe nicht künstlich, nicht »inszeniert«; weiß sie doch nichts von einem Lauscher der Jefimowitsch-Unterredung, den ihre Haltung richtet; ist sie sich doch der vernichtenden Wirkung ihres Liedleins nicht entfernt bewußt, das einem Moment der ungetrübten Innerlichkeit, der für-sich-seienden Stille entspringt. In der Haltung des Mannes dagegen ist überall berechnende Bewußtheit, inszenatorischer Kalkül seines Machtwillens: am deutlichsten, als er in der Revolverszene geradezu gewaltsam die Augen verschließt, sich schlafend stellt aus einer instinktiv richtigen Einschätzung der Situation heraus.
Die Dialektik des Geschehens ist von einer Ausgangslage entsprungen, die ihr von vornherein das Gepräge des Extremen, der Gewaltsamkeit und Grausamkeit verlieh. Die sozial bedingte Überhöhung des Mannes überspannt die inneren Haltekräfte der Geschlechterbegegnung; der dialektische Ausschlag muß in seiner Steigerung zuletzt zum Zerreißen führen. Der absolute Triumph des Weibes ist entgegen seiner wahren Bestimmung, ist Verfehlung seines tiefsten Wesens. Die erreichte Position ist eine tödliche. Das spricht sich aus in jenem abgründigen Erschrecken in der Blendung des ihr unerklärlichen Umschlages des Verhältnisses. Sie flieht in den Tod, weil sie keinen Ausweg mehr sieht, ihr Wesen, ihre Wahrheit zu retten; die Absolutheit ihres Sieges, das Stillstehen der Dialektik ist das Ende.
Der Tod aber reißt die Dialektik des Geschlechterverhältnisses noch einmal auf. Er ist Niederlage des weiblichen Vermögens, Macht zu tragen, ist Scheitern an der Endgültigkeit des Stärkerseins. Zugleich aber gibt der Tod dieser Macht ihre neue währende Gestalt. Die Frage nach der Achtung des Weibes, seine eigene Wertfrage, wird für den Mann nun 18zu einer unlösbaren und unaufhebbaren. Damit kehrt ein weiteres Leitmotiv seiner eigenen Wahl auf ihn zurück: er wollte dem Weib einmal »Rätsel« sein und Frage und darin seine Geltung begründen; nun bleibt er mit dem Rätsel des Weibes und der Frage allein. Der Dialog steht still; die Möglichkeit der Antwort ist aufgehoben; das Weib ist in seine säkulare Gestalt zurückgenommen, seine Macht bleibt in der Frage des Mannes. »Eins möchte ich gerne wissen: ob sie mich geachtet hat? Ich weiß nicht, hat sie mich geachtet oder nicht?«
Die dialektische Form der Begegnung der Geschlechter in Dostojewskis Erzählung bedarf noch einiger ergänzender Kennzeichnungen. Die formale Gestaltkraft des Dialoges ist die Ironie, jener feine Spott, mit dem ein nichtiger Wertanspruch scheinbar hingenommen wird. Ironie hat einen tödlichen Zug, eine Tendenz auf Vernichtung des ironisierten Gegenstandes; aber dieser Vernichtungswille ist gekleidet in ein spielendes Geltenlassen. Mann und Weib sind in verschiedener Weise Träger der Ironie. Die Ironie des Weibes ist echt, weil der Geltungsanspruch des Mannes nichtig und hohl ist; die Vernichtung der männlichen Position gelingt im Griff der Ironie. Sein Wertanspruch, der auf der Prämisse seiner sozialen Vorgeltung steht, zerbricht. Wo der Mann ironisch ist, da ist dieser Index angenommen und fiktiv. Sein Geltenlassen ist krampfhaft, sein Spott ist gefälscht und grob; seine Ironie ist Mittel zur Verstellung der eigenen Nichtigkeit. So muß ihm der ironische Zugriff mißlingen an der echten Wertgestalt des Weibes.
Die dialektische Haltung des Mannes ist aktiv, die des Weibes verhaltend, absichtslos. Vom Manne kommen die Antriebe und Anstöße; auch die Triumphe noch des Weibes sind nur Reaktionen. Ja, bei ihrem durchbohrendsten und vernichtendsten Tun noch ist ihr eine Art Unwillkürlichkeit eigen; ihr Handeln geschieht an ihr und mit ihr, wie von einem höheren Bewußtsein her, das ihr die blinde Sicherheit ihrer Geschlechtsrolle verleiht. So spricht sie den zerstörerischen Satz vom In-Ruhe-Lassen – »so unwillkürlich, daß sie vielleicht selbst gar nicht merkte, wie sie es sagte«.
Die Dialektik ist aufsteigend. Nicht nur, daß sie ihre Dynamik und Weite potenziert. Sie wird auch immer wesentlicher. Die Auseinandersetzung entzündet sich am Materiellen, streift aber immer mehr alles Akzidentelle ab und wird zum Gegenüber der letzten Abgründe der 19Personen, ja, am Ende bleibt das Weib in seiner, aller Faktizität und Kontingenz enthobenen Gestalt.
Der Standort des Erzählers ist dabei am Ausgang des Dialogs, bei dem sich Richtenden vor dem erstarrten Leben des Weibes. Das Geschehen ist projiziert auf diesen Punkt, ist zusammengerückt in die Ebene der Erinnerung. In der Aussage wird das Dialektische darum Widerspruch, Paradoxie. Rechtfertigung und Bezichtigung stehen sich gegenüber. Darin liegt das Moment, das Dostojewski seine Erzählung eine »phantastische« nennen läßt.
Hier mag die Frage ihren Ort haben, wie weit dem Dichter die Gültigkeit seiner Gestalten und ihres Ringens reichen mochte; ob der Charakter der Novelle wirklich im »Phantastischen« voll umschrieben ist, d. h. in einer extremen Abseitigkeit vom existentiell Zentralen. Die Antwort würde eine Untersuchung über die Gestalt des Dichtertums und seine Stellung zum Realen bei Dostojewski, über das abgründig Phantastische gerade als innerste Wahrheit des Menschlichen in seinen Werken erfordern. Hier gilt es, die wenig beachtete Erzählung ganz für sich und aus sich zu vernehmen. Und da mag ein wenig Licht auf unser Problem fallen, wenn wir die geringe realistische Ausstattung der »Szene« herausstellen, ihre Beziehungslosigkeit zu Zeit- und Ortsbestimmung, die mangelnde individuell-physiognomische Verdeutlichung der Gestalten und die sich aufdrängende Bemerkung, daß Mann und Weib keinen Namen tragen, sich nirgends mit Namen ansprechen. Mit diesen Andeutungen mag auf die Nähe symbolischer Gültigkeit nur hingewiesen sein.
Es bleibt die letzte Frage zu stellen, ob wir mit der Sicht des dialektischen Vollzuges schon den innersten Gehalt der Geschlechterbegegnung berührt haben. Ist das Feindliche, Grausame schon die letzte und tiefste Wahrheit des Zueinander der Geschlechter? Daß über die entzweiende Richtung des bewußten Willens hinaus vielleicht Gültigeres Mann und Weib verbindet, das deutet sich erst darin an, daß der sich Erforschende am Ende den Wert des Weibes über alle Beziehung auf seine eigene Geltung zu hinauswachsen sieht – »Ach, hätte sie mich doch verachtet, meinetwegen das ganze Leben lang verachtet, nur leben, leben sollte sie!« Von »Liebe« spricht er erst an diesem bitteren Ende; aber berühren wir hier nicht die tragende Grundfläche, die unter aller Dialektik, unter 20dem Machtkampf der Geschlechter das schlechthin Gültige ihres Zueinander ist? Den metaphysischen Standort, den im faktischen Vollzuge immer verdeckten, worin die gesollte, ideegestaltene Bestimmung der Geschlechter ihren währenden Beziehungsgrund hat? Der sich Richtende der Erzählung sucht schon für den Anfang seiner Begegnung mit dem Weib, sucht selbst für das Pfandleiherverhältnis diesen tragenden Grund. »Habe ich sie denn nicht schon damals geliebt?« Für jede Phase des Dialoges bleibt die Wirklichkeit der Liebe Frage, unlösbar und unaufhebbar.
Der Mann bleibt allein mit der Frage. Lastendes, unlösbares Vinculum! Aus jenem Bunde mit dem Weibe ist der Bund mit der Frage geworden. Und dieser Bund ist, ein Gleichnis jenes anderen, wahrhaft unauflöslich.21
Jean-Paul Sartre, »Die Fliegen«
I.
1. Die Unfruchtbarkeit, dem vielen schon Gesagten über den Existentialismus noch etwas hinzuzufügen.
2. Die unbefriedigende Vieldeutigkeit aller Aussagen erschließt eine wesentliche Einsicht:
3. Die Frage »Was ist Existentialismus?« enthält eine unangemessene Forderung, eine Vorausnahme der erwarteten Antwort in Richtung auf Definition, Lehre, System.
4. Der Existentialismus ist aber kein Ismus. Dazu wird er nur ständig von außen gedrängt.
Auch die subtilste Formel kann ihn nicht »enthalten«.
Alles Sagen weist hier über sich hinaus; es »verweist« auf ein »Wissen«, das nur im offenen Selbstsein des Menschen gegenwärtig wird, und allem Lehren, das doch nur »von außen« und in gegenständlicher Rede kommen kann, entzogen bleibt.
5. Das existentialist. Drama ist daher nicht aus der Zufälligkeit einer Begabungseinheit zu verstehen.
Auch die anderen Bücher der Existentialisten sind dramatisch (Sartres Hauptwerk »L'être et le néant«).
6. Die existentialist. Aussage drängt wesenhaft ins Dramatische. Es ist der gerade Gegensatz zum Drängen alles Philosophischen ins System. (Kierkegaard – Hegel).
Das Drama versucht, die Gegenständlichkeit der philosophischen Sprache zu überwinden und dem »Selbstsein« nahezukommen.
Die Distanz kann aber nur im Hörer und Zuschauer selbst ganz überwunden werden. Hierin liegt, bei aller abgrundtiefen historischen Ferne, die Gemeinschaft mit dem klassischen Theater und mit dem relig. Ursprung der griech. Tragödie.
7. Über die geistesgeschichtlichen Grundlagen des Existentialismus ließe sich ebenso viel sagen wie über die literarische Herkunft und Umformung des Atridenstoffes von Aischylos bis Sartre. Hier soll das Drama ganz für sich sprechen und gehört werden.22
8. Der Rahmen der Handlung ist der der Atridensage: Der aus dem trojanischen Feldzug heimkehrende Agamemnon wird von seinem Weib, Klytämnestra, und dem Ehebrecher Ägisth ermordet. Der Sohn, Orest, sühnt den Mord, indem er die Mörder tötet. Die Rachegöttinnen, die Erinnyen, verfolgen den so zum Muttermörder Gewordenen.
9. Sartre läßt seinen Orest 15 Jahre nach dem Mord an Agamemnon unerkannt in seine Vaterstadt Argos zurückkehren.
Der Zustand der Stadt. Das Schicksal Elektras.
10. Der Orest, der die Szene betritt, ist keineswegs philosophisch ungebildet; im Gegenteil: der ihn begleitende Pädagoge hat ihm die Fülle antiker Bildung mitgeteilt:
einen lächelnden Skeptizismus, der sich an der Unwirklichkeit des Wirklichen beruhigt hat und in einem ironischen Abstand von Schicksal und Entscheidung immer schon »weiß«, worum es darin gehen kann. Ein »überlegener Mensch« in der »Freiheit des Geistes«.
11. Diese Freiheit der Philosophie ist ein Freisein-von. Ihr ist alle Entschiedenheit zur Meinung geworden. Ein Nirgend-sein, das nichts etwas angehen kann. Unverbindlichkeit der Bildung. Alles Wahre ist allgemein.
12. Das ist die Ausgangssituation. Die der abendländischen Philosophie selbst.
13. Den Reisenden begegnet, ebenfalls unerkannt, Jupiter. Es ist der Jahrestag des Mordes, an dem die Beschwörung der Toten begangen wird.
II.
1. Orest scheint die Versuchung, die seiner Freiheit der Bildung, der Unverbindlichkeit begegnet, zu überwinden. Da begegnet ihm Elektra, der er sich nicht zu erkennen gibt.
2. Elektra kennt seine Freiheit nicht. Sie steht ganz in ihrem furchtbaren Schicksal und unter der Aufgabe der Rache. Von dieser Aufgabe erfüllt, empört sie sich gegen die Reue der Stadt und erscheint auf dem Totenfest, gegen den Befehl Ägists in weißem Gewand und tanzt vor dem Volk, um es aus seiner Bedrückung herauszureißen. Aber Jupiter läßt 23sie zerbrechen. Orest will sie vor den Drohungen des Königs durch Flucht retten.
3. An Elektra erfährt Orest, was es heißt, nicht »über«, sondern »in« einem Schicksal zu stehen. Daß man nur zu seinen Erinnerungen und zu seinem Schicksal wahrhaft »mein« sagen kann.
4. Diese Überwindung des antiken Denkens vom Menschen als »Lebewesen, das den Logos hat«, als Mikrokosmos im Makrokosmos, dem der Kosmos die Ordnung seines Seins vorgibt, ist durch das christliche Selbstverständnis des Menschen zuerst vollzogen worden.
5. Hier gehört der Mensch nicht mehr unbedingt zu der Welt. Er ist durch sie hindurch oder auch gegen sie. Er ist nur er selbst mit der Aufgabe seines Heils und der Verantwortung seines Gewissens ausgeliefert.
Er kann sich den Entscheidungen nicht entziehen. In ihnen wird er, was er ist – sein ewiges Schicksal, gegen das die Frage »Was ist der Mensch?« gleichgültig ist.
6. Diese Wendung vom »überlegenen« Wissen zum je-meinigen-Dasein erfährt Orest an Elektra und durch sie.
III.
1. Die Wandlung der Freiheit-von in eine Freiheit-zu.
2. Die Eroberung der zuvor gleichgültigen Gegenwart.
3. Hierin wird der Mensch erst, was er sein kann. Insofern »ist« er nichts, bevor er entschieden seine Gegenwart übernommen hat.
Der existentialistische Grundsatz: Die Existenz geht der Essenz voraus.
4. Diese Wendung ist eine Bekehrung ohne Gnade. Orest gebraucht die Terminologie der Bekehrung. Letztlich muß Sartre die Bekehrung in einen Vorgang des Intellekts auflösen. »Die Freiheit hat mich getroffen wie der Blitz.«
5. Die Freiheit, die die kosmische Ordnung durchbricht, die »durch« und »gegen« die Weltgesetze sich verwirklicht, sieht Jupiter als Gefahr. Er erweist sich dadurch als Gott des Kosmos, als der erste Beweger des Aristoteles, der sich in den Regeln des Weltlaufes ganz und gar ausspricht. 24
6. Jupiter sucht die Gefahr zu bannen, indem er Ägist kurz bevor Orest zur Tat schreitet, aufsucht, um ihn zur Vernichtung Orests und Elektras zu bestimmen.
IV.
1. Zitternd wartet Elektra auf den Todesschrei der Mutter. Als die Tat geschehen ist, zeigt es sich sogleich, daß sie dieser Tat nicht gewachsen sein wird, wie sie jahrelang den Traum davon genährt hat.
2. Schon bei ihrem aufbegehrenden Tanz am Totenfest hatte sie die Toten um Bestätigung ihres Tuns durch Schweigen gebeten und war an der Verweigerung dieser Bestätigung zusammengebrochen. Elektra kann ohne den Einklang mit einem höheren Willen nicht leben. Sie wird in die Arme Jupiters und der Reue zurücksinken.
3. Aber wenn wir fragen, wo das »Menschliche« in diesem Drama ist, so finden wir es in der Gestalt Elektras.
Orest verrät sich durch das intellektuelle Pathos. Elektra ist die Gestalt ohne Pathos. Orest behält die intellektuelle »Schwebe«, in der er sich als Skeptiker befand, auch als Träger der Tat. Der Durchbruch in diese Freiheit bleibt im Pathos stecken.
»Die Worte, die ich brauche, sind zu groß für meinen Mund …«
4. Die künstlerisch tödliche Antinomie des Stückes ist auch philosophisch bedeutsam:
Der Mensch ist frei – wenn Freiheit eine Leistung des Denkens sein kann.
5. Ob Sie meine Ansicht überzeugt oder nicht – es kommt darauf an, in diesem Werk zu sehen, wo und wie der Mensch noch existieren kann.
Orest und Elektra nehmen im Tempel des Apollo ihre Zuflucht vor den Fliegen.
Am Morgen hat sich das Volk von Argos vor dem Tempel zusammengerottet.
Um die Schlafenden haben die Erinnyen einen dichten Ring gebildet.
Sie erwachen, gezeichnet von der furchtbaren Tat.25
V.
1. Jupiter, der Kosmokrator, hat versucht, Orest mit einer gewaltigen Vision des Weltalls auf seine Zugehörigkeit zur gesetzten Ordnung zurückzuwerfen.
»Du bist hier nicht bei Dir zuhause, Eindringling; Du bist in der Welt wie ein Stachel im Fleisch …«
2. Elektra verfällt der Forderung Jupiters; sie eilt ihm nach, sie nimmt die Bedingung der Reue an, um sich vor sich selbst zu retten, Ruhe und Vergessen zu finden.
3. Orest widersteht Jupiter.
Was ist es für ein Gott, dem er widersteht? Der fremde Gott der Weltordnung, in der die Freiheit des Menschen eine Fehlkalkulation ist.
4. Bedingung der Freiheit:
»Vom Göttlichen absehen, um frei zu handeln«. Das Problem Vorsehung (Gottesgesetz) und Freiheit abgeworfen.
5. Letzte Steigerung des Pathos zum Erlöserpathos.26
Ernst Jünger als geistige Gestalt
I.
1. Das verblüffende Phänomen der Gegenwart: die Leere als Ergebnis der Fülle; der Nihilismus inmitten der differenziertesten Kulturentfaltung. Vor einem Schaufenster zu hören: »Es gibt doch nichts, was es nicht gibt!«
2. So im Geistigen: kein Mangel an Ideen, auch nicht an guten; kein Mangel an ernsten, aufrichtigen Wegweisungen und Ansätzen.
3. Deren Wirkungslosigkeit: der Mangel an Evidenz. Evidenz nicht als Schlüssigkeit, als Aufgehen der Theorien, sondern als überzeugende Gegenwärtigkeit des von neuem Sinn erfüllten Lebensvollzuges.
4. Fehlt es also nicht an Richtweisungen und Entwürfen, so doch an der Legitimation hierzu. Legitimation kann aber gerade nicht jene Unbescholtenheit sein, die sich dadurch bewahrt hat, daß sie sich nicht mit dem Zeitgeist einließ.
5. Gerade darin wird eine Glaubwürdigkeit vermißt, daß Erfahrungen und Einsichten Einzelner auf das Zeitalter gewendet werden können. Solche Glaubwürdigkeit setzt eine Verlorenheit an die Not des Nihilismus voraus, wie sie die Gegenwart selbst charakterisiert, zugleich aber das Bestehen und die Bewältigung dieser Not. Diese Legitimation könnte freilich niemand erbringen, der zugleich auf seine Integrität gegenüber dem Zeitgeist vernommen werden soll. Dies [ist] der Widerspruch in der ganzen Diskussion um Ernst Jünger.
II.
1. Wie alle geistigen Wandlungen und Neuorientierungen der Gegenwart, so steht auch der Weg Jüngers von vornherein in der Krise der Glaubwürdigkeit, die durch den Betrieb einer sog. Umerziehung 27sowie durch die allgemeine geistige Ratlosigkeit ausgelöst worden ist.
2. Die Spanne zwischen dem Abenteurer des élan vital, dem glühenden Krieger, dem Protagonisten der totalen Organisation und dem »neuen Theologen« muß als wirklich durchschrittene aufgewiesen werden. Nur darin kann ein solcher Weg über die individuelle Existenz hinaus in Anspruch nehmen.
3. Die Stilform, die der verwirtschafteten Glaubwürdigkeit fast aller literarischen Formen der Forderung solcher Rechenschaft am ehesten entspricht, ist das Tagebuch. Der lebende Autor unterzieht sich einer äußersten Preisgabe, um an die Echtheit und Legitimität des Ursprunges seiner Aussagen heranzuführen. Um nicht Produkte, sondern Wege zu zeigen.
4. Jüngers »Strahlungen« sind ein Zeugnis solcher Notwendigkeit. Die Entfernung zwischen den Orten des Kriegers und des »neuen Theologen« bleibt nicht leere Weite, sondern es zeichnet sich wie in einem Koordinatensystem Punkt um Punkt, Erfahrung um Erfahrung, Schritt um Schritt ein, bis sich die Figur dieser geistigen Gestalt aus dem Unbestimmten heraushebt, in der dies alles zu überzeugender Einheit kommt.
5. Das Tagebuch verlangt mehr als bloßes Lesen. Es ist gar nicht lesbar. Es bleibt alles im Atomaren und Amorphen, wenn nicht der Leser wenigstens die Affinität, die aus der umfassenden geistigen Not der Gegenwart entsteht, mitbringt.
6. Die Interpretation muß einige der Kondensationskerne dieser geistigen Gestalt aufzeigen. Sie kann nur die Funktion eines Katalysators versehen, nicht aber Verständnis »mitteilen«.
III.
1. In den letzten Tages des zweiten Weltkrieges notiert sich Jünger über die Arbeit im Garten und am Schreibtisch:
ob diese Tätigkeit nicht der jener Insekten gleicht, die man zuweilen am Wege antrifft – man sieht den Kopf noch fressen und die Fühler regen, während der Leib schon abgetreten ist. – Das ist indessen nur die eine Seite des Vorganges; 28die andere ist gleichnishaft, sakramental. Man sät ohne Erwartung, daß man auch ernten darf. Ein solches Treiben ist entweder: ganz und gar sinnlos oder: transzendental.[1] (S. 621)[2]
Diese Einsicht stellt die Klammer dar, die Leben und Werk Jüngers in der Einheit der Gestalt begreifen läßt: der Nihilismus ist nicht die einzige und absolute Konsequenz unserer geistigen Situation, sondern nur das eine Glied einer Alternative, die sich aus ihr ergibt. Wenn Leben und Sinn nicht zur Kongruenz zu bringen sind, gibt es zwei Möglichkeiten: entweder ist das Leben überhaupt sinnlos (Nihilismus) oder sein Sinn liegt über die Realität hinaus (Transzendenz, »neue Theologie«).
2. J. behauptet freilich nicht, man müsse die nihilist. Alternative zunächst ad absurdum durchprobiert haben, um die transzendentale annehmen zu können.
3. Aber zweifellos ist das ein eigener Weg. Er ist alles andere als ein Rezept. Aber er ist im höchsten Grade paradigmatisch insofern, als die nihilistische Alternative doch auch im Zeitgeist zum Zuge gekommen ist. Was zu bewähren ist: Ob Jüngers eigenste Erfahrung sich am Zeitgeist zu bestätigen vermag.
4. J. läßt in den »Marmorklippen« den Bruder Otho über die »Mauretanierzeiten« – wie er dort seine Kriegerphase nennt – sagen, »daß ein Irrtum erst dann zum Fehler würde, wenn man in ihm beharrt« (S. 32).[3] Das kennzeichnet Jüngers Denkstil: er ist nicht auf Ismen und Weltanschauungen aus – und in diesem Sinne auch nicht dem Nihil»ismus« verfallen –, sondern nimmt das Recht in Anspruch, das Leben als Experiment zu sehen. Das ist an ihm noch ganz und gar neuzeitlicher Wissenschaftsgeist: die Universalität des Experimentes, der Erforschung, zugleich dessen Unverbindlichkeit, die unbedingte Freiheit und Verfügbarkeit seines Ansatzes.
5. Insofern gehört für ihn auch der Krieg unter die großen Möglichkeiten des Experimentes. Freilich nicht als Selektionsexperiment, das man von oben her mit Völkern vornimmt, sondern als höchster Grad der 29Selbsterprobung. Ein Beispiel nur für die Experimentalität dieses Erfahrungsstils. (»In Stahlgewittern« S. 301) von einer schweren Verwundung:
Nun hatte es mich endlich erwischt. Gleichzeitig mit der Wahrnehmung des Treffers fühlte ich, daß das Geschoß scharf ins Leben schnitt. Schon an der Straße vor Mory hatte ich die Hand des Todes gespürt, – diesmal griff er fester und deutlicher zu. Als ich schwer auf die Sohle des Grabens schlug, hatte ich das sichere Bewußtsein, daß es unwiderruflich zu Ende sei. Und seltsamerweise gehört dieser Augenblick zu den ganz wenigen, von denen ich sagen kann, daß er wirklich glücklich gewesen ist. In ihm begriff ich, wie durch einen Blitz erleuchtet, mein Leben in seiner innersten Gestalt. Ich spürte ein ungläubiges Erstaunen darüber, daß es gerade hier zu Ende sein sollte, aber dieses Erstaunen war von einer sehr heiteren Art. Dann hörte ich das Feuer immer schwächer werden, als sänke ich wie ein Stein tief unter die Oberfläche eines brausenden Wassers hinab.[4]
Solche Schärfe der Selbsterfahrung gibt den Aussagen Jüngers ihre Legitimation. Anders als wenn ein zeitgenössischer Philosoph sagt, es fehle uns »jeder Anhalt, ob überhaupt der Tod irgendwie sonderlich wichtig für den Menschen ist. Als bloßes Aufhören – mehr wissen wir von ihm nicht – ist er es jedenfalls nicht.«[5] (K 1466)
6. Überhaupt liegt darin die eigentliche Kraft der Jüngerschen Tagebücher; die prüfbare Präzision im Berichten seiner visuellen Erfahrungen verleiht ihm auch dort das Ansehen solider Gewissenhaftigkeit, wo er einzigartige, nicht für jedermann nachvollziehbare innere Erlebnisse und Erkenntnisse mitteilt. Das Sehen des Zoologen und Entomologen in seiner faszinierenden Schärfe und Treffsicherheit der Umsetzung ins Wort und die Einsicht des Metaphysikers und Zeitgeistdiagnostikers, die äußere und die innere Erfahrung bestätigen sich hier aneinander.
7. Die Kraft der Anspielung hat ihren Boden in der Zuspitzung, die J. dem theoretischen Ideal des wiss. Denkens gibt: im »Arbeiter« sagt er, daß das »Sehen« die »Aufgabe des heroischen Realismus« sei. Das Se30hen ist hier das Aushalten und Durchstehen der Realität. War die Theoria der Griechen der Ausgang und Ursprung auch des Ethos, so ist das Sehen Jüngers, wie er es bis zum »Arbeiter« praktiziert, der Rückzug auf eine »letzte« und darum »heroische« Möglichkeit des Menschen.
8. Zwar bleibt das an dieser Aufgabe gebildete und erbarmungslos geschärfte Organ dasselbe. J. sagt, daß er mit einer »überscharfen Beobachtung … gestraft« sei, »wie andere mit einem übermäßig feinen Geruchsorgan«. (Str. S. 294)[6] Aber diese Schärfe erschöpft sich nicht nur im Abtasten der Konturen, im Fixieren der Nuancen der Impressionen; sie dringt in Hintergründe ein, nimmt verborgene Ordnungsgefüge wahr. »Im Sichtbaren sind alle Hinweise auf den unsichtbaren Plan. Und daß ein solcher vorhanden sei, muß im Modelle nachzuweisen sein«. (Str. S. 17)[7]
9. Jüngers Sehen sublimiert seine »realistische« Schärfe dahin, daß es überall an den Phänomenen das Archetypische, den schöpferischen Urgedanken wahrzunehmen sucht. Die Landschaft des Kriegers und Arbeiters wandelt sich in die des Reisenden, des Schauenden.
Die Systematik ist und bleibt die Königin der Zoologie. Ihr ist es vorbehalten, den Willen zu erfassen, mit dem die Schöpfung sich, gerade in diesem Wesen zum Ausdruck bringt – den Auftrag zu erraten, mit dem sie es versah. Die Charaktere, das Eingeritzte, die Zauberrunen auf den Masken – das sind die Schlüssel zu stets der gleichen Lebenskraft. Der Reigen der Bilder, Originale, Schöpfungsgedanken, Hieroglyphen gibt Zuversicht wie kaum ein anderes Schauspiel dieser Welt und offenbart die Zeugungsfülle, die sich in ihren unsichtbaren Schatzkammern verbirgt. Denn alle diese Wesen sind ja nur flüchtige Schemen, sind Scheidemünze, die mit vollen Händen dem Staube zugeschleudert wird, und dennoch trägt eine jede das Wappen und das Abbild des Souveräns. Und das erklärt den Rausch, den Taumel, den Eindruck von unerhörter Beschenkung, der jeden echten Botaniker und Zoologen beim Eintritt in diese Bildersäle überfällt. (Atl. F.)[8]
10. Zusammenfassung: Jüngers experimentierender Stil schließt aus, daß sich aus seinen Erfahrungen ein Ismus, eine Doktrin ergibt; aber 31auch, daß der Mitmensch zum Objekt wird. Daß J. »stramm nihilistisch« (AH I)[9] ist, stellt für ihn eine jener äußersten Möglichkeiten dar, die das Experiment nicht auslassen darf.[10]
11. Absetzung gegen die Experimente auf dem Rücken der Völker, wie Hitler sie betrieb: »All seine Erfindungen hatten den Anstrich von Experimenten, die dann im größten Maßstab am deutschen Volke zur Anwendung gekommen sind … Er zeigt zunächst, daß solche Taten ausdenkbar und möglich sind, zerstört die Sicherungen und gibt der Masse Gelegenheit zur Zustimmung.« (Str. 562)[11]
IV.
1. Das Problem, das sich für die Sicht des »heroischen« Realismus ergab: wie der Mensch in der Welt der Maschinen und Waffen dem aushaltenden Sehen zuvor und als dessen Bedingung überhaupt fortbestehen kann.
2. Alles was im »Arbeiter« mehr als Deskription, als Durchleuchtung der Tendenzen der Zeit ist, was also als Leitbild die eigentliche Angreifbarkeit des »Arbeiters« ausmacht, läßt sich unter diese Fragestellung einordnen.
3. J. selbst sagt, daß die Legitimation des neuen Typus darin liegt, daß er die »Meisterung der Dinge, die übermächtig geworden sind«, die »Bändigung der absoluten Bewegung, die nur durch ein neues Menschentum zu leisten ist«, ermöglicht (A S. 76).[12]
4. Der »Arbeiter« ist also der erste Versuch, mit den Erfahrungen der großen kriegerischen Selbsterprobung fertig zu werden: vor allem mit der übermächtigen Autonomie der technischen Welt. Dafür bietet sich Nietzsches Schema einer Perfektion des Menschen selbst an. Die Gestalt des Arbeiters ist beschrieben als »organische Konstruktion«, symbolisiert im Bilde des »Kentauren«: das Organische ist Funktion des Tech32nischen und umgekehrt. Keine Übermacht mehr, weil keine Distanz. Kein Gehorsam, weil kein Außen. Neuer Monismus: Absolute Macht.
5. Arbeit, Leistung ist die Wirklichkeit des kentaurischen Zusammenhanges. Letzte Konsequenz einer abendländischen Grundposition, die »Leistung« als unausschlagbares Korrelat aller Erfüllungen ansieht. Die höchste Form dieser Funktionsmonade ist die »totale Mobilmachung«.
6. Man darf bei all diesen Konzeptionen das Grundanliegen nicht übersehen: den Menschen aus seiner gejagten Verlorenheit und Verzweiflung in eine klare, wenn auch kalte Wirklichkeit zurückzuretten. Das kentaurische Bündnis als höchste Form der Sicherheit: [daß] die »Identität von Arbeit und Sein eine neue Sicherheit, eine neue Stabilität zu gewährleisten vermag« (A S. 87).[13]
7. Es darf keinen Zustand geben, »der nicht als Arbeit begriffen wird«. Denkbar sind Gegengewichte des Kraftausgleichs, nicht aber das »Gegenteil« von Arbeit – dies wäre Vernichtung. Auf den Punkt des Arbeiters ist »Zerstörung nicht mehr anwendbar«. Ebenso durchbricht er die Zone des Zweifels und setzt die Möglichkeit eines neuen Glaubens.
8. Man sieht, wie hier überall schon die Notwendigkeiten spürbar sind, gleichsam die Leerformen für das, was Jünger später die »neue Theologie« nennen wird.
9. Dennoch gehört der »Arbeiter« dem Nihilismus zu: dieser liegt im Verzicht auf die Sinnfrage, aber auch darin, daß die Voraussetzung seines Handelns die tabula rasa, der leere Raum ist. Alles nihilistische Handeln muß den Anspruch der creatio ex nihilo machen.
10. Der Irrtum, der in dieser Voraussetzung liegt, zeigte sich darin, daß der Versuch zur Realisierung der totalen Arbeitswelt in dem Unmaß von Zerstörung erstickte, das die tabula rasa erst schaffen sollte.
V.
1. Diese Zerstörung, das Wüten der »Feuerwelt«, ist dann auch für Jünger zum entscheidenden Kriterium gegen den »Arbeiter« geworden. 33Dabei bedurfte es nicht erst der faktischen Ruinierung unserer Welt; auch hier ist Jünger mit barometrischer Sensibilität der Realität voraus.
2. Schon in Mkl [»Marmorklippen«] weiß er, daß in den wirklich entscheidenden Auseinandersetzungen der Kriegsmut »im zweiten Treffen« steht (100).[14]
3. So wird es der eigentlich bedeutsame Ausblick auf die geistige Gestalt Jüngers, den aus dem Kriegserlebnis geformten Mann, der den Krieg als Vater aller Dinge erkannt zu haben glaubte, nun zwanzig Jahre später in den zweiten, ungleich gewaltigeren Krieg ziehen zu sehen. Und hier – bezeugt durch die Tagebücher – zeigt sich, daß der Nihilismus nur das eine Glied der Alternative war, die in der Not unserer geschichtlichen Situation wurzelt. Das andere Glied heißt: Transzendenz, neue Theologie.
4. J. bei einem Besuch des Malers Braque über dessen Bilder: »Der Augenblick, den sie für mich verkörpern, ist der, in dem wir aus dem Nihilismus auftauchen und uns der Stoff zu neuen Kompositionen zusammenschießt.« (Str. S. 421)[15]
5. Solches Auftauchen ist keine Verleugnung des Gewesenen. Im Gegenteil: J. spricht einmal von der »fürchterlichen Kraft« des Nihilismus, gegen die nur derjenige das Gegenspiel wagen kann, der selbst in die nihilistische »Schule« gegangen ist (Str. S. 571).[16]
6. Die Heilbarkeit des ungeheuren Krankheitsherdes, an die Jünger nun glaubt, beruht darauf, daß es sich nicht um ein mechanisches Fatum handelt, sondern um ein ganz und gar menschliches, ein inneres Ereignis. Daran glaubt Jünger schon im persönlichen Geschick:
Zur Katastrophe im Menschenleben: das schwere Rad, das uns zermalmt, der Schuß des Mörders oder auch des Leichtsinnigen, der uns trifft. Lange schon hatte sich in uns der Zündstoff angehäuft, nun wird von außen die Lunte angelegt. Aus unserem Innern kommt die Explosion. (Str. S. 95)[17]
347. So auch die globalen Zerstörungen. In den Mkl [»Marmorklippen«] gewinnt der Oberförster mit seinen Lemuren nur dadurch Macht, daß sich »tiefe Veränderungen in der Ordnung, in der Gesundheit, ja, im Heile des Volkes« vollzogen haben (109).[18] Und J. fährt fort: »Hier galt es anzusetzen, und daher taten Ordner not und neue Theologen, denen das Übel von den Erscheinungen bis in die tiefsten Wurzeln deutlich war; dann erst der Hieb des konsekrierten Schwertes, der wie ein Blitz die Finsternis durchdringt.«
8. Das Wort von den »neuen Theologen« ersetzt die Konzeption der kentaurischen Monade des »Arbeiters«.
9. Ihre Aufgabe kann es nicht sein, die Zerstörung aufzuhalten. Jüngers Einstellung zur Zerstörung:
1. sie schafft die tabula rasa, die alles Neue ermöglicht: »hinter der Verbrennung die Veränderung; die magischen Schmelzöfen, die glühen und zittern, während im rauschenden Blute der Geist in die Essenz eines neuen Jahrhunderts überdestilliert.«
2. sie gibt dem Elementaren den Weg frei, sie bricht die »Hochburgen der Sicherheit«, macht den »Triumph der Mauer« zunichte (in diese Linie fällt der Essay: »Über den Schmerz«);
3. sie schafft das Vergängliche, das Blendwerk aus dem Blick auf das Unvergängliche. »Jede Zerstörung nimmt nur die Schatten von den Bildern weg.« (GS S. 44)[19] Diese »platonisierende« Zuversicht kennzeichnet den J. des zweiten Weltkrieges. Sie ist der Keim seiner Transzendenzerfahrung, der »neuen Theologie«. Bezeichnend für die Kontinuität der Gestalt, daß sie im Zoologischen ansetzt und sich dort immer wieder auflädt. »Wenn die Tiere der Erde, wie ich oft in trüben Stunden fürchte, alle ausgerottet würden, so blieben sie doch in ihrer Unversehrbarkeit bestehen. Sie ruhen im Schöpfer, und nur ihr Schein wird ausgetilgt.« (GS S. 44)[20]
10. Die Entdeckung der unzerstörbaren Bereiche ist der eigentliche Inhalt der Tagebücher. Daß dies der Weg zu der »neuen Theologie« sein 35könnte, ist schon in den Mkl [den »Marmorklippen«] in der Gestalt des Pater Lampros angeklungen:
Wir fragten uns zuweilen, ob die Verderbnis ihm schon zu weit fortgeschritten scheine, um sie zu heilen; oder ob Bescheidenheit und Stolz ihn hinderten, im Streite der Parteien aufzutreten, sei es in Worten, sei es mit der Tat. Doch traf wohl Bruder Otho den Zusammenhang am besten, wenn er sagte, daß für Naturen wie die seine die Zerstörung des Schrecklichen entbehre, und sie geschaffen seien, in die hohen Grade des Feuers einzutreten wie durch Portale in das Vaterhaus. Er, der gleich einem Träumer hinter Klostermauern lebe, sei von uns allen vielleicht allein in voller Wirklichkeit. (S. 77)[21]
11. Um diese »volle Wirklichkeit« und ihre Transzendenz geht es Jünger. Sie gewährt die Gewißheit und Sicherheit, die ihm bei der Konzeption der »kentaurischen Monade« vorschwebte, die »Sicherheit im Nichts«, deren Symbol der Brennspiegel Nigromontans ist. Im Hinblick auf sie bekennt J. von seinen früheren Lebensphasen: »Wir kannten noch nicht die volle Herrschaft, die dem Menschen verliehen ist.« (Mkl S. 76)[22]
12. Daß diese Herrschaft nicht mehr auf »Arbeit«, nicht mehr auf der organischen Konstruktion beruhen kann, ist klar. Aber die Kategorie ist gewonnen, die Sicherheit und Gewißheit verbürgt; der Urtypus ist hier wie dort derselbe: »in der Bindung leben« (Mkl S. 109).[23] Die Namen dieser Bindung heißen jetzt vorzüglich: Gebet und Opfer.
13. Der Übergang von der Arbeit zum Gebet gehört, das verkennt Jünger nicht, zu den kühnsten Wandlungen des Menschen.[24] Es ist unendlich leichter; die Bewegung zu steigern als zur Stille zu bringen – darauf beruht der Vorteil des Nihilisten, und das macht das »ungemeine Wagnis der theologischen Aktionen, die sich anbahnen«, aus (Str. S. 8).[25]
14. Beim Lesen der Bibel, das die Pariser Tagebücher durchzieht. Jakobs Kampf mit dem Engel:
36Der Mensch darf sich nicht billig besiegen lassen: Gott muß sich ihm aufzwingen. Er wird in Versuchung kommen, sich aus Mattigkeit niederzuwerfen, sich fallen zu lassen, ehe er völlig durchdrungen, ganz unterjocht ist von der Hohen Kraft. Das ist eine besondere Gefahr unserer Zeit, in der die große Bedrohung die Menschen in Massen … zum Kreuze treiben wird. (Str. S. 597)[26]
Der ganze Ernst der neuen Theologie, die nichts preisgeben will, was sich der Mensch legitim errungen hat:
Wir müssen uns in unserer Eigenschaft als Rationalisten überwinden lassen, und dieser Ringkampf findet heute statt. Gott tritt den Gegenbeweis gegen uns an.[27] (l. c.)
Das ist das Bild des Zeitgeschehens, aber es trifft Jüngers eigene Existenz. Es macht seine Freiheit und Wahrhaftigkeit aus, wie er sich dieser Gegenargumentation stellt.[28]
15. Wie Jünger seiner Optik treu geblieben ist, auch wenn er sie auf andere Dimensionen gewandt hat, das überrascht immer wieder. So über die Speisung der Gefangenen: »Einer Zeit, die sich so auf die Energetik versteht, ist doch die Kenntnis der ungeheuren Kräfte verloren gegangen, die in einem Stückchen mitgeteilten Brotes verborgen sind.« (Str. S. 623)[29]37
[1] da Mittellage fehlt
[2] [Ernst Jünger, »Strahlungen«, Tübingen 1949, S. 621.]
[3] [Ders., »Auf den Marmorklippen«, Hamburg 1938, S. 32.]
[4] [Ders., »In Stahlgewittern«, Leisnig 1920, S. 301.]
[5] [Nicolai Hartmann, »Zur Grundlegung der Ontologie«, Berlin 21941, S. 197. In der Klammer vermutlich Verweis auf eine Karteikarte.]
[6] [Ernst Jünger, »Strahlungen«, Tübingen 1949, S. 294.]
[7] [Ebd., S. 17.]
[8] [Ders., »Atlantische Fahrt«, Zürich 1948, S. 97.]
[9] [Ders., »Das abenteuerliche Herz«, Berlin 1929, S. 186.]
[10] Widerspruch
[11] [Ernst Jünger, »Strahlungen«, S. 562.]
[12] [Ders., »Der Arbeiter. Herrschaft und Gestalt«, Hamburg 1932, S. 76.]
[13] [Ebd., S. 87.]
[14] [Ders., »Auf den Marmorklippen«, S. 100.]
[15] [Ders., »Strahlungen«, S. 421.]
[16] [Ebd., S. 571.]
[17] [Ebd., »Strahlungen«, S. 95.]
[18] [Ders., »Auf den Marmorklippen«, S. 109.]
[19] [Ders., »Gärten und Straßen«, Berlin 1942.]
[20] [Ebd.]
[21] [Ders., »Auf den Marmorklippen«, S. 77.]
[22] [Ebd., S. 76.]
[23] [Ebd., S. 109.]
[24] Vorformen der Gnade: Traum – Buch [unsicher] – Wandlung
[25] [Ernst Jünger, »Strahlungen«, S. 8.]
[26] [Ebd., S. 597.]
[27] [Ebd.]
[28] Kritik des Theologiebegriffs. Theologie nicht auf der Basis wechselseitiger Argumentation. Problematik des Opferbegriffs.
[29] [Ernst Jünger, »Strahlungen«, S. 623.]
Paul Claudel, »Der seidene Schuh«
Der dramatische Kern der Dichtung
Don Pelayo, Richter der spanischen Krone im ausgehenden 16. Jahrhundert, hat die sehr viel jüngere Französin Proeza zur Frau genommen. Bevor Pelayo ein Kommando über die spanischen Festungen an der nordafrikanischen Küste übernimmt, hat er als Ältester seiner ganzen Familie noch deren Angelegenheiten zu ordnen. Da er den Ausfahrthafen deshalb auf Umwegen erreichen wird, vertraut er Proeza seinem Freunde Don Balthazar an, der sie auf dem kürzesten Weg zu dem Hafen bringen soll.
Um Proeza bemüht sich, jedoch vergeblich, ein Vetter Pelayos und sein Stellvertreter im afrikanischen Kommando, Don Camillo. Proezas Herz gehört im geheimen Rodrigo, einem kühnen Pionier der spanischen Welteroberung, den sie kennen lernte, als er zu Tode erschöpft von einer afrikanischen Unternehmung zurückkehrte. Proeza wird alles daran setzen, Rodrigo wieder zu sehen, der inzwischen vom König mit der Statthalterschaft über Amerika betraut worden ist.
Es gelingt Proeza, dem Gewahrsam Balthazars zu entfliehen. Durch ein Mißverständnis wird Balthazar getötet. Proeza findet bei der Mutter Rodrigos Aufnahme; dieser selbst ist bei einem nächtlichen Gefecht mit Räubern schwer verwundet worden und befindet sich ebenfalls im Hause seiner Mutter, ohne daß Proeza zu ihm darf. Pelayo erscheint, um Proeza mit sich zu nehmen; er sieht, daß sie von ihrer Ehe mit ihm nicht erfüllt ist, und betraut sie deshalb mit einer fast unmöglichen Aufgabe, dem Kommando über die Festung Mogador, die der unzuverlässige Camillo bis dahin befehligte. Sie soll ihn zu ihrem Leutnant machen.
Rodrigo macht zur Bedingung für die Übernahme seiner amerikanischen Aufgabe, daß der König Proeza von diesem Kommando entbindet. Er selbst überbringt ihr bei seiner Ausfahrt nach Amerika einen Brief des Königs und Don Pelayos. Camillo empfängt Rodrigo und übergibt ihm die Antwort Proezas »Ich bleibe – Geht!«38
Während Rodrigo an die Aufgabe der Kolonisierung Amerikas herangeht und diese neue Welt zu der seinen zu machen sucht, behauptet Proeza verbissen und ohne jede Hilfe der spanischen Macht ihre Stellung in Afrika. Als ihr Gatte Pelayo gestorben ist und sie keine andere Möglichkeit mehr sieht, sich Camillos zu versichern, der mit dem Islam konspiriert, willigt sie in die Ehe mit ihm ein. Camillo hat die physische Macht über sie, sie beherrscht aber seinen Willen. In einer tiefen Empfindung ihrer ausweglosen Situation schreibt sie den Brief an Rodrigo, der ihn zu ihr ruft. Dieser Brief hat ein abenteuerliches Schicksal und erreicht seinen Adressaten erst zehn Jahre später. Er trifft Rodrigo in der vollen Hingabe an sein Werk der Erschließung der neuen Welt an. Sofort läßt Rodrigo Amerika im Stich und erscheint mit seiner Flotte vor der Festung Mogador.
Die Festung kommt in eine hoffnungslose Lage, da sie gleichzeitig von den aufständischen Stämmen angegriffen wird. Camillo bietet Proeza als Preis für den Abzug der Flotte an; sie selbst erscheint auf dem Schiff Rodrigos mit ihrem Kind, Maria Siebenschwert, das sie von Camillo hat, das aber die Züge Rodrigos trägt. Proeza steht bis zuletzt zu ihrer Aufgabe: sie zwingt Rodrigo, das Angebot abzulehnen, überläßt ihm das Kind und kehrt in die Festung zurück, mit der sie sich selbst in die Luft sprengt.
Rodrigo fällt wegen der Vernachlässigung Amerikas beim König in Ungnade und wird auf die Philippinen als Gouverneur geschickt. Im Kampf mit den Japanern verliert er ein Bein. Seinen Lebensabend verbringt er in den spanischen Gewässern auf einem alten Schiff, auf dem er mit Heiligenbildern in japanischer Manier handelt. Er wird in seiner Gier nach Weltgestaltung zum Opfer einer Mystifikation: die falsche Nachricht vom Sieg der Armada über die Engländer bestimmt den König, ihm England als Statthalterschaft zu übergeben. Rodrigos große Pläne für dieses Amt ziehen ihm die Anschuldigung der Verräterei zu. Die Wahrheit von der Niederlage der Armada läßt diese Illusion zerplatzen. Während die Tochter Proezas sich der Flotte Don Juans d'Austria zum Kampf gegen die Heiden anschließt, versinkt Rodrigo in letzte Nichtigkeit und Lächerlichkeit. Wir verlieren ihn in dem Augenblick aus den Augen, als Soldaten den Krüppel an eine lumpensammelnde Nonne verschenken.39
Der Aufbau der Dichtung
Dieser dramatische Kern schält sich aus einer verwirrenden Fülle von Szenen heraus, die das Geschehen ins Weltgültig-Symbolische emporheben, oder es im Grotesk-Parodierenden widerspiegeln.