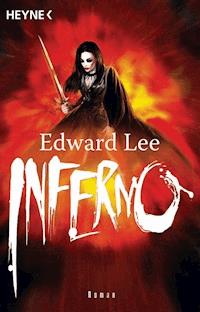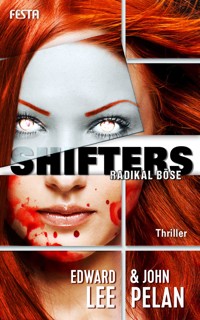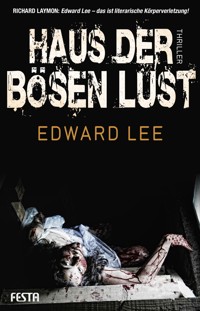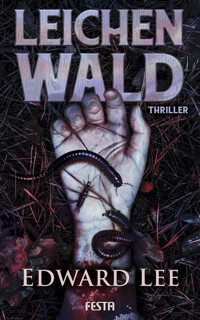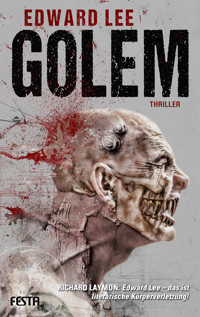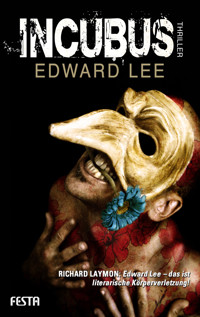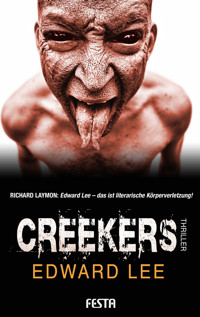4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Festa Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Horror Taschenbuch
- Sprache: Deutsch
Nachdem sein Großvater gestorben ist, sitzt Bighead ganz alleine in der Hütte irgendwo im tiefen Wald von Virginia. Als das letzte Fleisch verzehrt ist, treibt ihn der Hunger hinaus in die 'Welt da draußen', von der er bisher nur von seinem Opa gehört hat. Wer oder was ist der Bighead? Wieso hat er einen Kopf so groß wie eine Wassermelone? Ist er ein mutierter Psychopath? Was er auch immer ist, Bighead ist unterwegs und hinterlässt eine Spur aus Blut und Grauen. Richard Laymon: "Edward Lee – das ist literarische Körperverletzung!" Jack Ketchum: "Lustig, böse und pervers bis an die Grenzen der Menschlichkeit." John Skipp: "Noch nie habe ich mich so vor mir selbst geschämt, weil ich über etwas so sehr lachte, das derart obszön ist!" T. Winter-Damon: "Bighead würde den Marquis de Sade erschauern lassen!" Der Verlag warnt ausdrücklich: Edward Lee ist der führende Autor des Extreme Horror. Seine Werke enthalten überzogene Darstellungen von sexueller Gewalt. Wer so etwas nicht mag, sollte die Finger davon lassen. Für Fans dagegen ist Edward Lee ein literarisches Genie. Er schreibt originell, verstörend und gewagt – seine Bücher sind ein echtes, aber schmutziges Erlebnis. Deutsche Erstausgabe. Broschur 19 x 12 cm, Umschlag in Lederoptik.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 476
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Aus dem Amerikanischen von Manfred Sanders
Obwohl der Autor in der Schuld vieler steht, möchte er besonders Dave Barnett (für die erste amerikanische Ausgabe) und Dave Hinchberger (für die zweite) danken. Ob ihr’s glaubt oder nicht, beide sind ziemlich coole Typen, obwohl sie dieses Buch herausgegeben haben!
Anmerkung des Autors
Technisch gesehen sollte man diese Ausgabe von Bighead weniger als Neuauflage, sondern vielmehr als »Originaltext« bezeichnen. Im Mai 1997 gab Dave Barnett bei Necro Publications die erste Ausgabe dieser Geschichte heraus und damit hat er einen großartigen Job erledigt, für den ich ihm ewig dankbar sein werde. Allerdings hatte Dave mich gebeten, einen Aspekt der letzten 20 Seiten umzuschreiben, da ihm die konzeptionelle Perspektive nicht so recht gefiel. Ich habe diese Veränderungen ohne Zögern vorgenommen, aber ich kann sie jetzt nicht näher erläutern, ohne dem Leser das Ende des Buches zu verraten. Auf jeden Fall verkaufte sich die Necro-Ausgabe des Buches sehr gut und erregte ein gewisses Aufsehen abseits des Mainstream-Horrormarktes. Die vorliegende Version, die Dave Hinchberger so freundlich war zu publizieren, ist die Originalversion. Es handelt sich um das gleiche Buch wie in der Necro-Ausgabe, nur mit ein paar Veränderungen auf den letzten 20 Seiten. Ich hoffe, dass es Ihnen gefällt!
Edward Lee
Seattle, Washington
Januar 1999
PROLOG
Sie schlug dem Baby mit einer gusseisernen Bratpfanne den Schädel ein. Der Kopf zerplatzte wie eine bleiche, reife Frucht.
Sie hatten natürlich ihr Schluchzen gehört – aber wenigstens waren sie draußen geblieben, während sie es getan hatte.
Die Holztür quietschte. Einer der Männer sah herein. »Hast du’s schon gemacht?«
»Ja!«, schrie sie.
Es gab keinen Trost und keinen Zuspruch. Die Augen des Mannes waren leer und hart. »Das musste sein, weißt du doch, oder?«
Sie saß da, mit dem Kopf zwischen den Knien. »Ja«, krächzte sie, »ich weiß ...«
Nur eine Stunde vorher ...
Sie legte das gewickelte Bündel auf den schweren Tisch. Natürlich würden sie die Leiche des Babys sehen wollen – sie würden darauf bestehen. Sie werden bald zurück sein, wusste sie und schielte voller Furcht zur Küchenuhr. Ein Topf Hühnerbrühe köchelte auf dem Ofen.
Sie werden’s nie erfahren, sie werden’s nie erfahren.
Doch jetzt verengten sich die Augen des Mannes fragend. »Hast du ...«, begann er. Er kratzte seinen steifen Backenbart. »Ich mein’ ... war’s wach, als du ...?«
»Nein«, krächzte sie. Sie deutete auf den Kochtopf.
»Ah.«
Andere Männer schauten ins Zimmer, mit Trauermienen, die Augen hart und voller Entschlossenheit, aber auch nicht ohne Mitleid mit ihr. Doch dann glitten ihre Augen an ihr vorbei, zum Tisch ...
Zu dem leblosen Bündel auf dem Tisch.
»Wir wissen ja, dass es nich’ leicht war, aber’s musste sein«, sagte er. »Du hast das Richtige getan – haben wir alle. Aber jetzt ... Wir müssen’s begraben. Einer von uns wird’s machen.«
»Nein!« Ihre Stimme brach. Sie stand zitternd auf und nahm das tote Baby, vorsichtig, damit nichts auf den Boden kleckerte.
»Ich begrab’ es«, sagte sie.
Mit dem Bündel im Arm ging sie zur Tür. Schweigend machten die Männer ihr Platz.
Geraldine, oh Geraldine, dachte sie. Es ist vorbei. Eine kleine Holzkiste musste als Sarg reichen. Überall hörte sie Nachtgeräusche; Mondlicht ergoss sich durch die düsteren Bäume.
Ja. Gott sei Dank ist es vorbei.
Sie grub so tief, wie es ihre erschöpften Muskeln erlaubten, dann legte sie das tote Kind hinein.
Wetterleuchten blitzte lautlos, einige Meilen entfernt. Sie seufzte, wischte sich Schweiß und Tränen aus dem Gesicht.
Ja, es war vorbei. Dies war das Ende.
Doch alles, woran sie denken konnte, alles, woran sie sich erinnern konnte, war der Anfang. Vor neun Monaten ...
... als das Ding gekommen war.
EINS
(I)
Bighead leckte sich die Lippen, weil’s so lecker war: Blut und Fett, Fotzengeschmack, den Salzschleim von seiner eignen Wichse, die er grade aus ’m Nabel von der toten Puppe geschlürft hatte. Sein Ding hatte ihre Pussy voll aufgerissen; machte kein’ Spaß, ’ne Bauernfotze zu vögeln, wenn der Prügel in ’nem kaputten Gebärmutterhals und ’ner zerfetzten Scheidenrückwand rein und raus ging. No Sir. Die Puppen hier war’n ja ganz süß und alles, jedenfalls die paar, die er gesehn hatte, aber nie groß genuch. Keine war groß genuch für Bighead.
Bighead sagten sie zu ihm, wegen sei’m kongenitalen Hydrozephalus, nich’ dass Bighead gewusst hätte, was ’n kongenitaler Hydrozephalus war, genauso wenich, wie er wusste, was ’n Gebärmutterhals oder ’ne Scheidenrückwand war. Sein Kopf hatte ungefähr die Größe und Form von ’ner Wassermelone, groß und kahl, mit großen, schiefen Ohren wie zermatschte Kartoffelbrötchen. Die Leute sachten, dass Bigheads Mama in dem Moment abgekratzt war, wo er aus ihr rauskam, und sie sagten auch, dass Bighead sich mit sein’ messerscharfen Zähnen ’n Rest vom Weg freigefressen hatte. Bighead glaubte das. Klar, sie hätten ihn auch noch wegen ’nem andern Grund Bighead nennen könn’, und der Grund war der 35-Zentimeter-Hammer zwischen sein’ Beinen. 35 Zentimeter, ungelogen, und dicker wie ’n normaler Unterarm. Die Leute sachten auch, dass er schon bei seiner Geburt hart war. Yes Sir, er hatte schon ’n Mordsständer, bevor er sich überhaupt aus Mamas Möse rausgefressen hatte.
Bighead glaubte das.
Er quetschte den letzten Pimmelrotz aus sich raus, zog sein’ Overall hoch und mampfte ’n Rest Gehirn von der toten Puppe. Menschenhirn schmeckt übrings wie warme, salzige Rühreier, falls ihr’s noch nich’ wusstet. Bighead mochte’s, echt, und er mochte auch Leber. War gutes Futter. Er kaute auch gerne ’n bisschen auf Tittenfleisch rum, wenn er in ’n Wäldern rumstrich, so wie andere auf Tabak rumkauten.
Aber ’s war nich’ nur Pussy, was Bighead suchte. Da hatte er auch noch nich’ viel von gehabt, nur ab und zu mal ’ne Puppe, die sich verlaufen hatte, als er die ganzen Jahre mit sei’m Grandpap im Unterwald gewohnt hatte. Unterwald, so hatte Grandpap immer dazu gesacht. Hier im Unterwald, Bighead, müssen wir uns kein’ Kopp um die Welt-da-draußen machen.
Die Welt-da-draußen?
Bighead hatte sich schon immer gewunnert, was das sein sollte, weil er’s nich’ kannte. Er wollte immer dahin, aber Grandpap sachte immer, dass die Welt-da-draußen nur ’n böser Ort mit bösen Leuten war, und hier ging’s ihnen viel besser. Aber jetz’ war Grandpap tot ...
Und Bighead dachte sich, dass es höchste Zeit war, loszuziehn und aus ’m dunkeln Unterwald raus und in die Welt-da-draußen zu gehn. Jetz’, wo Grandpap tot war, hatte Bighead dieses komische Jucken in seiner Seele und er wusste nich’, was’s war, wusst’ er nich’. War fast so, als würd’ er von dieser komischen Welt-da-draußen gerufen, so wie Forellen vom Teich gerufen wurden, wenn’s Laichzeit war, und wie ’n Vogel von ’nem andern Vogel gerufen wurde, genau so. Und genau so kam’s Bighead vor, auch wenn er nich’ der Schlauste war, wie wenn die Welt-da-draußen ihn rufen würd’, ihm befehlen würd’, dahinzugehn.
Ja, wirklich, irgendwas rief Bighead, ganz klar. Vielleicht war’s die Stimme von Gott, vielleicht war’s das Flüstern von seiner Vorbestimmung. Er wusste’s nich’.
Aber eins wusste Bighead:
Was’s auch war, er wollte’s unbedingt rausfinden.
(II)
Die Nachricht, die er ihr hinterlassen hatte, dieses gedankenlose, unglückliche Gekritzel, ging ihr nicht aus dem Kopf. Liebe Charity: Tut mir leid, dass es letzte Nacht nicht so gut lief. Ich wünsche dir eine gute Reise. Nate. Was sollte das heißen: nicht so gut lief?
Es läuft nie gut, dachte Charity. Es war ihr ein Rätsel. Sie und Nate, zum Beispiel. Er war nett, intelligent, hatte eine Festanstellung im Fachbereich Englisch. Und er sah gut aus. Sie hatten sich zu einem netten Abendessen im Peking Gourmet getroffen, sich gut unterhalten. Sie hatte ihm alles von ihrer anstehenden Reise zu ihrer Tante erzählt und er schien ehrlich an allem interessiert zu sein, was sie zu sagen hatte. Dann gingen sie zu ihr und ...
Alles brach auseinander. Wie immer ...
Was konnte sie denn dafür, dass sie beim Sex nichts empfand? Aber die Männer spürten ihre Gefühllosigkeit, ihre primitiven Egos zerbrachen daran. Dann waren sie weg, und keiner kam jemals wieder, rief nicht einmal an. Wenigstens war Nate rücksichtsvoll genug gewesen, eine Nachricht zu hinterlassen. Aber er würde nie wieder mit ihr ausgehen – Charity wusste es. Er würde sie nie wieder auf die gleiche Weise ansehen.
Ihre Verzweiflung gab ihr Kraft. Nach all diesen Jahren hatte sie sich daran gewöhnt. Aber jetzt war sowieso nicht die richtige Zeit, über ihre ständigen romantischen Pleiten nachzugrübeln.
Die Reise, zwang sie sich zu denken. Tante Annie. Es war Jahre her, seit Charity etwas von ihrer Tante gehört hatte, und Jahrzehnte, seit sie sie gesehen hatte. Es war eine lange Geschichte und Charity wusste, dass Schuld dabei eine große Rolle spielte. Ihre Tante hatte sie aufgezogen, bis sie acht war (Charitys Vater war bei einem Grubenunglück ums Leben gekommen und ihre Mutter hatte sich kurz darauf das Leben genommen), und sie war die einzige Mutter, die Charity jemals wirklich gehabt hatte. Doch das war in Luntville gewesen, nicht in College Park, Maryland, nur einen Steinwurf von Washington D.C. entfernt. In der Provinz, am Arsch der Welt, ein winziger Fleck zwischen den Allegheny Mountains und den Appalachen. Mit Tante Annies Gästehaus war es langsam aber sicher den Bach runtergegangen, und da kein Geld mehr hereinkam, wurde ihre Tante vom Staat als »zur Vormundschaft ungeeignet« erklärt. Der Staat nahm ihr Charity weg und steckte sie in ein Waisenhaus in einem anderen Bundesstaat (in ihrem war kein Platz), und das war das Ende der Geschichte. Oder, wenn man so wollte, der Anfang.
22 Jahre später stellte sie fest, dass sie sich noch gut an »zu Hause« erinnerte. Diese hügelige ländliche Gegend, eine ganz andere Welt als die, in der sie jetzt lebte. Tante Annie hatte sie letzte Woche angerufen und eingeladen, »nach Hause« zu kommen.
Und ihr Zuhause war nicht hier, oder? Ihr Zuhause war da, wo sie geboren war ...
Warum nicht?, hatte sie gedacht.
Es wäre gut, einmal eine Weile von hier wegzukommen, und sie hatte weiß Gott genug Urlaubstage angesammelt. Und sie musste zugeben, dass allein schon Annies Stimme am Telefon wie ein Lockruf war, wie eine Aufforderung, zurück zu ihren Wurzeln zu flüchten. Die Einkaufsstraßen und der Smog und die lärmige Rushhour auf dem University Boulevard drängten sie noch zusätzlich. Ich fahre zurück nach Luntville, beschloss sie noch am selben Abend. Ich werde zurück an den Ort gehen, von dem ich komme, und die Frau besuchen, die ihr Bestes getan hat, um mich großzuziehen.
Dass sie sich das jetzt noch einmal bewusst machte, half ihr dabei, ihre anderen Probleme und Misserfolge zu verdrängen. Es belebte sie. Auch wenn es tiefste Provinz war, gab es doch einiges, was für die Gegend sprach, aus der sie stammte. Einfache Leute, einfache Weltanschauungen, das genaue Gegenteil zu dem täglichen Gerenne und Gehetze, dem sie hier ausgeliefert war. Es würde ihr guttun, dorthin zurückzukehren.
Sie hatte zwar keinen Wagen, aber sie hatte schon eine Mitfahrgelegenheit. Charity hatte eine Anzeige in den regionalen Zeitungen aufgegeben, sogar in der Washington Post. Eine der Journalistinnen der Post, eine Jerrica Perry, hatte sie sofort angerufen und gesagt, dass sie eine kurze Reise in die gleiche Gegend plane. Und sie hatte einen Wagen und würde Charity gerne mitnehmen, wenn sie sich an den Unkosten beteiligte. Es war alles abgemacht. Morgen früh würden sie fahren.
Und sie ließ mehr hinter sich zurück als nur College Park, Maryland, nicht wahr? Sie ließ auch all die Reinfälle ihres Lebens zurück, die Enttäuschungen und verpassten Gelegenheiten.
Nicht, dass sie wirklich gescheitert wäre. Sie hatte ihren unglaublich schlechten Chancen getrotzt; dem Waisenhaus, der Einsamkeit, den Nächten, in denen sie wach lag und darüber grübelte, warum sie eine Außenseiterin war. Sie hatte sich abgemüht, hart gearbeitet, um ihre Hochschulreife zu erlangen und den Verwaltungsjob am College zu bekommen, noch härter gar bei den Abendvorlesungen. Es würde seine Zeit dauern, aber sie wusste, dass sie mit ihrem Punktedurchschnitt von 3,4 schließlich ihren Abschluss in Rechnungswesen schaffen würde. Sie würde es packen.
Doch jetzt ...
Der Gedanke nahm sie gefangen.
Morgen, dachte Charity Walsh, als sie aus dem Fenster ihres Apartments blickte, fahre ich nach Hause.
(III)
Eigentlich sollten ihre Gedanken nur dem Artikel gelten. 1500 Dollar zahlte die Zeitung ihr, und weitere 1000, sobald sie den Text einreichte. Das war gutes Geld für einen Spezialauftrag und ihr Grundgehalt war auch nicht zu verachten. »Konzentriere dich auf deinen Job, Jerrica«, murmelte sie vor sich hin.
Der Streit, den sie mit Darren gehabt hatte – großer Gott! Er wollte einfach nicht lockerlassen. »Du hast wirklich ein Problem, Jerr«, hatte er an dem Abend gesagt, als er bei ihr hereingeplatzt war. Jerrica hatte nicht nur mit einem, sondern gleich mit zwei Männern im Bett gelegen. »Ist es das, was du willst?«, hatte er gefragt, in keinster Weise durch das, was er sah, in Verlegenheit gebracht. Die beiden Männer hatten in Rekordzeit ihre Kleidung angezogen und waren verschwunden. Aber Darren war geblieben. »Das ist für dich die Erfüllung? Wildfremde Männer in einer Bar aufzugabeln und einen flotten Dreier abzuziehen?«
»Verpiss dich!«, hatte sie gerufen, aber das war es eigentlich nicht gewesen, was sie hatte sagen wollen. Doch was hätte sie sagen können? Es war, na ja, ziemlich peinlich, so erwischt zu werden.
»Und was zur Hölle machst du überhaupt in meinem Apartment!«, hatte sie gerufen und sich die fleckige Bettdecke vor die Brust gezogen.
»Du hast mir einen Schlüssel gegeben, weißt du noch?«
»Ah ...«
Es gab nur wenig, was sie hätte sagen konnte. Ich kann nicht anders? Ich kann es nicht unterdrücken? Es tut mir leid? Für Darren wäre das vielleicht okay gewesen, aber sie konnte es einfach nicht sagen.
Es tut mir leid, dachte sie.
»Du brauchst Hilfe, Jerr«, hatte er gesagt. »Ich meine ... kennst du die Kerle überhaupt?« Er hatte ein finsteres Gesicht gemacht. »Ich will es gar nicht wissen. Ich will damit nur sagen – ich glaube immer noch, dass das zwischen uns etwas richtig Gutes ist, aber du machst alles kaputt. Warum?«
Warum? Was hätte Jerrica darauf antworten können? Gerade jetzt, mit Sperma im Haar und einer so wundgevögelten Vagina, dass sie wahrscheinlich kaum gehen konnte?
»Verschwinde!«, hatte sie nur gesagt, denn es war das Einzige, was sie sagen konnte, ohne dass sich ihr Stolz ganz in Luft auflöste. »Verschwinde einfach!«
Er war zurückgewichen, so langsam, dass er wie verloren wirkte. Darren liebte sie, das wusste sie, und kein anderer Mann in ihrem Leben hatte sie je wirklich geliebt. Trotzdem stürmte er nicht einfach hinaus, wie es die meisten Männer getan hätten.
»Ich liebe dich, Jerrica«, hatte er geflüstert, sein Gesicht hatte nur noch halb durch die Schlafzimmertür gelugt. »Wir werden eine Lösung finden, wenn du es willst.«
In dem Moment hatte sie jedes bisschen Bosheit in ihrer Seele zusammenkratzen müssen, um antworten zu können.
»Verschwinde.«
Und er verschwand.
Was stimmt mit mir nicht?, fragte sie ihr Spiegelbild. Sie war 28, sah aber fast zehn Jahre jünger aus. Wallendes seidig blondes Haar, die richtigen Kurven an den richtigen Stellen, ein fester, hoher Busen. Darren war ein guter Mann. Was wollte sie eigentlich?
Ihr Spiegelbild zuckte mit den Schultern, auf ihrer gebräunten Haut glitzerten noch die Wasserperlen von der Dusche.
Ich brauche Hilfe, stimmte sie Darren zu. Sie wusste es. Aber was? Für 75 Dollar die Stunde ging sie zweimal im Monat zu einem Therapeuten. Was noch? Sollte sie vielleicht zu den Anonymen Sexsüchtigen gehen? Auf gar keinen Fall würde sie noch einmal so eine Freakshow mitmachen. Ihre Kokainsucht loszuwerden war schon schlimm genug gewesen, aber Sexsucht? Ich muss die Sache einfach selbst in den Griff bekommen, redete sie sich ein.
Ich habe einen Auftrag. Ich fahre morgen in die Appalachen. Es wird eine gute Zeit werden und ich werde mir nicht den Kopf über Darren oder Männer oder mich oder sonst irgendwas zerbrechen, beschloss sie.
Jerrica Perry schlüpfte in ihren Bademantel. Sie seufzte, wischte sich sogar eine Träne weg.
Dann begann sie, ihre Koffer zu packen.
(IV)
Oh Mann! Heute musste Bigheads Glückstag sein, weil grade war er ’ne Meile gelatscht nach der letzten Pussy, da fand er noch eine, ’ne süße kleine Maus mit braunen Haaren, die sich grade zum Pipimachen neben ’n Baumstumpf gehockt hatte, direkt an der mächtich breiten Straße, wo er langging. Sie hatte große Augen und war barfuß, hatte nur ’n winzigsten Fetzen von Kleid an, den Bighead je gesehn hatte (war fuchsienrot das Kleid, nich’ dass Bighead belesen genuch gewesen wär’, um zu wissen, was verdammt noch mal fuchsienrot war), und das Kleid hat er ihr vom Leib gefetzt, bevor sie mit Pinkeln fertich war. Sie hat nich’ viel geschrien, no Sir, is’ auch nich’ einfach zu schrein, wenn ei’m die Kehle rausgerissen wird. Bighead hat auch gar nich’ erst versucht, ’n Rohr zu verlegen, weil er hat ihre Pussy gesehn, wie sie am Pinkeln war, und ’s war klar wie Regenwasser, dass sie nirgens ’n Loch hatte, das groß genuch war für Bigheads Prügel. Also hat er sie einfach abgemurkst und dann mal schnell auf ihre Titties gewichst. Der zweite Schuss am Tag is’ der Beste, hatte Grandpap immer gesagt. Bighead grunzte fast wie ’n Mastschwein, das ’n Schaf vögelt. Und da kam ’n netter Schuss, oh Mann, und die Maus hat in hübschen roten Bläschen mit ihr’m eignen Blut gegurgelt. Und wo sie noch am Sterben war, hat er natürlich von ihr’m Pussyzeug geleckt. Wär’ sonst Verschwendung gewesen. Schmeckte scharf: Fotzengeschmack, frisches Pipi und natürlich ’ne reine Scheißangst. Das war alles irnkwie vermischt und echt lecker und Bighead mochte das. Seine großen, schiefen, roten Augen wurden ganz klein, so geil war das. Und dann war er fertich und schlurfte los in die Brombeern, weg vom Unterwald und ...
Raus zur Welt-da-draußen.
Bighead dachte, dass’s wohl nich’ mehr lang dauern würd’, bis er da war.
ZWEI
(I)
Joyclyn, sieh mal!
Ich weiß. Er wacht auf!
Ein Kichern zwitscherte in seinen Ohren, genauso unwirklich wie die Körnigkeit der Luft. Der Priester stöhnte in sein Kissen.
Das wird Spaß machen ...
Die Blässe der Dämmerung legte dicken Schweiß auf seine Brauen; er fühlte sich, als wäre er voller Schleim, Furcht nagte an seinem Gesicht, kleine geisterhafte Daumen übten Druck auf seine Augäpfel aus, dass sie fast platzten. Erschöpft von der Wildheit des Albtraums blickte er zum Fuß seines spartanischen Bettes.
Gott, ich flehe dich an, dachte er. Ich habe solche Angst! Beschütze mich!
Vielleicht tat Gott es, denn die Furcht, die dem Priester das Gefühl gab, in einem heißen Tümpel zu ertrinken, ließ nach.
Doch die Vision ...
Jesus Christus ...
Das Nachbild der Vision verschwand noch nicht ganz.
Die beiden Nonnen blickten zu ihm herab, sie kicherten gnomenhaft. Sie grinsten, bedeckt von einer Patina aus trübem Morgenlicht. Ihre Augen waren stumpf wie der Tod, ihre Münder waren wie dünne Schlitze in grauem Fleisch. Dann lüfteten sie ihre schwarzen Nonnengewänder –
Gott im Himmel ...
– und begannen zu urinieren.
Direkt dort auf den Teppich des Pfarrhauses, in heißen, dampfenden Strahlen, ihre Finger an den Venushügel gelegt, darunter die zarten, kleinen Harnröhren ...
Das schrille, hexenhafte Gekicher verklang und die Bilder verblassten, als der Priester endgültig erwachte.
Scheiße, dachte der Priester. Verdammte Sch...
Doch da war noch etwas, nur für einen Sekundenbruchteil.
Ein Bild hing da für den Zeitraum eines Augenzwinkerns.
Ein schwarzer Schlund so groß wie ein Mülleimerdeckel, voller Zähne so scharf wie Eispickel ...
(II)
»Tja, freut mich, dich kennenzulernen«, sagte Charity, nachdem sie ihre Taschen in den winzigen Kofferraum gepackt hatte und eingestiegen war.
»Freut mich auch«, sagte die Blonde. Charity konnte sich nicht mehr genau an ihren Namen erinnern. Jennifer? Jessica?
»Und mir gefällt dein Wagen«, fügte Charity hinzu, weil ihr nichts Besseres einfiel. Es war ein knallroter Miata, ein zweisitziges Cabrio. Ein hübscher Wagen. Und wahrscheinlich ziemlich teuer. Eines Tages werde ich auch so einen Wagen fahren, schwor Charity sich. Sobald ich meinen Abschluss habe ...
»Es war gut, dass du die Anzeige aufgegeben hast«, sagte die Blonde. »Das kam genau richtig. Ich meine, wie viele Leute fahren schon zum Arsch der Welt?« Sie hielt inne und verzog das Gesicht. »Tut mir leid. Du kommst von da, richtig? Ich wollte nicht sagen, dass deine Heimat am Arsch der Welt liegt. Es ist nur eine Redensart.«
»Mach dir keine Sorgen«, sagte Charity. Das kleine Auto schoss auf den Stadtring und ihr langes lockiges Haar flatterte im Fahrtwind. »Es ist am Arsch der Welt. Einfache Leute, einfaches Leben. Aber es hat auch seine Vorteile.«
»Erzähl mir davon!«, stieß die Blonde aus, dann hupte sie einen schwarzen Pontiac an, der sie an der Ausfahrt geschnitten hatte. »Ich wette, da gibt es keine Leute, die so fahren wie dieser Idiot!«
Charity lächelte. Etwas neurotisch, erkannte sie. Und ... Jerrica! So heißt sie! Jerrica Perry. »Na ja ... es ist so lange her. Du bist Autorin?«
»Ich bin Journalistin der Washington Post«, korrigierte sie Jerrica hinter dem gepolsterten Lenkrad. »Lokalredaktion. Bin da seit vier Jahren.«
»Wow. Eine Zeitungsfrau.«
»Keine große Sache. Aber hin und wieder bekommt man von einem der Chefredakteure einen guten lukrativen Auftrag. Das ist mir passiert. Sie haben mir einen dreiteiligen Artikel über die ländlichen Appalachen gegeben. Bringt gutes Geld.«
Charity fragte sich, wie viel. Gutes Geld für Jerrica war vermutlich ein Vermögen für Charity.
»Also, was war das mit deiner Tante?«, fragte Jerrica, als sie auf dem Stadtring auf die Ausfahrt Richmond zusteuerten.
»Na ja, ich bin bei ihr aufgewachsen, bis ich acht war. Dann ...« Warum sollte ihr die Wahrheit peinlich sein? »Ihr Gästehaus geriet in finanzielle Schwierigkeiten und ich wurde in ein Waisenhaus gesteckt.«
»Scheiße, das ist hart.«
»Es war nicht so schlimm«, log Charity. In Wirklichkeit war es ziemlich schlimm gewesen. Sie hatte sich immer wie eine Außenseiterin gefühlt. Aber warum sollte sie das alles einer Frau erzählen, die sie gerade erst kennengelernt hatte? Es war ja gut ausgegangen.
»Mit 18 kam ich raus, hatte zwei Jobs, schaffte meine Hochschulreife. Jetzt arbeite ich an der Uni und belege Abendvorlesungen, weil dafür die Studiengebühren nur halb so hoch sind. Ich will Buchhalterin werden.«
»Klingt gut. Gutes Geld.« Für Jerrica schien alles auf gutes Geld hinauszulaufen.
»Wie auch immer«, fuhr Charity fort. »Meine Tante hat mich eingeladen und da ich noch kein eigenes Auto habe, habe ich die Annonce aufgegeben.«
Jerrica zündete sich eine Zigarette an, der Rauch wehte schnell davon. »Und deine Tante, sagtest du, hat ein Gästehaus?«
»Genau. Eine Zeit lang sah es aus, als wäre es pleite, aber dann hat sie das Ruder wieder herumgerissen.«
»Glaubst du, sie wird uns einen guten Preis machen?«
»Oh, ich denke doch. Ich schätze, sie wird uns gar nichts berechnen.«
»Das klingt ja richtig gut. Die Zeitung zahlt zwar für mich, aber je mehr ich spare, desto mehr kann ich für andere Sachen ausgeben.«
Charity wusste nicht, welche Vorstellungen Jerrica von den Möglichkeiten hatte, in Luntville oder Russell County Geld für »andere Sachen« auszugeben. Doch dann lenkte sie etwas ab, ein goldenes Glitzern.
Ein Ring.
Charity starrte den Diamantring an Jerricas Finger an, als sie den Wagen die lange Ausfahrt zur I-95 entlangsteuerte.
»Der ist wunderschön«, sagte sie. »Bist du verlobt?«
Jerrica zog bei dieser Frage sehr energisch an ihrer Zigarette. »Sozusagen«, antwortete sie. »Ich meine ... ich weiß nicht, ob ich es noch bin.«
Charity fühlte sich in die Enge getrieben, aber sie wusste, dass sie in Wirklichkeit nur neidisch war. Es war nicht nur Nate oder all die anderen Männer – es war komplexer als das. Sie wollte von jemandem geliebt werden, und ...
Keiner ruft nach dem ersten Date je wieder an ...
»Ein schöner Ring«, sagte sie. »Ich hoffe, er ist nett.«
»Das ist er«, sagte Jerrica – etwas zu schnell, wie es Charity schien. »Aber ... ich schätze, die Verlobung ist geplatzt.«
»Was ist passiert?«, traute Charity sich zu fragen.
Jerrica zuckte bei dieser persönlichen Frage mit keiner Wimper. Charity wusste noch nicht viel über Jerrica, aber persönliche Fragen mochte sie offensichtlich. »Ich weiß nicht genau. Es liegt wahrscheinlich an mir. Vielleicht bin ich einfach noch nicht bereit. Ich möchte es sein, aber ... Es ist schwer zu erklären. Und du hast recht, Darren ist ein guter Kerl. Er arbeitet für eine große Gentechnikfirma, verdient gutes Geld. Und ... na, es gibt einfach nichts Schlechtes, das ich über ihn sagen kann. Es liegt alles an mir, glaube ich.«
Charity sackte etwas zusammen. Alles an mir. Wie viele ihrer eigenen Pleiten in der Liebe lagen alle an ihr? Würde sie es je wissen?
Jerrica plapperte weiter. »Ich hoffe, dass mir diese Reise hilft, meine Gedanken zu sortieren. Weißt du, wenn man in D.C. arbeitet, für die Post, kann einen das ganz schön auslaugen. Vielleicht ist das mein Problem: Ich stecke so tief in der Arbeit, dass ich den Rest meines Lebens nicht sehen kann.«
Charity verstand vollkommen, doch da war etwas ...
Was war es?
Sie hatte es schon oft gespürt, bei vielen verschiedenen Leuten. Manchmal dachte sie, sie könne tatsächlich fühlen, was anderen im Kopf herumging. Deshalb sagte sie:
»Aber du liebst ihn, nicht wahr?«
Jerrica warf die halb gerauchte Zigarette aus dem Wagen. Der Highway huschte unter ihnen dahin. »Bin ich so leicht zu durchschauen?«
»Nun – ja, ich glaube schon.«
Eine weitere Pause, eine weitere Zigarette. »Du hast recht. Ich liebe ihn. Ich weiß nur nicht, ob ich überhaupt weiß, was Liebe ist. Und oft denke ich, dass ich es nicht wert bin, geliebt zu werden.«
»Wie kannst du so etwas sagen!«, protestierte Charity. Aber, ganz ehrlich, wie oft hatte sie sich selbst genauso gefühlt? Sicher, sie hatte Jerricas Gefühle gespürt, aber das war auch alles. Sie kannte nicht die ganze Geschichte und sie hatte nicht das Recht, ein Urteil zu fällen. Aber sie sagte lieber: »Na ja, wenn diese Reise vorüber ist, findet sich vielleicht eine Lösung.«
Jerricas Gesicht schien sich hinter dem Lenkrad zu verhärten. Sie hatte Charity kein einziges Mal direkt ins Gesicht gesehen und vielleicht gab es einen Grund dafür. Charity spürte weitere Gefühle aus dem Kopf der Blonden auf sich zuwallen. Schuldgefühle. Scham. Schande. Und noch mehr Schuldgefühle.
Lass es gut sein, dachte sie.
»Wir werden sehen«, stimmte Jerrica mehr oder weniger zu. »Aber jetzt will ich mir darüber nicht den Kopf zerbrechen. Ich will jetzt nur den Highway entlangflitzen, um meine Story zu schreiben und das Land zu sehen.«
»Das ist gut.«
»Aber – was ist mit dir? Ich habe noch nicht einmal gefragt. Bist du verheiratet, verlobt, hast du einen Freund?«
»Dreimal nein«, antwortete Charity bedrückt. »Ich weiß nicht, warum, aber ...« An dem Punkt beschloss sie, lieber nichts zu sagen. Das Letzte, was Jerrica brauchte, war, von ihren eigenen romantischen Problemen zu hören. Was sollte sie schon sagen? Ich gehe mit vielen Männern aus, schlafe sogar mit ihnen – aber keiner ruft je wieder an? »Ich schätze, ich habe einfach noch nicht den Richtigen getroffen«, schob sie stattdessen vor.
»Verdammt.« Zum ersten Mal blickte Jerrica zu Charity herüber und schenkte ihr ein breites, strahlendes Lächeln. »Vielleicht gibt es so etwas wie den Richtigen überhaupt nicht. Aber glaubst du, das interessiert mich einen Scheißdreck?«
Und sie lachten und ließen ihr Haar im Fahrtwind flattern.
Es sah ganz nach einem schönen Tag aus.
(III)
»Was ’n Scheißtag«, sagte Balls.
»Sieht für mich ganz okay aus«, antwortete Dicky Caudill hinterm Steuer. Das war Dickys Karre, und was für ’ne scharfe Karre: ’n pechschwarzer, in zehn Schichten lackierter 69er El Camino mit umgeschliffener Nockenwelle und ’nem frisierten 427er Motor. Rockcrusher-Getriebe, ’n Hurst-Schalthebel, Edelbrock-Krümmer, oh yeah, und offene Thorley-Abgaskrümmer und ’n Mehrkammerauspuff. Hatte Dicky Jahre gekostet, die Karre so hinzukriegen, und wenn man sie jetzt sah, könnt’ man meinen, sie käm’ direkt aus’m Autosalon. Hatte ’ne lange Sitzbank mit blankem Lederpolster, keine Schalensitze, was ganz gut war, weil ... na ja, manchmal nahmen sie jemand mit. Und der Camino war schnell, Leute, schaffte die Viertelmeile in guten 13 Sekunden, und die 450 oder mehr Pferde, die in dem fetten Motorblock pumpten, gaben ihr ’nen Topspeed von locker hundertfuffzig Meilen. Sie hatten schon ’n Haufen Bullenkarren damit abgehängt und einmal sogar ’ne Highway-Streife von der State Police. Hat den Bullen die Scheißtüren voll abgefetzt!
»Yeah, Mann. Scheiße. Jeder Tag is ’n Scheißtag, wenn du mich fragst.«
»Öh ... und warum, Balls?«
»Mag lieber die Nächte.« Balls nahm ’n Schluck Moonshine und glotzte aus ’m Beifahrerfenster, als würd’ er über wichtige Dinge nachdenken. War spät am Nachmittag und sie kamen grad zurück vom Nordkamm, von der Grenze gleich hinter Big Stone Gap. »Weißte was, Dicky?«, sagte er. »So wie ich das seh’, ham wir’s gar nich’ so schlecht. Yeah, eigentlich ham wir ’n ziemlich cooles Leben.«
Dicky musste runterschalten vor der nächsten Kurve der Tick Neck Road, die nach Eads Hills raufführte. »Da hast du recht, Balls, echt recht«, sagte er und war ’n bisschen von den Socken, dass sein bester Kumpel so was wie Dankbarkeit fühlte. »Könnt’ echt schlimmer sein, weißt du, und ’s gibt ’ne Menge, wo wir für dankbar sein müssen, wo so viele Leute am Verhungern sind und bei Kriegen draufgehn und in Gettos leben und alles.«
»Ach, scheiß auf die, Dicky«, spuckte Balls. »Verdammt. Davon red’ ich doch gar nich’. Ich geb ’n Scheißdreck auf diese Penner in ihren Scheißgettos oder auf Leute, die in irgendwelchen Scheißkriegen verhungern oder verrecken. Solln sie verhungern, soll’n sie verrecken. Die Welt brauch’ sie nich’. Wovon ich red’, is’ unser Leben und wie’s für uns läuft!«
Dicky konnte jetz’ nich’ mehr so ganz folgen. Oder irgendwie doch, weil Tritt »Balls« Conner manchmal weiß Gott ’n paar echt wilde Ideen übers Leben hatte. »Yeah, du meinst, ’s gibt ’ne Menge in diesem coolen Leben, wo wir Gott für dankbar sein müssen.«
»Äh, nee, Dicky.« Balls verzog sein Gesicht. »Das is’ auch nich’ das, was ich mein’. Was hat Gott denn je für uns getan?«
»Na ja ...« Dicky hielt inne, um sich ’n Popel aus der Nase zu holen. »Er hat uns dieses coole Leben gegeben, oder?«
»Nä, er hat uns nix gegeben, was auch nur zwei Spritzer Pisse aus ’m Pimmel von ’nem toten Hund wert is’, Dicky! Scheiße, Mann, du kapierst gar nix. Du hast nix von dem verstanden, was ich gesagt hab’.«
Dickys Augenbraue zuckte verwirrt, als er ’n kleinen Schluck aus seiner eigenen Pulle nahm. »Aber ... was meinst du denn, Balls?«
»Was ich meine, Dicky-Boy, is’, dass wir ’n feines und cooles Leben ham – aber nich’ wegen Gott, sondern wegen uns selbst. Scheiße. Alles, was wir ham, is’ auf unserm eignen Mist gewachsen.«
»Ah ... oh. Yeah«, gab ihm Dicky recht und sagte nix mehr. Er wollte nich’, dass Balls wieder mit einem von seinen Vorträgen anfing, davon hatte er schon zu viele gehört. Also hielt Dicky lieber die Klappe und fuhr weiter. Tritt Balls Conner und Dicky Caudill waren Jungs aus der Gegend, beide hinter Luntville aufgewachsen, in der Nähe von Whiskey Bottom ’n Cotswold. Hatten sich in der Siebten auf der Clintwood Middle School kennengelernt, dem Jahr, wo sie beide mit der Schule aufhörten. Waren jetzt beide Mitte 20, Dicky klein und fett mit Stoppelfrisur und Balls ziemlich groß und breit, lange Haare und ’n hartes, gemeines Gesicht mit fetten Koteletten und immer ’ne John-Deere-Kappe auf’m Kopf, auch wenn er schon Jahre nich’ mehr auf der Farm von seinem Alten geschuftet hatte. Dicky wusste, dass Balls die Kappe trug, weil er ’ne kahle Stelle kriegte, und da war er ziemlich empfindlich, also hielt Dicky lieber die Klappe. Und die fette Karre brauchten sie, damit sie schnell abhauen konnten, wenn sie ’ne Fuhre machten. ’n festen Job hatten sie beide nich’, brauchten sie auch nich’. Sie fuhren Selbstgebrannten für Clyde Nale, der oben in ’n Wäldern bei Kimberlin ’n paar Destillen hatte. Der gute Clyde hatte da ’n großes Geschäft aufgezogen und er brauchte Kuriere mit Mumm und deshalb bekamen Balls und Dicky immer die besten Fuhren, weil sie so ziemlich die fetteste Karre im County hatten und die ganzen Schleichwege kannten, deshalb hatten die State Cops und die Jungs vom Zoll einfach keine Schnitte gegen sie, und Balls Conner war so tough, dass er sich nix von den Hillbillys hinter der Grenze gefallen ließ. Und so fuhren sie vier- oder fünfmal die Woche mit ’ner Zweihundert-Gallonen-Ladung Moonshine rüber zu den Händlern nach Harlan in Kentucky. Clyde Nale war ’n cleveres Bürschchen; in Russell County gab’s genug Schnaps, deshalb brannte er seinen Fusel hier – weniger Bullen – und bezahlte Dicky und Balls dafür, das Zeug nach Harlan zu bringen, von wo’s in die »trockenen« Staaten vertickt wurde. Und weil’s ’ne lange und gefährliche Fahrt war, zahlte Nale ihnen 1000 pro Monat, die Balls und Dicky sich teilten. Mit andern Worten: Sie waren echt hart arbeitende junge Männer.
Aber wenn’s immer nur Arbeit gäb’ und keinen Spaß, wären Balls und Dicky bald ziemlich trübsinnig geworden. Also sorgten sie zwischen ’n Fuhren für ordentlich Spaß – einen draufmachen nannten sie’s. Weiber durchficken, Leute von der Straße drängen, sich hinter Bars verstecken und Besoffenen in die Eier treten und ihr Moos einsacken. Und, na ja ...
Manchmal auch Leute abmurksen.
Tote Fotzen reden nich’, hatte Balls beim ersten Mal gesagt. Sie kamen grad von ’ner Tour aus Harlan zurück und da war die schnuckligste kleine Puppe aller Zeiten, ’ne Blonde mit knallengen Shorts und fast nix an oben rum, und trampte mitten in der Nacht auf der Furnace Branch Road. War ’n Mäuschen aus ’n Hügeln und sie hielten an, um sie einsteigen zu lassen, und sie lächelte das strahlendste, schnuckligste Lächeln aller Zeiten und sagte: »Hey, Jungs, echt cool von euch.« Und rutschte gleich neben Balls auf die Sitzbank und Dicky zog die Karre wieder auf die Straße und dachte, sie nehm’ sie nur ’n Stück mit, als er KLATSCH! KLATSCH! KLATSCH! hörte und hinglotzte und entgeistert sah, wie Balls ihr mit seinem selbst gebauten Wagenheber ’n paar überzog. »He, Mann, was soll ’n das?«, jammerte Dicky. »Fahr in ’n nächsten Feldweg rein, dann zeig ich’s dir«, sagte Balls nur und Dicky machte’s und ... na ja, die Einzelheiten sind jetz’ mal nich’ so hübsch, sagen wir also nur, dass Tritt Balls Conner ’n Mordsfick hatte. Er steckte zweimal einen weg, bevor sie überhaupt zu sich kam, direkt da neben der Straße. Yes Sir, war wirklich ’ne hübsche Maus, aber vielleicht grad mal 14 oder so, und als sie mitten in Balls’ zweitem Ritt wach wurde, fing sie an zu schrein, als wollt’ sie alle Toten vom Beall-Friedhof aufwecken, aber Balls lachte nur so laut wie der Teufel selbst und fickte ihre arme junge Pussy einfach weiter in Grund und Boden. Dicky stand dabei und sah zu und, na ja, wie er dieses süße kleine Ding mit zerrissenen Klamotten sah und wie ihre kleinen Titties hüpften und alles – da kriegte er selber ’n mächtigen Ständer und konnte nich’ anders und holte sein’ Lümmel raus und wichste sich kräftig einen ab. Aber dass er wichste, hieß noch lang nich’, dass er gut fand, was Balls machte. He, Mann! ’ne Puppe hier aus der Gegend aufgabeln, ihr eins über die Rübe geben und sie gegen ihren Willen durchnudeln? Das war ’ne Vergewalterung, war das, und wenn die Perle sie identerfizierte, würden Dicky und Balls für 15 Jahre pro Nase in ’n Bau wandern, wo sie von riesigen und hauptsächlich schwarzen Bastarden in ’n Arsch gefickt wurden und ihre Schwänze lutschen mussten, wenn sie nich’ wollten, dass ihnen mit ’m selbst gebastelten Messer der Bauch aufgeschlitzt wurde. Als Dicky deshalb fertig damit war, den letzten Rotz aus seinem Pimmel zu schütteln, meckerte er: »Hey, Balls! Was soll’n wir ’n jetz’ machen?«
»Weiß nich’, was du machst, Dicky, aber ich sag dir, was ich jetzt mach’, verdammt. Ich nehm’ mir jetzt das Arschloch von dieser Schlampe vor.« Und er drehte das arme schreiende Ding um, rammte ihr sein’ dicken Schwanz zwischen die Backen und fickte sie wie verrückt in ’n Arsch, während das Blut aus ihrer Pussy lief wie aus ’m kaputten Wasserrohr.
»Das mein’ ich nicht, Balls!«, rief Dicky da. »Ich mein’, was is’, wenn sie ’n Cops sagt, wie wir aussehn!«
»Halt die Klappe und stör mich nicht«, grunzte Balls und pumpte weiter. Jetzt hatte der Schreikrampf von der Kleinen aufgehört und sie hatte gekotzt und war wieder ohnmächtig geworden. Balls beschleunigte sein Tempo und murmelte: »Yeah, oh Mann, yeah! Das is’ vielleicht ’n Klassearsch, das sag ich dir! Ich werd’ ihr ’ne Ladung Saft mitten in die Scheiße spritzen!« Und genau das machte Tritt Balls Conner dann auch, und als er fertig war, zog er ihn raus und wischte seinen dreckigen Prügel an ihren blonden Haaren ab und spuckte ’n fetten Rotzklumpen mitten auf ihren Kopf.
»Heilige Scheiße, Balls!«, meckerte Dicky weiter. »Sie wird ’n Bullen sagen, wie wir aussehn!«
»Und wie, Dicky?«, fragte Balls mit seinem bösen Grinsen und dann setzte er sich direkt mitten auf ihren Rücken und zog ihren Kopf zurück, bis –
knack!
– ihr Genick brach.
»Sie wird überhaupt niemand gar nix erzählen, weil tote Fotzen nich’ reden«, sagte Balls und schnüffelte. »Scheiße, Mann. Is’ doch echt eklig, wie einem der Schwanz nach ’m Arschfick stinkt!«
Na ja, das war jedenfalls das erste Mal, dass sie jemand abgemurkst hatten, aber danach kamen noch viele. ’ne Anhalterin hier, ’n liegen gebliebener Autofahrer da, Weiber, Kerle, das war Balls echt egal. ’n paarmal hielten sie neben ’nem liegen gebliebenen Wagen an und Balls ballerte dem Fahrer – WUMM! Einfach so! – mitten in die Birne, mit dieser alten, rostigen Knarre, die er von seinem Alten geerbt hatte. ’n anderes Mal fuhren sie grad die Davidsonville Road lang, da war da diese alte Lady in ihrem Rollstuhl auf ’m Weg zum Briefkasten und sie hielten an und Balls riss sie aus ’m Stuhl und warf sie hinten in ’n Wagen. Und nachdem Dicky auf einen von den alten Holzfällerpfaden gefahren war, hat Balls sie wie verrückt von hinten gerammelt – hat sich gar nich’ erst mit ihrer Fotze abgegeben, die sicher sowieso alt und schrumpelig und hässlich war. »Geht nix über ’n guten Arschfick, was, Grandma?« Balls lachte laut. »Schätze mal, so hat’s dir seit 50 Jahren keiner mehr besorgt!« Dann war Balls still und sah nach unten und Dicky sah’s auch, so ’n komischer Beutel, der an der Seite am Bauch der alten Dame hing. »Na, das is’ ja der Hammer!«, rief Balls.
»W-was is’ das, Balls?«, fragte Dicky.
»Das is’ ’n Kackbeutel! So einen hatte mein Onkel Nat auch. Weißt du, wenn du nich’ mehr aus ’m Arsch scheißen kannst, kriegst du so ’n Ding. Die Docs verlegen deinen Darm und bohren ’n Loch an der Seite und dann stecken sie diesen Plastikbeutel dran, und immer wenn du was isst, läuft hinterher die Scheiße in diesen Beutel.«
»Oh, verdammt, Balls«, stöhnte Dicky und machte die Augen zu. »Du meinst, der Beutel is’ voll mit Scheiße?«
»Klar doch, Dicky, aber wir brauchen den jetz’ nich’ mehr.« Und damit riss Balls diesen ekligen Beutel mit dem braunen Zeug vom Bauch der armen alten Lady, und wisst ihr, was er dann machte?
Balls ließ wieder die Hose runter.
»Warum ...« Dicky schluckte. »Warum lässt du die Hose runter, Balls?«
»Scheiße, Dicky. Fick is’ Fick, oder? Verdammt. Ich bin schon wieder hart, ich werd’ jetz’ das Darmloch von der Lady ficken.«
Dicky, müsst ihr wissen, sah wohl gern bei ’nem guten Fick zu, aber das wollte er nun wirklich nich’ sehen. Und als Balls mit dem Loch fertig war, schlug er der armen alten Dame mit seinem selbst gebauten Wagenheber die Rübe ein, bis ihr Hirn überall verstreut war, und dann nahm er diesen braunen Plastikbeutel und quetschte den stinkenden Inhalt über ihren Kopf. Nur so zum Spaß.
Na ja, so ’n Bursche war eben Tritt Balls Conner, und das war eben die Art von Spaß, den die Jungs sich zwischen ihren Fuhren für Clyde Nale gönnten. Und ...
»Ja, heilige Scheiße!«, schrie Balls in dem Moment fast.
Oh nee, dachte Dicky, denn er hatte’s auch gesehen.
Mitten im hellen Tageslicht stand sie da, ’ne richtig süße kleine Brünette mit langen, schlanken Beinen und abgeschnittenen Jeans und ’n Paar richtig leckeren Möpsen, die sich unter ihrem Top spannten. Und sie stand da direkt an der Tick Neck Road und lächelte wie nur was und hielt ihren Daumen raus.
»Scheiße, Mann«, sagte Balls. »Halt diese Schrottkarre an, Dicky. Wir werden der Puppe ’n Ritt spendieren.«
(IV)
Jerrica wusste nicht so recht, was sie von ihrer Mitfahrerin halten sollte. Charity war sehr nett, eine sehr hübsche Frau, und sie schien sehr introspektiv und intelligent zu sein. Aber ...
Hmm, dachte Jerrica hinter dem Lenkrad des Miata.
Es war etwas fast schon Geheimnisvolles an ihr, das sich ängstlich hinter der Fassade der Schüchternheit und Introvertiertheit verbarg. Sie ist 30, aber sie ist nicht verheiratet, hat nicht einmal einen Freund. Das konnte Jerrica Perry natürlich kaum begreifen. War sie lesbisch? War sie katholisch oder irgendwas?
»Also was genau machst du beruflich?«, fragte Jerrica. Sie fuhren jetzt schon lange auf der Interstate 199, die Ausfahrt zur Route 23 dürfte noch ungefähr 20 Meilen entfernt sein. »Du arbeitest an der University of Maryland?«
»Nur als Verwaltungsangestellte«, gestand Charity, während ihre braunen Locken im Wind tanzten. »Aber ich belege auch Vorlesungen.«
»Wo bist du zur High School gegangen? Ich war in Seaton.«
»Ich war auf keiner High School. Ich musste mir einen Job suchen, als ich das Waisenhaus verließ.«
Waisenhaus. Mist, Jerrica, du weißt wirklich, wie man die falschen Fragen stellt. Aber immerhin hatte sie das sprichwörtliche Eis gebrochen. »Ich schätze, das war ziemlich hart, oder?«
»Ich hatte mehr Glück als die meisten«, gab Charity zu. »Aber so, wie das System funktioniert – na ja, es ist fast unmöglich, unter diesen Umständen einen High-School-Abschluss zu schaffen. Es ist eine andere Welt. Und wenn du 18 wirst, geben sie dir einen Tritt, drücken dir 100 Dollar in die Hand und wünschen dir viel Glück. Ich habe in drei lausigen Jobs gearbeitet, um über die Runden zu kommen, schaffte gerade eben meine Collegezulassung. Aber die meisten dieser Mädchen kommen nicht so gut davon, sie landen auf der Straße, wissen nicht, wohin, und eh sie sich’s versehen, enden sie im Stall eines Zuhälters und hängen an der Nadel. Ich hatte wirklich Glück.«
Jerrica wollte etwas Passendes sagen, aber alles, was ihr einfiel, waren Statistiken aus ihrer eigenen Zeitung. »Stimmt, ich habe gelesen, dass es in diesem Land 800.000 Waisen gibt, aber nur ein Drittel von ihnen schafft einen Schulabschluss und findet einen Job. Der Rest verschwindet entweder oder landet auf der Straße.«
»Genau, und das ist das Traurige daran. Meine Tante hat mich aufgezogen, aber der Staat hat ihr die Vormundschaft genommen, weil sie nicht genug Geld verdiente. Trotzdem wäre es besser für mich gewesen, wenn ich bei ihr geblieben wäre, da bin ich mir sicher.«
»Wahrscheinlich vermisst du deine Tante sehr, wo du sie so lange nicht gesehen hast.«
»Ja, doch, eigentlich schon. Es ist 20 Jahre her und nach so einer langen Zeit erinnert man sich nur noch vage an einen Menschen. Ich meine ... ich erinnere mich noch an sie – ob du es glaubst oder nicht, ich erinnere mich noch an sehr viel von zu Hause –, aber es ist so weit weg, dass es mir kaum real erscheint. Deshalb bin ich ein bisschen nervös. Ich habe keine Ahnung, wie es sein wird, wenn ich sie wiedersehe, und wenn ich Luntville wiedersehe.«
»Na, du hast jedes Recht, nervös zu sein«, sagte Jerrica, aber sie konnte sich vorstellen, wie unaufrichtig das klingen musste. Was wusste sie schon von der wirklichen Welt? In Potomac von millionenschweren Eltern aufgezogen, das ganze Leben auf Privatschulen verbracht, ein brandneuer Z28 zum 16. Geburtstag. Ich weiß einen Scheißdreck, gestand sie sich ein.
»Also, wie war das jetzt mit diesem Darren?«, fragte Charity als Nächstes.
Wow. Jetzt war Jerrica an der Reihe. Doch komischerweise und vor allem nach Charitys eigener Beichte fühlte sie sich überraschend offen. »Ein heißer Typ, 30, guter Job – er arbeitet für eine Biotechnologiefirma in Bethesda. Ein guter Fang, keine Frage. Und er war Dynamit im Bett.«
Charity errötete leicht und beeilte sich, fortzufahren. »Aber hast du nicht gesagt, dass du die Verlobung beendet hast?«
Jerricas Gedanken rasten, als sie es zu formulieren versuchte. »Ich weiß nicht, es ist schwer zu sagen. Ich ... ich habe ihn rausgeworfen.«
»Warum?«
Noch mehr Zögern. Sei ehrlich!, befahl sie sich selbst. Und was spielte es schon für eine Rolle? Charity war jemand, den sie gerade erst kennengelernt hatte und nach dieser Fahrt wahrscheinlich nie wiedersehen würde. Jerrica zündete sich noch eine Zigarette an, zeigte ihre Zähne und blinzelte. »Er hat mich erwischt.«
»Erwischt?«
»Er hat mich mit zwei anderen Kerlen im Bett erwischt. Ich habe ihn betrogen.«
Charitys Gesicht zeigte offene Verwirrung. »Aber du hast doch gerade gesagt ...«
»Ja, ich weiß. Ich habe gesagt, dass er Dynamit im Bett war. Das stimmt auch. Aber ... ich schätze, ich habe ein Problem. Ich meine, ich liebe ihn – immer noch. Aber ich habe ihn trotzdem links und rechts betrogen, so wie ich jeden Freund betrogen habe, den ich in meinem Leben hatte. Es hatte nie etwas mit Liebe zu tun oder damit, dass Darren mir vielleicht nicht geben konnte, was ich brauche. Es war ... etwas anderes. Ich weiß nicht. Vielleicht bin ich sexsüchtig oder so was.«
»Vielleicht solltest du einen Therapeuten aufsuchen«, schlug Charity vor.
Normalerweise wäre Jerrica jetzt in die Luft gegangen. Aber aus irgendeinem Grund war es anders, als Charity es sagte. »Das hat Darren auch gesagt, er wollte, dass ich zu den Anonymen Sexsüchtigen gehe oder so, aber ich konnte mir einfach nicht vorstellen, mir so etwas anzutun. Und ich war eine Zeit lang bei einigen Therapeuten, aber es hat nichts gebracht.« Ihre Gedanken sprangen einen Satz zurück. Einen Moment mal ... ist es das, was ich bin? Sexsüchtig? Es klang so klischeehaft, wie eine dieser modernen Ausreden dafür, dass man sich dem Genuss und der Verantwortungslosigkeit hingab. Nichts war mehr eine Schwäche, alles war eine »Krankheit«: Alkoholismus, Drogenabhängigkeit, Spielsucht, ja, sogar Esssucht. Und Sex auch. Verdammt, heutzutage war sogar Ladendiebstahl eine Krankheit. Jerrica konnte das nicht glauben, trotz ihrer eigenen Fehltritte.
Und davon hatte es viele gegeben.
Sie hatte mitgezählt. Über 500, seit sie mit 16 ihre Unschuld verloren hatte. 500. Und sie war erst 28. Halbherzig versuchte sie, es zu erklären. »Ich weiß nicht, was über mich kommt. Wenn ich mit einem Mann zusammen bin, werde ich zu einem anderen Menschen. Ich brauche ... ich brauche die Empfindung, die Stimulation. Jedenfalls glaube ich, dass es das ist.« Sie hatte irgendwann einmal in der Cosmo etwas über »Sensualisten« gelesen, die sich nach den Gefühlen sehnten, die andere bei ihnen auslösten. Noch mehr Ausreden, sich aus der Verantwortung zu stehlen. Jerrica glaubte keine Sekunde daran. Aber andererseits ...
Sie wusste nicht, was sie glauben sollte.
Und da erst wurde ihr bewusst, was sie hier alles erzählte. Mein Gott, krächzte sie in Gedanken. Charity war im Grunde eine völlig Fremde und Jerrica erzählte ihr gerade Dinge aus ihrem intimsten persönlichen Leben. Aber vielleicht war das ja auch völlig in Ordnung. Manchmal musste man über solche Dinge reden, mit einem Menschen, der ungefährlich war. Denn das war Charity: ungefährlich.
Doch genug war genug; Jerricas Gedanken rasten wie eine Ratte in einem Labyrinth auf der Suche nach dem Ausgang. Sie zündete sich noch eine Zigarette an und wechselte das Thema. »Erzähl mir mehr über dich. Immerhin weiß ich schon, dass du nicht verheiratet bist und keinen Freund hast.«
Charity senkte sofort den Blick. Nicht aus Verlegenheit, sondern aus Verwirrung. Genau wie Jerrica war auch Charity Walsh verwirrt, nicht wegen der Welt und der Menschen darin, sondern wegen sich selbst. »Ich verstehe es nicht«, sagte sie. »Ich bin schon oft mit Männern ausgegangen – ich mag Männer –, aber ... aber noch nie in meinem Leben bin ich zweimal mit dem Gleichen ausgegangen. Ich kapier’s einfach nicht. Ich habe keine Ahnung, was ich falsch mache.«
»He, gib dir nicht selbst die Schuld, wenn es nicht richtig läuft«, sagte Jerrica. »Gott, ich stehe auch auf Männer, aber ich wäre nicht die Erste, die dir versichern würde, dass sie alle Arschlöcher sind. Aber, äh ... bist du ... hast du ...?«
»Ob ich bei der ersten Verabredung Sex mit ihnen hatte?« Charity errötete wieder. »Ja. Jedes Mal. Aber es hat nicht ... geklappt.«
Nicht geklappt. Selbst Jerrica mit ihren vielfältigen Erfahrungen konnte das nicht ganz begreifen. Vielleicht ist sie im Bett eine Niete, überlegte sie. Vielleicht weiß sie nicht, wie man richtig einen bläst ... Aber das waren natürlich Sachen, die sie niemals laut sagen konnte.
»Irgendwas funktioniert einfach nicht, irgendwas passiert einfach nicht, verstehst du?«, fuhr Charity verlegen fort. »Ich weiß nicht, was es ist.«
Diese Aussage ließ sich auf unterschiedlichste Weise interpretieren. Meinte sie Orgasmen? Meinte sie Chemie? »Weißt du«, begann Jerrica, ohne weiter zu spekulieren, »ich glaube, im Endeffekt läuft alles darauf hinaus, den Richtigen zu finden. Vielleicht ist das unser Problem. Wir haben nur noch nicht den Richtigen gefunden.«
Charitys schmale Schultern hoben und senkten sich.
Ja, vielleicht war es das.
Sie bogen auf die Route 23 ab, der kleine rote Wagen flitzte über die offene Landstraße, während weite Felder an ihnen vorbeizogen. Sie fuhren jetzt zwischen den Allegheny Mountains und den Appalachen entlang. Die Welt hatte sich tatsächlich verändert, der Herrschaftsbereich der Wolkenkratzer und des Smogs war von Waldrändern und Vogelscheuchen abgelöst worden. Für Jerrica war es fremd und doch belebend. Sie konnte es kaum erwarten, ihren Artikel über die ländliche Kultur der Appalachen zu schreiben. Die Reise versetzte sie in Begeisterung, doch eine Sache pochte ständig in ihrem Hinterkopf ...
Wie lange kann ich ohne ...?
Sie wagte es nicht einmal, die Frage zu beenden.
»Es tut so gut, zurück zu sein«, sagte Charity.
»Was?«
»Ich war mir nicht sicher, wie ich mich fühlen würde, aber jetzt, wo wir wieder in diesem hügeligen Land sind, wird mir klar, dass es die richtige Entscheidung war, zurückzukommen. Die Menschen, die hier leben, sind einfache Menschen und auch ihr Leben ist einfach. Aber es ist so viel ehrlicher und wirklicher als da, wo wir herkommen.«
Jerrica dachte darüber nach, als sie eine weitere Kippe aus dem Wagen schnippte. Der Motor schnurrte, das Chassis saugte den Wagen in den engen Kurven auf den Asphalt. Auf beiden Seiten erstreckten sich wunderbar weites Grün und Wälder. Und die Luft roch so sauber, dass Jerrica fast high davon wurde.
Und Charity war die perfekte Beifahrerin. Sie kannte die Gegend und ihre Tante hatte ein Gästehaus – besser ging es nicht. Sie folgte Charitys Richtungsangaben und eine Stunde später passierten sie ein rostiges grünes Ortsschild mit der Aufschrift LUNTVILLE.
Luntville. Jerrica hatte natürlich gewusst, dass das der Ort war, in den sie fuhren; aber erst jetzt ließ der Name etwas bei ihr klingeln. Etwas, das sie gelesen hatte. »He, kann es sein, dass ich vor einiger Zeit mal was in der Zeitung gelesen habe, etwas über ein Ordenshaus oder ein Kloster in der Nähe von Luntville?«
»Eine Abtei, glaube ich«, korrigierte Charity. »Aber ich weiß nichts darüber. Du kannst vielleicht meine Tante fragen.«
Genau, sie hatte es nicht in der Zeitung gelesen, sondern im Redaktionsnetzwerk. Es hatte irgendwelche Kontroversen gegeben, wenn Jerrica sich richtig erinnerte. Irgendetwas über ein Hospiz und sterbende Priester. Hmmm. Aber bevor sie weiter darüber nachdenken konnte, erklärte Charity mit ausgestrecktem Finger: »Bieg hier ab!«
Jerrica bog ab. Sie stöhnte innerlich. Sie waren jetzt seit zehn Stunden unterwegs; würden sie jemals ankommen?
»Wir sind da!«, sagte Charity, ihr rundes Gesicht strahlte vor Fröhlichkeit.
Jerrica verlangsamte, als sie an dem Holzschild vorbeikamen, dann bog sie ab und fuhr einen langen Schotterweg hinauf. An seinem Ende öffnete sich eine Lichtung. Und in der Mitte der Lichtung stand ein wunderschöner hölzerner Landgasthof mit einer langen umlaufenden Veranda, Zedernschindeln und großen Erkerfenstern, all dies inmitten eines üppig bewaldeten Tales. Ein Holzschild verkündete: ANNIES GÄSTEHAUS. 20 DOLLAR PRO NACHT. ZIMMER FREI.
»Das ist es?«, fragte Jerrica. Ihr helles blondes Haar kam endlich zur Ruhe und hing in der sanften Brise locker herab.
»Das«, sagte Charity, »ist es.«
DREI
(I)
»Tante Annie!«, rief Charity. Sie breitete die Arme aus. Die Frau, die auf die Veranda getreten war, sah aus wie etwa 60. Sie hatte schneeweißes Haar und war trotz ihres Alters attraktiv; ein warmes Lächeln lag auf ihrem leicht verwitterten Gesicht. Sie trug ein abgenutztes weißes Sommerkleid und schwarze Arbeitsstiefel. Kühle blaue Augen schienen sich auf die Besucher zu heften, als sie aus dem Wagen stiegen.
Die alte Frau stand auf der Veranda und brach in Tränen aus.
Charity war plötzlich in einem Zeitloch. Die Welt blieb stehen. Alles, was sie sah, schien eingefroren zu sein, und sie stellte fest, dass sie mehr auf sich selbst blickte als auf alles andere. Nein, es war ihr nicht klar gewesen, wie es sich anfühlte, nach Hause zu fahren, und sie hatte auch nicht gewusst, was es für ein Gefühl sein würde, Tante Annie wiederzusehen. Luntville, ihre Tante, dieses Haus – das alles waren die zerbrochenen Scherben ihres Lebens, die man am besten mit allem anderen hinter sich zurückließ, zusammen mit den tieferen Wunden: dem Tod ihres Vaters, den psychischen Problemen und dem Selbstmord ihrer Mutter, den Eltern, die sie nie gekannt hatte, den Schatten. Doch jetzt, wo sie mitten in diesem erstarrten Bild ihrer Erinnerung stand, wusste sie, dass sie das Richtige getan hatte. Das einzig Mögliche, um genau zu sein.
Die Rückkehr nach Luntville würde Charity die Möglichkeit geben, sich selbst gegenüberzutreten und all den Teilen ihres Selbst endlich den richtigen Platz zuzuweisen. Und das waren eine Menge Teile.
Charity, jetzt selbst in Tränen aufgelöst, umarmte ihre Tante auf der Verandatreppe.
»Oh Gott, Charity«, heulte Tante Annie. »Dich wiederzusehen, ist ein Geschenk des Himmels.«
»Aber ihr müsst müde sein«, sagte Annie und führte sie in den Salon. »Nach so einer langen Fahrt.«
»Es war nicht so schlimm«, sagte Jerrica. »Ungefähr zehn Stunden.«
»Oh, tut mir leid«, entschuldigte sich Charity, die vergessen hatte, ihre Begleiterin vorzustellen. »Das ist meine Freundin Jerrica Perry. Sie arbeitet für diese große Zeitung in Washington.«
»Freut mich, Sie kennenzulernen«, sagte Annie und reichte Jerrica ihre kleine, weiße Hand. »Eine Reporterin, hm?«
»Nicht ganz«, gab Jerrica zu. »Ich schreibe für die Lokalredaktion der Post. Ich gehöre zur Belegschaft, aber ich bekomme nur ganz bestimmte Aufträge. Und deshalb ist es ja so großartig, dass Charity und ich zusammen hierherfahren konnten.«
Tante Annie hielt inne und versuchte sich ihre Verwirrung nicht anmerken zu lassen. »Ich versteh nich’ ganz, was Sie meinen.«
Mein Gott, dachte Jerrica. Ich glaube, Charity hat ihr überhaupt nichts von mir gesagt. »Wir haben uns bei den Kleinanzeigen getroffen. Wir wollten beide Annoncen wegen der Fahrt hierher aufgeben. Meine Zeitung hat mich damit beauftragt, eine Serie von Artikeln über ländliche Regionen in der Nähe von Washington, D.C., zu schreiben. Die ersten Artikel werden von dieser Gegend hier handeln, zwischen den Allegheny Mountains und den Appalachen.«
»Das klingt nach einer wundervollen Chance für eine hübsche junge Frau wie Sie, in Ihrem Beruf, meine ich.«
Jerrica war verdutzt. Sie war sich nicht ganz sicher, was das heißen sollte. Normalerweise würde sie sich jetzt beleidigt fühlen; sie hasste es, wenn im Zusammenhang mit ihrer Karriere auf ihr Geschlecht angespielt wurde. Doch dann überlegte sie: Sie stammt aus einer anderen Welt, aus einer anderen Gesellschaft ... »Ja, so ist es«, antwortete sie, und es stimmte ja auch. Sie arbeitete für die Zeitung, seit sie ihren Abschluss an der Uni gemacht hatte, und dies war der erste richtig gute Rechercheauftrag, den sie bekommen hatte. Sie versuchte, die Unterhaltung etwas zu beleben. »Es ist eine Chance, da haben Sie recht, und das Beste dabei ist: Mein Chef bezahlt alles.«
Tante Annie legte den Kopf etwas schief. »Na, wegen Kost und Logis brauchen Sie sich keine Gedanken zu machen.« Sie klopfte Charity auf die Schulter. »Ich würde nich’ im Traum dran denken, einer Freundin meines kleinen Mädchens etwas zu berechnen.«
»Ich weiß Ihre Großzügigkeit sehr zu schätzen«, antwortete Jerrica, aber ihr war der Ausdruck in Charitys Gesicht nicht entgangen. Hier scheint es noch ein paar Kommunikationsprobleme zu geben, dachte sie. Lieber nicht fragen ...
»Das mit den Schildern ist schön«, sagte Charity und ließ sich endlich entspannt in die großen Kissen des Sofas sinken. »Wir haben sie überall an der Interstate gesehen. ›Annies Gästehaus‹, alle 20 oder 30 Meilen. Die müssen ein Vermögen gekostet haben.«
»Haben sie auch«, gab Annie zu. »und das is’ auch etwas, worüber wir reden müssen.«
Doch bevor Annie fortfahren konnte, unterbrach Charity sie wieder. »Und das Haus erst – es sieht großartig aus. Es sieht fast aus wie neu.«
»Na ja, nich’ wirklich neu«, schmunzelte Annie. »Aber ich hab’ einiges in die Renovierung gesteckt. Die McKully-Brüder – erinnerst du dich an sie? Sie haben bei der Renovierung hervorragende Arbeit geleistet und sie haben es für einen Spottpreis gemacht, wenn man die wirtschaftliche Lage bedenkt. Und was die Straßenschilder angeht – sie sind nich’ billig, aber sie bringen die Kundschaft her, vor allem im Herbst und Frühling.«
Charity beugte sich gespannt vor. »Aber, Tante Annie, wie konntest du dir das alles leisten?«
Wieder reagierte Annie zurückhaltend und zögerlich. »Ich bin zu etwas Geld gekommen. So wie jeder hier auf dem Nordkamm. Ich ... ich werde dir später alles erzählen.«
»Das ist doch wundervoll!«, freute sich Charity.