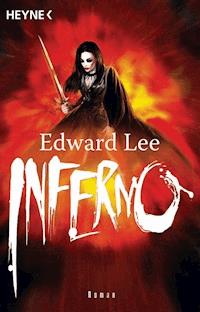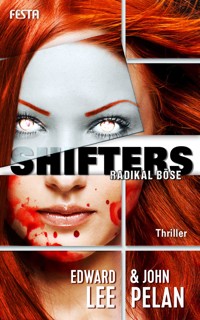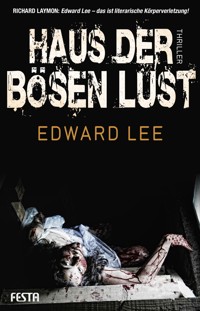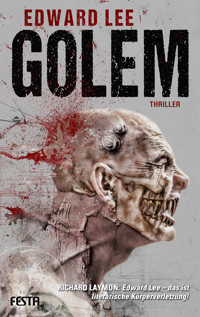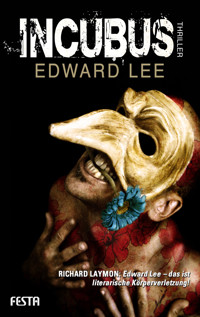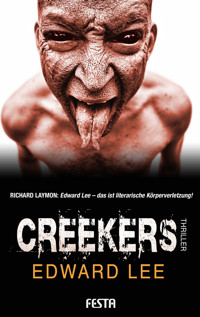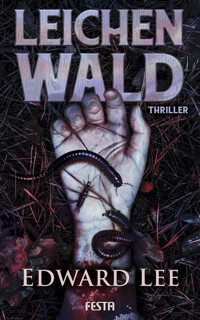
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Festa Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Eine Prostituierte, die fast zu Tode gewürgt und dann lebendig verscharrt wird. Kinder, die im Wald spielen – und nie wieder zurückkehren. Frauen, die vergewaltigt und ermordet werden. Männer, die man einfach so abschlachtet. Und überall ausgebuddelte Leichenteile … Willkommen zu Hause, Patricia. Als Patricia White in ihre verhasste Heimatstadt zurückkehrt, erwartet sie dort keine idyllische Landschaft zwischen Wäldern und Meer. Der beschauliche Ort wird von einer Serie bizarrer Morde heimgesucht, völlig wahllos und so grauenhaft, dass panische Angst um sich greift. Wurde die Stadt wirklich vom Bösen verseucht, namenlos und älter als die Sünde selbst? Richard Laymon: »Edward Lee – das ist literarische Körperverletzung!« Horror Reader: »Ein perverses Genie.«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 450
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Aus dem Amerikanischen von Simona Turini
Impressum
Die amerikanische Originalausgabe Backwoods
erschien 2005 im Verlag Leisure Books.
Copyright © 2005 by Edward Lee
Copyright © dieser Ausgabe 2021 by Festa Verlag, Leipzig
Titelbild: Arndt Drechsler-Zakrzewski
Alle Rechte vorbehalten
eISBN 978-3-86552-933-6
www.Festa-Verlag.de
Dieses Buch ist für Pam Herbster.
Ich bin sehr dankbar für die Freundschaft, Inspiration und Unterstützung so vieler Menschen:
Tim McGinnis. Dave Barnett, Rich Chizmar, Doug und Matt, Don D’Auria, Jack Ketchum, Tom Pic, Michael Slade, Cooper, Keene, Mike R. und alle »Horrorfinder«.
Das Testleser-Komitee: Pam (deren Blut auf dem Ausdruck den Wert exponentiell erhöht hat!), Bob Strauss und Ben Ricciardi.
Besonderer Dank gilt David Graham und Lord Gore. Außerdem meinen ganz besonderen Freunden: Christy und Bill, Darren, R. J. Myers, Kathy, Sarah S., Karyn Valentine und Patti Beller, Jeff Walton und natürlich Charlie Meitz und Tim Shannon – für internationale Krustentiere, besonders Portunus holsatus.
PROLOG
Der Mond verschwamm vor seinen Augen. Während er wartete, starrte er vor sich hin, starrte durch den Schleier der Nacht zur anderen Seite des Flusses. Er lächelte. Bald …
Das Mondlicht schien auf stillstehende Bulldozer, Bauholzstapel und Wohnwagen, die offenbar als Büros dienten. Fortschritt, hatte sein Gönner vor nicht allzu langer Zeit gesagt. Fortschritt bedeutet mehr Jobs, mehr Zufriedenheit und mehr Geld. In Ihrer Tasche und in meiner. Das ist exponentiell.
Dwaynes Kenntnisse der englischen Sprache schlossen dieses spezielle Adjektiv nicht ein – aber er glaubte zu verstehen. Er sorgte für Fortschritt, und das war etwas Gutes, nicht wahr?
Eine knarzende Stimme drang aus dem Dunkel: »Ich will, dass Sie diesen Job zu meiner vollen Zufriedenheit erledigen.«
»Das mach ich doch immer, oder etwa nich’?«, sagte Dwayne Parker. Als der schnell eingeschnappte Redneck, der er nun mal war, fühlte er sich von der Bemerkung des anderen Mannes beleidigt.
»Das tun Sie, o ja. Das will ich nicht leugnen.«
»Wurd noch keiner gefunden, oder?«, forderte Dwayne ihn heraus.
»Richtig.«
Arbeitsstiefel knirschten leise, als der Sprecher vortrat. Im Mondlicht erkannte Dwayne Blätter und Moos, die an den Stiefelspitzen klebten, aber keinen Schlamm wie an seinen eigenen. Das war der wahre Unterschied zwischen Angestellten und Arbeitern, zwischen Köpfchen und Kraft. Na und?, dachte er. Ich wette, ich werd doppelt so oft flachgelegt wie der … Das schien ihm ein fairer Ausgleich.
»Klingt, als würden Sie mir nich’ zutrauen, den Job richtig zu erledigen«, gab Dwayne schließlich zu. »Ihr Tonfall und so. Vielleicht weil ich kein toller College-Absolvent bin wie Ihre Kumpels.«
»Seien Sie nicht so unsicher.« Jetzt schwang im Tonfall etwas Neues mit. Das gefiel Dwayne gar nicht, aber er ging nicht weiter darauf ein. Die Stiefel machten noch ein paar knirschende Schritte nach vorn, unter ihnen brachen Zweige. Mondlicht drang zwischen den Bäumen hindurch, die Schatten der Äste legten dunkle Balken auf das Gesicht des anderen Mannes. »Ich setze höchstes Vertrauen in Sie«, sagte er zu Dwayne und reichte ihm einen Umschlag.
Schon besser …
Im Umschlag befanden sich fünf druckfrische 100-Dollar-Scheine.
Die Stimme des anderen schien zu schwingen, ein tiefes Hallen aus einem kaum erkennbaren Gesicht. »Sie werden das nicht mehr allzu häufig machen müssen, ehe alle abhauen.«
»Und was is’ dann?«, fragte Dwayne.
»Ihre Frau verkauft Ihr Land an mich. Dann ist sie reich, und Sie sind es auch.«
Dwayne steckte das Geld ein. O ja, so ist es. Und bis dahin werd ich ’ne Menge Spaß haben.
Die Zikaden zirpten, ein fast elektrisch klingendes Dröhnen, das aus dem Wald in alle Richtungen schallte. Wenn es ein Geräusch gab, dessen man schnell überdrüssig wurde, dann dieses. Es bedrückte ihn wie die widerlich süße Feuchtigkeit des Sumpfes.
»Hier isses gut«, sagte Dwayne.
Die Frau wirkte überrascht. »Hier?«, fragte sie. »Willste nich’ lieber in meine Hütte?«
Dwayne runzelte die Stirn. Er wusste, wie die Squatter, die schon seit Ewigkeiten geduldeten Landbesetzer der Gegend, lebten: Die meisten hatten Blechhütten an der Bucht. Er zögerte. »Ähm …«
»Oh, ’s is’ hübsch da«, versprach die Frau. »Nich’ wie die andern. Meine Brüder haben’s für mich gebaut, un’ jetzt, wo ich 18 bin, wohn ich da ganz allein.«
Dwayne unterdrückte ein Grinsen. 18? Scheiße, das Mädel sieht höchstens aus wie 14. Sie war spindeldürr, wog vielleicht 40 Kilo. Aber alle Squatter wirkten winzig – typisch für Stanherds Sippe. Die Größten ihrer Männer erreichten 1,70 Meter und die Frauen waren alle wie die hier: 1,50, höchstens 1,52. Das musste was Vererbtes sein, im Blut ihrer Vorfahren. Stanherds Squatter waren kleine Leute.
Aber was hatte sie gesagt? Sie will nicht im Wald anschaffen, dachte er. Ich soll mit ihr in ihre Bude gehen – Scheiße, nein. Jemand könnte ihn sehen.
»Nee, hier is’ gut«, wiederholte er. »Ich hab nur Zeit für ’nen Quickie.«
Im Dunkeln wirkte die Frau wie ein geschmeidiger Schatten. »Oh, okay«, sagte sie. »’s wird spät und deine Frau will bestimmt wissen, wo du warst.«
»Lass meine Frau mal meine Sorge sein«, sagte Dwayne genervt. »Die hat mir gar nix zu sagen.«
»Wird die nie misstrauisch?« Die Frau stellte diese Frage aufreizend gelassen und zog dabei ungeniert ihre Flip-Flops und die Shorts aus. »Wir ham sie alle so gern, so großzügig, wie sie zu uns is’.«
Verschissene Krebse knacken zum Mindestlohn, dachte Dwayne mit einem weiteren verborgenen Lächeln. Und diese Siebhirne glauben, das wär viel Geld. Scheiße. Natürlich hatte Dwayne das selbst eine ganze Zeit lang gemacht, das und alle möglichen anderen Handlangerjobs für Leute ohne Vorurteile. Müllcontainer leeren, Abfall entsorgen, Ölwechsel und all so was – jeden Job, den sein Bewährungshelfer ihm beschaffen konnte.
Dwayne war jetzt fast 40 und hatte schon dreimal im Gefängnis von Russell County eingesessen, insgesamt sieben Jahre. Nach dem letzten Mal (zwei Jahre, tätlicher Angriff mit einem Baseballschläger) war er hier gelandet, um für Agan’s Point Krustentiere Krebsfleisch zu pulen. Nicht gerade der tollste Job, den er je gehabt hatte. Nach einer Weile hatte er begonnen, nach Krebs-Innereien zu stinken; egal wie oft er duschte, ständig ging ein schaler, fischiger Geruch von ihm aus. Aber dann hatte er Judy kennengelernt und sein Leben hatte sich vollkommen verändert. Ihr gehörte die Firma, und ihre Schwester oben in D. C. hatte ihr bei der Umstrukturierung geholfen. Ein Kleinunternehmen, das heimlich, still und leise sehr lukrativ geworden war. Als Dwayne Judy lange genug umgarnt hatte, hatte sie ihn regelrecht angefleht, sie zu heiraten. Und jetzt?
Jetzt bin ich fein raus, dachte er.
Dwayne musste keine Krebse mehr pulen. Jetzt war er der Aufseher über die Squatter und das übrige Gesindel, die das taten.
Aber man bekam niemals genug, oder etwa doch?
Die 500 Dollar in seiner Tasche erinnerten ihn daran.
Als sich die Frau im Mondlicht umwandte, erkannte Dwayne, dass sie mittlerweile völlig nackt war. Die Schlampe verschwendet keine Zeit, dachte er. Er erkannte noch etwas anderes: einen Hinweis, dass sie wirklich mindestens 18 Jahre alt war. Volle, feste Brüste mit dunklen Nippeln; sehr feminine Formen von den Schultern über die Taille bis zur Hüfte; ein üppiger Wuchs ungebändigten Schamhaars. Nicht dass Dwayne ein Problem mit Unzucht mit Minderjährigen hätte … Nein, bei der nicht, dachte er. Oder bei den anderen sechs.
»Ich kann’s nich’ fassen, dass du’s lieber hier machen willst als in meiner Hütte«, sagte sie. Sie beugte sich im Dunkeln nach vorn, als würde sie Netzstrümpfe anziehen. Aber warum sollte sie das tun? Mitten im Wald?
»Un’ wie gesagt«, fuhr sie fort, »deine Frau is’ so nett zu uns un’ gibt uns gute Arbeit.« Sie blickte direkt zu ihm auf, ihre Augen wie dunkle Funken. »Ich find’s nich’ so gut, das hier zu machen, wo du doch Miss Judys Mann bist un’ so.«
Dwayne runzelte die Stirn. »Hey, Geld ist Geld, oder etwa nich’? Du willst mit mir wegen meiner Frau nich’ ficken? Na, eine von deinen kleinen Freundinnen macht’s bestimmt. Ohne zu nörgeln.«
»Ich weiß …«
»Außerdem geb ich dir 20 Kröten für fünf Minuten deiner Zeit. Dafür müssteste drei Stunden lang Krebse pulen.«
»Ich weiß«, wiederholte sie.
Mehr blieb nicht zu sagen. Die Squatter waren arm und sie waren nicht einmal registrierte Bürger. Unsichtbar wie illegale Einwanderer. Sie arbeiteten hart für wenig Geld, und die attraktiveren Mädchen – wie diese hier – nutzten zusätzlich andere Einkommensquellen. So lief es in der Welt, seit die Menschen von den Bäumen geklettert waren.
Dwayne kniff die Augen zusammen, um im Dunkeln etwas zu erkennen. Was macht sie? Wieder beugte sie sich nach vorn, und wieder fand er, dass es aussah, als zöge sie Strümpfe oder Hüfthalter oder so etwas an. Ja, sie hatte irgendetwas hochgezogen, bis zu ihren nackten Oberschenkeln.
»Was ziehste da an?«, fragte er sie schließlich.
»Weizenbänder«, sagte sie. »Muss aber ’n bestimmter Weizen sein, un’ sie sind gar nich’ so leicht zu machen. Schwer, die Körner zusammenzuhalten, wenn man sie ans Band näht.«
Was zum Teufel?, dachte er. Plötzlich fühlte er sich abgelenkt. Zunächst mal vom endlosen Chor der periodisch in Massen auftretenden Zikaden, diese hier in der Dreijahresvariante. In diesem Teil Virginias, in Agan’s Point, gab es sie alle – drei Jahre, sieben Jahre, 13 Jahre und 17 Jahre. Als Kind hatte Dwayne diese Wellen um Wellen von Insektenlauten als rätselhaft und fesselnd empfunden. Aber jetzt – ein Ex-Häftling kurz vor der 40 – fand er sie nur noch nervtötend.
Auch die Stimme der Frau irritierte ihn, ihr Akzent. Alle Squatter hatten ihn, zumindest die aus Everd Stanherds Sippe. Niemand wusste ihn so recht einzuordnen. Teils war es der typische Hinterwäldler-Singsang, aber darunter war etwas gemischt, das nicht einmal amerikanisch klang. Da lag etwas Sattes und Betörendes in der Art, wie sie redeten. Wenn sie sprachen, schienen sich ihre Lippen kaum zu bewegen.
Und dann war da diese neue, seltsame Information. Was zum Teufel?, dachte Dwayne wieder. Hat sie »Weizenbänder« gesagt?
Sie stand nun im Mondlicht, ihr draller junger Körper nahezu strahlend, die Brüste ragten vor, ihr Bauchnabel ein perfekter schwarzer Schatten. Sie hatte sich um jeden Oberschenkel eines der Bänder gelegt wie löchrige Strumpfbänder.
»Die Dinger sind aus Weizen gemacht?«
»Mhm. Es is’ Futterweizen und er is’ nich’ von hier. Die Clanmutter macht sie, und jedes Mädchen kriegt ’n Paar, wenn ihre Periode kommt. Das is’ ganz alte Magie.«
»Magie«, sagte Dwayne.
»Ja, wenn man mit ’nem Typen zusammen is’. Wenn man ’nen Jungen will, macht man’s an den linken Schenkel, und wenn man ’n Mädchen will, an den rechten.« Anmutig richtete sie die seltsamen Bänder mit ihren Fingern. »Un’ wenn man gar nix will, zieht man beide an.«
Dwayne schüttelte den Kopf. Squatter. Herrgott. Er wusste, dass sie recht abergläubisch waren, aber das hier war neu. Er lachte tief in sich hinein. Dumme Assis. Das Letzte, worüber die sich Sorgen machen muss, is’ ’n Braten in der Röhre.
Es wurde spät. »Zeit, zur Sache zu kommen«, sagte er und ging zu ihr. Er ließ einen 20-Dollar-Schein auf ihre Kleidung fallen, dann drehte er sie brutal herum, bis sie mit nacktem Rücken zu ihm stand, und griff um ihren Körper, um seine schwieligen Hände über die zarte Haut ihres Bauches und ihrer Brüste gleiten zu lassen. Er rieb seine Lenden an ihrem Hintern und spürte eine verbotene Gier. Ihre Haut schien wärmer zu werden, als er mit seinen rauen Liebkosungen fortfuhr, und ihr Atem ging schneller. Innerlich lachend dachte Dwayne: Sieh sich einer das an, ich mach die Schlampe heiß. Ich mach’ne Hure geil. Die dreckigen kleinen Jungs aus ihrer Sippe bringen’s wohl nicht. Aber Dwayne eilt zur Rettung …
Das war das Mindeste, was er tun konnte, wenn man bedachte …
Er saugte an ihrem Hals und spielte intensiv an ihren Brüsten herum. Ihre Nippel wurden hart wie Kiesel, und als er sie fest drückte, quietschte sie vor Wonne und erhob sich auf die Zehenspitzen.
»Ich fand dich schon immer toll«, flüsterte sie mit ihrem seltsamen Akzent. »Du hast da was an dir …«
Der Beweis dieser Aussage lag klar vor ihm, als er mit den Fingern durch das Dickicht ihrer Schamhaare in ihr Geschlecht tauchte. Dwayne spürte eine Regung unterhalb der Gürtellinie. »Ich hab auch schon vor ’ner Weile ’n Auge auf dich geworfen.«
»Haste nich’!«, widersprach sie spielerisch.
»Klar doch. Du bist die Hübscheste von allen Mädels aus der Sippe …«
»Bin ich das?«
»… und ich hab dich oft bei der Arbeit gesehen. Eine der fleißigsten Schälerinnen. Das hab ich auch meiner Frau gesagt.«
»Das sagste doch nur so«, kokettierte sie. »Ich wette, du weißt nich’ ma’ meinen Namen, obwohl du jede Woche die Gehaltsumschläge machst.«
»Klar weiß ich deinen Namen«, behauptete Dwayne, der nach wie vor ihre Brüste bearbeitete, aber dabei dachte er: Scheiße, wie heißt die kleine Schlampe noch? »Äh …« Er zögerte. »Sunny, richtig?«
»Fast«, sagte sie. Immerhin schien sie nicht beleidigt zu sein. »Cindy. Zumindest nennt man mich meistens so.«
Dwayne interessierte es einen Dreck, wie sie hieß … Dennoch fragte er nach. »Was meinste mit meistens? Entweder isses dein Name oder nich’.«
»Es is’ nich’ mein Clanname. Der is’ furchtbar.«
Er bearbeitete ihre Brüste fester, mit mehr Aufmerksamkeit. »Wie is’ denn dein Clanname?«
»Sag ich nich’!« Sie schien sich zu schämen. »Du lachst eh nur!«
»Nein, echt nich’.«
»Everd sagt, wenn wir mit den Leuten aus der Gegend zusammen sind, solln wir unsre andern Namen benutzen. Everd sagt, dann passen wir besser rein. Wir wissen aber alle, dass wir bei euch nich’ reinpassen.«
Dwayne dachte nur an eine Sache, die »reinpassen« sollte, und die hatte wahrlich nichts mit Namen zu tun. Aber der Mann, den sie erwähnte – Everd Stanherd –, war in der Tat ein merkwürdiger alter Sack. Er war der Clanälteste, der weise Mann der Squatter, wenn man so wollte. Der Scheißer behauptete, 60 zu sein, sah aber aus wie 80. Mit Ausnahme seiner Haare: Kein einziges graues Haar wuchs auf seinem Kopf, sie waren alle rabenschwarz. Alle in der Sippe hatten dieses seltsame, glänzende, kohlschwarze Haar, auch die alten Frauen. Dwayne konnte sich nicht vorstellen, dass Leute wie die sich die Haare färbten.
»Du fühlst dich echt gut an … Cindy«, flüsterte er. Als seine eigene Erregung wuchs, klang der dichte Chor der Zikaden fast ohrenbetäubend. Jetzt hatte er seine Hände überall – sie fühlte sich so klein an, die geschmeidige Form, die spindeldürre Figur mit den beinahe übermäßig großen Brüsten, die fest und voll waren wie die Brötchen, die Judy an Feiertagen machte – und genauso warm.
Das Vorspiel war beendet; hinter seinem Reißverschluss war Dwayne mehr als bereit. Er drängte sie zwischen die Bäume, von denen große Büschel Louisianamoos herunterhingen, schob sie regelrecht mit seinen Lenden und ließ seine Finger erneut hoch zu ihren Nippeln gleiten. Als sie die Lichtung erreicht hatten, keuchte sie.
»Genau da«, sagte er, drehte sie um und legte ihre Hände an seinen Gürtel, um ihr zu bedeuten, dass es Zeit für sie war, ihm die Hose auszuziehen.
Jetzt klangen ihre Worte vor Lust ganz ausgetrocknet. »Willste sicher nich’ mit zu meiner Hütte kommen?« Sie flehte fast.
Seine Jeans fiel zu Boden. »Nee.«
»Da wär’s viel gemütlicher. Was is’ denn so besonders hier?«
Dwayne drängte sie auf den dreckigen Boden und beantwortete in Gedanken ihre Frage, während er ihr die Knie bis zu den Ohren schob. Hier? Hier sind wir nur drei Meter von dem Loch weg, das ich letzte Nacht gegraben hab …
1
(I)
Ich wüsste gern, wie er wohl gestorben ist, überlegte sie. Patricia White hätte niemals gedacht, zu derart makabren Gedanken fähig zu sein, nicht mal als Anwältin, aber hier waren sie nun und lauerten ihr auf. Ihre Beförderung war das Letzte, woran sie jetzt dachte, genau wie das zusätzliche Einkommen durch die Gewinnbeteiligung. Nein, da kreisten gerade einzig diese flüchtigen Bilder voller Dunkelheit und Morbidität. Judy sagte, er sei ermordet worden, aber nicht, wie. Als sie wie betäubt eine Reihe von Statuen aus der Ming-Dynastie betrachtete, drängte sich ihr die Frage regelrecht auf: Ich wüsste gern … wie …
Ja. Wie war der Ehemann ihrer Schwester genau umgebracht worden? Unter welchen Umständen? Auf welche Art? Pistole? Messer? Knüppel?
Dann: Ich sollte mich besser zusammenreißen, bevor MEIN Ehemann noch glaubt, ich würde durchdrehen.
Byron saß ihr am Tisch gegenüber und tat so, als bemerkte er ihre Zerstreutheit nicht. Wenn er spürte, dass sie etwas beschäftigte, bemühte er sich normalerweise immer, sie abzulenken. »Ich weiß nicht, ob das hier das beste chinesische Restaurant der Stadt ist«, sagte er, »aber schon jetzt bin ich bereit zu behaupten, dass es das am besten riechende chinesische Restaurant der Stadt ist.«
Patricia war so sehr in Gedanken versunken gewesen, dass sie es gar nicht bemerkt hatte, bis er es erwähnte. Aber jetzt weiteten sich ihre Augen vor Überraschung. Schlanke asiatische Kellnerinnen huschten mit großen Tabletts voller Essen hin und her, die regelrechte Duftschwaden durch das Restaurant zogen. »O Byron, wow. Du hast recht. Die Aromen hier sind fast …«
Sein breites Gesicht verzog sich zu einem Grinsen. »Erotisch.«
»Das hast du gesagt, Mr. Perverser Restaurantkritiker.«
Er hielt seine Hände über die Suppenschüssel, die bis vor wenigen Minuten noch mit Haifischflossensuppe gefüllt gewesen war. »Gutes Essen muss eine sinnliche Reaktion hervorrufen; das tut es, seit die frühen Menschen mit dem Kochen angefangen haben. Daran ist nichts Perverses.«
Sie konnte nicht anders als sich vorzubeugen und zu flüstern: »Bis auf dieses eine Mal, als wir in L. A. waren und du drauf bestanden hast, das Stück Schoko-Martini-Käsekuchen aus dem Spago’s mitzunehmen und es von meinem Bauch zu essen, als wir zurück im Beverly Hills Hotel waren.«
»Mhm. Und ich glaube, man könnte deine Reaktion darauf als ganz besonders sinnlich bezeichnen. Und vergiss nicht, Mrs. Perverse Superanwältin, was du vorher mit der Sahne angestellt hast.«
Sofort errötete Patricia. Wie hatte sie diesen Teil nur vergessen können? Als die Vorspeisen gebracht wurden, stiegen weitere wundervolle Düfte in ihre Nase: Scharfe Soßen, ausgeklügelte Gewürzkompositionen und Kräuter dampften ihr entgegen.
»Bevor wir uns unserem nordchinesischen Gelage widmen«, sagte Byron, »erzähl mir doch, was dich belastet.«
Sag es einfach. »Ich fühle mich mies«, gab Patricia zu. »Weil ich mich nicht … mies fühle.« Ungewohnt verlegen hob sie den Blick von der üppigen Platte mit dem sautierten Hummer auf Schalotten. »Ergibt das irgendeinen Sinn?«, fragte sie.
Byrons Essstäbchen schwebten in der Luft. Er hatte gerade einen Streifen kurz gebratenes Seeohr aufnehmen wollen. Sein Gesicht im Kerzenlicht wirkte nachdenklich. »Schatz, in diesem Fall ergibt das durchaus Sinn. Es ist schwer zu formulieren, weil man über die Toten nicht schlecht reden soll. Darum geht es doch, oder?«
»Ja …« Sie legte ihre eigenen Essstäbchen auf das Porzellanbänkchen. Offensichtlich raubten ihnen beiden die Umstände den Appetit. Eine Schande in einem so teuren und für seine exotische Küche bekannten Restaurant. »Ein Teil von mir hat Mitleid mit Judy, aber der größte Teil von mir fühlt … Ach, verdammt noch mal. Ich komme mir so beschissen vor, dass ich es überhaupt nur denke.«
»Lass mich es für dich aussprechen und sag mir, ob ich richtigliege. Der größte Teil von dir freut sich für Judy, weil sie ein zu guter Mensch ist, um mit einem Kerl wie Dwayne verheiratet zu sein. Dwayne war ein ziemlich beschissener Typ. Er war ein Lügner und ein Krimineller und ein Hochstapler, und jetzt ist er tot. Und ein Teil von dir ist froh, dass er tot ist. Und dafür fühlst du dich schuldig.
Mir geht es genauso, auch ich bin froh, dass er tot ist. Niemand konnte ihn leiden. Ich hab ihn nur ein einziges Mal getroffen, aber ich konnte sofort sehen, dass er ein gerissener Prolet war, der deine Schwester nur geheiratet hat, um sich das Leben leichter zu machen.
Er hat ihr so viel Kummer bereitet, das hat sie nicht verdient. Ich meine, er hat sie verprügelt, in Gottes Namen! Das kann er jetzt nicht mehr. Alles in allem ist es gut, dass Dwayne umgekommen ist. Die Welt ist ohne ihn ein besserer Ort und Judy ist ohne ihn besser dran.«
»Ich weiß«, gestand Patricia. »Aber …«
»Aber sie ist deine Schwester«, fuhr Byron fort. »Und du liebst sie, und du weißt, dass du dich nicht darüber freuen solltest, dass ihr Ehemann gestorben ist. Eine Situation wie diese ist niemals einfach.«
»Sie hat die ganze Zeit geglaubt, dass er sich eines Tages ändern würde, dass es nur seine Vergangenheit wär, die ihn so gemacht hat …«
»Natürlich, das musste sie doch glauben, um nicht die Hoffnung zu verlieren. Aber in Wahrheit ändern sich Typen wie Dwayne nicht. Das sind Räuber, bis zum Tag ihres Todes. Das kann man noch so sehr der Umwelt oder der Erziehung oder mangelnder Bildung oder sonst was ankreiden, und sicherlich sind das manchmal entscheidende Faktoren. Aber manchmal eben auch nicht. Dwayne war einfach ein böser Mensch und wäre das immer geblieben.«
Patricia schüttelte den Kopf. »Aber sie hat ihn so sehr geliebt.«
»Liebe macht blind und dumm«, sagte Byron. »Deine Schwester war schon immer ein bisschen unsicher. Sie ist auf Dwaynes falschen Charme reingefallen, und diese raue Bad-Boy-Attitüde. Also hat er sie verarscht. Sie hätte ihn schon nach einem Jahr rausschmeißen sollen, aber da kommt wieder diese Unsicherheit ins Spiel. Das passiert Frauen in ihrem Alter oft; ab 40 glauben sie, sie finden nichts Besseres mehr als den Mann, mit dem sie gerade zusammen sind.«
»Frauen in ihrem Alter?«, fragte Patricia halb anklagend, halb im Scherz. »Sie ist 42. Ich bin 43.«
»Stimmt, aber der Unterschied ist, dass sie mit einem muskelbepackten Redneck verheiratet war und du mit einem kahlen Vielfraß. Ich bin der unsichere Part in dieser Ehe. Die meisten Männer meines Alters haben Bierbäuche.« Byron tätschelte seinen dicken Wanst. »Ich habe einen Foie-Gras-und-Chateaubriand-Bauch.«
Beide lachten, eine mehr als willkommene Abwechslung zu ihrer düsteren Stimmung. Byron war Restaurantkritiker für die Washington Post. Er verdiente gut daran, in den besten Restaurants der Gegend um D. C. essen zu gehen, machte sich aber dennoch ständig über sich selbst lustig. Patricias Gehalt war fünfmal so hoch wie seines, und jetzt, da sie zur Partnerin gemacht worden war, würde sie sogar noch mehr verdienen. Außerdem sah sie, obwohl sie im mittleren Alter war, eher wie eine Frau Anfang 30 aus. Trotz der vielen Arbeit schaffte sie es dreimal die Woche ins Fitnessstudio, und die Natur oder Gott war so freundlich gewesen, ihr übermäßige Falten vom Leib zu halten.
Die Wand neben ihrem Tisch, direkt hinter einem eleganten, mit weißen Ziegeln eingefassten Fischteich, war komplett verspiegelt, und als Patricia einen Blick auf sich warf, war sie mehr als zufrieden mit dem, was sie sah. Ihr seidiges, glattes rotes Haar mit dem langen Pony, den sie zur Seite gestrichen hatte, schimmerte. Sie hatte es erst vor wenigen Tagen schneiden lassen, bis zum Schlüsselbein und absolut gerade. Der schmale schwarze Rock betonte ihre schlanke Figur, die von einem ausladenden Busen gekrönt wurde. Die meisten von Byrons Freunden glaubten, sie hätte Implantate, obwohl das nicht stimmte. Sie sah genauso aus wie die fitte, attraktive D. C.-Geschäftsfrau, die sie war.
Byron dagegen war die Verkörperung des Wortes »mopsfidel«, und das wusste er auch. Genau deshalb liebte sie ihn. Er mochte übergewichtig sein, aber er war authentisch, und solche Männer fand man in den Washingtoner Kreisen der Macht viel zu selten.
Sie hatte in der Tat ihren besten Freund geheiratet und sie wusste, dass sie ohne ihn nicht mehr weiterwüsste. Ich habe wirklich Glück, dachte Patricia dankbar. Das wünschte ich Judy auch …
Um sie herum belebte sich das Restaurant. Leise Gespräche wurden untermalt von einer dezenten orientalischen Harfe und weiche Akzente erläuterten die Spezialitäten des Abends: Tintenfisch nach Thai-Art in drei Gewürzen, Pekingente und Rind Szechuan.
Byron wurde ernster, als er sagte: »Es tut mir leid, dass diese Sache dein Festmahl ruiniert. Ich wollte, dass es etwas Besonderes wird.«
Sie drückte unter dem Tisch seine Hand. »Es ist besonders. Wir könnten zu McDonald’s gehen und es wäre etwas Besonderes, solange du bei mir bist.«
Byron lächelte bescheiden. »Wie dem auch sei, lass uns trinken. Auf deine Beförderung.«
Sie stießen mit kleinen Gläsern eines vollmundigen Pflaumenweins an. Patricia war Anwältin für Immobilienwirtschaft, deren Kanzlei gerade offiziell von Platz zwei auf Platz eins in diesem Feld aufgestiegen war. In den letzten zehn Jahren war der Immobilienmarkt in ganz Washington und dem nördlichen Virginia regelrecht explodiert, und nie war es turbulenter zugegangen als jetzt, was für eine erstklassige Anwältin wie sie florierende Geschäfte bedeutete. Die Gewinnbeteiligung durch die Partnerschaft zahlte ihr Sandsteinhaus in Georgetown ab, dessen Wert sich jetzt schon verfünffacht hatte. Sie und Byron hatten schon immer ein gutes Leben gehabt, aber jetzt würde es ein großartiges Leben werden.
»Eins gefällt mir allerdings nicht. Es wirkt sexistisch.« Byron schnappte sich ein Stückchen Rumaki und ging wieder zu leichteren Themen über. »Deine Kanzlei meine ich, McGinnis, Myers und Morakis. Du bist jetzt Partnerin. Sollte es dann nicht McGinnis, Myers, Morakis und White heißen?«
»Mieser Klang, Byron«, antwortete sie. »Das würde den typischen Sound zerstören, die drei M. Meiner Meinung nach muss mein Name nicht an der Tür stehen. Und das Erste, was ich mit meinem Bonus anstelle, ist, meinen wunderbaren Ehemann nach Hongkong zu bringen, damit du dein Gourmet-Buch beenden kannst.«
»Es mag wie ein törichter Luxus klingen, dass ich diesen unmäßigen Traum habe, aber du musst wissen, dass ein derart hervorragender Kritiker wie ich unbedingt den Tao-Fu-Fa-Räuchertofu und die Fischkopfsuppe im besten kantonesischen Restaurant der Welt probieren muss …«
Sie lächelte ihn an. »Was immer dich heißmacht, Schatz. Ich liebe deine Leidenschaft. Ich finde gutes Essen auch toll, weiß es aber nicht ganz so sehr zu schätzen.« Sie deutete auf ihren Teller. »Das hier zum Beispiel. Es ist großartig. Vermutlich sind das die besten Shrimps, die ich je hatte …«
Reflexhaft runzelte Byron die Stirn. »Schatz, das sind keine Shrimps. Das sind Kaisergranate aus der Morton Bay in Australien. Absolut keine Shrimps, sondern tatsächlich eine Art Hummer.«
Patricia nickte abwesend. »Gut. Aber für einen wenig ausgefeilten Geschmackssinn wie meinen sind es Shrimps, und sie sind köstlich, aber ich habe einfach nicht deine Fähigkeit, das anderen Leuten zu erklären. Ich teile nicht deine Hingabe dafür. Du würdest sie vermutlich beschreiben als …«
Ehe sie ihren Satz beenden konnte, schnappte sich Byron einen Hummerschwanz von ihrem Teller, schob ihn sich genießerisch in den Mund und sagte: »Eine rätselhafte Verschwörung authentischer Gewürze, die die Süße dieses fernen und so exotischen Krustentieres unterstreichen. Der wilde Biss der zarten Schalotten wurde durch genau das richtige Maß an Hitze ausreichend gezähmt, um diese fabelhafte Köstlichkeit zu vermitteln, die einem amerikanischen Gaumen viel zu selten zuteilwird. Insgesamt gleicht dieses Gericht einem kulinarischen Poem.«
»Genau so«, sagte sie und lachte. »In Hongkong wirst du definitiv in deinem Element sein, und ich kann es kaum erwarten, das zu erleben.« Das stimmte. Sie waren schon seit 20 Jahren zusammen und Byron hatte zahllose Überstunden gemacht, während Patricia Jura studiert und als Assistentin gearbeitet hatte. »Du hast mir geholfen, meinen Traum wahr zu machen«, sagte sie nun leiser. »Und ich weiß, dass es oft so wirkt, als hätte ich das vergessen.«
»Unsinn. Es ist unser Traum und wir leben ihn gemeinsam«, widersprach Byron.
Jetzt fühlte sie sich noch schuldiger. Die meiste Zeit war sie zu beschäftigt, außergerichtliche Anhörungen vorzubereiten, um wahrzunehmen, dass auch sie Teil dieses Lebens war. Ich werde das alles wiedergutmachen, und ich fange sofort damit an, versprach sie sich und hoffte, dass das nicht nur eine weitere lahme Beteuerung war.
Er hatte schon immer nach Hongkong fahren wollen – wegen des Essens –, und in all den Jahren hatte sie niemals »Zeit dafür« gehabt. Sie war immer zu »beschäftigt« gewesen. Jetzt nicht mehr, beschloss sie. Ich gehöre jetzt zu den Chefs. »Wie gesagt, das Erste, was ich als Partnerin machen werde, ist, mit dir nach Hongkong zu fahren.« Aber dann fiel ihr das Problem wieder ein. »Na ja, ich meine, das Zweite …«
»Natürlich, die Beerdigung«, sagte Byron ernüchtert. »Warum kann ich nicht mitkommen? Es ist eine lange Fahrt.«
»Es sind doch nur drei Stunden oder so.«
»Das meine ich nicht. Du willst doch nicht allein zu diesen Leuten und in so eine Situation.«
Sie wusste, was er meinte. Sie hatte sich in Agan’s Point immer fehl am Platz gefühlt, weil sie dort schlicht fehl am Platz war. Die denken alle, ich sei eine eingebildete Kosmopolitin … Was ich vermutlich auch bin. »Judy mag mich«, versicherte sie. »Und was die anderen angeht – die sollen zur Hölle fahren.« Das war eine der seltsamen Ansichten der Menschen ihrer Heimatstadt: Nur undankbare Leute verlassen ihren Geburtsort, um in die Stadt zu ziehen, Leute, die glauben, besser zu sein als alle anderen. »Ganz ehrlich, ich habe keine Lust hinzufahren. Von mir aus können sie Dwaynes Leiche in eine Grube kippen und mit Dreck zuschütten, ganz ohne Beerdigung. Aber …«
Byron nickte. »Aber du willst für Judy da sein. Natürlich willst du das. Jeder normale Mensch würde das.«
Sie schämte sich für ihre eigenen Gedanken und das, was Byron ihr in den Mund gelegt hatte. Ich war niemals für sie da, als sie mich WIRKLICH brauchte, oder? Familiäre Loyalität und Karriereziele befanden sich oftmals in einem regelrechten Krieg – typisch für moderne Familien –, und in Patricias Fall hatte die familiäre Loyalität den Kürzeren gezogen. Tief drinnen hat Judy mir nie vergeben, dass ich nicht geblieben bin und mir ein College in der Nähe gesucht habe, als Mom und Dad starben …
Zwischen dem Leben, wie sie es führte, und dem, was man als familiäre Verantwortung interpretieren mochte, herrschte ein regelrechter Krieg. Patricia lenkte lieber ab. »Ich will auch einen Blick auf die Unternehmenszahlen werfen, falls Dwayne hinter ihrem Rücken irgendeinen Schaden angerichtet hat. Eigentlich sollte sie sich um die Buchhaltung kümmern und Dwayne einfach nur das Personal überwachen, aber ich habe so meine Zweifel. Es würde mich nicht überraschen, wenn er Bestechungsgelder von den Krebsfischern genommen hätte.«
»Wechsel nicht das Thema. Ich finde immer noch, dass ich dich begleiten sollte«, beharrte Byron.
Sie seufzte. Es kam nicht infrage. Seine Familienkrisen hatten nie Auswirkungen auf sie gehabt, also bestand sie darauf, dass es umgekehrt genauso war. »Du sollst dir nicht wegen so was freinehmen«, sagte sie.
»Meine monatliche Kolumne ist schon fertig – das Stück über die lokalen Kaviar-Lounges – und ich könnte die Kritik für diese Woche noch heute Abend raushauen. Unter diesen Umständen zurück nach Agan’s Point zu fahren muss verdammt schlimm für dich sein. Lass mich mitkommen – wenigstens die ersten paar Tage. Vielleicht mindert das den Stress ein bisschen.«
Patricia wünschte, sie könnte es zulassen – sie wollte es so gern. Aber das wäre ihm gegenüber nicht fair. In dem Hinterwäldler-Kaff fühlt er sich doch genauso unwohl wie ich. »Nein«, erklärte sie. »Du bleibst hier und machst deinen Job. Du bist der beste Restaurantkritiker dieser Zeitung. Ich kann nicht zulassen, dass du meinetwegen pausierst.«
»Aber …«
»Nein«, wiederholte sie. Dann beugte sie sich vor und flüsterte: »Aber lass uns noch großartigen Sex haben, bevor ich fahre.«
Byrons rundes Gesicht wurde kurz starr, dann zuckte er die Achseln und sagte: »Kein Problem.«
Im dämmrigen Licht des Morgens wirkte die Straße trostlos. Es sah ganz und gar nicht nach einem Sommer in der Stadt aus. Einzig ein paar dünne Sonnenstrahlen schafften es durch den Smog, der noch schlimmer werden würde, sobald die Rushhour einsetzte. Zumindest das bliebe ihr heute Morgen erspart.
Patricia kam sich sehr allein vor, als Byron ihr Gepäck in den Kofferraum des sportlichen Cadillac SRX lud. Im Dämmerlicht wirkte die aufwendige dunkelrote Lackierung des Wagens schwarz.
Byron sah sie irritiert an. »Du weißt schon, dass du massenhaft Unfälle verursachen wirst, wenn du mit offenem Verdeck fährst.«
Sie erwiderte seinen Blick genauso irritiert. »Was?«
»Aber ich muss zugeben, der Gedanke, dass mich die ganzen Virginia-Rednecks beneiden, gefällt mir irgendwie.«
»Byron, was redest du?«
»Dein BH. Oder sollte ich sagen, das Fehlen eines solchen?«
Sie berührte kurz ihre Brust und fuhr schockiert auf. Eigentlich trug sie fast immer einen BH und konnte sich nicht daran erinnern, dass sie an diesem Morgen beim Anziehen absichtlich darauf verzichtet hatte. Ihre üppigen Brüste unter der einfachen weißen Bluse würden auf dem Highway sicherlich alle Blicke auf sich ziehen. »Ich wollte das Verdeck sowieso zumachen, wegen der Sonne, Byron. Das eifersüchtige Sex-Monstrum in dir kann sich also entspannen. Vermutlich ist meine Schwester sowieso die Einzige, die ich heute treffe.«
»Da bin ich erleichtert«, sagte er in scherzhaftem Ton. »Glaub mir, dieses Cabrio und diese Bluse und deine Möpse würden definitiv eine Massenkarambolage auslösen.«
»Siehst du? Ich denke nur an die öffentliche Sicherheit.«
Hinter ihnen ragte hoch das Mietshaus auf. Byron lächelte. Sein spärliches Haar stand wild ab und ein Bartschatten verdunkelte sein Gesicht. »Letzte Chance. Ich könnte mich schnell umziehen und mit dir fahren.«
Sie umarmte ihn, ein bisschen zu verzweifelt vielleicht. »Nein, Schatz. Ich mache das allein und du hältst hier die Stellung. Mit Glück bin ich in einer Woche zurück.«
»Richte deiner Schwester mein Beileid aus. Ich bestelle nachher Blumen und lasse sie liefern. Oh, und ich will nicht unsensibel klingen, aber … Könntest du mir ein paar von ihren Krebsküchlein mitbringen?«
Patricia kicherte. Der Vertrieb von Krebsfleisch mochte nach einem eher wenig lukrativen Geschäft klingen, aber Judy hatte tolle Arbeit geleistet, das Familienunternehmen aufzumöbeln, nachdem Patricia ihr ein wenig Startkapital zur Verfügung gestellt hatte. Sie hatte alles mit Zinsen zurückgezahlt und die Firma wuchs nach wie vor. Judy hatte ihr Ding gefunden. Die idealen Bedingungen im Wasser vor Agan’s Point ließen dort Unmengen außergewöhnlich großer Blaukrebse gedeihen, deren Fleisch so besonders süß war, dass die Restaurants des ganzen Landes sich allein der hohen Qualität wegen darum rissen. Entsprechend wuchs das Geschäft unaufhaltsam. Selbst Byron mit seiner pingeligen Einstellung gegenüber Essen musste zugeben, dass die besten Krebsküchlein, die er je gegessen hatte, die von Patricias Schwester waren. »Ich bringe dir eine Kiste mit«, versprach sie.
Die leere Straße verschluckte das gedämpfte Geräusch, mit dem Byron den Kofferraum schloss. Da fiel Patricia etwas ein: »Ich bin so ein Siebhirn. Ich hab meinen Laptop vergessen …«
»Willst du in Agan’s Point etwa arbeiten?«, fragte ihr Mann amüsiert.
»Ich will nur mit meinen Kollegen in E-Mail-Kontakt bleiben, außerdem muss ich meine Unterlagen bei mir haben, falls es einen Notfall im Büro gibt«, sagte sie und eilte zurück in die Wohnung.
Der Wert des alten, anheimelnden Steingebäudes mit den insgesamt sechs großen Wohneinheiten war in den zehn Jahren, die sie jetzt hier lebten, in die Höhe geschossen. Patricia nahm den Aufzug nach oben. Sein Summen klärte ihren Kopf und bestärkte sie in dem Beschluss, heute »nach Hause« zu fahren.
Was die Inneneinrichtung der Wohnung anging, hatte sie sich Byrons modernem, städtischem Geschmack gebeugt – man konnte es als »Post-Art-déco« bezeichnen. Das störte sie keinesfalls, besonders in Anbetracht der wenigen Zeit, die sie hier verbrachte; wie für so viele Anwälte in der Stadt fühlte sich das Büro mehr wie ein Zuhause an.
Sie durchquerte das spärlich möblierte, in hellen Farben gehaltene Wohnzimmer, um ins Schlafzimmer zu gehen – der einzige Raum der Wohnung, den sie nach ihrem Geschmack eingerichtet hatten. Schwere Wandverkleidungen, dunkle Vollholzmöbel und ein ausladendes Himmelbett. Der Kolonialstil, obgleich er aus der Mode war, hatte ihr schon immer gefallen. Sie nahm an, dass er sie an ihre Kindheit in Agan’s Point erinnerte, was merkwürdig war, denn weder mit ihrer Kindheit noch der Stadt verband sie gute Erinnerungen. Eine verschlossene, bettelarme Gemeinde, in der sie und ihre Schwester von mürrischen, lieblosen Eltern aufgezogen worden waren. Gott sei ihrer Seele gnädig, dachte sie kurz. Ihr knarrendes altes Haus auf dem Hügel war in einem ähnlichen Stil eingerichtet gewesen.
Als sie an der Kommode vorbeiging, um sich ihren Computer und die Tasche zu holen, hielt sie inne und betrachtete das gerahmte Foto von sich und ihrer Schwester, auf dem sie lächelnd auf der breiten Veranda mit dem klobigen Geländer standen. Vor dem Haus, in das sie heute zurückkehren würde. Als das Foto gemacht wurde, war sie 15 gewesen und Judy 14. Beide trugen die bescheidenen Sommerkleider, die sie in den heißen Monaten im südlichen Virginia so oft angehabt hatten. Beide hatten trotz ihrer hellen Haut und der leuchtend roten Haare keine Sommersprossen, und etwas an dem Bild ließ sie noch jünger aussehen, als sie waren. Ein Blick in eine lange vergangene Jugend. Hinter ihnen sah man die enorme Eingangstür, über deren Schwelle Patricia in drei oder vier Stunden treten würde. Sie fragte sich, was für Erinnerungen wohl dahinter warteten.
Ein anderes Bild auf der Kommode zeigte ihre Mutter und ihren Vater im Garten. Sie waren erst mit Ende 30 Eltern geworden – so spät, dass Patricia sich fragte, ob sie und Judy nicht in Wahrheit Unfälle gewesen waren. Die harte Arbeit in der Krebsfischerei hatte ihre Eltern vorzeitig altern lassen. Der Blick ihres Vaters auf dem alten Foto wirkte hart, der ihrer Mutter gelangweilt. Beide waren früh grau geworden, und genau wie auf diesem Bild hatten sie auch im echten Leben nur selten gelacht. Ein ganz profaner Verkehrsunfall hatte sie in dem Jahr das Leben gekostet, in dem Patricia das College abschloss. Sie bedauerte, dass sie nicht lange genug bei ihnen gewesen waren, um den Erfolg ihrer Töchter zu erleben. Aber dass sie auch nicht lange genug gelebt hatten, um zu sehen, wie Judy Dwayne heiratete, bedauerte sie eindeutig nicht.
Ohne nachzudenken, drehte sie das Foto zur Wand. Ihre Aufrichtigkeit in dieser Angelegenheit hatte sie immer gestört. Sie fühlte sich schuldig. Patricia hatte ihre Eltern wohl geliebt, aber besonders gemocht hatte sie sie nie. Ihre Jugend war eine endlose Reihe unschöner Episoden.
Eine neue Erinnerung überfiel sie, als sie sich gerade umwandte, um wieder nach draußen zu gehen. Du böses, gieriges Mädchen, dachte sie. Das hohe, mit Vorhängen behängte Bett, das sie mit Byron teilte, war von der ausschweifenden Orgie der letzten Nacht noch unordentlich. Vielleicht lag es am Pflaumenwein im Restaurant, überlegte sie. Da war eindeutig etwas gewesen, etwas, das sie auch jetzt noch zum Beben brachte. Byron war nicht der attraktivste Mann der Welt, aber Patricia wusste, dass es in ihrem Alter erregender war, sich beim Sex mit einem anderen Menschen wohlzufühlen, als es Muskeln, gemeißelte Kiefer oder andere Sinnbilder von Männlichkeit je sein könnten.
Sie errötete: Er hatte ihre Lust schon den ganzen Abend gespürt, und kaum dass sie zu Hause waren, hatte er ihr Kleid bis über die Hüften nach oben geschoben, ihr Höschen runtergezogen und sie zum Bett gedrängt. Er wusste, was ihr gefiel, und er hatte keine Zeit verloren, es ihr zu geben, hatte nicht mal seine eigene Kleidung ausgezogen, ehe er sich einer oralen Exkursion ihres Körpers gewidmet hatte, die mehr als eine Stunde dauerte. Erst zart und federleicht, aber nach und nach zu wilder Raserei gesteigert. Patricia kam wieder und wieder und biss sich dabei in die eigenen Knie, als wären es Äpfel. Mehrfach hatten ihre Lustschreie durch die Wohnung gehallt.
Zum Glück haben die Nachbarn nicht die Polizei gerufen, dachte sie jetzt. Dann kam ihr ein roherer Gedanke und vertiefte ihre Schuldgefühle: Letzte Nacht habe ich im Grunde das Gesicht meines Ehemanns wie einen Fahrradsattel benutzt. Und ich habe danach nicht mal was für ihn getan. Ihre Orgasmen hatten sie derart ausgelaugt, dass sie sofort eingeschlafen war …
Ich erzähle ihm ständig, dass jetzt, wo ich Partnerin bin, endlich er an der Reihe ist. Sie runzelte die Stirn. Toller Anfang, Patricia. Du bist eine selbstsüchtige Schlampe.
Sie überprüfte ihre Erscheinung ein letztes Mal im Spiegel, froh, dass ausgebleichte Jeans, Sneaker und eine alte Bluse für die Fahrt nach Hause vollkommen ausreichten. Gut, die Tatsache, dass sie keinen BH trug, überließ nur wenig der Fantasie, aber das kümmerte sie nicht. Vielleicht hab ich absichtlich keinen angezogen und es nur nicht gemerkt, überlegte sie. Immerhin würden ihre Brüste, die den Stoff der Bluse ausbeulten, und die dunklen Umrisse ihrer Nippel ihrem Mann noch einen letzten erotischen Kick verschaffen, ehe sie losfuhr.
Fertig, dachte sie, atmete tief ein und schaltete das Licht aus. Dann ging sie zurück nach draußen, küsste ihren liebenden Ehemann zum Abschied und machte sich auf die dreistündige Fahrt, die sie zurück ins Herz ihrer Kindheit führen würde …
… und zur unwillkommenen Erinnerung an das schreckliche Erlebnis, das ihr vor so langer Zeit zugestoßen war.
(II)
Manchmal hat man einfach Pech, dachte er, als er seine Brieftasche öffnete und lediglich vier Dollarscheine darin fand, kurz nachdem er den Donut King am Stadtrand betreten hatte. Ein Dutzend Donuts kostete vier Dollar und 69 Cent, und er traute sich nicht, Trey nach dem fehlenden Geld zu fragen.
Das wäre entwürdigend. Immerhin war Sutter der Polizeichef.
Also kaufte er einen Donut und einen Kaffee und verließ den Laden.
»Willst du kürzertreten?«, fragte Trey. »Sonst kaufst du dir doch ein Dutzend.«
»Ja«, log er. »Der Doc sagt, ich soll abnehmen, wenn ich lang genug leben will, um meine verdammte Rente zu kassieren. Ich hab da fast 50 Scheißjahre eingezahlt, da lass ich mich doch nicht beklauen.«
Das wäre schließlich typisch für sein Glück …
Chief Sutter war eigentlich kein zynischer Mensch, denn das war eine Haltung, die er als ungesund betrachtete. Er war vernünftig, fair und vermutlich großherziger als die meisten Polizisten, die sich der Pension näherten. Father Darren erinnerte sie jeden Sonntag in der Kirche daran, dass es eine Sünde war, für selbstverständlich zu halten, was man hatte, es sei ein Schlag ins Gesicht Gottes, der diese Welt und alles darin als Geschenk für die Menschheit erschaffen hatte. Jeder Tag über der Erde war ein guter Tag, ein Segen und eine weitere Gelegenheit, das Leben zu feiern. Und die meisten Menschen stimmten dem sicherlich zu.
So eine verdammte Scheiße, dachte er säuerlich.
Auch gute Menschen hatten schlechte Tage. Chief Sutter war am Morgen aus dem Schlaf gerissen worden, weil er mit seinen 140 Kilo vor Hitze fast umgekommen wäre und seine Frau – die auch nicht viel weniger wog – schnarchte wie ein Berggorilla. Über Nacht hatte die Klimaanlage den Geist aufgegeben – was für eine Freude, wenn das im Hochsommer im Süden passierte.
Es würde ihn bestimmt zwei Riesen kosten, sie zu ersetzen. Mit zwei Hypotheken, steigender Grundsteuer und einer Frau, die sämtliche Kreditkarten ausgereizt hatte, wusste Chief Sutter beim besten Willen nicht, wie er das machen sollte.
Das ist einfach nicht fair, dachte er auf dem Weg zur Polizeiwache. Ich hab mir mein Leben lang den Arsch abgearbeitet, um anderen zu helfen, und was hab ich davon?
Jetzt gerade nicht viel. Nur einen Riesenberg Schulden und verdammt wenig Spaß.
»Immer noch Geldsorgen?«, fragte Trey vom Beifahrersitz. Sergeant William Trey war Sutters rechte Hand und offiziell der Deputy Chief des Reviers. »Rechte Hand« bedeutete bei einer Wache mit nur zwei Polizeibeamten nicht viel, aber Sutter fand, dass sein Kollege diese Anerkennung verdiente.
Trey war 50, benahm sich aber immer noch wie der schamlose, resolute Drecksack, den Sutter vor fast drei Jahrzehnten eingestellt hatte. Ein Junge aus dem Ort, mit guten Absichten und Respekt vor seiner Heimat. Er sah ein bisschen aus wie Tom Cruise, wenn Tom Cruise niemals groß rausgekommen wäre. Aber er war immer noch agil und ziemlich fit, was Sutter – in Anbetracht seines Gewichts – leider nicht war. Wenn jemand gebraucht wurde, der über einen Zaun sprang und ein paar Störenfriede verfolgte, war Sutter froh über seinen Deputy. Außerdem hatte Trey die Fähigkeit, jeder Situation etwas Gutes abzugewinnen.
»Sehen Sie’s doch so, Chief. Alle verheirateten Männer haben Geldsorgen. Nehmen Sie uns. Wir haben beide Frauen in der Größe von ’n paar ausgewachsenen Berkshire-Schweinen, und der einzige Unterschied ist, dass sie noch mehr essen als ’n paar ausgewachsene Berkshire-Schweine. Das kostet, Chief, und der Ehemann hat die Aufgabe, das ranzuschaffen. Eine fette Ehefrau ist der Beweis, dass sich ein Mann gut um sie kümmert, und das isses, was Gott will.«
Chief Sutter wusste den Aufmunterungsversuch zu schätzen, war sich aber nicht sicher, ob es funktionierte.
»Wir sind beide in den Augen des Herrn verheiratet, und so soll’s auch sein«, fuhr Trey fort. »Sie verstehen nicht, worauf ich hinauswill, oder?«
»Na ja …«
»Father Darren würd sagen: Warum glauben Sie, dass Sie zu wenig Geld haben?«
»Na, weil …«
»Weil Ihre Frau die Hälfte des Geldes, für das Sie sich den Arsch abarbeiten, für Essen ausgibt und Sie die andre Hälfte für ’n Dach überm Kopf und dafür, dass sie ihren dicken Arsch in ’nem Auto parken kann, richtig?«
Sutter warf ihm einen warnenden Blick zu. »Genau, und das nervt mich tierisch.«
Trey nickte wissend. »Also, Father Darren würd sagen, dass ’ne fette, glückliche Frau die Frau von ’nem gottesfürchtigen Mann is’, ’nem Mann, der sein Bestes tut, um nach Gottes Gesetzen zu handeln.«
Sutter blinzelte. »Das würde er sagen?«
»Da können Sie sicher sein, Chief. Und ich sag Ihnen auch, warum: Wenn Ihre liebe Frau June rappeldürr wär und kein Kabelfernsehen hätt oder kein eigenes Auto, und wenn sie in ’nem elenden kleinen Haus leben müsst, dann würde das bedeuten, dass Sie nich’ nach Gottes Gesetzen leben.«
Sutter seufzte. »Ich hoffe, Sie haben recht, Trey, aber Sie müssen verstehen, dass ich unter ’nem verdammten Riesenhaufen Schulden ersticke und jetzt auch noch irgendwie zwei Riesen für ’ne neue Klimaanlage auftreiben muss. Ich bin echt froh, dass ich nach Gottes Gesetzen lebe, aber ich bin sicher, dass Gott mir keine neue Klimaanlage kauft.«
Trey deutete auf ihn. »Kapiern Sie’s nich’? Das wird er eben doch. Sie müssen ihn nur fragen. Gott kümmert sich um die, die es verdienen. Tun Sie’s jetzt, in Ihrem Kopf. Bitten Sie Gott dafür um Vergebung, dass Sie Ihre Finanzen nich’ im Griff haben, und fragen Sie ihn, ob er Ihnen da raushilft. Los. Tun Sie’s. Denken Sie immer dran, was Father Darren sagt: Ein Mann darf sich niemals schämen, Zwiesprache mit Gott zu halten.«
Sutter sackte hinter dem Steuer zusammen. Kann wohl nicht schaden. Er schloss die Augen und betete: Gott, ich bitte dich, mir zu verzeihen, dass ich selbstsüchtig und undankbar war und deine Gaben für selbstverständlich gehalten habe. Vergib mir, dass ich nicht genau genug drauf geachtet habe, wie alles laufen soll, und dass ich meine Finanzen nicht richtig im Griff habe und dass ich zugelassen hab, dass alles außer Kontrolle gerät. Ich brauche deine Hilfe, Gott, und ich meine, ich brauche wirklich, wirklich die Kohle für ’ne neue Klimaanlage, wenn ich die nämlich nicht zusammenkriege, wird June lauter jammern als ’n Lastwagen voller Wiesel …
Als Chief Sutter die Augen wieder aufschlug, fühlte er sich besser. Er fühlte sich nicht reicher, aber definitiv besser.
»Guter Mann, Chief. Sprechen Sie, und Gott hört zu.« Trey nippte selbstsicher an seinem Kaffee. »Mir hört er zu, das kann ich Ihnen sagen. Ich will nich’ angeben, aber schaun Sie sich das mal an.« Er zog seine Brieftasche hervor und nahm zwei Zettel heraus. »Ich verdien weniger als Sie, und wenn überhaupt, isst meine Frau Marcy mehr als Ihre, aber sehn Sie sich das an.«
Er gab Sutter die Zettel.
Heilige … SCHEISSE! Es waren Kontoauszüge. »Trey, ich würde sagen, Sie haben Ihre Finanzen gut im Griff. Herr im Himmel!« Trey hatte fünf Riesen auf seinem Konto und acht auf seinem Sparbuch.
Er nahm seinem Chef die Zettel wieder ab und nickte. »Das is’, weil Gott zuhört, wenn ich mit ihm rede. Gott sieht mich an, und wissen Sie, was er sieht? Er sieht ’nen Mann, der viele Irrwege hätt gehen können, das aber nich’ getan hat. Er sieht einen Cop, genau wie Sie. Er sieht ’nen Mann, der sich den Arsch aufreißt, um das Gesetz zu schützen und Frieden und Anstand zu bewahren. So einen Mann lässt Gott nich’ hängen. Lieber hilft er ihm. Und genauso wird er auch Ihnen helfen.«
Sutter dachte darüber nach. Er erinnerte sich noch gut, wie Trey in jüngeren Jahren gewesen war, vor der Hochzeit und bevor soziale und private Verantwortung in sein Leben getreten waren. Der Kerl war ein totaler Schürzenjäger gewesen, ein versoffener Typ, der gern und viel feierte. Die Mädels haben ihm die Bude eingerannt, dachte Sutter. Er hat sein Geld für Bars, alte Autos und Frauen rausgeworfen … Aber das Leben hatte Sergeant William Trey verändert, und zwar zum Besseren. Er hatte sich aus purer Willenskraft in einen guten Menschen verwandelt und jetzt stieß ihm nur Gutes zu.
Würde dasselbe Gute auch Sutter zuteilwerden?
Er konnte ein bisschen Glück gebrauchen.
Es war fast, als könnte Trey seine Gedanken lesen, denn er sagte: »Das Gute, Chief.«
»Was meinen Sie?«
»Den Männern, die auf Gott vertrauen, begegnet das Gute.«
Sutter sah aus dem Fenster. Treys Worte hoben seine Stimmung. Er schüttelte den Kopf. »Trey, ich kenne Sie jetzt seit fast 30 Jahren, und die ganze Zeit hatte ich keine Ahnung, dass Sie so ein religiöser Typ sind.«
»Kein Geheimnis und kein großes Ding.« Gelassen trank Trey von seinem Kaffee. »Lebe nach Gottes Gesetzen, und er wird dir seinen Segen schenken.« Aber in just diesem Moment fiel Treys Blick auf eine Gestalt draußen am Straßenrand. Es war eine Frau, eine Anhalterin, und da rief der sehr gottesfürchtige Sergeant Trey aus: »Heilige elende Scheiße, Chief! Sehn Sie sich mal die Titten von dem Saftarsch da an!«
2
(I)
Natürlich hatte Patricia es vergessen. Es waren immerhin fünf Jahre gewesen.
Fünf Jahre, seit sie zuletzt in Agan’s Point gewesen war.
Der Cadillac glitt ruhig und leise dahin, aber als die Stadt hinter ihr verblasste und die Highways langen, gewundenen und sehr ländlichen Straßen wichen, begann die Heimsuchung:
O Gott, Mädchen. Wie konntest du das nur zulassen?
Es waren die Worte ihres Vaters, keine Woche nach ihrem 16. Geburtstag …
Sein Blick und die Formulierung, die er gewählt hatte. Als wäre es MEINE SCHULD gewesen, dachte sie jetzt und ihre Stimmung verdüsterte sich. Als hätte ich es GEWOLLT …
In ihrem ganzen Leben war sie nicht so schlimm verletzt worden.
Sie hatte sich doch gut gefühlt, oder? Als sie losgefahren war, hatte sie sich wider Erwarten gut gefühlt, obwohl sie genau wusste, wohin sie unterwegs war. Ihre wundervolle, gar selbstsüchtige Liebesnacht mit Byron hatte dazu beigetragen, zweifellos, dennoch hatte sie sich gut gefühlt. Zu sehen, wie die Sonne immer höher stieg, auf der Interstate 95 das Verdeck des Cadillac zu öffnen und immer weiterzufahren, all das schien ihren Kopf vom Lärm der Stadt und dem endlosen Stress der Arbeit zu befreien. Tatsächlich fühlte sich Patricia klar, neu; sie fühlte sich gereinigt. Bis …
Nach und nach sank ihre Laune. Sie wusste, was sie hier tat. Ich schiebe es auf. Aber ich KANN es nicht weiter aufschieben. Alles, was ich tun kann, ist rumzutrödeln und Zeit zu verschwenden.
Sie hatte das historische Viertel in Richmond durchquert und eine Stunde damit verbracht, ein Café zu suchen, in dem sie frühstücken konnte. Dasselbe in Norfolk, als es ums Mittagessen ging. Sie hatte die dreistündige Fahrt in einen Tagestrip verwandelt, als würde es ihr Unwohlsein mildern, wenn sie später in Agan’s Point ankam. Aber sie wusste, dass dem nicht so war. Ich quäle mich doch nur selbst, dachte sie.
Stunden später tauchten die ersten vertrauten Straßenschilder auf. Sie zeigten an, dass sie weniger vor ihrem anstrengenden Leben in Washington davonfuhr als vielmehr etwas sehr viel Anstrengenderem entgegen. Auf der wenig befahrenen Route 10 flogen die Schilder nur so an ihr vorbei. Orte mit Namen wie Benn’s Church, Rescue oder Chuckatuck. Ihre Laune verschlechterte sich zusehends.
DISMAL SWAMP – 10 MEILEN stand auf einem Schild.
Dann folgten mehr Schilder mit noch seltsameren Bezeichnungen:
LUNTVILLE – 6 MEILEN
CRICK CITY – 11 MEILEN
MOYOK – 30 MEILEN
Mein Gott, dachte Patricia.
Übelkeit stieg in ihr auf, und mit der Übelkeit kam eine Erinnerung. Sie hatte schon ewig nicht mehr an den Psychologen gedacht, einen verkrampften, kahlen Mann mit tiefen Falten namens Dr. Sallee. Schließlich hatte sie ihn nur einmal gesehen, nämlich vor fünf Jahren, kurz nachdem sie von ihrem letzten Besuch in Agan’s Point zurückgekehrt war und ihre Verzweiflung nicht mehr hatte ertragen können.
»Wir begraben Traumata«, hatte er ihr erklärt. »Wir tun das auf die unterschiedlichsten Arten, aber das Ergebnis bleibt gleich. Manche Leute konfrontieren sich sofort mit ihren Traumata und vergessen sie dann, aber andere kommen besser zurecht, wenn sie sie zuerst vergessen und sich niemals mit ihnen konfrontieren, weil es einfach keinen Grund dafür gibt. Das ist es, was Sie machen, Patricia, und daran ist nichts Falsches. Es gibt keinen Grund für eine Konfrontation, weil Sie sich von den Örtlichkeiten Ihres Traumas entfernt haben.«
Die Örtlichkeiten des Traumas, dachte sie. Eine seltsame Wortwahl. Aber er hatte recht gehabt: Ich bin abgehauen, so schnell ich konnte.
»Was Ihnen zugestoßen ist, wird immer da sein«, fuhr er fort und spielte dabei mit einem Briefbeschwerer in Form einer blauen Pille mit der Aufschrift STELAZIN. »Ich bin Verhaltenstherapeut und daher nicht so frei, was meine Einschätzung der menschlichen Psyche angeht. Andere Experten würden Ihnen vielleicht raten, Ihre Traumata nicht hinter sich zu lassen, weil sie sich in Ihrer Psyche festsetzen, ohne dass Sie es merken. Das passt aber nicht zu der Art, wie wir in unserem Leben, der Gesellschaft und der Welt im Allgemeinen zu funktionieren haben.
Wenn Sie diese Funktionalität aufrechterhalten können, indem Sie schlicht nicht in Agan’s Point leben, dann haben Sie genau das Richtige getan. Ihr Trauma wird neutralisiert, unbedeutend – es wird zu etwas, das Sie nicht weiter beeinflusst. Es hat keine Bedeutung mehr für Ihr Leben und wird auch nie wieder eine haben … es sei denn, Sie lassen das zu. Sie brauchen keine Tonnen von Antidepressiva und teurer Psychotherapie, um mit Ihrem Trauma klarzukommen. Sie müssen sich nur von dem Ort fernhalten, an dem es geschehen ist. Ihr Leben jetzt gerade ist die Bestätigung dafür. Sie sind eine ausgesprochen erfolgreiche Anwältin und genießen eine erfüllende Karriere und eine wunderbare Ehe. Stimmt’s?«
Patricia breitete auf der Couch ihre Hände aus. »Ja.«
»Sie sind nicht traumatisiert von dem, was Ihnen zugestoßen ist, als Sie 16 waren, oder? Sie sind kein hoffnungsloser Psychofall; dieses Ereignis in Ihrer Vergangenheit hat Sie nicht zerstört. Diese 25 Jahre zurückliegende Tragödie überschattet nicht immer noch Ihre Existenz, oder etwa doch? Würden Sie das sagen?«
Patricia musste fast lachen. Er brachte sie dazu, sich etwas einzugestehen, das ihre nagende Verzweiflung durch frivole Heiterkeit ersetzte. »Nein, Doktor, das würde ich nicht sagen.«
Er sah sie ausdruckslos an. »Was ist also Ihr Problem?«
Sie musste zustimmen. »Sie haben recht. Ich habe überhaupt kein Problem mehr.«