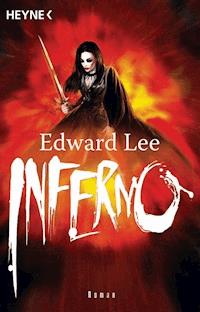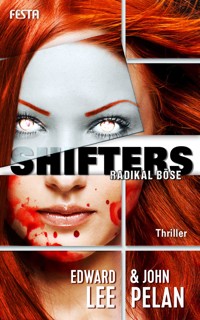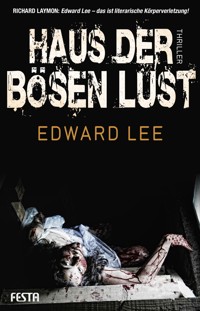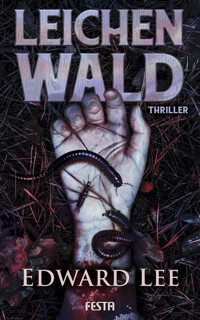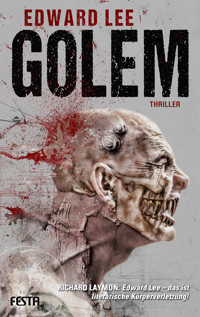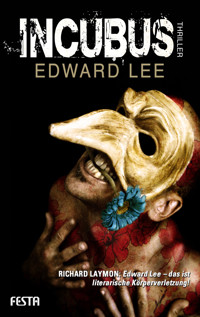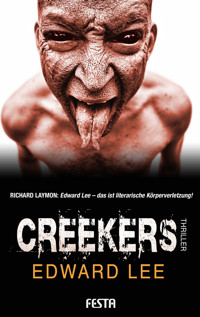4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Festa Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Horror Taschenbuch
- Sprache: Deutsch
Es ist kein Geist. Kein Dämon. Es ist etwas Schlimmeres. Möchtest du manchmal jemand anderes sein? Nun, jemand anderes ist dabei, du zu werden. Er wird in dein Herz und deinen Verstand eindringen, wird dich in Verzückung versetzen – und dich auf ein Schlachtfest mitnehmen. So wie Gott seinen Boten hat, so hat auch der Teufel seinen. Und dieser Bote ist hier, jetzt, in deiner Stadt. Jack Ketchum: 'Edward Lee hat einen ganz besonderen Platz in der modernen Horrorliteratur. Lee liebt Sex und das Schlüpfrige, und dafür schämt er sich nicht. Er peitscht eine Geschichte voran wie ein Rennpferd, weiß, wie er dich zu Tode erschreckt. Aber wenn er will, kann er auch langsam und eindringlich, damit du mitfühlst und nachdenkst. Und das ist es, was ihn einzigartig macht.' Der Verlag warnt ausdrücklich: Edward Lee ist der führende Autor des Extreme Horror. Seine Werke enthalten überzogene Darstellungen von sexueller Gewalt. Wer so etwas nicht mag, sollte die Finger davon lassen. Für Fans dagegen ist Edward Lee ein literarisches Genie. Er schreibt originell, verstörend und gewagt – seine Bücher sind ein echtes, aber schmutziges Erlebnis.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 424
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Aus dem Amerikanischen von Manfred Sanders
Impressum
Die amerikanische Originalausgabe Messenger erschien 2004 im Verlag Dorchester Publishing Co., Inc.
Copyright © 2004 by Edward Lee
© dieser Ausgabe 2014 by Festa Verlag, Leipzig
Lektorat: Alexander Rösch
Titelbild: Abe Robinson – www.blind7photography.com
Alle Rechte vorbehalten
eISBN 978-3-86552-296-2
www.Festa-Verlag.de
Für Kathy Rosamilia.WUMUITIFAY
Danksagung
Wie immer stehe ich bei vielen Menschen in der Schuld, aber besonders bedanken möchte ich mich bei folgenden Personen für ihre Unterstützung, Inspiration und Freundschaft: Tim McGinnis, Dave Barnett, Patti Beller, Wendy Brewer, Rich Chizmar, Doug Clegg, Don D’Auria, Kim und Tony Duarte, Dallas, Teri Jacobs, Tom Pic, Bob Strauss, Karen Valentine. Ewiger Dank gebührt Amy und Scott, Christy und Bill, Charlie, Cowboy Jeff, Darren, Julie, R. J., Stephanie und natürlich Audrey Craker und Kathy und Kirt Rosamilia; außerdem den coolen Leuten bei Philthy Phil’s und The Sloppy Pelican. Und nicht zuletzt danke ich Rich Underwood und John Grubmeyer für den technischen Kram bei diesem Buch – für alle Fehler ist hingegen allein der Autor verantwortlich!
PROLOG
In dem Paket wartete der Tod. Natürlich konnte Dodd das unmöglich wissen, schließlich war er kein Hellseher, aber das spielte ohnehin keine Rolle. Er hätte es niemals ahnen können – wie auch? Es handelte sich um eine simple Tatsache, die er noch früh genug erkennen würde: Das seltsame Päckchen, das er gerade vom Laufband genommen hatte, enthielt seinen Tod.
Dodd sortierte Pakete. Das war sein Job. Angestellter in der Paketbearbeitung. Nicht die schlechteste Beschäftigung der Welt. Eine Menge Vergünstigungen, gute Bezahlung und Rente, bezahlter Urlaub, die Möglichkeit, jederzeit Überstunden zu machen, wenn er mehr Geld brauchte, und natürlich die günstige Lage seines Arbeitsplatzes. Als er das besagte Paket vom Band nahm, dachte er nicht großartig darüber nach. Seine Aufgaben waren ihm mittlerweile derart in Fleisch und Blut übergegangen, dass er das Denken weitgehend einstellte.
Das Paketesortieren erledigte er wie ein Automat. Tagein, tagaus. Dieselbe Umgebung, derselbe Lärm, dieselben Aufgaben. Er stand neben dem Band und dachte: Das alles muss ich noch neun Jahre lang machen, bevor ich in Rente gehen kann. Diese Aussicht empfand er oft als frustrierend, obwohl seine Arbeit in der Regel ganz in Ordnung ging. Er wollte gar nicht darüber nachdenken, wie viele Pakete er im Laufe seiner beruflichen Laufbahn schon bearbeitet hatte; ob sie nebeneinandergelegt wohl um die Erde reichten? Oder bis zum Mond? Aber solche Rechnungen brachten einen am Verladeband nicht weiter. Besser, er legte jedes Paket einfach nur auf den richtigen Rollwagen und wandte sich dem nächsten zu.
Tagein, tagaus. Hin und wieder jedoch schweiften seine Gedanken ab, meistens zu etwas, das mit Sex zu tun hatte. Dodd war mit einer liebevollen, aber recht langweiligen Frau verheiratet. Weder attraktiv, noch unattraktiv, nur ... langweilig, so langweilig wie Dodds Leben in der Sortierstation. Wenn er seine Gedanken einmal abschweifen ließ, dachte er nie an sie. Vor seinem geistigen Auge zogen flüchtige Standbilder von Frauen vorbei, die er draußen auf der Straße gesehen hatte; so dicht an einem Strandbad gab es einiges, womit sich seine Gedanken beschäftigen konnten, wenn die Arbeit zu langweilig oder nervig wurde.
Gestern zum Beispiel hatte er an einem Drugstore angehalten, um Zigaretten zu kaufen, und dann war da diese wunderschöne Frau aufgetaucht – vielleicht 30 Jahre alt –, um ein Strandtuch und eine Flasche Sonnenöl zu bezahlen. Dodd hatte einen Tunnelblick bekommen, als er hinter ihr in der Schlange stand. Ihr Haar war glänzend, schokoladenbraun, schulterlang und duftend gewesen. Dazu weiße Shorts und ein umwerfendes rosafarbenes Bikinioberteil. Das Oberteil saß etwas zu eng; es quetschte ihre Oberweite auf rosiges Handtaschenformat zusammen. Ihre Haut jedoch hatte alles andere als gebräunt gewirkt; vermutlich arbeitete sie genau wie Dodd in einem Job, bei dem sie nicht viel in die Sonne kam. Aber ihre Schönheit hinterließ einen konzentrierten, sehr kompakten Eindruck. Sie dort stehen zu sehen, so sexy und dabei so ungezwungen, hatte Dodd wie ein Schlag getroffen – wie ein köstlicher, sinnlicher Schlag aufs Auge.
Ob sie spürte, wie er sie anstarrte?
Sie hatte sich umgedreht und ihn angelächelt.
Ein weiterer Schlag.
»Hi«, sagte sie.
»Hi«, antwortete Dodd und wäre fast ins Taumeln geraten. »Auf dem Weg zum Strand?«
»Ja.« Verlegen hielt sie das Strandtuch hoch. »Ist das zu glauben? Jetzt wohne ich seit fast einem Jahr hier und besitze noch nicht mal ein Strandtuch und bin noch kein einziges Mal am Meer gewesen. Aber heute werde ich das nachholen. Ich bin blass wie ein Gespenst.«
»Ich komm auch nicht viel raus«, erwiderte Dodd.
»Als Postbote?«, wunderte sie sich mit Blick auf seine Uniform. »Trotz Briefzustellung bei Wind und Wetter?«
»Ich bin kein Zusteller. Ich arbeite in der Filiale.« Ich bin Paketsortierer ... und du bist ein Päckchen, das ich gern mal auspacken würde ...
»Oh, das tut mir leid.«
»So schlimm ist es nicht. Ich hab’s dank Klimaanlage schön kühl, während alle anderen in der Hitze schmoren.«
»Gutes, altes Florida.« Sie spielte an der Flasche mit dem Sonnenöl herum. »Aber das gehört zu den Sachen, die mir nichts ausmachen. Ich liebe die Hitze. Ich liebe es, wenn es heiß ist.«
Wieder lächelte sie ihn an, sehr dezent.
»Ich auch«, antwortete Dodd.
Der Tunnelblick verengte sich. Sie erinnerte an eine Lichterscheinung mit ihren Kurven, ihren langen Beinen, ihrer frischen, glänzend weißen Haut. Er überlegte, wie ihre Nippel wohl aussehen mochten – groß und dunkel, wahrscheinlich etwas runzlig, entschied er. Er stellte sich vor, wie er sie küsste. Er stellte sich vor, wie ihre Körper sich aneinanderpressten, beide nackt, wie sie ihre Körperwärme miteinander teilten, die Arme ineinander verschlungen. Ihre Hände wanderten über seinen Körper ...
»Haben Sie Lust, mitzukommen?«
Seine Vision zersplitterte. Er blinzelte. »Mitzukommen?«, murmelte er.
»An den Strand, mit mir«, sagte sie, noch immer lächelnd. »Wir könnten in eine der Strandbars bei den Hotels gehen. Da bin ich noch nie gewesen.«
»Ich ...« Seine Hand klammerte sich um seine Brieftasche. »Ich würde sehr gerne, aber ...«
Jetzt sah sie seinen Ehering. Aber ihr Lächeln verflog nicht. »Oh, ich verstehe. Sie sollten kein allzu schlechtes Gewissen deswegen haben.« Sie hielt ihre Hand in die Höhe. »Ich hab auch so einen.«
Dodd blieb die Luft weg. Mach, dachte er, geh mit ... Aber er sagte: »Es ... es tut mir leid. Ich würde wirklich gern, aber ich kann nicht.«
Sie klimperte mit den Wimpern. »Ich verstehe. Sie sind ein guter Mann.«
Er konnte nicht aufhören, sie anzustarren, als sie ihr Handtuch und das Sonnenöl bezahlte. Ich könnte sie damit einreiben, stellte er sich vor. Ihr Hintern in den engen weißen Shorts hätte perfekter nicht sein können. Auch den wollte er mit Sonnenöl einreiben, genau wie den Rest ihres Körpers. Sie könnten zum FKK-Strand hinter dem Campingplatz gehen. Er wollte das Öl auf ihren Beinen verreiben, auf ihrem Rücken und sie dann umdrehen. Und noch mehr Öl über ihren perfekten Bauch und ihre Brüste verteilen ... über die Innenseiten ihrer Schenkel.
Überall.
»Bye«, verabschiedete sie sich mit einem Winken. Ein letztes Lächeln, das Dodd jetzt traurig vorkam, so traurig wie sein Leben.
»Bye. Viel Spaß.«
Sie ging hinaus, ihre Waden strafften sich im Takt ihrer schlappenden Badelatschen.
Großer Gott ...
Die Vision verblasste. Dodd stand wieder im Postamt und sortierte die endlosen Pakete.
Und dann nahm er das Paket in die Hand, das seinen Tod enthielt.
Er drückte den Stoppschalter des Laufbandes. Warum, wusste er nicht. Er dachte nicht: Warum habe ich das getan? oder Ich werde das Band anhalten. Er tat es einfach, stand da und sah das Paket an.
Es besaß eine ungewöhnliche längliche Form. Eingepackt in schlichtes braunes Papier, wie das, aus denen Einkaufstüten bestehen. Es gab keine Absenderadresse, der Poststempel war verschmiert; Dodd konnte deshalb weder Stadt noch Bundesstaat oder Postleitzahl des Absenders erkennen. Er betrachtete erneut die Anschrift:
POSTAMT DANELLETON
DANELLETON, FLORIDA
Eine unregelmäßige Kritzelei mit rotem Filzstift.
Aufgrund der typischen Kennzeichen – kein Absender, schäbige Verpackung – ließ ein Paket wie dieses bei jedem Sortierer sofort die Alarmglocken läuten. Aber es war keine Bombe. Das Paket enthielt kein Anthrax, kein Giftgas oder bakteriologische Kampfmittel. Man hatte es bereits im zentralen Verteilerdepot in Orlando geröntgt und auf Sprengstoff gescannt. Selbst zu dieser Zeit, vor dem Unabomber und der Anthraxhysterie von 2002, wurden derart verdächtige Postsendungen im Vorfeld in jedem Fall gründlich durchleuchtet. Auch dieses hatte man untersucht und als unbedenklich eingestuft. Und doch enthielt es seinen Tod. Aber es stammte nicht von einem Terroristen oder Psychopathen.
Nachdem auf dem Paketaufkleber kein konkreter Empfänger stand, hätte Dodds Aufgabe jetzt darin bestanden, es in das Büro des Filialleiters zu bringen. Sein Chef war derzeit noch nicht im Dienst. Doch stattdessen tat Dodd etwas, wozu er ausdrücklich nicht befugt war.
Er öffnete das Paket.
Es raschelte, als er das Papier aufriss. Fühlte sich der Karton heiß an? Nein, was für ein Unsinn. Er öffnete es langsam, nicht aus Furcht oder weil er Bedenken hatte, sondern in einer schwer erklärbaren Art von Verehrung. Seine Augen hatten sich geweitet, sein Blick ging ins Leere. Er sah das Paket nicht einmal an, verehrte es nur mit seinen Händen.
Und dabei schweifte ein Teil seiner Gedanken ab. Er dachte an die Frau, die ihn an den Strand eingeladen hatte. Doch jetzt stellte er sich nicht vor, wie er sie küsste; er stellte sich vor, wie er sie tötete. Wie er sie mit der Hand an der Kehle zu Boden drückte und ihr das rosafarbene Oberteil und die weißen Shorts herunterriss. Nein, er wollte nicht länger mit ihr schlafen, er wollte ihren Bauch aufschlitzen und ihr die Eingeweide herausreißen, während ihre Beine strampelten und ihr Körper zuckte. Das war es, was Dodd mit dieser eingebildeten Schlampe mit den dicken Titten, dem glänzenden schokoladenbraunen Haar und den weißen Shorts anstellen wollte. Er wollte ihre Shorts blutrot färben. Er wollte ihr das glänzende braune Haar vom Kopf reißen.
Dodd öffnete das Paket endgültig und schaute hinein.
Jimmy O’Brady war 14 Jahre alt und hatte jedes einzelne dieser 14 Jahre in Danelleton verbracht. Morgens trug er Zeitungen aus und an den meisten Tagen mähte er nach der Schule Rasen – ein fleißiger Junge. Und im Moment waren sogar Ferien, da konnte er noch mehr arbeiten. Die lange Straße – die Straße, in der er wohnte – badete in der grellen Floridasonne, und gerade strampelte er mit seinem Fahrrad zum nächsten Straßenblock, wo ein weiterer Rasen darauf wartete, gemäht zu werden. Geld regiert die Welt, das wusste Jimmy schon in seinen jungen Jahren. Er konnte es gar nicht erwarten, endlich 16 zu werden und einen Fulltime-Job anzunehmen. Dann konnte er in einem der Restaurants am Strand kellnern und richtiges Geld verdienen. Und erst recht konnte Jimmy es nicht erwarten, erwachsen zu sein. Er wusste schon, was er werden wollte, wenn er groß war: Er wollte bei der Post arbeiten.
Da vorne lief der Postbote. Mr. Dexter war cool. Er stellte jeden Tag in diesem Viertel die Briefe und Pakete zu und hatte immer ein bisschen Zeit, um mit Jimmy zu quatschen. Er erzählte ihm alles über die Arbeit bei der Post.
Jetzt kam Mr. Dexter gerade von der Haustür des Nachbarhauses zurück. Lächelnd bremste Jimmy und winkte. »Hi, Mr. Dexter!«
Der Postbote drehte sich auf dem Bürgersteig um, erwiderte das Lächeln und ging auf Jimmy zu.
Da sah Jimmy, dass es gar nicht Mr. Dexter war.
Dodd näherte sich dem Jungen mit dem Fahrrad. Nein, nein, nicht auf offener Straße, entschied er klugerweise. Kinder brauchten Erwachsene, zu denen sie aufblicken konnten, sie brauchten Vorbilder – genau wie Präsident Reagan es gesagt hatte. Fast hätte Dodd laut aufgelacht. Wenn ich dem Kleinen den Kopf abschneide, wird es schwierig mit dem Aufblicken.
»Hallo, Jimmy. Wie geht’s dir?«
»Prima, Sir.« Der flachsblonde Junge warf Dodd einen misstrauischen Blick zu. »Woher kennen Sie meinen Namen?«
»Ich bin der Postbote. Du heißt Jimmy O’Brady und wohnst in der Gatesman Lane 12404.« Dodd deutete auf das Haus an der Ecke. »Genau da. Als Postbote kennt man nun mal die Namen aller Leute.«
Der Junge blinzelte in die Sonne. »Aber Sie sind nicht der normale Postbote. Unser Postbote ist Mr. Dexter. Kennen Sie ihn?«
»Und ob ich ihn kenne, Jimmy. Ich bin für ihn eingesprungen, weil er heute krank ist.« Und das ist nicht mal wirklich gelogen. Ich habe den fetten Hurensohn mit dem Schulterriemen seiner Posttasche erdrosselt und seine Leiche in den Müllcontainer gestopft, bevor die Frühschicht in der Filiale eintraf. »Normalerweise trage ich selbst keine Post aus, schon seit Jahren nicht mehr. Ich bin Paketsortierer. Aber hin und wieder macht es Spaß, mal wieder eine Zustellrunde zu übernehmen. Gerade habe ich etwas bei euch zu Hause abgeliefert.«
»Ja? War was für mich dabei?«
»Tatsächlich, ja. Eine große Überraschung wartet auf dich, wenn du nach Hause kommst.«
Jetzt strahlte der Junge. Dodd fühlte sich wundervoll. In der Tat wartete eine große Überraschung auf den Jungen.
»Was ist es denn?«
»Das wirst du sehen, wenn du da bist. Es ist toll, Postbote zu sein. Jeden Tag kann man den Leuten nette Überraschungen ins Haus bringen. Und weißt du was, Jimmy? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass du auch eines Tages Postbote werden möchtest.«
»Woher wissen Sie das?«, fragte der Junge beeindruckt.
Ich weiß jetzt eine Menge. »Äh, Mr. Dexter hat mir davon erzählt.«
»Es stimmt! Ich will tatsächlich Postbote werden, wenn ich groß bin.« Aber der Junge wurde ungeduldig. Er schaute auf seine Armbanduhr. »Ich müsste jetzt eigentlich einen Rasen mähen, aber ...«
»Hat das nicht ein paar Minuten Zeit?«, schlug Dodd vor. »Du kannst doch schnell nach Hause fahren und dir erst die Überraschung ansehen. Deine Mutter ist zu Hause. Sie wird sie dir zeigen.«
Der Junge tappte nachdenklich mit dem Fuß. »Ja, ich glaube, das werd ich machen. Vielen Dank, Sir! Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder!«
»Das hoffe ich auch, Jimmy. Ich wünsche dir einen großartigen Tag.«
Aber bevor der Junge mit seinem Rad losfuhr, musterte er Dodd noch einmal. »Warum haben Sie den an? Ist Ihnen nicht heiß?«
Dodd trug den langen offiziellen Dienst-Regenmantel. »Mir? Nein, ich liebe die Hitze, Jimmy. Außerdem soll es in Kürze ein Gewitter geben.«
Jimmy warf einen Blick auf den wolkenlosen Himmel, dann zuckte er die Schultern. »Wenn Sie es sagen. Tschüss!«
»Bis später, Jimmy«, erwiderte Dodd und wandte sich dem nächsten Haus zu. Er hatte bisher erst fünf Adressen in der Straße geschafft, aber er hatte sich vorgenommen, alle zu erledigen, bevor die Polizei eintraf. Die Männer waren alle auf der Arbeit und hatten ihre Frauen allein zurückgelassen. Frauen waren am einfachsten und machten am meisten Spaß. Mit ein bisschen Glück, dachte Dodd, schaffe ich vielleicht sogar zwei oder drei Straßenblocks, bevor sie mich schnappen ...
Er wollte jedenfalls sein Bestes geben.
Er ging zur nächsten Tür – zu den McNamaras, Hausnummer 12408 – und klingelte. Sie öffnete sich ein paar Zentimeter und ein hübsches Gesicht lugte heraus.
»Hi, Mrs. McNamara. Ich bin’s nur, der Postbote. Ich habe eine Expresszustellung für Sie, für die ich Ihre Unterschrift brauche.«
»Ah, okay. Kommen Sie rein«, sagte die Frau und öffnete die Tür vollständig.
Dodd dankte ihr mit einem Lächeln und trat ein. Als er im Flur stand, von der Straße aus nicht mehr zu sehen, zog er die Machete hervor, die er unter dem Regenmantel versteckt hatte.
Einige Sekunden nachdem Jimmy O’Brady in das geräumige Haus im Kolonialstil an der Gatesman Lane gestürmt war, konnte er sich nicht länger bewegen, nicht schreien, nicht blinzeln. Er konnte nur starren und zittern. Er litt an etwas, das ein Arzt womöglich als reaktiven psychogenen Adrenalinschock bezeichnet hätte. Laienhaft ausgedrückt litt er darunter, dass ihm das Entsetzen in die Glieder gefahren war.
Eine rote Flüssigkeit glänzte auf den unbehauenen Feldsteinen der Diele. Unterbewusst erkannte er sofort, dass es sich um Blut handelte. Bewusst wollte sein Gehirn es nicht akzeptieren, vor allem, weil er wusste, dass die einzige andere Person im Haus seine Mutter war. Deshalb musste es ihr Blut sein.
Und es war eine Menge Blut. Es sah aus wie damals, als sein Vater in der Garage den Eimer mit dem zinnoberroten Lack, Sherwin-Williams No. 10, umgestoßen hatte. Eine riesige rote Pfütze.
Der enthauptete Leichnam seiner Mutter lag auf der Treppe, der Halsstumpf auf der untersten Stufe, sodass sie mithilfe der Schwerkraft noch schneller ausbluten konnte. In Jimmys Körper spielten sich eine Reihe gegensätzlicher Reaktionen ab: Sein Herz hämmerte, aber sein Blutdruck sank, sein Adrenalinspiegel war hoch, aber seine Knie wurden weich, sein Gehirn schrie nach Flucht, während sein Körper den Dienst versagte. Verteidigungsmechanismen kämpften gegen eine psychologische Überlastung an, die sein Bewusstsein aus dem Verkehr ziehen wollte.
Doch trotz seines jugendlichen Alters kehrte nach knapp einer weiteren Minute ein Funken Verstand in ihn zurück. Er blinzelte, seine Synapsen begannen wieder zu feuern. Er erkannte:
Meine Mutter ist ermordet worden.
Und es muss dieser Postbote gewesen sein, denn er hat mir gesagt, dass er gerade hier gewesen ist ...
Das Haus war still. Er blinzelte noch einmal und dann dachte er:
Ich muss die Polizei anrufen.
Er rannte zum Telefon in der Küche, sah, was sich dort befand, und schrie. Ja, der Postbote hatte ein Päckchen für ihn dagelassen. Der Kopf seiner Mutter lag ordentlich direkt neben dem Telefon auf dem Küchenschrank. Ihre Augen standen offen und sie schaute ihn an. Fast schien es, als lächele sie.
Jimmy konnte nur glotzen.
Seine Mutter lächelte tatsächlich. Ihre Lippen krümmten sich, und ihre Augen öffneten sich noch ein Stück weiter, während er sie anstarrte. »Jimmy«, sagte sie mit ihrer sanftesten, freundlichsten, süßesten Stimme. »Wie geht es dir, mein Schatz? Solltest du nicht irgendwo Rasen mähen?«
»M-M-Mom?«, stammelte Jimmy.
»So ein braver, braver Junge«, lächelte seine Mutter. »Wusstest du, dass dein Vater und ich eigentlich gar nicht vorhatten, Kinder zu bekommen? Er wollte mich nicht mal heiraten! Also hörte ich auf, die Pille zu nehmen, damit ich schwanger werde. Ich wusste, wenn ich schwanger bin, dann heiratet er mich. Er verdiente nicht schlecht und ich hatte keine Lust mehr, zu arbeiten – er war der perfekte Trottel. Scheiße, ich wollte keine Kinder, ich hasse Kinder. Aber zu arbeiten, hasse ich noch mehr, also dachte ich mir: So ein kleiner Hosenscheißer wird schon nicht so schlimm sein.«
Jimmy glotzte sie nur an.
»Aber du bist ein guter Junge, Jimmy. Das hast du bestimmt von deinem Vater, denn ich bin ganz sicher kein guter Mensch. Keine Sorge, du wirst später einmal so wie dein Vater. Ein perfekter Trottel, ein Armleuchter.«
Jimmy wurde schwindelig.
»Ich habe deinen Vater bei jeder Gelegenheit betrogen ...«
Jimmy rannte zum Nachbarhaus, zu den Norahees. Vor Schock und Entsetzen fühlte er sich ganz benommen; er konnte nicht mehr klar denken. Nur sein Instinkt trieb ihn an. Die Haustür stand einen Spalt weit offen, also stürmte er hinein.
Der Flur war voller Blut, genau wie zu Hause. Mrs. Norahee lag geköpft auf der Treppe, und als er in die Küche rannte ...
»Deine Mutter ist jetzt in der Hölle«, sagte der Kopf von Mrs. Norahee. »Das kannst du mir glauben. Ich bin nämlich bei ihr.«
Dem Wahnsinn nahe rannte Jimmy in jedes Haus in der Gatesman Lane. Überall das gleiche Bild.
Vor dem letzten Haus brach er zusammen. Sein Verstand stand kurz davor, komplett den Dienst zu verweigern. Mit halbem Ohr nahm er einen kurzen Schrei aus dem Gebäude an der nächsten Straßenecke wahr. Einen Augenblick später sah er den Postboten herauskommen und gemächlich zu den Nachbarn gehen. Bevor er an die Tür klopfte, drehte sich der Mann langsam um und winkte Jimmy lächelnd zu.
Kapitel 1
20 Jahre später
(I)
Mit einem lauten Schnipp durchtrennten die rostfreien Klingen der Schere das gelbe Band. Als es zu Boden fiel, applaudierte die kleine Menschenmenge, die sich zu der Feierstunde eingefunden hatte.
Das war einfach, fand Jane. Sie reichte die Schere zurück an den Bürgermeister. Einige Kameras blitzten auf und der Applaus wurde lauter. Unter den Gästen fanden sich sogar ein paar Reporter und Fotografen von den Lokalzeitungen. Eigentlich war es keine große Sache, aber es wirkte trotzdem so. Dieses ganze Trara. Und wozu? Meine Güte, wir eröffnen doch nur ein neues Postamt! Aber in einer Kleinstadt war das nun einmal ein echtes Ereignis. Jane hielt nicht viel von Presse und Publicity – sie war mehr die Pragmatikerin. Sie fühlte sich sogar ein wenig unwohl.
Ja, dachte sie noch einmal. Das war einfach. Jetzt beginnt der schwierige Teil.
»Vielen Dank, Jane«, sagte der Bürgermeister ins Mikrofon; durchaus möglich, dass er sich vor der Eröffnungszeremonie schon den einen oder anderen Wodka Tonic genehmigt hatte. »Nachdem das Band nun durchtrennt ist, darf ich Sie alle zu Keksen und Punsch in das neue Postamt einladen!«
»Oh Gott«, raunte Carlton Spence ihr zu. »Kekse und Punsch. Wie spießig ist das denn?«
»Wart’s nur ab«, flüsterte Jane zurück. »Du hast den Punsch noch nicht probiert.«
Jane lächelte und nickte und schüttelte den Besuchern die Hände, als sie an ihr vorbei ins Gebäude strömten. Dieses Spiel beherrsche ich nicht besonders gut, dachte sie. Als der größte Teil der Menschenschlange drinnen angekommen war, seufzte Carlton. Er arbeitete jetzt als Janes Stellvertreter. Ein freundlicher und liebenswürdiger Kerl, Anfang 40, immer für eine sarkastische Bemerkung zu haben. Er beherrschte seinen Job so gut wie Jane ihren eigenen, deshalb wusste sie, dass sie beide ein hervorragendes Team abgaben. Und manchmal hatte er ein überraschend feines Gespür.
»Entweder hat dir heute Morgen dein Hund in die Schuhe gepinkelt«, sagte er, »oder unsere wunderbare Einweihungsfeier geht dir gehörig auf die Nerven.«
»Ich hab keinen Hund.«
»Ich weiß.«
Sie lächelte matt. »Ich will nur endlich weitermachen. Diesen Quatsch hinter mich bringen und meinen Job erledigen.«
Carlton kratzte sich den Bierbauch, an dem er die letzten 20 Jahre hart gearbeitet hatte. »So ist es nun einmal mit der Kommunalpolitik. Die Einweihung eines Postamts bedeutet in einem Kaff wie Danelleton genauso viel wie die Einweihung eines Einkaufszentrums in einer richtigen Stadt.« Ein Fotograf erwischte einen Schnappschuss von ihnen beiden und eilte dann ins Gebäude. Carlton runzelte die Stirn. »Außerdem brauchen die Lokalzeitungen doch etwas, worüber sie schreiben können, oder?«
Jane verstand die Anspielung. Danelleton hatte eine der niedrigsten Pro-Kopf-Verbrechensraten im gesamten Bundesstaat. Ich sollte mich freuen, dass das hier die Top-Story der Woche ist, und nicht eine Schießerei oder ein Drogenmord.
»Oh, und noch etwas«, fuhr Carlton fort. »Herzlichen Glückwunsch zur Beförderung, Jane. Du wirst den Laden schon schaukeln, als Chefin des Ganzen.«
»Wir werden den Laden schaukeln, Mr. Stellvertretender Vize-Postmeister.«
»Ist das nicht so was Ähnliches wie der Stellvertreter des Assistenten des Assistenten des stellvertretenden Staatssekretärs?«
»Genau. Du kochst den Kaffee, und ich verteil ihn dann.«
Sie lachten, aber sie wussten auch: Ganz so schlimm war es nicht.
Carlton schielte zur Sonne hinauf. »Es wird großartig, wart’s nur ab.«
»Das hoffe ich. Aber ich verstehe immer noch nicht, wofür Danelleton ein zweites Postamt braucht.«
»Machst du Witze? In den letzten zwei Jahrzehnten hat sich die Einwohnerschaft vervierfacht. Das Hauptpostamt am Marktplatz reicht nicht mehr aus. Fortschritt nennt man das, Jane. Es ist eine gute Sache. Mehr Leute, die herziehen, bedeuten mehr Geld für die hiesige Wirtschaft.« Carlton zuckte die Schultern. »Mehr Post, die zugestellt werden muss. Und ich sag dir eins ...« Er spähte wieder in Richtung Sonne, betrachtete den wolkenlosen Himmel. Gerade flog eine Schar Honigpapageien vorbei. »Es gibt üblere Orte, um bei der Post zu arbeiten.«
»Ich weiß, wir sitzen hier im Sonnenparadies und die anderen armen Schweine dürfen Post in den Gettos von South St. Pete zustellen. Keine Sorge, ich weiß das durchaus zu schätzen und freu mich drauf ...«
Jane schwieg und betrachtete das kleine, aber schmucke Gebäude. Es gehört mir, sagte sie sich. Plötzlich verdrängte Stolz das Unbehagen, das die Einweihungsfeier bei ihr auslöste. Ich bin der Boss. Diese kleine Zweigstelle ist mein Baby. Kühle Luft blies ihnen entgegen, als die Automatiktüren vor ihnen zur Seite glitten und sie das Gebäude betraten. Sie ignorierten die fortgesetzten Einweihungsformalitäten drüben beim Souvenirshop – dem Bürgermeister schien der aufgepeppte Punsch allmählich in den Kopf zu steigen – und gingen zu den Postschaltern.
»So viel zu Punsch und Keksen«, sagte Carlton.
Kunden standen an den Schaltern Schlange, um Briefmarken zu kaufen, Pakete zu verschicken und Briefe abwiegen zu lassen. »Ja«, nickte Jane. »Ich schätze, wir sollten uns besser um die Kundschaft kümmern. Mein Gott, sieh sie dir nur alle an.«
Carlton kratzte sich erneut am Bierbauch. »Ach, keine Panik. Ich wette, die Hälfte von denen ist nur wegen der neuen Elvis-Briefmarke gekommen.«
Jane hoffte es. Was du heute kannst besorgen ..., überlegte sie. »Wir sehen uns zum Feierabend, Carlton. Und vergiss nicht, die alten Akten aus dem Keller räumen zu lassen. Wir wollen doch nicht, dass wir gleich in der ersten Woche eine Verwarnung von der Feuerwehr bekommen.« Dann ging sie durch die Schiebetür hinüber in den Verwaltungsbereich. Hier war es ruhiger, aber wenn sie die Ohren spitzte, konnte sie die Lkws hören, die hinter dem Gebäude an die Laderampen heranfuhren.
Ihre Schritte klackerten über die brandneuen Fliesen. Sie ertappte sich dabei, wie sie in einem Bürofenster ihr Spiegelbild betrachtete. Wie gefällt dir das?, fragte sie sich selbst. 35 Jahre und immer noch verdammt attraktiv. Wenn man einmal den marineblauen Rock und die himmelblaue Postjacke außer Acht ließ, hatte Janes Aussehen in den letzten Jahren sogar noch gewonnen, als sei ihre Attraktivität gereift und gewachsen. Die Brüste noch straff, der Bauch noch flach, und das nach zwei Kindern. Ich kann mich wirklich nicht beschweren. Mittagsblaue Augen blickten ihr entgegen; der unsichere Gesichtsausdruck wurde von einem selbstbewussten Lächeln weggewischt. Ihr Haar war etwas zu hell, um es als brünett zu bezeichnen, aber es war auch kein Kastanienbraun, sondern ging eher in Richtung Zimt, und sie trug es etwas kürzer als schulterlang.
Das helle Glänzen ihrer Haare wurde noch verstärkt durch ihre satte Sonnenbräune – ein Musterbild von Vitalität. Jane war froh, dass ihre Kurven alle an den richtigen Stellen geblieben waren. Ihre Brüste füllten die Bluse gut aus, ihre Nippel zeichneten sich andeutungsweise unter dem leichten Stoff ab, und wenn sie mit den Hüften wackelte und grinste, konnte sie richtig verrucht aussehen. Irgendwie passt das nicht zu mir, dachte sie lächelnd. Jane, das Postluder. Nein, sie sah aus wie eine schöne, selbstbewusste, moderne, berufstätige Frau, gut in Form und im besten Alter. Mein Leben liegt noch vor mir, und was noch besser ist, lachte sie in sich hinein, die Kerle auf der Baustelle pfeifen mir immer noch hinterher!
Der Tag hatte gut angefangen und war noch besser geworden; Jane fühlte sich rundum zufrieden. Es hatte auch andere Zeiten gegeben seit dem Umzug – seit dem Tod ihres Mannes. Manchmal kam ihr das Leben als Witwe mit zwei kleinen Kindern wie eine unlösbare Aufgabe vor. Es war unmöglich, alles richtig zu machen, zu viele Hindernisse schienen sich ihr in den Weg zu stellen, zu viele Probleme. Oft war sie unsicher gewesen und hatte an sich selbst gezweifelt.
Aber sie hatte durchgehalten und jetzt konnte es kaum besser sein: die Beförderung, das neue Postamt, und die Kinder gewöhnten sich allmählich an die Schule und ein Leben ohne ihren Vater.
Und jetzt das hier ...
Janes Blick wanderte an dem Bürofenster entlang, das ihr Spiegelbild einrahmte, bis zu den Worten, die dort oben in schwarzen Buchstaben standen: JANE RYAN, FILIALLEITERIN, POSTSTELLE DANELLETON WEST.
(II)
›Idyllisch‹ war nicht das richtige Wort, es brachte die Sache nicht auf den Punkt. Die Stadt als romantisch, malerisch oder anheimelnd zu bezeichnen, mochte abgedroschen klingen, passte aber besser. Danelleton war gewachsen, hatte aber keine der Eigenschaften eingebüßt, die es in der heutigen Zeit so einzigartig machten. Aus dem kleinen Vorort im mittleren Florida war längst eine eigenständige Stadt geworden, die blühte und gedieh, ohne dabei ihren ursprünglichen Charakter zu verlieren. Vielleicht sorgte die Lage abseits eines großen Highways an einer ländlich anmutenden Umgehungsstraße für die nötige Isolation, vielleicht war da aber auch etwas Spirituelles, das den Ort vor dem üblichen Niedergang schützte, der normalerweise der Immobilienerschließung in der Nähe großer Touristenhochburgen folgte.
Das Städtchen lag zwischen Tampa und St. Petersburg – große Städte mit hohen Kriminalitätsraten –, aber in Danelleton gab es so gut wie gar kein Verbrechen. Im vergangenen Jahr beispielsweise hatten die schwersten Vergehen in einem Fahrraddiebstahl bestanden, einigen Graffiti in einer Seitenstraße der Main Road und einem umgekippten Dixi-Klo auf einer Baustelle. Keine Drogen, keine Vergewaltigungen, keine bewaffneten Raubüberfälle.
Man fuhr nur zehn Minuten bis zu den Stränden am Golf von Mexiko. Es gab hervorragende Schulen, ausgezeichnete städtische Versorgungsbetriebe, eine Vielzahl an Vereinen und wohltätigen Organisationen. Die Immobilienpreise waren auf wundersame Weise stabil geblieben, während sie in anderen Städten explodierten. Genügend Betreuungsplätze für Kinder, genügend Freizeitangebote. Die Familien hielten zusammen; jeder passte auf den anderen auf. Es gab so gut wie kein zwielichtiges Gesindel, keine ›sündigen‹ Viertel. Im Grunde war Danelleton so etwas wie ein Vorzeigemodell für den Mittelstand in Florida.
Und dann diese Schönheit.
Palmen säumten saubere Straßen, an denen sich üppige grüne Rasenflächen ausdehnten, farbenprächtige Gärten und bescheidene, aber gepflegte Eigenheime. Noch mehr üppiges Grün diente als Kulisse für den Osten der Stadt: ein bewaldeter Hügel voller Farne und australischer Kiefern. Im Westen erhob sich der große zitronengelbe Wasserturm mit seiner grellrosa leuchtenden Aufschrift: IT’S A BEAUTIFUL DAY. Der Marktplatz verbreitete einen geruhsamen Charme und Boote schaukelten sanft an ihren zur Bucht hin gelegenen Liegeplätzen und ließen träge ihre Taue gegen die Masten schlagen. In Danelleton schien die Sonne immer heller zu sein, der Himmel strahlender, die Luft reiner.
Was konnte man von einer Stadt mehr verlangen? Und wer würde nicht hier leben wollen? Danelleton kam der Perfektion so nahe, wie es nur sein konnte. Wunderschön, zivilisiert und sicher. Keine Drogen, keine Vergewaltigungen, keine bewaffneten Raubüberfälle, keine Mor...
Na ja, es hatte hier mal ein paar Morde gegeben.
Aber das lag schon lange zurück.
(III)
Im Keller.
Mein Gott, was für ein Durcheinander, dachte Carlton. Auf den Knien kroch er tiefer in den niedrigen, dunklen Abstellraum hinein. Mit einer Hand schwenkte er unbeholfen die Taschenlampe, während er mit der anderen Kartons herauszog, die sich seit Jahrzehnten hier stapelten. Die einzige Möglichkeit, ans andere Ende des kleinen Raumes zu gelangen, bestand darin, alles auszuräumen. Aber mit einer Sache hatte Jane recht gehabt. Der Keller stellt wahrhaftig ein Brandrisiko dar. Das wurde dem mittlerweile über und über mit Staub bedeckten Carlton klar. Wenn die Feuerwehr das hier sieht, macht sie uns sofort den Laden dicht, bis wir alles weggeschafft haben. Der Müll bestand hauptsächlich aus alten Kartons voller Akten, antiquierten Sortiergeräten und Ersatzteilen, alten Postuniformen und nicht mehr verwendetem Verpackungsmaterial. Wenn er diese ganzen Kartons nach draußen schleppte, konnte er bestimmt eine Pyramide daraus bauen, die so hoch war wie das Postamt selbst.
Da bin ich der Vizechef in diesem Laden und was mache ich? Schleppe Müll aus dem Keller! Carlton bezweifelte, dass dieser Aufgabenbereich in seiner Stellenbeschreibung auftauchte.
Aber er nahm es sportlich und lachte darüber, auch als ihm die Spinnweben im Gesicht klebten. Es war eine stumpfsinnige Arbeit: hineinkriechen, einen Karton schnappen, ihn herausziehen, dann wieder reinkriechen und den nächsten holen. Damit dürfte er für den Rest des Tages beschäftigt sein, aber zumindest konnte er sich auf den Feierabend freuen. Er hatte sich vorgenommen, einen Abstecher in die Bar zu machen – bedeckt mit Staub und Spinnweben –, um den ersten Tag seiner Beförderung zu feiern.
Carlton störte es nicht, dass man Jane die Filialleitung übertragen hatte und nicht ihm, obwohl er schon länger im Dienst war als sie. Er fühlte sich sowieso eher als Mann fürs Grobe, hatte einen guten Draht zu den Angestellten, während Jane besser mit dem Papierkrieg und den Verwaltungsaufgaben zurechtkam. Ehrlich gesagt freute er sich für sie, und er freute sich auch darüber, dass die Stadt dieses zweite Postamt eröffnet hatte, denn es bewies, dass Danelleton im Aufschwung war. Mehr Einwohner bedeuteten mehr Häuser und somit auch mehr Post, als die Hauptfiliale bewältigen konnte. Tatsächlich hatten sowohl Carlton als auch Jane ihre berufliche Laufbahn dort am Marktplatz von Danelleton begonnen, und es rankten sich nicht gerade erfreuliche Erinnerungen um das Gebäude. Oh Gott, dachte er, als ein Bild aus seiner Vergangenheit an seinem geistigen Auge vorbeizog. Er hielt inne, von einem jähen Anflug von Verzweiflung überwältigt.
Er holte tief Luft, wartete einige Momente, dann griff er nach dem nächsten Karton und zerrte ihn ins Freie.
Im Hauptpostamt hatte sein Leben als Familienvater beginnen sollen, aber tatsächlich hatte es dort geendet.
Denk nicht darüber nach, warnte er sich. Es ist vorbei. Du hast ein neues Leben, auf das du dich konzentrieren solltest. Die Vergangenheit ist Geschichte, im Guten wie im Schlechten.
In der letzten Zeit, in den letzten Jahren, musste er nur noch selten daran denken. Er war darüber hinweggekommen, mithilfe von Zeit, Vernunft und einem guten Therapeuten.
Schluss mit dem Mist! Hol die nächste Kiste und erledige deinen Job!
So ganz konnte er es vermutlich nie abschütteln. Wie auch? Wie konnte ein Mensch so etwas vergessen? Und was er gar nicht verstand, als er einen weiteren Karton mit alten Akten aus dem Kabuff zog, war: Warum musste er gerade jetzt daran denken? Und warum ausgerechnet hier? Vor seiner Beförderung hatte er sich nie in diesem Gebäude aufgehalten. Die Filiale Danelleton West war vor 20 Jahren aufgegeben und geschlossen worden. Seitdem hatte man sämtliche Post über das Hauptpostamt in der Stadt geschleust. Die gerade erst wiedereröffnete Filiale besaß keinerlei persönliche Bedeutung für Carlton.
Er schüttelte den Kopf in dieser muffigen, vom Licht der Taschenlampe nur unvollkommen zurückgedrängten Dunkelheit.
Warum brachte ausgerechnet dieses Gebäude die schlimmsten Erinnerungen seines Lebens wieder zum Vorschein?
Gewaltsam versuchte er, seinen Geist davor zu verschließen, und zerrte grunzend eine weitere Kiste aus der Kammer. Sein Kragen färbte sich dunkel vom Schweiß. Sein Herz schlug schneller.
Erst Mariel, überlegte er. Dann Belinda.
Es war alles so schnell gegangen, sodass es ihm auch heute noch manchmal wie ein schlechter Traum vorkam. Nach acht wundervollen Ehejahren und ohne jede Vorwarnung hatte Mariel den Verstand verloren. Komplett. Laienhaft ausgedrückt war sie schlicht und einfach durchgedreht. Die Psychiater sagten, sie hätte einen systematischen psychotischen Zusammenbruch erlitten, zusammen mit paranoiden Vorstellungen und Amin-induziertem Wahn sowie Anzeichen von etwas, das sich Capgras-Syndrom nannte. Mit anderen Worten: Carltons Frau hatte angefangen zu glauben, dass nichts und niemand um sie herum echt war. Zum Beispiel hatte sie sich eingeredet, dass Carlton in Wirklichkeit gar nicht Carlton war, sondern ein identisch aussehender Doppelgänger.
Das Gleiche hatte Mariel auch von den Nachbarn, ihren Freunden und ihren Eltern gedacht – von allen, die ihr im Leben nahestanden. Ihrer Meinung nach waren sie allesamt Fälschungen. Und denselben Verdacht hegte sie auch gegenüber dem Haus, dem Auto und schließlich dem ganzen Stadtviertel. Alles war im Zuge einer Verschwörung ausgetauscht worden, um sie hinters Licht zu führen. Carlton hatte später im Internet etwas über das Syndrom gelesen. Es galt als selten, aber überaus ernst zu nehmend, ausgelöst entweder durch Gehirnschäden oder Mikrotumore. Mit anderen Worten: unheilbar. Von einem Moment auf den anderen hatte Carlton seine Frau verloren.
Und seine Tochter Belinda.
Sieben Jahre lag das jetzt zurück. Belinda hätte in Kürze ihren 19. Geburtstag gefeiert – aber dann korrigierte er sich: Nicht ›hätte‹. Sie ist jetzt fast 19.
Carlton hatte nie die Hoffnung aufgegeben, dass Belinda noch lebte. Mariels Leiche war aus dem Unfallwagen geborgen worden, aber Belinda hatte man nie gefunden. Man fand in den Trümmern keine Rückstände ihrer Blutgruppe, keinerlei Spuren, die darauf hindeuteten, dass sie verletzt worden war. Sie hatte im Auto Popcorn gegessen, und die Leute von der Spurensicherung fanden Belindas Fingerabdrücke und Rückstände von Maissirup und Zucker auf dem Verschluss des Sicherheitsgurtes und dem Griff der Beifahrertür, also war sie definitiv angeschnallt gewesen.
Aus unerfindlichen Gründen war Belinda der einzige Mensch, den Mariel in ihrem Wahn nicht für eine Fälschung gehalten hatte. Also hatte sie eines Nachts ihre Tochter in den Familienkombi gesetzt und die Stadt verlassen – um sich selbst und ihre Tochter vor der ›Verschwörung‹ in Sicherheit zu bringen. Sie kam bis Baltimore, wo sie auf der Interstate 95 von einem betrunkenen Autofahrer gerammt wurde. Mariel war durch die Windschutzscheibe geschleudert worden – sie vergaß immer, sich anzuschnallen – und hatte sich beim Aufprall das Genick gebrochen. Sofort tot.
Aber Belindas Leiche tauchte nicht auf.
Denk nicht drüber nach, denk nicht drüber nach, denk nicht drüber nach, hämmerte es in Carltons Schädel.
Aber irgendetwas zwang ihn, darüber nachzugrübeln.
Auch der betrunkene Fahrer war ums Leben gekommen, daher hatte es keine überlebenden Zeugen gegeben. Die Polizei von Maryland sagte Carlton jedoch, ein Autofahrer, der damals anhielt, um zu helfen, habe gesehen, wie in dem Moment, als er anhielt, ein anderes Fahrzeug vom Seitenstreifen abfuhr. Er glaubte, durch das Heckfenster zwei erwachsene Männer und eine kleinere Gestalt gesehen zu haben. »Kleiner, tiefer sitzend, ein Kind vielleicht«, hatte er gegenüber der Polizei ausgesagt.
»Ich weiß, dass es für Sie schwer zu akzeptieren ist«, hatte ein FBI-Mann später zu Carlton gesagt, »aber wir gehen davon aus, dass Ihre Tochter in unlauterer Absicht vom Unfallort entführt wurde.«
Entführt? Unlautere Absicht?
Nein. Das war nichts, was er jemals im Leben ›akzeptieren‹ konnte.
Bestimmt war Belinda, traumatisiert von dem Unfall und Zeugin des Todes ihrer Mutter, im Schockzustand aus dem Wagen gekrochen und von einem anderen Autofahrer gefunden worden. Einem normalen, anständigen Menschen, der das Wrack gesehen und das kleine zwölfjährige Mädchen von der Straße aufgegabelt hatte. Nicht in unlauterer Absicht. Anschließend hatte er Belinda zum nächsten Krankenhaus gebracht. Bestimmt würde Carlton bald von der Polizei hören, dass sich Belinda in Sicherheit befand, auf dem Wege der Besserung und in Kürze wieder zu Hause.
Nach ein paar Wochen wusste ein Teil von Carlton, dass er sich etwas vormachte. Und nach ein paar Monaten stieg in ihm der Verdacht auf, dass er seine Tochter nie wiedersehen würde. Sie war in unlauterer Absicht entführt worden.
In Gott weiß welcher Absicht.
Schließlich setzte die Polizei ihn über ihre schlimmsten Befürchtungen in Kenntnis, aber Carlton hörte gar nicht zu. Er konnte nicht in solchen Begriffen von seiner geliebten Tochter denken. Stattdessen klammerte er sich an die bestmögliche Hoffnung: dass ein ansonsten hochanständiges Paar Belinda zu sich genommen hatte, weil es selbst keine Kinder bekommen konnte. »Ich meine ... das ist doch möglich, oder?«, hatte er den FBI-Mann förmlich angefleht. »So etwas könnte doch geschehen sein. Oder?«
»Natürlich, Sir. So etwas passiert jeden Tag ...«
Das war alles, was Carlton hören wollte, und dabei beließ er es auch. Er beließ es bei diesem schwachen Hoffnungsschimmer und wollte nichts Gegenteiliges glauben. Und dann schob er alles zur Seite, das Beste, was ein Mensch in seiner entsetzlichen Situation tun konnte.
Bis heute.
Bis er in diesen alten dunklen Keller gekommen war, um einen Haufen 20 Jahre alter Kartons wegzuräumen, die ein Brandrisiko darstellten.
Oh, Belinda. Bitte sei am Leben. Bitte sei gesund. Bitte sei bei Leuten, die sich um dich kümmern ...
Er hatte schon öfter von so etwas gelesen oder es im Fernsehen gesehen: Ansonsten freundliche und anständige Paare, die todunglücklich waren, weil sie keine eigenen Kinder bekommen konnten, entführten die Kinder von anderen. Und das in dieser Situation? Nachdem sie gerade den Tod ihrer Mutter mit angesehen hatte? Im Schock aus dem Wrack des Autos gekrochen war? Gut möglich, dass Belinda das Gedächtnis verloren hatte und ihr die neuen Eltern einredeten, dass nicht nur ihre Mutter bei dem Unfall ums Leben gekommen war, sondern auch ihr Vater. Vermutlich konnte sie sich an gar nichts mehr aus ihrer Vergangenheit erinnern, einschließlich Carlton. Verzögerte Stressreaktion. Amnesie. Etwas in der Art. Carlton konnte nur beten, dass es so gelaufen war.
Belinda.
Eine letzte Kiste, voll mit klappernden Ersatzteilen. Keuchend zerrte Carlton den staubigen, dreckigen Karton aus dem Verschlag. Das war’s. Das ist der letzte. Mit dem Ärmel wischte er sich den Schweiß von der Stirn, dann leuchtete er noch einmal in den Kriechgang, ob er auch nichts übersehen hatte.
Etwas glänzte.
Was mag das sein ...
Kartons befanden sich dort keine mehr. Aber er war ganz sicher, dass dort etwas auf dem Boden schimmerte, wenn er mit der Taschenlampe hineinleuchtete.
Ach, was soll’s. Ein letzter Kontrollgang bringt mich nicht um. Und dreckiger kann ich sowieso nicht mehr werden.
Also kroch Carlton wieder hinein. Die Rückwand des engen Raumes blitzte im Licht der Taschenlampe auf, als er näher kam. Aber auch seine Augen leuchteten. Der glänzende Gegenstand war ein Armband ...
Ein Armband, das ihm sehr bekannt vorkam.
Carlton hob es auf.
Und starrte es an.
Das ist unmöglich.
Es war ein silbernes Kettenarmband mit glänzenden kleinen Delfinen. Es sah genauso aus wie das Armband, das er Belinda vor sieben Jahren zu ihrem zwölften Geburtstag geschenkt hatte.
Unmöglich.
Wahrscheinlich ging nur seine Fantasie mit ihm durch. Ja, so musste es sein. Es war nur irgendein altes Armband, und weil er gerade an Belinda gedacht hatte, redete sein Unterbewusstsein ihm ein, dass es genauso aussah wie das von Belinda.
So musste es sein.
Seine Hände zitterten, als er einen der silbernen Delfine umdrehte und die Inschrift las:
FÜR BELINDA. VON DAD.
Und dann hörte er ...
Carltons Kopf ruckte hoch.
Er blickte genau auf das Ende des Kriechgangs, anscheinend nichts weiter als eine ganz normale Rigipswand.
Aber dieses Geräusch ...
Was zum ...?
... ein Geräusch, das von irgendwo hinter der Wand kam.
Ein Kratzen.
Es klang, als hockte dort jemand auf der anderen Seite und kratzte mit den Fingernägeln an der Rigipsplatte. Carlton leuchtete mit der Taschenlampe in eine der oberen Ecken und sah, dass die quadratische Platte offenbar nur lose im Betonrahmen verkeilt war. Er drückte mit der flachen Hand dagegen, drückte noch ein bisschen stärker, und die Platte gab leicht nach.
Seine Nackenhaare richteten sich auf.
Das Kratzen auf der anderen Seite wurde hektischer.
Das ist ... wahrscheinlich ... eine Ratte oder so was ...
Carlton versetzte der Rigipsplatte einen heftigen Stoß.
Fump!
Die Ecke rutschte ein paar Zentimeter weit aus dem Rahmen, und jetzt hörte das Kratzen auf und wurde durch ein schnelles Klopfen ersetzt.
Keine Ratte. Das konnte keine Ratte sein.
Aber es konnte ein Mensch sein. Ein Mensch, der mit den Knöcheln gegen die andere Seite der Rigipswand klopfte. Carlton konnte nicht leugnen, was er da wahrnahm:
Da muss jemand hinter der Platte sein!
»Wer ist da?«, rief er. »Ist da jemand?«
Schließlich holte er aus und rammte seine Faust mit voller Wucht gegen die Platte. Sie wurde aus dem Rah-men gerissen und von der Dunkelheit verschluckt. Faulige Luft wehte aus der Öffnung.
»Ist da jemand? Ich WEISS, dass da jemand ist! Ich höre Sie doch!«
Er hob die Taschenlampe auf, um in das Loch hineinzuleuchten, doch ...
Dunkelheit brach wie eine Lawine über ihn herein.
Carlton erstarrte. Die Taschenlampe war ohne Vorwarnung ausgegangen. In einer filmreifen Geste der Verzweiflung schlug er sie gegen die Wand, in der Hoffnung, dass sie wieder anging, aber es blieb dunkel.
Blind, wie er jetzt war, überlegte er, rückwärts aus der kleinen Kammer herauszukriechen. Eine Kleinigkeit. Nur ein paar Sekunden, und schon hätte er wieder Licht. Aber er tat es nicht.
Er bewegte sich nicht.
»Ist da jemand?«, flüsterte er in die Dunkelheit.
Aber er kannte die Antwort bereits, bevor die leise, aber vertraute Stimme antwortete:
»Hi, Daddy. Ich bin’s. Belinda.«
Carltons Herz schien weniger zu schlagen, als sich vielmehr in seiner Brust zu winden. Immer noch wehte ihm die faulige Luft ins Gesicht, ein übler Gestank nach verwestem Fleisch und wochenlang nicht gewaschenen Körpern. Wieder wollte ein Teil von ihm zurückkriechen, wollte den Raum verlassen und vor dieser Halluzination, diesem Albtraum – was auch immer es war – fliehen, aber seine Muskeln gehorchten nicht den Befehlen seines Gehirns. Er blieb auf Händen und Knien hocken und starrte in die stinkende Finsternis.
»Du solltest sehen, wo ich gewesen bin, Daddy«, schwebte ihm die Stimme seiner Tochter entgegen. »Es ist nicht wie in der Bibel.«
»Was?«
»Aber ich kann nur ein paar Minuten hierbleiben. Er lässt mich raufkommen, damit ich mit dir reden kann.«
Er?
»Er ist der Bote. Er will, dass ich dir ein paar Sachen sage.« Die bezaubernde Stimme schien sich auf und ab zu bewegen. Carlton war sich nicht sicher, aber als seine Augen sich allmählich an die Dunkelheit gewöhnten, glaubte er, direkt hinter der Öffnung eine kaum zu erahnende Gestalt auszumachen, eine verschwommene Silhouette.
»Wer ist ... er?«, krächzte Carlton.
»Das kann ich nicht sagen. Sein Name ist ein Geheimnis, und jemandem wie mir ist es nicht erlaubt, ihn auszusprechen.«
»Jemandem wie dir? Aber du bist nur ein junges Mädchen. Was meinst du mit ›jemand wie du‹?«
»Ich bin nur eine niederstufige Myrmidone, Daddy.«
Myrmidone? Das Wort hatte Carlton noch nie gehört.
»Ich bin so eine Art sexueller Akolyth. Hier unten gibt es unglaublich viel Sex, Daddy.«
»Aber du bist noch nicht einmal 20! Du bist noch ein Teenager!«, brüllte Carlton in den Wahnsinn hinein.
»Nicht mehr. Ich könnte genauso gut 10.000 Jahre alt sein, Daddy. Hier unten werde ich ewig leben. Du weißt, wo hier ist, oder?«
»Du bist meine Tochter! Du bist ein unschuldiges kleines Mädchen! Das ist ein Trick! Eine Stressreaktion! Ich höre und sehe das als Reaktion auf den Schock, dass deine Mutter tot ist und du entführt wurdest! Ich weiß, dass du irgendwo am Leben bist, dass sich gute Menschen um dich kümmern, Menschen, die kein eigenes Kind bekommen konnten, sich aber so sehr eins gewünscht haben, dass sie dich mitgenommen haben!«
»Oh, ich bin mitgenommen worden, das stimmt, Daddy. Aber nicht von Leuten, die sich ein kleines Mädchen gewünscht haben, um es aufzuziehen. Als Mommy sich das Genick brach, haben mich ein paar Männer aus dem Wagen gezogen und in ihr Auto gesetzt. Sie fuhren mit mir nach Baltimore. Sie gaben mir sofort Crack, damit ich alles tat, was sie verlangten. Meistens gaben sie mich Freiern oder ließen mich in Filmen mitmachen. Die Fäkalienfilme waren am schlimmsten, aber nach einer Weile machte es mir nicht mehr so viel aus. Ich gewöhnte mich daran, Hauptsache, ich bekam meinen Stoff. Und sie gaben mich oft den abgedrehten Freiern, die spezielle Sachen und so wollten.«
Carlton hörte mit offenem Mund zu.
Die zarte Stimme aus dem Dunkeln fuhr fort. »Und dann laugten mich die ganzen Drogen immer mehr aus, ich sah irgendwann völlig fertig aus. Scheiße, wenn ein Mädchen in dem Business über 16 ist, taugt sie nicht mehr für Kinderpornos und Pädophile. Tja, und als die Jungs vor ungefähr einem Monat wieder einen Film drehten, einen Vierfachfick, hat es eins von den Schwanzdoubles ein bisschen übertrieben. Das dämliche Arschloch hatte ein Teil so groß wie ein Nudelholz und stand voll unter Meth. Na ja, jedenfalls hatte ich schwere Blutungen und bin gestorben.«
Carltons Augen fühlten sich an, als hätten sie keine Lider.
»Und dann kam ich nach hier unten.«
Kicherte sie?
»Jetzt bin ich eine Odaliske, Daddy. So nennen sie hier unten die Prostituierten. Die Wächter des Großherzogs Belarius von der Präfektur Drakonia beaufsichtigen mich. Er befiehlt über vier Legionen – das sind etwa 12.000 Rekruten. Im Tiefland herrscht momentan ein großer Krieg, deshalb bin ich oft an der Front. Wir haben diese großen Zelte, in die sie die Truppen im Rotationsprinzip schicken – zur sexuellen Erleichterung natürlich. Manchmal liege ich eine Woche am Stück auf dem Rücken, ein Rekrut nach dem anderen, bis der Feldzug vorüber ist. Und Schlaf bekomme ich auch keinen. Es ist eine endlose Nacht, und das ist alles, was ich tue. Wie ich schon sagte, Daddy, hier unten gibt es eine Menge Sex. Das ist so ziemlich alles, worum es in der Hölle geht.«
»Du bist nicht in der Hölle!«, brüllte Carlton so laut, dass ihm fast die Stimmbänder rissen. »Du bist ein unschuldiger Teenager! Selbst wenn du gestorben wärst, hätten sie dich nie in die Hölle geschickt, sondern in den Himmel!«
Das Kichern flatterte umher, dann schien es von der Dunkelheit verschluckt zu werden. »Bist du sicher? Die Dinge sind nicht immer, wie sie scheinen. Mommy ist auch hier unten, aber sie ist keine Odaliske. Sie arbeitet in einer Sträflingskolonne an einem der Müllhochöfen in der Industriezone. Hier wird alles recycelt, Daddy, sogar Scheiße. Sie backen sie in den Hochöfen und produzieren daraus Steine. Dort arbeitet Mommy und sie wird dort arbeiten bis ans Ende aller Zeiten.«
»Das ist ein Albtraum! Nur ein Albtraum!«, kreischte Carlton, und Speichel flog ihm von den Lippen.
»Glaub, was du willst. Ich muss jetzt sowieso zurück. Dies ist nur eine partielle Entkörperung. Aber es gibt einen Grund, weshalb er mich heute herkommen ließ, wenn auch nur für ein paar Minuten. Er hat mich geschickt, um dir etwas mitzuteilen.«
Er.
»Er hat mich geschickt, um dir eine Botschaft zu überbringen. Die Botschaft lautet: Sehet den Boten. Die Ankunft des Boten ist nahe.«
Und jetzt schien die Dunkelheit zu heulen.
»Ich muss gehen, Daddy. Es war nett, mit dir zu reden. Aber bevor ich gehe, möchte ich, dass du hier reinschaust. Ich möchte, dass du mich so siehst, wie ich jetzt bin. Ich bin kein kleines Mädchen mehr. Ich bin eine erfahrene Odaliske.«
Carltons Kopf drehte sich. Alles, was er erkennen konnte, war diese schwache Silhouette. »Ich sehe nichts! Es ist zu dunkel!«
In dieser Sekunde leuchtete die Taschenlampe wieder auf. Grell schien das Licht um ihn herum.
Und als er in das Loch leuchtete, schrie er auf.
Belinda war kein Teenager mehr, sondern eine reife Frau – eine Frau, ja, und noch mehr. Nackt lag sie in der Nische, ihr geschmeidiger Körper und die langen Beine träge auf etwas ausgestreckt, das Carlton zuerst für eine Couch hielt, aber als er genauer hinsah, erkannte er, dass die Couch aus abgetrennten Händen bestand. Einige dieser Hände schienen menschlich zu sein, andere waren es eindeutig nicht. Einige besaßen mehr als fünf Finger, andere nur zwei oder drei. Manche hatten Krallen. Manche waren mit reptilienhaften Schuppen besetzt, manche mit Tumoren, Schimmel oder namenlosem Dreck überzogen, während andere mumifiziert oder bis auf die Knochen verwest waren.
Und dann bemerkte Carlton noch etwas: Die Hände bewegten sich. Diese dämonische Couch aus Händen lebte.
Belindas schwere Brüste waren makellos straff und ragten in die Höhe, obwohl sie lag. Schweiß bedeckte ihren Körper so dick wie Glyzerin; ihre porenlose, perfekte Haut schimmerte weiß wie Sommerwolken, ein atemberaubender Kontrast zu den großen, blutroten Nippeln und ihren flammend orangefarbenen Augen. Ihr Haar schien zu leuchten, in meterlangen sonnenblonden Strähnen hing es über ihre Schultern. Sie stöhnte mit geschlossenen Augen, grinste wie eine Katze. Ihr Gesäß, ihre Beine, ihr Rücken wanden sich in erotischer Verzückung – es waren die Hände, all diese abgetrennten, aber lebenden Hände, die sie von unten liebkosten, ihr Fleisch kneteten. Carltons Blick wanderte vom lasziven Körper seiner Tochter hinauf zu ihrem Gesicht.
Rosafarbene Hörner sprossen aus ihrer Stirn und in ihrem präorgasmischen Grinsen konnte Carlton Fangzähne und eine schmale gespaltene Zunge erkennen. Jetzt zog sie zwei Hände aus der wogenden Masse – eine Dämonenhand und eine, die krakenartig aussah – und legte sie sich seufzend auf die Brüste. Die Hände massierten sie selbsttätig und lösten neue Wellen sexueller Wonne aus. Schließlich nahm sie noch eine dritte Hand – eine große menschliche – und begann, damit zu masturbieren.
Das Bild strahlte ihm grell wie Fernlicht ins Gesicht.
»Mach’s gut, Daddy. Wir werden uns eines Tages wiedersehen. Und vergiss nicht, was ich gesagt habe. Vergiss nicht seine heilige Botschaft.«
Carltons Herz war nur noch ein absterbender Klumpen.
»Die Ankunft des Boten ist nahe ...«
Und dann war sie weg.