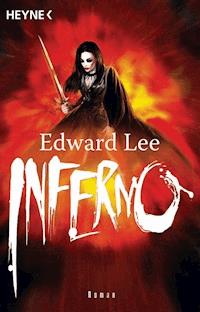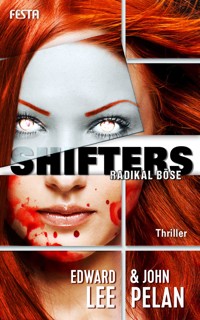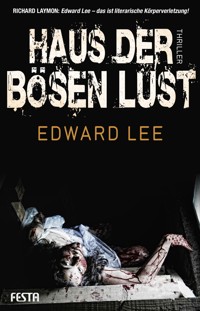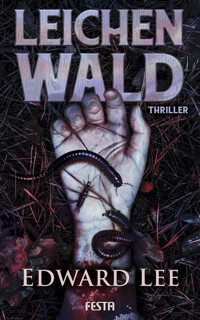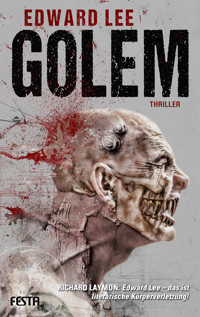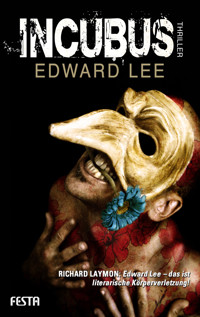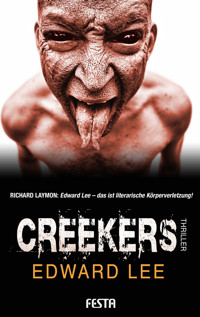4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Festa Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Die Göttin Ardat-Lil kehrt zurück. Kein Gebet kann dich retten. Nachdem ihr Vater einen Schlaganfall erlitten hat, macht sich die erfolgreiche Anwältin Anne auf den Weg nach Lockwood, einer kleinen Stadt in der Wildnis von Maryland. Obwohl sie dort aufgewachsen ist, erinnert sie sich kaum noch daran. Doch in Lockwood stimmt etwas ganz und gar nicht. Offenbar werden die Männer von den Frauen als Sklaven gehalten! Anne kann es kaum glauben. Aber das ist erst der Anfang der Geschichte … Um eines klarzustellen: Dies ist ein brutaler Horrorroman. Ein echter Pageturner voll von blutigem Sex und Kannibalismus. Fangoria: »Edward Lee respektiert keine Grenze.« Richard Laymon: »Edward Lee – das ist literarische Körperverletzung!« Horror Reader: »Ein perverses Genie.«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 455
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Aus dem Amerikanischen von Manfred Sanders
Impressum
Die amerikanische Originalausgabe Succubi
erschien 1992 im Verlag Diamond/Charter.
Copyright © 1992 by Edward Lee
Copyright © dieser Ausgabe 2021 by Festa Verlag, Leipzig
Titelbild: Sabercore23
Alle Rechte vorbehalten
eISBN 978-3-86552-898-8
www.Festa-Verlag.de
Mein besonderer Dank gilt Dave Barnett und Ginger Buchanan für die Veröffentlichung des Taschenbuchs sowie Bob Strauss.
Prolog
»Sie haben Köpfe gekocht«, sagte Miss Eberle.
Professor Fredrick erschauderte. In der anschließenden Stille schien sein Geist hilflos zu treiben. Sie haben Köpfe gekocht. Er starrte die seltsame grazile Frau an, dann wieder hinab in die Grube mit den Schädeln.
Ein Erdofen, begriff er.
Trotz des grellen Loderns der Sonne zitterte er in der sauberen Hochlandluft. Der Fundort beschwor Bilder von Gräueltaten herauf, von Vergewaltigungen. Eine lang gezogene Reihe enthusiastischer Studenten machte sich mit Spitzhacken über den Hügelkamm her. Andere gruben mit Schaufeln um die amorphen Formen von Dingen herum, die durch die Ausgrabungen der letzten sechs Tage dem jahrhundertelangen Vergessen entrissen worden waren. Staub stieg in Schwaden auf. Das hektische Schlagen von Metall auf Stein hallte wie ein altvertrautes Lied in seinen Ohren. Fredrick hatte sein ganzes Leben mit so etwas verbracht: erstickte Kulturen aus der dicken Haut der Erde herauszuwürgen. Doch so wie jetzt hatte er sich noch nie gefühlt. Er fühlte sich wie ein Eindringling.
Miss Eberle stand neben ihm und blickte in das Ausgrabungsfeld hinab wie eine Göttin auf einer Klippe. Sie war mager und relativ groß; bleich – eine weibliche Version von Fredrick. Ihr glattes grauschwarzes Haar umgab ihr hageres Gesicht wie ein Helm. Sie hatte für ihre Figur außergewöhnlich große Brüste, die die Vorderseite ihrer kakifarbenen Feldbluse straff spannten. Große blassblaue Augen beobachteten aufmerksam die Aktivitäten auf dem Ausgrabungsfeld. Wenn sie lächelte, zeigte der schmale Spalt ihres Mundes eine Reihe scharfer, gleichmäßig weißer Zähne.
Sie besaß ein bizarres Spezialwissen: Sie war archäologische Soziologin. Fredrick hatte viele ihrer Abhandlungen in den Fachzeitschriften gelesen. Ihre Arbeit faszinierte ihn – die Anwendung gesellschaftlicher Mechanismen auf die Mythologie.
Außerdem war sie möglicherweise die weltweit einzige Expertin für das rätselhafte präiberische Volk der Urlocs. Fredrick hatte sie in den Staaten kontaktiert, als bei der Oxford-Ausgrabung Dinge ans Tageslicht gefördert wurden, die sich eigentlich nicht innerhalb des Grabungsbereichs befinden sollten.
Grabstätten. Dolmen. Gewaltige Massengräber inmitten der sanften grünen englischen Landschaft.
Eine britische Luftvermessungsfirma hatte die Universität von Oxford benachrichtigt, als auf einigen der topografischen Aufnahmen verräterische Merkmale entdeckt wurden. Man vermutete, es sei ein Urnenfeld. Daraufhin hatte Oxford Fredrick und sein Team mit Ausgrabungen beauftragt; seit der Entdeckung mehrerer britonischer Schriften vor 20 Jahren suchte man in der Gegend nach einer abgelegenen sächsischen Siedlung. Fredrick war noch keinen vollen Tag am Ort der Ausgrabung gewesen, als ihm schon klar geworden war, dass sie hier auf etwas völlig anderes gestoßen waren.
Sie haben Köpfe gekocht, drang ihm wieder die leise, kehlige Stimme der Frau ins Bewusstsein. Schlächter. Kannibalen.
Ein großer Dieselbagger pumpte Lärm und Abgase in den gesprenkelten Himmel. Junge Stratigrafie-Techniker fummelten an der Wand der tiefsten Grabungsstätte mit Kernschneidern herum. Hier wurde die Zeit nicht in Jahren, sondern in Schichten gemessen, in Strichen von Kamelhaarpinseln und in Staub. Fluorsonden wurden in Öffnungen aus feuchtem Lehm und Schiefer geschoben. Nein, dies war kein Urnenfeld – es war eine Gruft.
Hohe Bäume erzitterten an den Rändern der Täler, als hätten sie Schmerzen. Die Fundstätte sah aus wie bombardiert, durchsetzt von Kratern. Dreckverschmierte Studenten hoben Eimer voller Fundstücke von der Winde und trugen sie an Stangen über ihren Schultern. Das Förderband brachte Steinbrocken und menschliche Knochen aus der Hauptgrabung herauf.
»Die Urlocs«, sagte Fredrick. »Also sind Sie sicher?«
Miss Eberle schraubte eine Vergrößerungslinse auf ihre modifizierte Nikon F. »Es gibt keinen Zweifel«, erwiderte sie. »Alles, was Ihre Leute gefunden haben, entspricht genau den Archiven der römischen Besatzungszeit. Das hier ist die archäologische Entdeckung des Jahrzehnts.«
Ihre großen Augen strahlten wieder hinunter in das Ausgrabungsfeld. Ihr Glitzern erinnerte Fredrick an sexuelle Erregung.
Die Ausgrabung war fast beendet; sie hatten ihr Budget bereits überschritten. Fredrick und Miss Eberle gingen an der letzten Baumgruppe vorbei zu den Zelten. Er blickte auf seine lehmbeschmierten Lederstiefel, die gleichen, die er schon bei zahllosen anderen Ausgrabungen getragen hatte. Von Galli bis Ninive, von Jericho über Troja bis Knossos. Seine Gedanken schweiften ab, ein Lächeln spielte um seine Lippen. Er sah sich als ein Gespenst aus der Zukunft. All diesen einst so mächtigen Städten war vorherbestimmt gewesen, dass tausend Jahre später Fredricks alte Stiefel auf ihnen herumtrampelten. Vergrabene Zeit. Ganze Kulturen, eingeschlossen in Schichten aus Lehm. Er wanderte über Welten, und eines Tages, so wurde ihm klar, würde auch jemand über seine Welt wandern.
»Wir werden berühmt sein«, flüsterte Miss Eberle.
»Was?«
Sie antwortete nicht und trottete weiter. Lkws verließen rumpelnd die Ausgrabungsstätte, ihre Federungen ächzten unter dem Gewicht der Vergangenheit. Jede Menge Bronze und primitives Eisen. Broschen, Fibeln, Keulenbeschläge und Armreife. Kisten mit Tonscherben hauchten alterslosen Staub aus, während die Lkws über die Feldwege holperten. Sie hatten sehr viele Schneidwerkzeuge gefunden, fein gearbeitet und noch immer scharf. Flache Klingen mit langem Erl, eindeutig nicht sächsisch oder friesisch. Cnifs hatte Eberle sie genannt. Für Menschenopfer. Sie hatten einige sehr große Kessel gefunden. Fek-chettle. Aber am meisten war Miss Eberle über die Manuskripte in Verzückung geraten. Die qualitativ hochwertigen Tongefäße und die stickstoffhaltige Erde hatten sie gut erhalten; Eberle gelang es, fast alle zu fotografieren, bevor die brutale Wahrheit der offenen Luft das Pergament zu feinem Staub zerfallen ließ und die Unendlichkeit sich zurückholte, was ihr gehörte.
Sie blieben an der Kreuzung stehen, um dem Rest des Exodus nachzublicken. Die Lkws fuhren weiter, voll beladen mit den Innereien einer anderen Zeit.
Die letzten Lkws beförderten Bedeutsameres:
Knochen.
Wie viele Gruben hatten sie exhumiert? Wie viele Gräber? Wie viele Löcher voller menschlicher Köpfe?
»Es wird Monate dauern, die Gräber zu exhumieren«, sagte Miss Eberle.
»Wir haben keine Monate«, erwiderte Fredrick. Gegen das zunehmende Gewicht seines Alters musste er sich bewusst aufrecht halten. Sein sonnengebräuntes, von scharfen Linien durchzogenes Gesicht sah aus wie ein ausgetrocknetes Flussbett. »Deswegen muss ich mit Ihnen reden. Wir haben vielleicht nicht einmal mehr Stunden.«
»Was meinen Sie damit?«, protestierte sie. »Begreifen Sie denn nicht, was das hier ist? Diese Ausgrabung ist der erste handfeste Beweis für die Existenz der Urlocs. Sie gehören nicht länger dem Reich der Legenden an – diese Ausgrabung beweist, dass sie wirklich real waren.«
»Ich erzähle Ihnen was, das noch realer ist. Rezession. Steuersätze. Inflation. Sie denken, in den Staaten sieht es übel aus? Das hier ist England. Oxford wird uns jetzt wahrscheinlich die Mittel streichen. Sie haben uns dafür bezahlt, ein sächsisches Urnenfeld zu finden.«
Das Gesicht der Frau rötete sich. »Aber dies ist Geschichte. Wie können die ihre eigene Geschichte ignorieren?«
Mit Leichtigkeit, dachte Fredrick. »Sie werden Ihre Chance bekommen, sie zu überzeugen. Der Mann vom Bewilligungsausschuss wird morgen früh hier sein. Aber machen Sie sich keine zu großen Hoffnungen.«
Ihre Schritte knirschten auf dem mit Unkraut überwucherten Pfad. Die Sonne sah deformiert aus, so kurz vor ihrem Untergang, eine Kugel aus geschmolzenem Orange, vom langsamen und gleichförmigen Drehen der Erde ihrer Konturen beraubt.
Fredrick hielt ihr die Zeltklappe auf. Als sie das Zelt betrat, starrte er ihr hinterher, ihr und ihrem schlanken Schatten.
Er verharrte einen Augenblick, dann betrat er selbst das Zelt, wobei er sich fragte, wie viele Tausend Menschen hier wohl abgeschlachtet worden waren.
Es war die Unbekümmertheit, mit der Miss Eberle sprach, bei der es Fredrick flau im Magen wurde. Sie nahm ein Foto der riesigen Kessel in die Hand. »Die Urlocs haben Dinge getan, gegen die Vlad der Pfähler wie die Heilsarmee wirkt. Häuten, Kastrieren, Verstümmeln – das gehörte alles zu ihrem Repertoire. Sie plünderten ganze Siedlungen, aber nicht um Beute zu machen oder ihr Herrschaftsgebiet zu expandieren, sondern um infydels zu fangen, die ihnen als rituelle Opfer, Sklaven oder Nahrung dienten. Besonders gerne opferten sie Kinder aus eroberten Siedlungen. Babys stellten das ultimative Opfer für das Objekt des Urloc-Glaubens dar. Männer wurden als Sklaven gehalten. Frauen wurden abgeschlachtet, um als Nahrung zu dienen. Die Urlocs betrachteten alle Frauen, die nicht ihrer Blutlinie angehörten, als spirituelle Feinde. Also aßen sie sie auf.«
Fredricks alte Hand zitterte leicht, als er Tee aus einer Thermoskanne eingoss. Der Tee dampfte vor ihren Gesichtern.
»Und diese Kessel, die chettles.« Sie zeigte auf eins der Fotos. »Sie haben ein Fassungsvermögen von fast 400 Litern. Sie füllten sie mit Blut und kochten darin das Fleisch für ihre Festlichkeiten. Wissen Sie, wie viele menschliche Wesen man braucht, um 400 Liter Blut zu erhalten?«
Fredrick verzog das Gesicht, als er über die unerfreuliche Frage nachdachte. »Wie viele?«, zwang er sich zu fragen.
»Etwa 75.«
Großer Gott, dachte Fredrick.
»Sie grillten dutzendweise Babys auf Dolmen.« Miss Eberle klopfte sich Staub und Erde aus den Haaren. »Sie waren besessen von der Jugend – oder besser gesagt von der spirituellen zyklischen Umkehrung der menschlichen Weltlichkeit in Unendlichkeit. Daher ihre rituelle Besessenheit von der Opferung junger Menschen. Es war eine Transaktion, eine Geste des Tributes in Form einer spirituellen Nachahmung.«
»Das ist absurd«, sagte Fredrick.
»Ist es das? Ist es das wirklich? Die Urlocs waren eine geheime okkulte Gemeinschaft. Sie lebten über 1000 Jahre inmitten der Kelten, Gälen und Britonen, die kaum etwas oder gar nichts von ihrer Existenz ahnten. Ur ist übrigens ein Wort aus der Zeit vor dem Altenglischen, aus dem sich weik oder wicc ableitete.«
»Witch – Hexe«, murmelte Fredrick.
»Genau. Wir sprechen hier von einem subkulturellen Glaubenssystem, das älter ist als alle europäischen Aufzeichnungen. Hexen, bevor es die Hexerei gab. Es ging um Transitivität. Sie glaubten, indem sie junge Menschen opferten, könnten sie diese in das Objekt ihrer Anbetung verwandeln. Glaube und Opferung. Das Fundament aller religiösen Systeme, das Christentum eingeschlossen.«
»Christen haben keine Babys auf Dolmen gegrillt«, wandte Fredrick ein.
»Nein, aber lesen Sie mal nach, wie die Christen waren, bevor Christus kam, bevor die Gesetze des Alten Testaments durch den Neuen Bund abgelöst wurden. Sie glaubten an den gleichen Gott, aber sie waren besessen von Opferungen. Lesen Sie Levitikus, das dritte Buch Mose, wenn Sie es ertragen. Es ist universell, Professor. Es ist ein Beweis von Heiligkeit.«
»Heiligkeit? Was hat das Kochen von Menschenfleisch in 400-Liter-Kesseln voller Blut mit Heiligkeit zu tun?«
»Blut«, erwiderte sie. »Die Essenz des Lebens. Es war ein Symbol, und man kann durchaus sagen, dass jede Religion mittels einer mechanischen Nutzung soziologischer Symbole funktioniert. Man kann auch sagen, dass Religion das Verständnis einer Gesellschaft von Hoffnung durch Glauben demonstriert.« Lächelte sie? »Blut, die Essenz des Lebens. Ist denn nicht der Verzehr von Blut ein universelles Symbol für Ewigkeit? Für Heiligkeit? Die Druiden taten es bereits 600 Jahre, bevor Christus geboren wurde. Schon mal vom heiligen Abendmahl gehört?
»Okay«, sagte Fredrick. Er war angewidert und müde. Was würde der Mann vom Bewilligungsausschuss denken, wenn er erfuhr, was die Urlocs tatsächlich waren? Er wünschte, er hätte stattdessen das langweilige, schnöde Urnenfeld gefunden.
Miss Eberle breitete weitere Fotos aus. Eines zeigte einen tiefen Erdofen. »Die Urlocs hatten eine besondere Vorliebe für menschliche Gehirne, langsam im Schädel gegart. Die Köpfe wurden über Stunden in ihrem eigenen Saft gedünstet, dann holte man sie heraus und brach sie mit Steinhämmern auf. Sie hatten Sklaven, die speziell für diese Aufgabe ausgebildet waren und cok-braegans genannt wurden, was wörtlich übersetzt ›Gehirnkocher‹ heißt. Die Gehirne wurden heiß auf Fladen aus gebackenem Haferbrei serviert.«
Fredricks Magen schien die ernsthafte Absicht zu verfolgen, sich gründlich umzudrehen. Er schmeckte Galle.
»Und kennen Sie die Rocky Mountain Oysters – frittierte Stierhoden? Nun, die Urlocs hatten ihre eigene Version dieser Delikatesse. Statt Stierhoden wurden menschliche Hoden mit Maismehl paniert und in Sesamöl frittiert. Des Weiteren kannten sie ein Knochenmark-Allerlei, das eine beliebte Vorspeise war. Das Mark wurde mit Paprika und wilden Zwiebeln gemischt, in einer Pfanne geschmort und auf Weizenfladen serviert. So ähnlich wie Pastete auf Toastecken. Ein besonders berüchtigtes, zeremonielles Gericht – ausschließlich hochrangigen Urloc-Priesterinnen vorbehalten – war das ›Uterus-Brot‹. Menschliche Gebärmütter wurden mit gemahlenem Weizen und einem Backtriebmittel gestopft und dann in Steinöfen gebacken. Oft wurden sie zusätzlich mit Sperma bestrichen.«
Uterus-Brot, dachte Fredrick mit tiefster Abscheu.
»Eierstöcke wurden mariniert und an Spießen über einem offenen Holzfeuer geröstet. Lungen wurden püriert, sorgfältig mit wilden Himbeeren gemischt und wie Pudding gekocht. Zungen, Lippen und Gesichtsmuskeln wurden klein gehackt, gewürzt, in Menschenhaut eingewickelt und dann in Öl gebraten, bis sie kross waren. Das bekannteste Festgericht der Urlocs war als entrillus-brok bekannt – was übersetzt ›Darmrolle‹ bedeutet: klein gehackte Eingeweide, eingewickelt in Lotusblätter und in Blut gedämpft.«
Fredrick erbleichte und starrte sie stumm an. Sein Mund wurde immer trockener, während Miss Eberle mit ihrer allzu detaillierten Beschreibung der Urloc-Cuisine fortfuhr.
»Was die riesigen Kessel angeht – sie wurden mit Blut gefüllt und erhitzt, bis sie blubbernd kochten. Ausgewählte Organe wie Leber, Milz oder Nieren wurden in das kochende Blut gegeben und dann wurde regelmäßig umgerührt. Auch alle größeren Muskelgruppen wurden fachgerecht filetiert und hinzugegeben. Nach und nach fügte man Kräuter und Gewürze hinzu und gegen Ende des Kochvorgangs noch etwas Gemüse.«
Etwas Gemüse. Fredricks Geist wurde für einen Augenblick von einem Nebel grauenvoller Bilder eingehüllt. Er stellte sich Urloc-Schlachthäuser vor, in denen Menschen wie Forellen filetiert wurden, wo aus Bauchhöhlen systematisch die schmackhaftesten Teile entnommen wurden, wo Kehlen durchgeschnitten und erbarmungslos in erhitzte Kessel entleert wurden. Uterus-Brot, dachte er. Darmrollen. Konnte eine solche Gesellschaft wirklich existiert haben? Konnten spirituelle Vorstellungen tatsächlich jemanden dazu gebracht haben, Babys zu grillen? »Miss Eberle«, sagte er und schüttelte den Nebel ab. »Wenn der Mann vom Bewilligungsausschuss kommt, sollten Sie ihm vielleicht diese kulinarischen Details ersparen. Er wird wissen wollen, warum die Urlocs aus archäologischer Sicht so wichtig sind. Was werden Sie ihm sagen?«
»Die Wahrheit«, antwortete Miss Eberle. »Die Urlocs waren eine matriarchale Gesellschaft. Sie betrachteten das männliche Geschlecht als notwendiges Übel. Wenn eine Urloc ein männliches Kind zur Welt brachte, wurde das Kind kurzerhand dem Objekt ihres Glaubens geopfert. Die Urloc-Kommandantinnen griffen andere Siedlungen mit einer Miliz an, die vollständig aus männlichen Sklaven von früheren Feldzügen bestand.«
»Das ist etwas schwer zu glauben.«
»Vielleicht wollen Sie es nur nicht glauben. Sie wollen nicht glauben, dass es eine Gesellschaft gegeben haben könnte, in der Frauen einen weitaus höheren Stand hatten als Männer, obwohl es in der Menschheitsgeschichte viele solcher Beispiele gab.«
War es das? Fredrick glaubte es nicht. »Aber wie haben sie es gemacht? Wie war ein Haufen abtrünniger Amazonen in der Lage, ganze Gesellschaften von Männern zu versklaven?«
»Eine berechtigte Frage, Professor«, gestand sie ein. »Leider gibt es darauf keine eindeutige Antwort. Wie ich schon erwähnt habe, waren die Urlocs Hexen. Die römischen Registraturen sind voll mit okkulten Verweisen auf sie, und auch wenn die Kelten selbst nur sehr wenige schriftliche Aufzeichnungen hinterlassen haben, dokumentiert das wenige, was es gibt, genau das.«
»Hexen, sagen Sie? Wollen Sie behaupten, die Urlocs hätten tausend Jahre lang über ein Gebiet geherrscht, weil sie Männer verzaubert haben?«
»Ich behaupte das gar nicht. Lesen Sie die alten Aufzeichnungen. Den Berichten zufolge haben die Urlocs auf rituelle Weise das Objekt ihres Glaubens angerufen, damit dieses ihnen Macht über ihre Feinde verlieh. Aber das spielt auch keine Rolle. Ich glaube nicht an das Okkulte, Professor Fredrick. Ich glaube jedoch an die Wichtigkeit, das Volk der Urlocs als eine soziologische Einheit zu studieren. Sie müssen doch zugeben, dass wir nur zu schnell bereit sind, über das zu lachen, was wir nicht objektiv oder wissenschaftlich erklären können …«
Fredrick blendete ihre Worte aus. Ganz langsam nahm ein Bild in seinem Kopf Gestalt an. Er sah Bauern, die entsetzt vor dem Donnern von Hufen flohen, er sah Schatten herabsausen, zum Schlag erhobene Schwerter und Streitäxte. Er sah, wie Unschuldige hingemetzelt wurden, sah, wie in einer Wolke aus Staub und Pferdeleibern Bäuche aufgeschlitzt und Gliedmaßen abgetrennt wurden. Klingen blitzten und bohrten sich wahllos in das Fleisch der Opfer, primitive Behausungen wurden niedergebrannt. Er sah Frauen, die Köpfe abhackten. Er sah Babys, die kreischenden Müttern aus den Armen gerissen wurden. Wunderschöne starke Frauen sprangen inmitten dieses Grauens von ihren Pferden, ihre langen Haare wie Mähnen flatternd, ihre biegsamen Leiber von der Kampfmontur umschmeichelt. Verstümmelte Leichen zuckten im blutigen Matsch, während Köpfe in die Erdöfen geworfen wurden. Blut spritzte. Schreie durchdrangen die Luft. Die ruhmreichen Urlocs befahlen Sklaven mit ausdruckslosen Gesichtern, die Sterbenden und Toten auszuweiden. Und inmitten der entsetzlichen Deutlichkeit dieses Bildes konnte Professor Fredrick das Gesicht eines dieser armseligen Diener erkennen.
Es war sein eigenes.
»… und bedauerlicherweise auch die Tendenz unseres Intellektualismus, das Esoterische und Unbekannte abzulehnen.«
Fredricks Bewusstsein kehrte in die Gegenwart zurück. Der Schlag seines alten Herzens verlangsamte sich wie nach einem großen Schrecken, als seine Vision verblasste und von Miss Eberles glitzernden Augen und ihrem Grinsen ersetzt wurde.
»Was wurde aus ihnen?«, fragte Fredrick. Er trank einen Schluck Tee, um sich abzulenken. Der Tee war kalt.
»Niemand weiß es genau. Wie die Maya und die Tai’tk scheinen die Urlocs innerhalb einer sehr begrenzten Zeitspanne verschwunden zu sein. Es gibt keine Hinweise auf eine militärische Eroberung oder einen Genozid. Hunger oder Seuchen erscheinen gleichermaßen unwahrscheinlich. Meine Vermutung, basierend auf der Nomenklatur ihrer Religion, ist, dass sie aufgrund einer vorsätzlichen Bevölkerungsstreuung verschwanden.«
»Was veranlasst Sie zu der Vermutung?«
»Eine einfache konnotative Studie ihrer religiösen Praktiken. Jeder Aspekt der Urloc-Kultur ist in den römischen Archivaufzeichnungen dokumentiert. Die Urlocs praktizierten, ebenso wie die Druiden und die Hindus, eine Religion der Aszension. Sie betrachteten das körperliche Leben als einen Prozess der spirituellen Reinigung. Sehr wahrscheinlich waren die Urlocs der Überzeugung, dass sie eine ausreichend hohe Stufe spiritueller Reinheit erlangt hatten, woraufhin sie sich auf die umliegenden Populationen und Völker verteilten, wie es ihnen vom Objekt ihres Glaubens aufgetragen worden war.«
Fredricks Gesicht verriet seine Verständnislosigkeit. Das Objekt ihres Glaubens. Diesen Begriff hatte sie schon mehrmals benutzt, nicht wahr? Er wollte nicht fragen, tat es aber trotzdem: »Was genau war das Objekt ihres Glaubens?«
»Laut den Römern nannten sie es Ardat Lil«, antwortete sie, »allerdings haben auch zahlreiche andere Religionssysteme eine ähnliche oder sogar identische Gottheit verehrt. Betrachten wir die Ableitungen aus dem Mittel- und Altenglischen: das loc in Urloc und das Lil in Ardat Lil. Das ergibt liloc, was man grob als Sexgeist übersetzen könnte.«
Professor Fredrick verstand immer noch nichts.
Miss Eberle lehnte sich auf ihrem Klappstuhl zurück. Und dann schien sie kaum merklich zu grinsen. »Ardat Lil war ein Succubus.«
1
Ein Stück voraus verschmolzen die Schatten hinter blitzenden roten und blauen Lichtern. Der Scheinwerfer ihres Wagens fiel auf das große orangefarbene Schild: ›State Police – Alkoholkontrolle – Bitte anhalten!‹
Oh, gut, dachte sie. Nach all dem Trubel im Büro und dann noch Dr. Harolds diagnostischen Unerklärlichkeiten brauchte Ann etwas Aufmunterung.
Na, die können was erleben.
Natürlich hatte sich die Polizei die wirklich ungünstigste Stelle für diesen berüchtigten Verfassungsverstoß ausgesucht: die Hauptausfallstraße der Stadt während der abendlichen Rushhour.
Ann stoppte ihren Mustang GT vor der offenen Handfläche, die der Bundesstaatspolizist ihr entgegenhielt. Zwei weitere Polizisten, gesichtslos vor der blitzenden Hintergrundbeleuchtung, näherten sich dem Fenster auf der Fahrerseite.
»Guten Abend, Ma’am«, sagte einer von ihnen.
»Ja, war es«, antwortete Ann.
»Wie bitte?«
»Ich wollte sagen: Es war ein guter Abend, bis Sie es für nötig hielten, mich mit diesem ungerechtfertigten und unangemessenen Eingriff in meine Bürgerrechte der individualverkehrlichen Freizügigkeit zu belästigen.«
»Das ist keine besonders gute Einstellung, nicht wahr, Ma’am?«
»Ist es jetzt Aufgabe der State Police, die Einstellungen der Bürger zu kontrollieren, Officer?«
Der Polizist zögerte. »Kann ich bitte Ihren Führerschein und die Fahrzeugpapiere sehen?«
»Ich weiß nicht, ob Sie das können, Officer. Ich bin keine Augenärztin und daher nicht qualifiziert zu entscheiden, was Sie sehen können und was nicht. Ob Sie meinen Führerschein und meine Fahrzeugpapiere sehen dürfen – nun … ich denke, schon.« Ann reichte sie ihm.
»Haben Sie getrunken, Miss Slavik?«
»Ja«, antwortete sie.
»Wie viel?«
»Ich bin mir nicht sicher. Ich wusste nicht, dass es jetzt gesetzlich vorgeschrieben ist, über die tägliche Flüssigkeitsaufnahme Buch zu führen.«
»Wie viel haben Sie heute getrunken, Miss Slavik?«
Sie überlegte. »Ungefähr ein halbes Dutzend Tassen Kaffee. Eine Cola light zum Mittagessen. Und eine Flasche Kakao für den Nachhauseweg.« Sie hielt die Kakaoflasche hoch, damit er sie sah.
Der Polizist schwieg für einen Augenblick. »Haben Sie heute Alkohol getrunken, Miss Slavik?«
»Alkohol? Sie meinen diese flüchtige und hoch entflammbare Hydroxylverbindung, die allgemein in industriell hergestellten Lösungs- und Reinigungsmitteln enthalten ist, ein tödliches Gift? Nein, Officer, ich habe heute keinen Alkohol getrunken. Und falls Sie meinten, ob ich irgendwelche alkoholhaltigen Getränke zu mir genommen habe, lautet die Antwort ebenfalls Nein.«
Wieder schwieg der Polizist.
Dann sagte er: »Miss Slavik, ich möchte Sie bitten, aus dem Wagen zu steigen.«
»Warum?«, fragte sie. »Um mich zu zwingen, gegen meinen Willen meine Nase zu berühren? Um mich zu zwingen, gegen meinen Willen auf einer geraden Linie zu gehen? Um mich zu zwingen, in einen 08/15-Smith-&-Wesson-Alkomaten zu pusten?«
»Wir bezeichnen es als Alkoholkontrolle, Miss Slavik.«
»Bezeichnen Sie es so? Ich bezeichne es als Polizeiwillkür. Es verstößt nicht gegen das Gesetz, unkoordiniert zu sein, Officer, und Sie sind nicht beruflich qualifiziert, meinen Zustand körperlicher Koordinationsfähigkeit zu beurteilen. Ebenso wenig können Sie dem Richter zweifelsfrei die ordnungsgemäße Funktion und Kalibrierung des Alkomaten garantieren. Und jetzt hören Sie mir mal zu, Officer. Ich bin 37 Jahre alt. Ich bin 1,63 Meter groß und wiege 50 Kilo. Sie hingegen sind … was? Anfang 20, 1,85 Meter, mindestens 90 Kilo, wenn ich mich nicht täusche, und Ihr Freund da ist noch größer und kräftiger. Mit anderen Worten: Sie beide sind große, starke, junge Männer, die mich mit Leichtigkeit gegen meinen Willen auf einer Hauptverkehrsstraße aus meinem Wagen holen könnten. Und ja, ich vermute, Sie könnten mich auch zwingen, Ihren albernen Alkoholtest zu machen. Ich hätte keine Chance, Sie daran zu hindern, wenn man bedenkt, in welchem Zustand der Angst ich mich befinde. Tatsächlich denke ich, dass jede Frau in meiner Situation hilflos wäre gegen zwei große, starke, junge Männer mit tödlichen Schusswaffen an ihren Gürteln.
Was ich damit sagen will, Officer: Wenn Sie mich auf einer öffentlichen Straße gewaltsam aus meinem Fahrzeug holen und zwingen wollen, Ihren peinlichen und zutiefst verfassungswidrigen Test durchzuführen, dann nur zu. Aber wenn Sie das tun, werde ich Ihre Dienststelle wegen Einkommenseinbußen, Folgeschäden und psychischer Grausamkeit verklagen, denn ein solcher Vorfall würde mich mit Sicherheit derart aus der Bahn werfen, dass ich meine Arbeit nicht mehr vernünftig erledigen, Probleme mit meinem Arbeitgeber bekommen und infolgedessen eine psychische Störung davontragen würde. Falls Sie andererseits beschließen sollten, mich zu verhaften, werde ich Ihre Dienststelle wegen all dieser Dinge verklagen und zusätzlich noch wegen unrechtmäßiger Verhaftung.«
Die beiden Polizisten zögerten unsicher. »Sind Sie Anwältin, Miss Slavik?«, fragte der zweite.
»Ist die Polizei berechtigt, einen unbescholtenen Bürger zur Preisgabe seines Beschäftigungsstatus zu zwingen? Ich denke, ich werde von nun an von meinem Recht zu schweigen Gebrauch machen, Officer, es sei denn, die Verfassung der Vereinigten Staaten von Amerika wurde aus irgendeinem Grund aufgehoben, seit ich das letzte Mal einen Blick hineingeworfen habe. Und jetzt … lassen Sie mich fahren!«
Die beiden Polizisten traten zur Seite und winkten sie durch.
Viel besser, dachte Ann Slavik und fuhr weiter die West Street entlang. Sie wusste, dass die Männer nur ihren Job machten, aber mit ihnen zu spielen hatte geholfen, ihre Gedanken von den anderen Dingen abzulenken. Na gut, ich bin also ein Arschloch. Ich kann nicht anders. Ich bin Anwältin.
Dieser Tag war der ungewöhnlichste Tag ihres Lebens gewesen, ein großer Triumph und eine große Verwirrung. Sieben Jahre hatte sie auf diesen Tag gewartet; sie sollte glücklich sein. Aber alles, woran sie im Augenblick denken konnte, war das, was Dr. Harold gesagt hatte.
Über den Traum. Den Albtraum.
Sie hörte Martin tippen, als sie die Wohnung betrat. Warum schaffte er sich nicht endlich einen Computer an? Der machte wenigstens nicht so einen Lärm. Sie hatte angeboten, ihm einen zu kaufen, aber er hatte ihr versichert, dass er keinen wollte. »Ich werde nicht zulassen, dass meine Muse durch Floppy Disks und das Geblinke auf einem Monitor besudelt wird«, hatte er gesagt. Aber Ann kannte den wahren Grund: Mit dem ›Sklavenlohn‹, den er vom College erhielt, konnte er sich keinen Computer leisten. Und sein männlicher Stolz ließ es nicht zu, dass sie ihm das Geld dafür gab.
Sie trat in die Diele mit dem Schieferboden und stieß die Tür mit dem Hintern zu. Mit einem erleichterten Seufzer setzte sie die Prozesstasche ab, die schwerer war als ein Reisekoffer. Die Prozesstasche war der Fluch jedes Juristen; man trug sein Leben darin mit sich herum, und das Leben einer Anwältin wog eine Menge. Ein von einem professionellen Fotostudio aufgenommenes Porträt von ihr mit Melanie und Martin lächelte ihr entgegen, als sie ihren Burberry-Regenmantel aufhängte. Meine Familie, dachte sie. Aber war sie das wirklich? Oder war es nur ihr schwacher Versuch, so etwas wie Normalität herzustellen? Häufig deprimierte das Porträt sie – es erinnerte sie daran, was sie Martin mit ihrer Unentschlossenheit antat. Sie befürchtete, dass Martin, je mehr Monate vergingen, immer verdrossener wurde über ihr Zögern, ihn zu heiraten. Sie wusste, dass er sich selbst die Schuld gab, dass er jeden Tag mit einer inneren Furcht lebte, irgendetwas an ihm sei vielleicht nicht gut genug für sie, und das bereitete ihr ein noch schlechteres Gewissen, denn es hatte wirklich überhaupt nichts mit seinen Fehlern und Unzulänglichkeiten zu tun. Was hält mich zurück?, fragte sie in Gedanken das Porträt. Aber natürlich bekam sie keine Antwort.
Ann ging ins Wohnzimmer und schaltete aus Gewohnheit den Fernseher ein. Sie rechnete mit den üblichen düsteren Enthüllungen: Finanzdefizite, gescheiterte Banken, Mord. Doch stattdessen sagte eine Nachrichtensprecherin mit zu viel Make-up gerade: »… das vor Kurzem reparierte Hubble-Weltraumteleskop. In der letzten Woche berichteten Astronomen der NASA von einem bevorstehenden astronomischen Ereignis, das sie als ›tangentiales lunares Apogäum‹ bezeichneten, ein Vollmond, der genau auf die diesjährige Frühjahrs-Tagundnachtgleiche fällt. ›Das klingt zunächst einmal nicht besonders spektakulär‹, sagte John Tuby vom MIT heute Vormittag gegenüber der Presse, ›aber für Astronomen ist es etwas ganz Besonderes. Aufgrund der Stratosphärenbrechung wird der Mond zeitweise rosafarben erscheinen. Es ist das erste derartige Ereignis seit 1000 Jahren.‹ Also, liebe Sternengucker, holen Sie Ihre Teleskope heraus und machen Sie sich bereit«, fuhr die Sprecherin fort. »Und jetzt: Pudel auf Skiern!«
Pudel auf Skiern. Ann schaltete den Fernseher aus. Zumindest besser als die üblichen schlechten Nachrichten. Sie hörte nun schon seit Tagen von dieser Äquinoktiumssache, als wäre es das Ereignis des Jahrhunderts. Ihr war es egal, welche Farbe der Mond hatte oder warum. Im Augenblick wollte sie sich nur entspannen.
Sie ging in den Flur. »Ich bin zu Hause«, rief sie.
Das Zuhause war eine luxuriöse Vierzimmerwohnung am Circle. Sie war perfekt, aber für 340.000 Dollar sollte man das auch erwarten – so viel musste man für eine Eigentumswohnung am Wasser berappen. Ann mochte die Wohnung. Melanie hatte ein eigenes Zimmer und Ann konnte eines als Büro nutzen. Martin hatte das kleine Wohnzimmer für seine Schreiberei. Es war eine Eckwohnung. Der Balkon am Schlafzimmer ging zum Wasser hinaus und das Wohnzimmer zum State Circle, der nachts einen wundervollen Anblick bot. Ann würde die Wohnung vermissen. Wenn man Teilhaber wurde, wohnte man nicht mehr in einer Eigentumswohnung.
Sofort kam Martin aus dem Wohnzimmer, mit seinen sorgenvollen Augen. Schriftsteller waren seltsam, aber Martins Seltsamkeit war anders. Mindestens einmal pro Woche drohte er, mit dem Schreiben aufzuhören, um ihre Beziehung zu stärken, und sie glaubte es ihm sogar. Er fühlte sich schuldig wegen der finanziellen Situation, was völlig albern war. Ann zahlte mehr Steuern, als Martin brutto verdiente. Er war ein Poet, der von der Kritik gefeiert wurde. »›Von der Kritik gefeiert‹ bedeutet, dass man großartige Kritiken bekommt und kein Geld verdient«, hatte er ihr einmal erzählt. Seine Gedichtsammlungen – vier bislang und bei einem großen Verlagshaus erschienen – waren in der BookWorld, der New York Times,Newsweek und jedem größeren Literaturmagazin des Landes sehr positiv besprochen worden. Im letzten Jahr hatte sein Agent drei seiner Kurzgeschichten an Atlantic Monthly, The New Yorker und Esquire verkauft, und mit diesen Geschichten hatte Martin mehr Geld verdient als mit sämtlichen Einnahmen aus seinem letzten Gedichtband. »Schreib mehr Kurzgeschichten«, hatte sie ihm vorgeschlagen. »Nein, nein«, hatte er gejammert. »Prosa ist unvollkommen. Der Vers ist die einzige Wahrheit im geschriebenen Wort als Kunstform.« Meinetwegen, hatte sie gedacht.
»Was hat Dr. Harold gesagt?«, fragte er jetzt und legte die Arme um sie.
»Das Gleiche wie immer. Manchmal glaube ich, dass ich nur meine Zeit verschwende.«
»Mein Gott, Ann, du hattest bisher erst drei Termine. Gib der Sache eine Chance.«
Eine Chance, dachte sie. Der Albtraum hatte vor zwei Monaten begonnen. Er kam jede Nacht. Manchmal unterschieden sich die Details, aber in den Grundzügen war er immer gleich. Mittlerweile beunruhigte der Traum sie so sehr, dass sie bei der Arbeit müde und zerschlagen war; sie fühlte sich neben der Spur. Martin war es gewesen, der ihr vorgeschlagen hatte, zu einem Therapeuten zu gehen. »Wahrscheinlich sind es irgendwelche unbewussten Sorgen um Melanie«, hatte er gemeint. »Ein guter Seelenklempner kann die Ursache isolieren und einen Weg finden, wie du damit umgehen kannst.« Vermutlich hatte er recht. Es waren nicht die 200 Dollar pro Stunde, die ihr Kopfschmerzen bereiteten (auch Anns Kanzlei stellte diesen Betrag dem durchschnittlichen Klienten pro Stunde in Rechnung), sondern die Sorge, dass, wenn sie die Sache nicht schnell in den Griff bekam, ihre Karriere darunter leiden könnte, und wenn ihre Karriere litt, würde auch Melanies Zukunft leiden, ganz zu schweigen von ihrer Beziehung zu Martin.
Ein abstrakter Druck an der Wand zeigte die unscharfe Rückseite eines Kopfes, der ein pointillistisches Zwielicht betrachtete. Traum vom Träumer hieß das Bild, es stammte von einem hiesigen Expressionisten. Sie und Martin hatten es in der Sarnath Gallery gekauft. Jetzt jedoch erinnerte die verzerrte Form des Motivs sie an den schwangeren Bauch aus ihrem Traum.
Sie drehte sich um und küsste Martin. »Ist Melanie da?«
»Sie ist mit ihren Freunden unterwegs.«
O Gott. Melanies ›Freunde‹ beunruhigten Ann mehr als jeder andere Aspekt ihres Lebens. Die ›Main Street Punks‹ hatten die Zeitungen sie genannt. Lederjacken, zerrissene Jeans, die von Sicherheitsnadeln zusammengehalten wurden, und Frisuren, die Vidal Sassoon in den Selbstmord getrieben hätten. Ann war klar, dass sie nur Vorurteile hatte; diese Punks waren für sie das, was für die Generation von Anns Eltern die Hippies gewesen waren. Martin hatte einige von ihnen kennengelernt und ihr versichert, dass sie ganz in Ordnung waren. Sie sahen ziemlich wild aus, das war alles – sie sahen anders aus. Die überfürsorgliche Mutter in Ann wollte nicht, dass Melanie anders war, auch wenn sie wusste, dass der Begriff relativ war. Sie wusste, dass es engstirnig von ihr war, aber irgendwie spielte das keine Rolle, wenn es um die eigene Tochter ging. Die Tochter von anderen Leuten – ganz egal. Aber nicht meine. Sie liebte Martin mehr, als sie je einen anderen Mann in ihrem Leben geliebt hatte; aber oft ärgerte sie sich über seinen Liberalismus. Sie hatten sich häufig darüber gestritten.
»Es ist eine Frage der Perspektive, Ann. Als du in ihrem Alter warst, hast du Peace-Zeichen und bunte Perlen getragen und Jimi Hendrix gehört. Das hier ist genau das Gleiche. Es ist eine Strömung, zu der sie sich hingezogen fühlt. Vielleicht solltest du versuchen, sie besser zu verstehen, dann wäre sie vielleicht nicht so unsicher.«
»Oh, verstehe«, hatte Ann gekontert. »Gib nur mir die Schuld. Ich muss eine schlechte Mutter sein, weil ich nicht will, dass mein einziges Kind mit einer Bande von Leuten herumhängt, die aussehen wie Sex-Pistols-Ausschussware! Großer Gott, Martin, hast du dir die Typen mal angesehen? Einer von ihnen hat Metallspitzen, die aus seinem Kopf ragen!«
»Sie sehen anders aus, also müssen sie ein schlechter Einfluss sein? Willst du das damit sagen, Ann? Hast du schon mal was von Selbstentfaltung gehört? Wahrscheinlich würden sie eher deinen Beifall finden, wenn sie alle Slipper ohne Socken tragen würden und Namen wie Biff und Muffy hätten.«
»Leck mich, Martin.«
»Es sind nur unschuldige Kinder mit einer anderen Sicht auf die Welt, Ann. Du kannst doch nicht Melanies Freunde für sie aussuchen. Das ist ihre Sache, und das solltest du respektieren.«
Verdammt sollte er sein. Und wenn er nun recht hatte? Dr. Harold meinte, dass ihre ablehnende Haltung gegenüber Melanies Freunden ein Verteidigungsmechanismus sein könnte. Ann fühle sich so schuldig, weil sie sich so selten um Melanie kümmere, dass ihr Unterbewusstsein einen anderen, alternativen Weg der Schuldzuweisung gefunden habe. »Sie arbeiten sehr hart«, hatte der Therapeut gesagt. »Sie sind überaus erfolgreich, aber diese Tatsache nutzen Sie dazu, diejenigen anzugreifen, die Sie lieben. Unterbewusst haben Sie das Gefühl, eine schlechte Mutter zu sein, und Sie haben das Gefühl, dass das der Grund für das geringe Selbstvertrauen Ihrer Tochter ist. Aber statt das zuzugeben und dementsprechend zu handeln, haben Sie sich dafür entschieden, sich dem gar nicht erst zu stellen.«
Er sollte auch verdammt sein. »Ich bezahle zwei Hunderter pro Stunde, um mich beleidigen zu lassen?«
Dr. Harold hatte gelacht. »Sich selbst deutlicher zu sehen ist keine Beleidigung. Wenn Sie wollen, dass Ihre Tochter glücklich ist, müssen Sie ihre Einstellungen und ihre Weltsicht unterstützen. Jedes Mal wenn Sie im Eifer des Gefechts ihre Überzeugungen infrage stellen, beleidigen Sie sie. Solche Dinge können einen jungen Geist leicht verletzen.«
»Sie ist kein Baby mehr, Ann«, sagte Martin jetzt. »Sie ist eine kluge, kreative 17-Jährige. Mach dir keine Sorgen.«
Ann schnaubte. Der Tag war einfach zu verwirrend gewesen, und Martin merkte es ihr an. Er warf einen Blick auf seine Armbanduhr. »Zeit für einen Drink.« Er mixte ihr einen Gin Tonic und machte sich eins seiner Snob-Biere auf. Auf höfliche Weise ein schlechtes Thema zu wechseln, war seine Art, ihr nicht ihre eigenen Bedenken unter die Nase zu reiben.
»Hast du heute was geschafft?«, fragte sie mit einer Kopfbewegung in Richtung Schreibmaschine. Schon der erste Schluck Gin hatte eine lockernde Wirkung auf sie.
»Ja, einiges. Ich hätte noch mehr geschafft, wenn ich nicht dauernd unterbrochen worden wäre. Irgendein Typ hat ständig für dich angerufen – bestimmt fünf-, sechsmal.«
»Irgendein Typ?«
»Ich hab ihm gesagt, dass du erst am frühen Abend wieder da bist. Hab gefragt, ob ich dir was ausrichten soll, aber er wollte nicht.«
»Irgendein Typ?«, wiederholte sie.
»Muss dein anderer Liebhaber sein«, meinte Martin.
»Ja, aber welcher? Ich habe Dutzende, weißt du?«
»Klar, aber warum gibst du dich mit denen ab, wenn du so einen charmanten, intelligenten und überaus fürsorglichen Mann wie mich hast? Ganz zu schweigen von meinen Talenten im Schlafzimmer.«
»Ich nehme dir ja wirklich nur ungern deine Illusionen, aber der einzige Grund, weshalb ich dich bei mir behalte, ist der, dass du ein guter Koch bist.«
»Ah, das ist es also.«
Spaß beiseite – der Anrufer machte sie nachdenklich. Vielleicht war es jemand aus der Kanzlei, der ihr gratulieren wollte.
»Der Typ hatte eine komische Stimme, so wie jemand mit einem Emphysem oder einer Halsentzündung.«
Ann tat es mit einem Achselzucken ab. Wer es auch war – er würde sich schon wieder melden.
»Ich habe noch nicht mit dem Abendessen angefangen«, gestand Martin und zündete sich eine Zigarette an. »Ich könnte was auftauen …«
Jetzt wurde Ann erst bewusst, wie sehr sie in Gedanken gewesen war. Sie hatte es ihm noch gar nicht erzählt, oder? »Tau nichts auf«, sagte sie. »Wir gehen essen. Ich habe einen Tisch im Emerald Room reserviert.«
Martin machte ein finsteres Gesicht. »Das ist das teuerste Restaurant der Stadt.«
»Und das beste.«
»Ja, aber, äh, können wir uns das leisten?«
Fast hätte sie gelacht. Ann war nach den Begriffen der meisten Leute reich, und ab heute noch reicher. Bei solchen Gelegenheiten brach immer wieder Martins finanzieller Stolz durch. Im Grunde lebte er von Anns Geld, und das wussten sie beide. Wenn er fragte: Können wir uns das leisten?, meinte er eigentlich: Ich bin pleite, wie üblich, also wirst du das Essen bezahlen müssen. Wie üblich.
»Wir haben was zu feiern, Martin.«
Misstrauisch klopfte er die Asche von der Zigarette. »Was denn?«
»Ich bin heute Teilhaberin geworden.«
Die Neuigkeit ließ ihn verblüfft erstarren. Er stand nur da und schaute sie an. »Du machst Witze.«
»Nein. Es kam völlig überraschend. Gestern habe ich noch für Collims, Lemco und Lipnick gearbeitet. Seit heute arbeite ich für Collims, Lemco, Lipnick und Slavik.«
»Das ist ja großartig!«, jubelte Martin endlich und drückte sie fest an sich. Aber Ann musste ihre eigene Freude vortäuschen; sieben Jahre hatte sie auf diesen Tag gewartet, auf den größten Triumph im Leben eines Anwalts, und alles, woran sie denken konnte, war der Albtraum.
Martin hatte ihr zweimal einen Antrag gemacht. Beide Male hatte Ann Nein gesagt, und selbst jetzt noch war sie sich nicht ganz sicher, warum. Schlechte Erfahrungen, vermutete sie. Ihr erster Mann hatte sie vor zwölf Jahren verlassen. Es waren harte Zeiten gewesen, und Mark hatte es ihr nicht gerade leichter gemacht. Ann hatte tagsüber Jura studiert, nachts gearbeitet und zwischendurch irgendwie versucht, Melanie großzuziehen. Marks Scheitern war nicht allein seine Schuld gewesen. Anns Eltern hatten ihn nicht gemocht. Mom fand, er sehe ›durchtrieben‹ aus, während Dad ihn immer als ›Tagedieb‹ bezeichnete. Die Arbeit in der Baubranche war hier in der Region recht lukrativ, sofern man für einen zuverlässigen Bauunternehmer tätig war. Mark hatte es mit mehreren Auftraggebern zu tun gehabt, die gerade das nicht waren. Er hatte sich Ann gegenüber immer minderwertig gefühlt. Zumindest hatte die Zeit, in der er nicht arbeitete, Ann eine Menge Geld für Kinderbetreuung und Babysitter erspart. Eine Woche nach ihrem Juraabschluss hatte Mark sich aus dem Staub gemacht. Tut mir leid, aber ich halte das nicht mehr aus, stand in seinem Brief. Such dir jemanden, der dir besser das Wasser reichen kann. Mark.
Ihre Eltern waren tatsächlich froh darüber gewesen, was Ann ihnen bis heute nicht verziehen hatte. Sie hatte Mark nie wiedergesehen. Melanie war zu der Zeit fünf gewesen; sie konnte sich kaum an ihren leiblichen Vater erinnern.
Anns erste Jahre in der Kanzlei waren so stressig gewesen, dass sie praktisch kein Privatleben gehabt hatte. Die paar Verabredungen hier und da hatten nie zu etwas geführt – kein Wunder als Anwältin und alleinerziehende Mutter. Eines Tages stellte sie fest, dass drei Jahre vergangen waren, ohne dass sie ein einziges Mal mit jemandem geschlafen hatte. Sie konnte auch schlecht von einem Mann erwarten, die Rolle des Ehemannes einer Frau zu übernehmen, die sechs Tage die Woche zehn bis zwölf Stunden arbeitete und eine grüblerische Tochter von einem anderen Mann hatte.
Aber Martin war anders gewesen. Sie hatte ihn im College kennengelernt; die Kanzlei hatte sich ein Computersystem zugelegt und Ann musste einen dreitägigen Textverarbeitungskurs belegen. Martin saß in der Cafeteria, wo er rauchend einen Stapel Seminararbeiten über die Thematiken von Randall Jarrell korrigierte. Er blickte kaum auf, sie betrieben ein bisschen Small Talk und er lud sie auf einen Drink ein. Sie verbrachten einen netten, höflichen und harmlosen Abend im Undercroft, und damit war es geschehen. Eine Woche später waren sie ein Paar. Es half sehr, dass sein Tagesablauf als Schriftsteller sich gut mit ihrem von der Arbeit dominierten Tagesablauf kombinieren ließ. Es gab nie irgendwelche Spannungen, und sie musste sich nie zwingen, auszugehen und etwas zu unternehmen, wenn sie zu müde war.
Bevor er bei ihr und Melanie eingezogen war, hatte er ihr erklärt: »Ich bin ein Poet, das ist mein einziger beruflicher Ehrgeiz. Ich schreibe sechs bis acht Stunden pro Tag, und das jeden Tag, und ich unterrichte in Teilzeit am College. Ich könnte Vollzeit arbeiten und mehr Kurse unterrichten, um mehr Geld zu verdienen, aber dann hätte ich nicht mehr genug Zeit zum Schreiben. Das werde ich nie tun. Wahrscheinlich werde ich nie mehr als 20.000 im Jahr verdienen. Bevor es mit uns weitergeht, will ich, dass du das weißt. Ich will, dass alles auf dem Tisch liegt, damit es später keine Missverständnisse gibt. Ein armer Poet ist alles, was ich jemals sein werde.« Waren alle Männer so empfindlich, was das Geld anging? Ann hatte nie an ihrer Liebe zu ihm gezweifelt; es war ihr egal, wie viel er verdiente, solange er sie liebte. Und auch daran hatte sie nie gezweifelt.
Martin war ein guter Hausmann. Er unterrichtete zwei Kurse, dienstags und donnerstags am Vormittag. An den anderen Tagen schrieb er von morgens bis abends. Er bevorzugte klare Routinen – ›psychische und kreative Ordnung‹ nannte er es. Er brachte Melanie jeden Morgen zur Schule, dann fuhr er nach Hause und schrieb oder fuhr zur Schule und unterrichtete, dann schrieb er noch ein bisschen und holte Melanie ab. Er bereitete alle Mahlzeiten zu (alle Schriftsteller waren gute Köche) und spülte sogar ab! Wäschewaschen und Putzen teilte er sich mit Melanie. An vielen Abenden kam Ann nicht zum Essen nach Hause, aber auch das war nie ein Problem. Melanie hatte ihn sofort in ihr Herz geschlossen. Er förderte und unterstützte sie besser, als Ann es je hätte erwarten können, und da sie beide glühende Liberale waren, waren sie in allem einer Meinung. Martin mochte sogar Melanies wilde, misstönende Musik. Mindestens einmal im Monat fuhr er mit ihr und einigen ihrer Freundinnen zu einem der New-Wave-Clubs in D. C., um sich Bands anzusehen wie Car Crash Symphony, Alien Sex Fiend oder Nixon’s Head.
»Nixon’s Head!«, hatte Ann einmal geschimpft. »Du bist mit ihr zu einer Band gegangen, die Nixon’s Head heißt?«
»Kreativer Alternativismus, meine Liebe«, hatte Martin ruhig geantwortet. »Ohne das wären wir nur ein weiteres Rotchina.«
Vielleicht war Ann ja dumm, aber sie verstand nicht, wie eine Gruppe, die Nixon’s Head hieß, ein Beweis für Demokratie sein konnte. Doch wie dem auch war, ohne Martin hätte Melanie gar keine Vaterfigur und wäre wahrscheinlich längst von zu Hause weggelaufen. Martin war tolerant gegenüber Dingen, die andere Männer nie hinnehmen würden: Er war beständig, reagierte mit Freundlichkeit und Nachsicht auf ihren Arbeitsstress, war nie eifersüchtig, und er war definitiv niemand, der tobte und schäumte, wenn sie bis spätabends an irgendwelchen eidesstattlichen Aussagen arbeiten musste oder mit Klienten in Restaurants ging, in denen ein Essen für zwei mehr kostete, als Martin in einer Woche verdiente. Er fühlte sich nicht im Geringsten untergeordnet; manchmal bezeichnete er sich sogar selbst scherzhaft als ihre ›Ehefrau‹. Er bestand darauf, seinen Teil, so klein er auch war, zum Abzahlen der Wohnung beizutragen, und weigerte sich, seinen zehn Jahre alten Ford Pinto von ihr durch eine Corvette ersetzen zu lassen. »Die Leute werden denken, dass ich dein Gigolo bin«, war sein Einwand. »Jeder Poet, der keinen zehn Jahre alten Wagen mit mindestens 200.000 Kilometern auf dem Tacho fährt, ist ein reiner Poser.«
Seinen ersten Heiratsantrag hatte er ihr fröhlich und gut gelaunt gemacht. »Wenn du mich nicht bald heiratest, werden die Nachbarn denken, dass ich nur für Sex gut bin.«
»Das ist nicht wahr, Martin. Du bist auch ein sehr guter Koch. Lass uns später darüber reden.«
Beim zweiten Mal war es nicht so gut gelaufen. »Ich kann mich im Moment noch nicht mit dem Gedanken an eine Heirat anfreunden«, hatte sie gesagt, als sie zum zweiten Mal den Ring zurückwies, auf den er Jahre gespart haben musste.
»Warum?«, fragte er.
»Weil ich schon einmal verheiratet war und es nicht geklappt hat«, antwortete sie.
»Es ist doch nicht meine Schuld, dass du einen Idioten geheiratet hast!«, fuhr er sie an.
Sie hatte sich danach tagelang mies gefühlt, weil er ja im Grunde recht hatte. Ein Teil der Misere war, dass sie nicht heiraten wollte, solange sie nicht wusste, dass ihre berufliche Zukunft sicher war.
Aber war das wirklich das Problem?
Was stimmt mit mir nicht?, dachte sie.
Melanie dazu zu bringen, sich etwas Angemessenes anzuziehen, war wie Zähneziehen. »Ja, du wirst hingehen«, hatte Ann befohlen. »Und nein, du kannst nicht deine Lederhose und dieses Rob-Zombie-T-Shirt anziehen.« Natürlich war es Martin gewesen, der sie überzeugt hatte. »Sich der Konformität anzupassen, ist doch auch eine Art Statement, oder?« Daraufhin hatte Melanie tatsächlich ohne weitere Widerworte ein Kleid angezogen.
»Ich fühle mich wie ein Yuppie«, sagte sie jetzt, nachdem die Bedienung ihnen den Platz am Fenster zugewiesen hatte. Das Emerald Room war in der Tat das beste Restaurant der Stadt. Die Regierung des Bundesstaates hielt hier während der Sitzungsperioden ihre Geschäftsessen ab, oft in Begleitung von Unmengen an Lobbyisten. Der Gouverneur tauchte einmal wöchentlich auf und der County Executive ließ sich oft spätabends sehen. Jeder Promi, der in die Stadt kam, landete unweigerlich hier, auf Empfehlung anderer Promis. Stallone soll einmal einem Produzenten gegenüber bemerkt haben: »Hervorragender Mampf!«
»Was genau bedeutet es, Teilhaberin zu sein, Mom?«, fragte Melanie.
»Es bedeutet, dass ich meinen Anteil an allen Profiten der Kanzlei erhalte.«
Es bedeutete auch, an allen Haftungen beteiligt zu sein, aber darüber machte Ann sich keine Sorgen. Sie hatte selbst den größten Klienten der Kanzlei, Air National, an Land gezogen und es geschafft, das Unternehmen doppelt so lange bei der Stange zu halten wie jede andere Kanzlei. Es war ein etwas zwielichtiger Laden, aber das Beste an der Vertretung einer verantwortungslosen Fluggesellschaft war die Tatsache, dass das Unternehmen jeden Betrag zahlen würde, um sich aus der Klemme helfen zu lassen. Aber hauptsächlich bedeutete Teilhaberin zu sein, dass sie mehr delegieren konnte und demzufolge mehr Zeit für Martin und Melanie haben würde. Von nun an würden es die angestellten Anwälte sein, die bis drei Uhr morgens über Akten brüteten. Vielleicht entwickelte sich jetzt alles in Richtung der häuslichen Stabilität, die sie dringend benötigte. Vielleicht konnten sie jetzt endlich eine Familie sein.
Der Oberkellner zählte die Empfehlungen des Tages auf und überließ sie ihren ledergebundenen Speisekarten.
»Wie läuft es in der Schule?«, fragte Ann.
»Okay«, antwortete Melanie vage. Okay bedeutete, dass zumindest keine katastrophal schlechten Noten am Horizont dräuten. Melanie war ein kluges Mädchen, sie passte sich nur nicht gut an. Bevor Martin aufgetaucht war, hatte sie oft den Unterricht geschwänzt und in vielen Fächern schlechte Noten kassiert. Aber dann sagte sie strahlend: »Ich werde eine Eins in Kunst bekommen.«
Kunst, ausgerechnet, dachte Ann. »Melanie, mit Kunst wirst du in dieser Welt nicht weit kommen.«
»Rembrandt wäre da vermutlich anderer Meinung«, sagte Martin und warf ihr diskret einen finsteren Blick zu.
»Was ich meine, Liebling, ist, dass Kunst keinen besonders guten Lebensunterhalt darstellt. Kunst verkauft sich erst dann gut, wenn der Künstler tot ist.«
Martins Gesicht war noch immer finster. »Deine Mutter hat recht, Melanie. Peter Max verdient nur 500.000 Dollar die Woche. Letztes Jahr hat Denier ein 30-mal-30-Zentimeter-Bild für 17 Millionen verkauft. Da kann man ja nur verhungern.«
Ich habe es wieder getan, dachte Ann. Martins heiterer Sarkasmus war seine Art, Anns Negativität zu kontern. Was Melanie brauchte, war mütterliche Unterstützung und nicht Kritik. Ann fürchtete mehr und mehr, dass Martin vollkommen recht hatte – dass Melanies Unangepasstheit auf dem Fehlen solcher Unterstützung basierte. Anns eigene Eltern waren fuchsteufelswild gewesen über ihren Entschluss, Jura zu studieren. »Anwälte sind Haie und Lügner«, hatte ihre Mutter gesagt. »Das ist kein Beruf für eine Frau.« Und ihr Vater hatte ihr versichert: »Du wirst es nie zur Anwältin bringen, Ann. Das ist eine Welt, die viel zu brutal für dich ist.« Ann hatte sich wahrscheinlich noch nie in ihrem Leben verletzter gefühlt, und beim Gedanken daran bekam sie ein noch schlechteres Gewissen. Wie oft hatte sie Melanie mit ähnlichem Spott verletzt?
»Es tut mir leid, Liebling«, sagte sie, aber es klang schrecklich unaufrichtig.
Martin wechselte rasch das Thema. »Was ist das hier eigentlich für ein Schuppen? Keine Chili-Hotdogs auf der Speisekarte!«
»Keine Sorge, mein Lieber«, sagte Ann. »Ich bin mir sicher, dass sie dir Gänseleber und Beluga-Kaviar auf einem Hotdog-Brötchen servieren, wenn du danach fragst.«
»Das sollten sie verdammt noch mal auch besser tun, wenn sie nicht wollen, dass ich anfange, Tische umzuwerfen. Und sie sollten mir besser auch Ketchup zu meinen Pommes bringen.«
Melanie liebte es, wenn Martin sich über das Establishment lustig machte oder zumindest über die Orte, wo das Establishment speiste. Aber Martin wurde wieder ernst, als er die Vorspeisen überflog. »Großer Gott.« Er beugte sich vor und flüsterte: »Der pochierte Lachs kostet sieben Mäuse. Das ist eine Menge Schotter für ein Appetithäppchen.«
»Mach dir deswegen keine Sorgen, Martin«, versicherte Ann ihm. »Wir feiern meine Teilhaberschaft, schon vergessen? Geld spielt keine Rolle.«
»Ich will keine Vorspeise«, sagte Melanie. »Ich hätte lieber ein Bier.«
»Du bist zu jung, um Bier zu trinken«, erinnerte Ann sie.
Martin meinte: »Ich nehme die Austern Chesapeake. Die sind zwei Dollar billiger als der Lachs.«
Ann wusste nicht, ob sie lachen oder schreien sollte. Würdest du bitte den verdammten Lachs nehmen und die Klappe halten?, hätte sie am liebsten gesagt. Mein Jahresgehalt ist gerade um 40.000 Dollar erhöht worden. Ich denke, da ist ein Sieben-Dollar-Appetithäppchen drin! Aber stattdessen sagte sie: »Ich werde für alle bestellen. Das dürfte das Einfachste sein.«
Eine wunderschöne Rothaarige nahm ihre Bestellungen entgegen, während roboterhafte Kellner Brot brachten und ihre Wassergläser füllten. Martin und Melanie plauderten über einige Kunstausstellungen in der Stadt, und in der Zwischenzeit kamen drei Anwälte von konkurrierenden Kanzleien an den Tisch, um Ann zu ihrer Teilhaberschaft zu gratulieren. Das überraschte sie – alarmierte sie sogar ein bisschen –, da sie nicht erwartet hatte, dass die gegnerischen Lager ihren Erfolg ohne jedes Anzeichen von Neid anerkannten. »Du scheinst so was wie das Tagesgespräch in der hiesigen Anwaltsszene zu sein«, meinte Martin, als Melanie sich entschuldigte, um zur Toilette zu gehen.
»Es ist ein komisches Gefühl.«
»Ich freue mich sehr für dich«, sagte er.
Und das stimmte auch, es war unübersehbar. Warum also konnte sie sich selbst nicht richtig freuen? Es kam ihr alles verzerrt vor. Teilhaberin zu sein erschien ihr immer noch so fern und unwirklich. Warum? »Ich werde jetzt mehr zu Hause sein«, sagte sie. »Ich werde dir Melanie ein bisschen vom Leib halten können.«
»Ann, sie ist ein großartiges Kind, sie ist überhaupt keine Belastung für mich. Ich glaube, dass sie jetzt allmählich anfängt, aus ihrem Panzer zu kriechen.«
»Wobei ich keine große Hilfe bin.«
»Würdest du bitte aufhören? Alles läuft doch großartig, oder nicht?«
Ja, das tat es. Ann verstand nicht, warum sie selbst nicht dieses Gefühl hatte. Alles lief großartig.
»Ist alles in Ordnung?«
»Was?«, fragte sie.
»Du siehst plötzlich ganz blass aus.«
Ann versuchte es abzuschütteln. Sie fühlte sich auch blass. »Ich weiß nicht, was los ist. Es wird schon wieder.«
»Du arbeitest zu viel«, meinte Martin. »Kein Wunder. Und dann noch diese Sache mit dem Albtraum …«
Der Albtraum, dachte sie. Die Hände auf ihrem Körper …
»Es wird alles besser werden, wart’s nur ab«, sagte Martin und trank einen Schluck von seinem Wild-Goose-Lagerbier. »Es kommt alles vom Stress. All die Überstunden, die du gemacht hast, und deine Sorgen um Melanie – das kommt alles zusammen. Aber Dr. Harold ist ein hervorragender Therapeut. Ich kenne ein paar Profs am College, die zu ihm gehen. Der Kerl wirkt Wunder.«
Aber war das wirklich die Antwort auf ihr Problem? Dabei war Ann nicht mal wirklich sicher, was ihr Problem war.
Jenseits des großen Fensters erstreckte sich die Stadt in glitzernder Dunkelheit. Der Mond hing über dem alten Postamt; er sah rosafarben aus. Ann starrte ihn an. Seine bucklige Gestalt bannte sie ebenso wie dieses bizarre Rosa.
»Mom, ist alles okay?«, hörte sie Melanies Stimme.
Jetzt sahen beide sie besorgt an. »Vielleicht sollten wir nach Hause fahren«, schlug Martin vor. »Du brauchst ein bisschen Ruhe.«
»Es geht mir gut, wirklich«, erwiderte sie schwach. »Wenn ich was gegessen habe, geht es mir besser.«
Ann musste sich zwingen, sich normal zu verhalten, aber alles lenkte sie ab. Unterbewusste Referenzvorstellungen hatte Dr. Harold es genannt. Bildsymbolisierungen. Sogar Unwichtigkeiten erinnerten sie an den Albtraum. Der kugelförmige Glas-Kerzenständer auf dem Tisch. Die perfekt manikürten Hände der Bedienung, die ihnen die Vorspeisen servierte. Das fleischige Rosa von Martins pochiertem Lachs erinnerte sie an das rosafarbene Fleisch des Traumes, das das gleiche gespenstische Rosa zu sein schien wie das des bauchigen Mondes hinter dem Fenster. Der Mond sah aufgebläht aus, schwanger.
In dem Traum war sie schwanger. Ihr Bauch dehnte sich gewaltig und rosafarben. Dann sah sie die Gesichter …
Die gesichtslosen Gesichter.
»Irgendein Typ hat gestern ein paarmal für dich angerufen«, sagte Melanie. »Ich habe ihn gefragt, was er wollte, aber er hat es nicht gesagt.«
Martin blickte auf. »Klang seine Stimme …«
»Sie klang gruselig, als hätte er eine schwere Erkältung oder so was.«
Der gleiche Anrufer, den Martin erwähnt hatte. »Wahrscheinlich jemand, der Zeitschriftenabos verkauft«, tat Ann es ab. Aber jetzt war ihre Neugier geweckt. Es gefiel ihr nicht, dass jemand für sie anrief und sie nicht wusste, wer oder warum.
»Der ruft bestimmt noch mal an«, meinte Martin. »Jetzt bin ich selber ein bisschen neugierig.«
Sobald Ann etwas im Magen hatte, fühlte sie sich tatsächlich besser. Ihre glasierte Moschusente war perfekt, und Martin schlang begeistert seinen pochierten Lachs herunter. Aber Ann merkte, dass ihr plötzliches seltsames Benehmen die Stimmung des Abends gedämpft hatte. Melanie und Martin gaben sich alle Mühe, aber man merkte es. Sie wussten, dass etwas nicht stimmte. Noch einmal versuchte Ann Konversation zu treiben, zur Normalität zurückzukehren. »Ich werde Melanie an den meisten Tagen zur Schule fahren können«, sagte sie, aber dann fiel ihr ein, dass Melanie jetzt schon seit zwei Jahren zur High School ging und Ann keine Ahnung hatte, wie die Schule aussah. Sie wusste noch nicht einmal, wo sie war. Martin hatte Melanie angemeldet.
»Ich dachte mir, dass ich nächste Woche mit ihr zu einigen der Museen im District fahre«, sagte Martin. »Schade, dass du dir nicht freinehmen kannst.«
Ann hatte keine Ahnung, wovon er redete. »Museen?«
»Ja, und einige Galerien.«
»Ich wollte schon immer mal in die National Gallery«, sagte Melanie.
Wieder ein Stich des schlechten Gewissens. Das war etwas, das Ann Melanie schon seit Jahren versprochen, aber nie eingelöst hatte. Trotzdem verstand sie immer noch nicht. »Martin, wie kannst du mit ihr in die Stadt fahren? Sie muss zur Schule.«
Martin bemühte sich, sie nicht zu böse anzusehen. »Es sind Frühlingsferien, Ann. Ich erinnere dich seit Wochen daran.«
Tatsächlich? O Gott, dachte sie. Jetzt fiel es ihr wieder ein. Sie hatte es komplett vergessen.
»Melanie hat die ganze Woche frei, und ich nehme mir auch frei«, sagte Martin.
Ein Urlaub, dämmerte ihr. Das wäre perfekt. »Tut mir leid, ich habe es ganz vergessen. Wir fahren irgendwohin, wir drei zusammen.«
Martin warf ihr einen seltsamen Blick zu. Sie hatte seit Jahren keinen Urlaub mehr genommen, und bisher war es jedes Mal, wenn er das Gespräch darauf gebracht hatte, in einen Streit ausgeartet. »Ist das dein Ernst? Glaubst du, sie geben dir einfach so eine Woche frei?«
»Martin, ich bin jetzt eine von ihnen. Ich kann mir freinehmen, wann ich will, vorausgesetzt das Geschäft läuft.«
Martin sah sie über seinen Lachs hinweg zweifelnd an. »Ich glaube es nicht!«, spöttelte Melanie. »Mom nimmt sich Urlaub? Das ist ja mal ganz was Neues.«
»Vieles wird sich jetzt ändern, Liebling«, versicherte Ann ihr.
Melanie war begeistert. »Ich glaube es nicht! Endlich werde ich die National Gallery sehen können und die Corcoran Gallery.«
»Da deine Mom gerade große Reden schwingt«, sagte Martin, »kann sie vielleicht noch einen draufsetzen. Vielleicht Giverny. Vielleicht den Louvre.«
Glauben sie, ich rede Blödsinn?