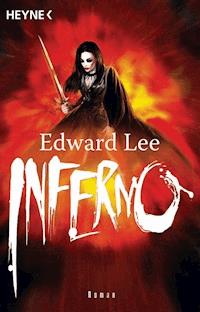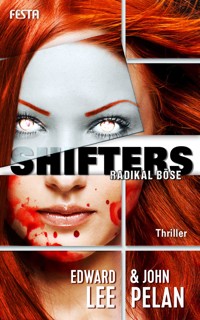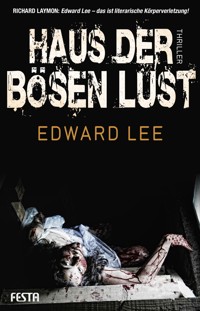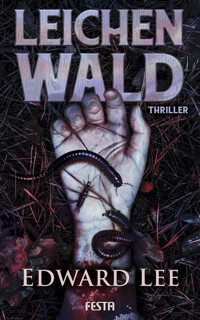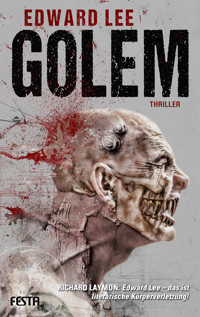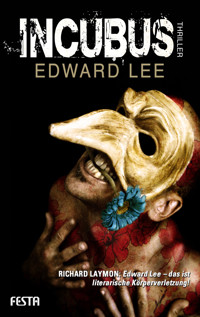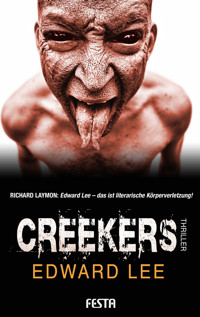4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Festa Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Hat Dahmer seinen eigenen Tod nur vorgetäuscht? Im Juli 1991 fasste die amerikanische Polizei einen der teuflischsten Serienmörder der Geschichte – den Kannibalen Jeffrey Dahmer. Drei Jahre später wurde er im Gefängnis von einem anderen Insassen erschlagen ... Doch kurz nach dem Begräbnis beginnt eine weitere kannibalistische Mordserie. Fingerabdrücke, DNA und modus operandi – alle Spuren führen zu Dahmer. Die Ermittlerin Helen Closs ist sich sicher, dass es sich um einen perversen Nachahmer handelt ... bis in der Nacht ihr Handy klingelt und Jeffrey Dahmer selbst mit ihr redet. Eine fein geschliffene Geschichte. Edward Lee und die Serienkillerexpertin Elizabeth Steffen sind auf Augenhöhe mit den besten Kriminalschriftstellern. Gruselig und intelligent ... so wie Jeffrey Dahmer selbst.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 413
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Aus dem Amerikanischen von Christian Jentzsch
Impressum
Die amerikanische Originalausgabe Dahmer’s Not Dead
erschien 1999 im Verlag I D I Publications.
Copyright © 1999, 2011 by Edward Lee und Elizabeth Steffen
Copyright © dieser Ausgabe 2017 by Festa Verlag, Leipzig
Titelbild: Arndt Drechsler
Lektorat: Tanja Lottes
Alle Rechte vorbehalten
eISBN 978-3-86552-567-3
www.Festa-Verlag.de
Für Doris June und J-Fer.
Außerdem für Debra Miller, Patricia Bradley, Vette Myers und den Rest meiner behördlichen und zivilen Freunde, die mir bei meinen Überspanntheiten und animalischen Abenteuern mit Nachsicht begegnen. Vielen Dank!
Und für R. K.
PROLOG
MILWAUKEE, WISCONSIN, JULI 1991
»Streife Zwo-Null-Sieben, bitte kommen.«
»Hier Zwo-Null-Sieben, ich höre. Was gibt’s denn?«
»Wagen Zwo-Null-Sieben, sind Sie Zehn-Acht?«
»Absolut.«
»Fahren Sie zur 25. Straße Nord, Haus Nummer 1055, Wohnung 213. Wir haben ein mutmaßliches Signal 22. Sehen Sie sich das mal an und erstatten Sie dann Bericht.«
»Verstanden, aber was ist da Sache?«
»Könnte ein Fall von häuslicher Gewalt sein. Es folgt die Beschreibung des Anzeigeerstatters laut der von Streife Zwo-Null-Acht aufgenommenen Fallnummer … Der Mieter heißt Dahmer, Vorname Jeffrey, ist 31 Jahre alt, männlich, weiß …«
»Zehn-Vier«, ächzte Chase. »Zwo-Null-Sieben, Zehn-Sechs zur 25. Straße Nord. Ende.«
Mann, ist das nervig, dachte er, als er das Mikro einhängte. Er drückte eine Winston aus und dann auf die Hupe des Streifenwagens. Warum tretet ihr mir nicht auch noch in die Eier? Augenblicke später kehrte Chases Partner Sergeant Dallas Gollimar mit zwei Kaffeebechern und einer Burger-King-Tüte mit Doppel-Whoppern plus Käse zum Streifenwagen zurück. »Was denn!?«, schnauzte Gollimar.
»Gerade kam ein gottverdammter Funkspruch für uns rein«, beklagte sich Chase.
»Du willst mich verarschen, oder? In 20 Minuten ist Schichtwechsel!«
Chase setzte den leuchtend weißen Dodge Diplomat in Gang, ein altes, aber immer zuverlässiges Fahrzeug. Er und Gollimar waren gute Cops, zumindest relativ gesehen. Wenn man ihnen blöd kam, kam es von ihnen blöd zurück, aber wenn man sie anständig behandelte, taten sie das auch. Sie hatten in ihrem Revier schon reichlich heftige Sachen erlebt und nie davor gekniffen. Sie wussten, was sie taten, und kannten sich in ihrem Job aus. Wirklich verhasst waren ihnen nur Einsatzbefehle, die 20 Minuten vor Schichtende kamen.
»Gerade kam ein Signal 22 für uns rein«, sagte Chase. »Herrgott, ich weiß nicht mal, was das überhaupt ist.«
»Ärger der unbekannten Art«, klärte Gollimar ihn auf, während er einstieg und die Tür zuknallte. »Eine 22 hatte ich schon seit Jahren nicht mehr. Normalerweise sind das immer irgendwelche häuslichen Probleme.«
»Hat die Zentrale auch gesagt.« Chase steckte sich die nächste Winston an. »Bist du startklar? Zwo-Null-Acht hat gerade irgendeinen Jungen aufgegriffen, der schreiend über die Straße gerannt ist. Der Junge hatte die Hände auf dem Rücken gefesselt und ein paar blaue Flecken und Blutergüsse.«
»Zwo-Null-Acht? Wer ist das? Bierbauch und Karp, nicht?«
»Genau.« Chase fuhr auf die heiße, grelle Straße. Der Verkehr konnte einem zu schaffen machen, aber man gewöhnte sich daran. Das Tageslicht fegte über die Windschutzscheibe. »Die haben also diesen Jungen aufgegriffen, und der hat ihnen erzählt, ein Kerl habe versucht, ihn in seiner Wohnung umzubringen – ein Kerl namens Dahmer, in der 25. Straße Nord –, und wir sollen uns das mal ansehen.«
»Schwachsinn!«, rief Gollimar. »In 20 Minuten haben wir Feierabend! Diese dämlichen Kerle wälzen ihre Scheiße immer auf uns ab. Sollen die der Sache doch auf den Grund gehen!«
»Geht nicht. Wir sind dafür zuständig, Weisers Befehl. Bierbauch und Karp sind gerade mit dem Papierkram beschäftigt. Sie mussten den Jungen ins Krankenhaus bringen. Er hat blaue Flecken und Blutergüsse, wie ich schon sagte, und behauptet außerdem, er wäre unter Drogen gesetzt worden.«
»Unter Drogen gesetzt? Ach, Mann. Das hört sich nach ’nem Haufen Scheiße an. Andauernd lädt irgendwer seine Scheiß-Einsätze auf uns ab. Zehn zu eins, dass Bierbauch und Karp sich gerade irgendwo Kaffee und Donuts reinziehen und sich schlapplachen, die fetten Hurensöhne.«
Chase zuckte die Achseln, während sie an The Pier Three Annex vorbeifuhren, einem Restaurant, in dem er nie würde essen können. Bei einem Verdienst von 32.500 im Jahr und mittlerweile 15 Prozent Steuern? Stuckey’s passte da besser. Und Burger King. Aber … Ein Arbeitsplatz ist ein Arbeitsplatz, machte er sich klar. Alles könnte noch viel schlimmer sein.
»Hey, Mann?«, fragte er. »Wo ist jetzt mein Doppel-Whopper mit Käse?«
»Ein ganz furchtbarer Gestank, praktisch die ganze Zeit«, erzählte ihnen die alte Dame. Chase und Gollimar waren ihr auf der Treppe begegnet. Sie war nicht der Hausmeister, sondern irgendeine alte Schachtel in einem ausgefransten Morgenrock. »Und dann der Krach! Das würdet ihr Jungs nicht glauben.«
»Was für ein Krach, Ma’am?«, fragte Gollimar.
»Wie … von Elektrowerkzeugen oder so was. Von einer großen Säge.«
Elektrowerkzeuge?, wunderte sich Chase. Okay, der Typ baut irgendwas zusammen. Das Einzige, was stank, war dieser Einsatz. Die kriegten sie immer mit so etwas dran. Partnerzoff. Die Frau ist sauer, rennt weg, erzählt Scheiße über ihren Mann oder Freund und überlegt es sich dann anders. Sie küssen und vertragen sich wieder. Alle Klagen werden zurückgenommen. Der einzige Unterschied in diesem Fall war der, dass der Anzeigesteller ein Typ war, was bedeutete, er war entweder schwul oder hatte eine knallharte Freundin mit dem Vornamen Jeffrey. Doch was hatte die alte Dame noch gesagt? Irgendwas von einem Gestank? »Ich rieche nichts«, stellte Chase fest.
»Ich auch …«
»Ha!« Chase schreckte zurück und hätte beinahe aufgeschrien, kaum dass sie die nächste Treppenstufe genommen hatten.
Da war tatsächlich ein Gestank. Schwach, aber durchdringend. Widerlich. Er weckte Kindheitserinnerungen in Corporal Jack Chase – daran, wie er und ein Freund namens Lee hinter dem alten, geschlossenen McCrory’s in Newark herumgestöbert hatten. Sie hatten ihre beherzten jungen Köpfe direkt in den Abfallcontainer gesteckt und etwas gesehen, bei dem es sich wohl um die Überreste eines Deutschen Schäferhundes gehandelt hatte, der sicher schon ein paar Tage in der Sonne gelegen hatte und verweste. Bei dem Gestank waren sie zurückgeschreckt und hatten sich ins hohe Unkraut übergeben …
»Was ist das?«, maulte Gollimar.
»Jedenfalls nichts Gutes, das kann ich dir sagen.«
»Wie heißt der Typ noch mal?«
Chase zog sein Notizbuch zurate. »Dahmer, Jeffrey, weißer Kaukasier, 31 Jahre alt. Arbeitet in der Wokina-Schokoladenfabrik am Toback Boulevard in der Nachtschicht.«
Gollimar klopfte energisch an die Tür von 213. Die Stärke des Gestanks schien sich zu verdreifachen.
»Scheiße, der Typ arbeitet nachts«, erinnerte Chase. »Wahrscheinlich schläft er gerade.«
»Ja, du hast recht. Wahrscheinlich liegt er …«
Mit einem Klicken öffnete sich die Wohnungstür. Ein mürrisches Gesicht schien in dem entstandenen Spalt zu hängen, verdutzte Mimik. Unrasiert, irgendwie blass, glatte hellbraune Haare.
Irre Augen, nahm Chase sofort zur Kenntnis.
»Ja?«
»Jeffrey Dahmer?«
»Ja?«
»Ich bin Sergeant Gollimar vom Milwaukee Police Department, und das hier ist mein Partner, Corporal Chase. Macht es Ihnen etwas aus, wenn wir reinkommen und uns kurz mit Ihnen unterhalten?«
Chases Augen schienen ein Zucken entwickelt zu haben, während er seinem Sergeant über die Schulter blickte.
»Es macht mir tatsächlich etwas aus, Officer. Ich arbeite in der Nachtschicht und bin sehr müde …«
»Ja, Sir, das verstehe ich durchaus«, erwiderte Gollimar im bei der Polizei üblichen freundlich-höflichen Tonfall, auch wenn einem in Fällen wie diesem gar nicht freundlich oder höflich zumute war. »Aber man hat uns gebeten, einer Anzeige nachzugehen, die von einem …«
Plötzlich riss Chase die Augen auf. Er wusste nicht einmal genau, was er da sah, als sein Instinkt in seinem Verstand plötzlich einen Großalarm auslöste. In einer geübten halbsekündigen Bewegung klappte er mit dem Daumen den Verschluss seines Halfters auf, zückte seinen Colt Trooper Mark III und drängte sich an Gollimar vorbei. Er hielt Dahmer den Revolver vors Gesicht und rief: »Nehmen Sie die Hände hoch! Nehmen Sie sofort die Hände über den Kopf!«
Gollimar fuhr zusammen. »Was machst du denn da, verdammt noch …«
»Da hängt irgendwas im Schrank, und auf dem Bett liegt was richtig Krasses!«, rief Chase. »Sieh dir das mal an, während ich den Kerl hier im Auge behalte!«
Sergeant Gollimar zog nun ebenfalls seine Kanone. »Halt ihn in Schach«, sagte er, während er die stinkende Dreizimmerwohnung vorsichtig betrat. Die Bude war eine Müllhalde, verkommen, und der Gestank war jetzt beinahe überwältigend. Was, in Gottes Namen …
Der Schrank. Jack hat gesagt, ich soll mir den Schrank ansehen …
Gollimar starrte ungläubig hinein.
»Das ist … Scheiße, Mann, das ist was aus ’nem Scherzartikelladen«, sagte er spöttisch. Sie hingen surreal da. Sie konnten gar nicht echt sein.
»Das Bett!«, blaffte Chase hinter ihm. »Sieh auf das Bett!«
Gollimar drehte sich um. Etwas war hier nicht richtig. Plötzlich brach ihm der Schweiß aus und um seinen Verstand wurde es neblig. Er sah auf das Bett, das mit einer Plastikplane bedeckt zu sein schien. Ja, er sah nach unten und … starrte wieder.
Das waren keine Scherzartikel aus Gummi. Sie waren echt. Echte abgetrennte Gliedmaßen! Und er wusste jetzt, dass die Dinger, die er im Schrank hatte hängen sehen – zwei abgetrennte, mit Draht zusammengebundene Hände – genauso echt waren. Ein Arm auf dem Bett sah aus, als sei der Bizeps herausfiletiert worden. Ein Blick in höhere Regionen des Schranks zeigte ihm noch mehr dunkel verfärbte Sachen auf dem obersten Regal, aber an dieser Stelle hätte man Gollimar eine Kanone an den Kopf halten können und er wäre trotzdem nicht zu einer eingehenderen Untersuchung vorgetreten. Stattdessen zeigte ihm ein anderer Blick in die gegenüberliegende Ecke des Schlafzimmers ein gewerbliches 250-Liter-Fass mit Deckel.
Fässer war alles, was Gollimar gedanklich dazu einfiel.
»Heilige Scheiße, Mann!«, brüllte Chase wieder. »Hier ist noch mehr so Zeug! In der ganzen Bude!«
Dies war keine Wohnung. Wir sind in der Hölle, dachte Gollimar. Er wusste nicht, wie er reagieren sollte. Ein psychischer Würgereflex schien in ihm zu beben, während ihn der geringfügige noch übrige Rest seines professionellen Instinkts aus dem Zimmer gehen ließ.
»Halt bloß deine gottverdammten Scheißhände oben, du beschissener Hurensohn, oder ich puste dich, so wahr mir Gott helfe, sauber ins nächste Jahr!«, brüllte Chase im anderen Zimmer.
Nach nur wenigen Sekunden komplett geschockt, stolperte Gollimar im Gestank zurück. Bleib cool, bleib ganz cool. Fall nicht auseinander. »Ich muss Verstärkung anfordern. Das hier ist massives 64er-Material.«
»Erzähl mir mehr …«, antwortete Chase sarkastisch. »In der Kiste da ist ein verdammter Kopf! Gleich neben dem Kühlschrank!«
Tatsächlich waren noch ein paar Köpfe mehr im Kühlschrank, der mit seinen gut eineinhalb Metern Größe zu den kleineren Modellen gehörte. Gollimar würde diese Köpfe jedoch nie sehen. Seine Psyche gestattete es ihm nicht, die Tür zu öffnen, und sie ließ auch nicht zu, dass er den Kopf in der Kiste direkt ansah oder auch nur in Erwägung zog, die Kühltruhe auf der anderen Seite der Küche zu öffnen.
»Ich leg dich um, wenn du noch einmal auch nur mit der Wimper zuckst, du Hurensohn!«, brüllte Chase den Verdächtigen an.
Konnte ein menschlicher Geist empfindungslos werden? Gollimar trieb mehr durch die winzige verwahrloste Küche, als dass er ging. Er wollte gerade den Telefonhörer abnehmen und in der Zentrale vom Sechsten Bezirk anrufen, als sein Blick auf den Herd fiel …
Etwas schien dort zu rumoren, ein schwarzer, emaillierter Topf. Ein Hummerkochtopf, ging ihm auf. Er und seine Frau hatten auch einen. An jedem Labor Day veranstalteten sie eine große Party für ihre Freunde und kochten darin Hummer.
Doch dies war keine Party.
Dampf stieg durch den Spalt zwischen Topf und Deckelrand auf. Gollimar hätte nie gedacht, dass ebendieser Hummerkochtopf vier Jahre später für 2500 Dollar versteigert werden sollte. Kaufen würde ihn schließlich ein Anwalt für Luftverkehrsrecht aus Philadelphia. Den Zuschlag für den Kühlschrank würde hingegen ein Privatinvestor aus Reston, Virginia, für 15.400 Dollar bekommen. Tatsächlich sollten später viele Dinge aus ebenjener Wohnung für außerordentliche Summen veräußert werden, und zwar einzig und allein wegen der Dinge, die sich in diesem Moment darin abspielten.
Gollimar starrte auf den Hummerkochtopf. Dann hob er den Deckel mit einem Topflappen hoch, auf dem die gehäkelte Karikatur einer angeblich Glück bringenden dreifarbigen Katze prangte. Warum er das tat, würde er sich niemals erklären können – es aber ewig bereuen. Er sah in den Topf.
Mein Gott! Doch es war der blasseste und unweiseste Gedanke, der ihm in seinem ganzen Leben je gekommen war.
»Geht’s dir gut?«
Gollimar, der mittlerweile auf einem Knie kauerte, nickte mit der Stirn in der Hand. Dann stand der große weiße Lieferwagen mit sich drehendem Blaulicht auf dem Parkplatz. »MILWAUKEE COUNTY GERICHTSMEDIZIN« stand auf der Seite des Fahrzeugs. Die Spurensicherung war mittlerweile ebenfalls eingetroffen, dazu mindestens ein Dutzend Cops aus dem Sechsten Bezirk. Nach einem Blick auf den Inhalt des Hummerkochtopfs hatte Chase seinen Doppel-Whopper mit Käse beinahe nicht bei sich behalten können. Gollimar hingegen hatte sich nicht so sehr unter Kontrolle gehabt.
Zwei Sanitäter marschierten mit einer Bahre voller gefüllter Plastikbeutel durch die geöffnete Wohnungstür nach draußen. Ein Fotograf vom Erkennungsdienst folgte ihnen schwankend und mit kreidebleichem Gesicht. Noch mehr Techniker der Spurensicherung betraten das Gebäude – in Schutzanzügen und mit Scott-Atemgeräten.
Gollimars Stimme klang ausgedörrt, nur halb lebendig. Er rieb sich das Gesicht und schauderte. »Was für eine Welt ist das?«, fragte er mehr an sich als an seinen Partner gerichtet.
»Eine total kaputte …«, antwortete Chase ebenso teilnahmslos. Jedes Mal, wenn er sich eine Zigarette anzündete, spuckte er sie kurz darauf wieder aus. Alles schien so zu schmecken, wie es in der Wohnung roch. Er würde für den Rest seines Lebens von diesem Geruch träumen und Gollimar würde in eineinhalb Jahren die Kündigung einreichen, ebenfalls von Albträumen heimgesucht. Erfahrene Streifenpolizisten rechneten immer mit dem Schlimmsten. Aber das hier?
Das war schlimmer als das Schlimmste jemals sein konnte.
»Eine böse Welt«, vervollständigte Chase seine Antwort. Ein Blick nach rechts zeigte ihm seinen Streifenwagen, Zwo-Null-Sieben. Auf der Rückbank saß der Verdächtige in Handschellen, die an einer Hüftkette befestigt waren. Wie von ihm herbeordert, näherte sich Chase dem Wagen, indem er sich durch die Phalanx der ihn umringenden Uniformierten drängte.
Die Sonne stand hoch am perfekten Himmel und der Tag strahlte förmlich. Vögel zwitscherten und flatterten in eleganten Kreisen umher. Es war ein wunderschöner Tag. Wie konnte also etwas wie das hier passieren? Wie konnte es nur?
Chase beugte sich zu dem halb geöffneten hinteren Seitenfenster. »Hey«, sagte er.
Der Verdächtige blickte auf. Das blasse Gesicht blieb so ungerührt wie der Juli-Himmel.
»Wie konnten Sie so etwas tun?«, fragte Chase mit einer Stimme, die wie zerbröselndes Gestein klang.
Der Verdächtige erwiderte Chases Blick. Die Augen in seinem Kopf sahen tot aus.
»Und doch hattest du dir in deinem Herzen vorgenommen: Ich will zum Himmel emporsteigen«, sagte Jeffrey Dahmer. »Ja, zum Totenreich fährst du hinab …«
Grundgütiger Gott, Allmächtiger, dachte Chase.
»… in die tiefste Grube.«
1
STRAFVOLLZUGSANSTALT COLUMBUS COUNTY,
PORTAGE, WISCONSIN
28. NOVEMBER 1994, 7:50 UHR
»Na los, J. D., bequem dich da raus, ja? Du auch, Rosser!« Detention Officer Wells wünschte sich eine Zigarette und eine Tasse Kaffee. Er musste Perkins finden, um sich von ihm die Ergebnisse von gestern zu holen, die er wegen eines lächerlichen Streits mit seiner Frau verpasst hatte. Er scheuchte Dahmer, Vander und Rosser in den Freizeitbereich von Block C. Der zusammengewürfelte Haufen der drei Insassen schlurfte mit Eimern und Wischmopps voran, alle in dunkelgrünen Gefängnis-Overalls. Vander war ein weißer Rechtsextremer, hatte Wells gehört, und Mitglied in irgendeinem KKK-ähnlichen Verein voller dämlicher Nazi-Hohlköpfe. Er hatte seine Frau umgebracht und behauptet, zwei Schwarze hätten es getan. Rosser, ein Schwarzer, war 1,90 groß, eine muskelbepackte Hiobsbotschaft und spielte den Anstaltspsychologen zufolge ein Psychospiel. Ein Furcht einflößender Anblick – Mord und Wahnsinn auf zwei Beinen. Die Seiten seines Kopfes waren seit der neuen Regel für Häftlinge, die Haare so zu tragen, wie sie es wollten, rasiert. »Eine Verletzung des menschlichen Grundrechts auf Selbstentfaltung«, hatte irgendein Anwalt der ACLU, der Amerikanischen Bürgerrechtsunion, beharrlich vorgebracht. Prima. Sollten sie sich den Kopf rasieren und lackieren, Wells war das egal. Rosser hatte sich die Seiten rasiert, sodass oben ein fettes Büschel Haare übrig blieb. Vor ein paar Monaten hatte ein neuer DO den Fehler gemacht, einen persönlichen Kommentar dazu abzuliefern. »Werd diesen schwarzen Klecks Popcorn-Scheiße auf deiner Rübe los, du Arschloch«, hatte er zu Rosser gesagt. Der DO war noch am gleichen Tag wegen rassischer Diffamierung gefeuert worden, obwohl der DO selbst schwarz war. Aber auch das war prima, soweit es Wells betraf. Im Knast nahm er weder die Rasse noch den Verurteilten mit seiner menschlichen Vorgeschichte wahr. Sie sitzen alle in einem Boot, also hätten ihnen DOs, die ihnen bloß wegen ihrer Hautfarbe aufs Dach steigen, gerade noch gefehlt. Rosser hatte 1990 einem Kerl bei einem Raubüberfall viermal in den Kopf geschossen und würde frühestens 2042 begnadigt werden. Seine Psychose hatte mit Gott zu tun, was nicht ungewöhnlich war.
Und dann war da noch Dahmer – »J. D.«, wie er von fast allen im Block genannt wurde. Er konnte frühestens 2927 begnadigt werden. Du lieber Gott, dachte Wells im Scherz bei sich. Ich frage mich, ob er es wohl schafft … Dahmer war eine Art stiller, trauriger Sack, was jeden DO in diesem Rock Ramada mit seinen 676 Gästen überraschte. Wenn ein Kerl 17 Leute erwürgt und zerstückelt und auch noch ein paar von ihnen isst, erwartet man ein gewisses Aussehen, eine gewisse Aura. Doch Dahmer hatte nichts von alldem. Er sah aus wie ein Pudding, nachdem er seit seiner Ankunft im Februar 1992 30 Pfund zugelegt hatte. Die meiste Zeit saß er in Zelle 648, rauchte Zigaretten und hörte sich religiöse Musik an. Das Komische war, er hatte um Standardunterbringung gebeten, was Wells ziemlich dämlich fand. Jeder schwarze Insasse in diesem Laden wollte Dahmer ans Leder, und trotzdem hatte der Kerl seinen Anwalt dazu gebracht, sich beim Direktor für eine gewöhnliche Zelle einzusetzen. Im letzten Juli hatte irgendein Penner versucht, Dahmer während einer Messe die Kehle durchzuschneiden, es aber vermasselt, weil ihm die Klinge aus dem improvisierten Messer gefallen war. Trotzdem. Dahmer wusste, dass Leute hinter ihm her waren, und dennoch bestand er darauf, mitten unter der allgemeinen Knastbevölkerung zu leben. »Ich will die Welt sehen«, hatte er zu Wells gesagt. Das hier ist keine Welt, du Blödhammel, hatte Wells gedacht. Es ist ein Scheiß-County-Gefängnis voller Mörder, und die Hälfte davon will dich ermorden. Das war dem Kerl aber egal. Fast schien es, als bettelte er darum. Also gab ihm der Direktor TE – therapeutische Einzelhaft – und ließ ihn für 70 Cent die Stunde im Reinemach-Trupp arbeiten. Da malochte Dahmer vier Stunden pro Tag, und jeden Morgen ging er zur Messe in die Kapelle.
»Dahmer! Ey, Dahmer«, stichelte Rosser. »Wie schmeckt Menschenfleisch denn so?«
»Halt die Klappe, Rosser!«, befahl Wells. Dahmer blieb stumm und schlurfte weiter neben Vander her. Vanders kahler Kopf glänzte im Licht der vergitterten Lampen. »Achte nicht auf den, J. D.«, sagte Vander von der Seite. »Das is’n Arschloch.«
»Dahmer! Ey, Dahmer …«
»Gottverdammt, Rosser, ich sagte: Halt die Klappe!«, wiederholte Wells. »Wenn nicht, sperr ich deinen fetten, gemeinen Arsch gleich wieder in Einzelhaft, wo du dreiundzwanzigeinhalb Stunden am Tag die Mauersteine zählen kannst.«
»Es gibt keine Zelle auf der Welt, die Gottes Sohn festhalten kann«, flüsterte Rosser. »Sie sind die Zahl des Tiers und Ihre Zahl ist 666.«
»Hör mit dieser Psychosenscheiße auf. Du machst dich damit nur zum Arschloch.«
»Sie nennen Gottes Sohn ein Arschloch?«
Wells musste unwillkürlich lachen. Er folgte ihnen nach oben in die Fitnessräume und wies ihnen dann ihre Aufgaben zu. »Vander, J. D., ihr zwei übernehmt den Gewichteraum und die Nische mit den Laufbändern, und Rosser, du wischst die Latrine. Alles klar, Leute?«
Dahmer und Vander nickten. Und Rosser? – Auf keinen Fall. Er musste immer wegen irgendwas die Klappe aufreißen. »Ach, Mann«, beklagte er sich. »Sie lassen Gottes Sohn die Latrine wischen, Mann?«
»Ganz recht.«
»Aber … aber ich bin der Millionen Jahre alte Sohn Gottes!«
»Super«, sagte Wells. »Und du machst die Latrine so sauber, dass Gott persönlich seine Freude daran hätte, sein Ei in unsere Schüsseln zu legen. Also, sag das deinem Dad. Ich bin draußen, aber ich behalte euch alle im Auge. Erledigt eure Arbeit und trödelt nicht rum.«
Die drei Insassen verteilten sich mit ihren Eimern und Wischmopps. Wells ging nach draußen in den Hauptkorridor und drückte eine Zigarette aus.
Von Perk keine Spur. Mein Gott, wie hoch die Redskins gestern wohl verloren haben? Wells hatte einen Fünfer auf einen knappen Spielausgang gewettet, aber Shuler hatte top in Form ausgesehen.
Am frühen Morgen wirkte der Hauptkorridor immer seltsam still, wie ein Zombiedorf aus dahinschlurfenden Männern, die alle die gleiche schlammgrüne Gefängniskleidung trugen und die gleiche ausgelaugte Miene aufgesetzt hatten. Gruppen von jeweils vier bis sechs Männern wurden zum oder aus dem Speisesaal geführt. Wells fand es komisch: An diesem Morgen hatte Dahmer nur ein hart gekochtes Ei – er aß nur das Eiweiß und ließ das feste Eigelb übrig – und ein paar Cornflakes ohne Milch gegessen. Er hatte gesagt, er sei auf Diät … ausgerechnet. Für wen musst du denn gut aussehen?, dachte Wells. Für die Wände?
Wells rauchte trübsinnig eine halbe Zigarette, dann drückte er den Rest im roten Aschenbecher aus. Perkins musste wohl Fahrdienst haben und Insassen zu Gerichtsterminen in die Innenstadt von Portage und zurück bringen.
Ungefähr zehn Minuten später, um genau 8:10 Uhr, wollte sich DO Wells wieder auf seinen Beaufsichtigungsposten begeben, kam aber nicht einmal bis zur Ecke, bevor der Sicherheitsalarm losging und wie eine Luftschutzsirene durch das Gefängnis jaulte – so laut, dass sogar die massiven Blockwände bei jedem Aufheulen zu pulsieren schienen. Das Gefängnis hatte einen Herzanfall.
Das Albtraumgesicht schwebte so dicht vor ihr, dass sie es riechen konnte. Doch es roch nicht real, es roch nicht menschlich. Wie Lehm roch es, wie feuchte Erde von einem Bachufer. Das Gesicht sah in dem Traum grau aus, als seien seine Züge krude in einen Klumpen tatsächlichen Lehms gedrückt worden. Ein Schlitz für den Mund, ein Schlitz für die Nase. Zwei Schlitze für die Augen. Doch wessen Gesicht war es?
Helft mir, helft mir!, kreischte sie im Tumult ihres REM-Schlafs. Holt es weg von mir!
Es war das undeutliche Gesicht der Angst eines Cops, das Gesicht des symbolischen Todes, der hinter jeder Ecke lauerte.
»Helen? Helen?«
Das Rütteln fühlte sich erdbebenartig an. Die Wände ihres Traums machten Geräusche wie bei einem echobildenden Abriss. Die Hand aus einer anderen Welt fuhr fort, sie zu rütteln.
»Helen?«
Ihre Augen öffneten sich. Jetzt schwebte ein anderes Gesicht über ihr – ebenso obskur, ebenso blass und ebenso unmenschlich seiner Züge beraubt. Ihr Bewusstsein schien mit dem ungebetenen Öffnen ihrer Augen zu gleiten. Dann wurde die reale Welt klarer, ebenso wie die Gesichtszüge vor ihr. Natürlich war es Tom.
Sofort fing sie sich und rieb das silberne Medaillon zwischen ihren Fingern. Es war ein wuchtiges Medaillon, so groß wie ein 200-Jahr-Feier-Dollar, und dick. Innen war das Bild ihres Vaters. An einer Vielzahl von Ketten hing es seit annähernd drei Jahrzehnten um Helen Closs’ Hals, ein Geschenk ihres Vaters zu ihrem 13. Geburtstag. »Jetzt bist du ein Teenager!«, hatte er sie beglückwünscht. Am nächsten Tag war er in seinem Maklerbüro an einem massiven Herzinfarkt gestorben.
»Schatz, ist alles in Ordnung mit dir?«, fragte Tom.
Warum sollte nicht alles in Ordnung mit mir sein?, beeilte sich ihr erster Gedanke. Wenn nicht alles in Ordnung ist, dann nur deshalb, weil du mich geweckt hast.
»Du schläfst seit acht Uhr heute Morgen.«
»Ich weiß«, kam ihre raue Antwort. »Ich hatte gestern die Nachtschicht.«
»Tja, ich auch, aber …«
Ihre Schultern ruckten wie zur Bestätigung, dass sie nicht länger schlief. »Aber was?«
»Tja, ich hatte auch Nachtschicht, aber, Herrgott, Schatz, es ist jetzt schon nach sieben. Ich bin schon vor Stunden aufgestanden.«
Und was sollte das wieder heißen? Ihre Grundhaltung nahm wie immer eine rasiermesserartige Schärfe an, so schnell, wie Strom durch einen Kupferdraht fährt. Was will er damit sagen? »Was!?«, forderte sie ihn heraus. »Ich schlafe bis sieben und das bedeutet, ich bin nur eine faule, abgehalfterte Kuh?«
Toms Miene verlor ihren Ausdruck der Besorgnis und fiel sofort wieder in etwas schrecklich Müdes zurück. Aber natürlich hatte sie auch das schon viele Male zuvor gesehen. »Ach komm, Helen, hör auf damit, ja? Ich sage nicht, dass du faul bist, ich bin nur etwas besorgt. Du schläfst sonst nie so lange. Ich dachte, du könntest vielleicht krank sein.«
Helens Blick richtete sich aufwärts.
»Du machst es einem echt schwer«, sagte er. Dann ging er aus dem Schlafzimmer.
Sie blieb liegen und lächelte gekünstelt. Dann sickerten weitere Tatsachen der Realität in ihren Geist. Ich habe elf Stunden geschlafen. Herr im Himmel, werd endlich erwachsen, Helen! Und sie hatte es schon wieder verbockt, nicht? Es kam ihr wie ein Wunder vor, dass Tom sie in Anbetracht ihrer Zickigkeit nicht schon vor Monaten aus seinem Leben verbannt hatte. Ich habe ihn schon wieder angepflaumt, ging ihr auf, und wofür das alles? Weil er um dich besorgt war. Wie viele Partner in der Vergangenheit hatten mit dem genauen Gegenteil aufgewartet? Eine Grobheit nach der anderen, und nach soundso vielen Grobheiten schossen sie einen dann ab. Und warum auch nicht? Wer will schon so eine gehässige Zicke wie mich?
Jetzt war ihr auch der ganze Rest wieder gewärtig. Sie hatte ihre Schicht um sieben Uhr früh beendet und war zu Toms Wohnung gefahren, um mit ihm zu schlafen. Zeitversetzte Schichten machten die Sache nicht leichter, denn im Büro der Gerichtsmedizin wurde ebenfalls in Wechselschicht gearbeitet. Tom war der stellvertretende Leiter der Pathologie und hatte alle drei Wochen eine Woche Nachtschicht. Sie »trafen« sich seit eineinhalb Jahren, was »sich treffen« auch immer bedeuten mochte.
Es ist immer dasselbe. Was stimmte bloß nicht mit ihr? Prämenopausale Unruhe? Oder vielleicht bin ich ja auch von Natur aus eine Zicke, erwog sie. Ihre Hormone und Stimmungsschwankungen waren nicht Toms Schuld. »Die Wechseljahre können als physischer Tod der Weiblichkeit einer Frau interpretiert werden«, hatte Dr. Sallee, der Seelenklempner der State Police, zu ihr gesagt. »Aber für Sie ist wichtig, sich klarzumachen, dass dies eine Fehlinterpretation ist, die der Angst entspringt. Frauen fürchten sich nur wegen der grundlegenden Glaubenssätze der Furcht selbst davor.« Sallees Gesicht hatte für sie oft eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Gesicht in ihrem ständig wiederkehrenden Albtraum. »Ja, Sie kommen bald in die Wechseljahre, aber die Wechseljahre kündigen nicht den Tod Ihrer Weiblichkeit an. Angekündigt wird lediglich ein neues Stadium Ihrer Weiblichkeit, ein neues Stadium des Lebens. Das ist ganz und gar nichts Negatives, sondern etwas Positives.«
Zumindest konnte er gut mit Worten umgehen. Doch es fiel ihr schwer, Tom als etwas anderes zu betrachten als ihre letzte Hoffnung. Sie war 42 – wie viel Zeit konnte da noch übrig sein? Ihr erster Mann hatte sich als ein solches Arschloch erwiesen, dass es sie immer noch überraschte, ihn nicht umgebracht zu haben. Und die Beziehungen, die darauf gefolgt waren? – Ein Murks nach dem anderen. Sie wusste, falls sie die Hoffnung hatte, je wieder verheiratet zu sein, war Tom derjenige, der es sein sollte. Aber wenn sie ihre »pseudonatale Feindseligkeit«, wie Dr. Sallee es nannte, nicht in den Griff bekam, würde sie es auch mit Tom verbocken. Und das würde dann der letzte Tropfen sein.
Sie quälte sich aus Toms Bett und eilte ins Badezimmer, um zu gurgeln und sich die zerzausten, schmutzig-blonden Haare zu richten. Dann eilte sie ebenso hastig ins Wohnzimmer. Tom saß vor seinem neuen Compaq-Computer und spielte darauf eines seiner Spiele. Er war so darin vertieft, dass er ihr Eintreten gar nicht bemerkte.
Wer kann es ihm verdenken?, fragte sich Helen. Ich würde ein Miststück wie mich auch nicht beachten …
Der X-Wing-Raumjäger auf dem Bildschirm stürzte kurz vor der vollständigen Zerstörung der Energieversorgung des Dämonenplaneten ab, als Helen Tom von hinten überfiel und die Arme um ihn legte. Beängstigende Explosionen klangen aus den winzigen Lautsprechern. »Tja, damit hast du soeben Captain Quark getötet«, sagte er.
»Du kannst ihn im nächsten Spiel wieder zum Leben erwecken«, erinnerte sie ihn. »Außerdem sieht er sowieso nicht so gut aus wie du.«
Tom kicherte vage.
Sie beugte sich vor und flüsterte ihm ins Ohr. »Es tut mir leid, dass ich immer so ein Biest bin. Ich wollte dich nicht anschnauzen.«
»Du hast mich nicht angeschnauzt«, sagte er in einem Tonfall, der tatsächlich meinte: Ja, das hast du, aber mittlerweile bin ich daran gewöhnt, also verzeihe ich dir. »Ich war nur besorgt. Ich dachte, du wärst vielleicht krank. Ist alles in Ordnung mit dir?«
»Abgesehen von dem Anfall akuter Zickigkeit ist alles bestens.« Sie küsste ihn auf den Kopf. »Wie wär’s, wenn ich uns zu Chinesisch einlade? Du kannst Captain Quark von den Toten auferwecken, und ich gehe das Essen holen.«
»Wow, eine Frau, die das Essen bezahlt und es auch noch holt? Also, das nenne ich mal eine Frau!«
»Vergiss nicht, dass sie auch noch gut im Bett ist.«
»Ja, na klar, aber das versteht sich von selbst«, gab er zu, während er am Joystick herumwackelte. »Ich könnte mich auf Kung Pao und diese kleinen Krabbendinger einlassen.«
»Ich glaube, die Krabbendinger heißen Shrimp Toast«, korrigierte sie ihn.
»Ja, genau, aber … Wann fängt deine Schicht an?«
Sie schmiegte die Brüste an den oberen Teil seines Rückens. Der Druck schien einen Sturm an Empfindungen durch ihre Lenden zu jagen. Heute Nacht gibt’s kein Halten, gelobte sie. Ich mach’s wieder gut. »Heute Nacht habe ich frei«, sagte sie verheißungsvoll.
»Ach, echt?« Er drehte sich zu ihr um. »Das ist ja super …«
Dann wurde er von ihrem Pieper unterbrochen. Ach, stimmt ja … Ich habe Bereitschaft, fiel ihr wieder ein. Wenn man es zum Captain im Dezernat für Gewaltverbrechen bringt, hat man für den Rest seines Lebens Bereitschaft …
»Willst du nicht rangehen?«, fragte er.
»Eigentlich nicht. Gottverdammt, wie ich diese Scheiße hasse!«
Wie gewöhnlich schrak Tom bei ihrer Flucherei leicht zusammen. »Du rufst besser zurück.«
»Ich weiß.«
Sie ging in die Küche, nahm zögerlich den Telefonhörer ab und wählte die Nummer der Zentrale, dann wartete sie, hörte zu.
»Gottverdammt noch mal, ich hasse diesen Scheiß!«, bekräftigte sie.
»Was ist denn los?«
»Sie haben mir gerade einen 64 in Farland aufs Auge gedrückt.«
»In der Provinz. Ist es schlimm?«
»Wenn es nicht schlimm wäre, würden sie mich nicht aus dem Dane County in ihren Zuständigkeitsbereich rufen. Scheiße!«
»Und … was ist ein 64?«
»Es ist …«, begann sie, aber beließ es dabei. Er brauchte es nicht zu wissen, und sie wollte nicht wiederholen, was ihr die Zentrale gerade mitgeteilt hatte: Das Opfer war ein kleines Kind. »Es ist einfach nur … schlimm, wie üblich.«
Aber das waren Helens Jobs: die besonders schlimmen, solche, die zu extrem oder zu entsetzlich für die lokalen Behörden waren, um allein damit klarzukommen.
Sie nahm eiligst eine zweiminütige Dusche, streifte sich ihr Kleid über und schlüpfte in den Burberry-Mantel, den Tom ihr letztes Jahr zu Weihnachten geschenkt hatte. Dann eilte sie auch schon in Richtung Tür, die Haare noch immer nass.
»Krieg ich keinen Kuss?«, fragte Tom. Er stand schon an der Tür bereit, wie sie überrascht feststellte. Dann küsste er sie bei einer festen, warmen Umarmung auf den Mund.
»Es tut mir leid«, flüsterte sie noch einmal.
»Ach, das Kung Pao kann warten und dieses Krabbenzeug auch.«
»Nein, ich meine das vorher.« Und unvermittelt spukten seine Worte wieder durch ihren Kopf. Du machst es einem echt schwer. Sie wusste nur zu gut, dass das stimmte. Ihr gesamtes Erwachsenenleben war der Beweis dafür.
Tom war so süß und wahnsinnig gut aussehend – kurze dunkle Haare, tiefe, durchdringende Augen voller Mitgefühl und Intellekt. Außerdem hatte er einen ausgeprägten Sinn für Humor, anders als ihr Ex-Mann, der ungefähr so fröhlich und optimistisch gewesen war wie Jean-Paul Sartre. Mit seinen Scherzen konnte Tom die schlimmste Stress-Migräne und den dunkelsten Feierabend-Blues verjagen.
Ihre Augen öffneten sich, blickten in sein sanft lächelndes Gesicht und Helen schmolz förmlich dahin. Ich verdiene ihn gar nicht, dachte sie, doch dann konnte sie Dr. Sallee hören, wie er ihr deswegen auf dem ganzen Weg vom HQ die Hölle heißmachte.
»Du reibst das Ding noch so lange, bis es nicht mehr da ist«, warnte Tom.
Was? Doch dann wurde es ihr bewusst: Sie rieb wieder einmal mit viel Druck ihr Medaillon. Im Laufe der Jahre hatte sie tatsächlich schon eine ganze Menge der Details von der Oberfläche abgerieben.
»Du reibst immer an diesem Medaillon, wenn du aufgebracht bist.«
»Ich bin nicht aufgebracht!«, konterte sie.
»Na ja, ob du nun gestresst bist, besorgt oder was auch immer … Warum bist du es?«
Sie antwortete nicht direkt, weil sie nicht konnte, aber sie nahm an, dass er recht hatte. Das Medaillon war so etwas wie ihre persönliche Linus-Decke, ihre Hasenpfote. »Es ist ein Glücksbringer, und heute Nacht werde ich ihn wahrscheinlich brauchen.«
»Willst du mir immer noch nichts über diesen 64 in Farland erzählen?«
»Nein«, bestätigte sie. Die Worte aus dem Telefon waren noch immer in ihrem Kopf, wie Treibgut auf der Oberfläche eines dunklen Meeres. Ein Baby. Jemand hat ein Baby getötet … Aber in dieser verrückten Zeit töteten Leute doch jeden Tag Babys. Es ist mein Job, Morde zu untersuchen, schalt sie sich und ließ das Medaillon los. Also tu das auch und hör auf, so ein unsicheres Weichei zu sein!
»Na los, raus mit dir«, sagte Tom. »Du kannst den öffentlichen Dienst doch nicht warten lassen. Hast du deine Kanone?«
»Ja«, stöhnte sie. Helen hasste Kanonen, hatte aber kaum eine andere Wahl, als eine zu tragen. Eine winzige Beretta Jetfire .25 ACP. Helen war so schlecht auf dem Schießstand, dass sie jedes Jahr eine Ausnahmegenehmigung benötigte, um die Waffe weiterhin mit sich führen zu dürfen.
»Gut. Und sei vorsichtig, ja?«
»Bin ich.« Für sie war wie immer offensichtlich, dass es hier einen Mann gab, der aufrichtig um sie besorgt war, jemanden, der sie aufrichtig liebte. Verbock’s nicht wieder, Helen, warnte sie sich.
Sie küsste Tom noch einmal und ging.
Dane County hatte kein eigenes Police Department – wie viele Countys in Wisconsin war es diesbezüglich Neuland. Stattdessen gab es ein kleines Sheriffbüro. Helens Zuständigkeitsbereich, das Grid South Central, reichte von Beloit bis zum Petenwell-Stausee. Wenigstens würde die Fahrt dorthin in ihrem Zivilstreifenwagen nicht allzu schlimm werden. Es hatte Zeiten gegeben, in denen sie mit dem weißen Ford Taurus 150 Kilometer und mehr aus Madison hinausfahren musste, nur um ein vorläufiges WSP-Formular 18-82 – einleitender Untersuchungsbericht für einen möglicherweise kritischen Mordfall – auszufüllen und dann eine Empfehlung auszusprechen, ob der 64 das Eingreifen des Dezernats für Gewaltverbrechen der Wisconsin State Police rechtfertigte. Das DGV wurde von sechs regionalen Captains geleitet, zu denen auch Helen Closs gehörte. Sie hatte vor 18 Jahren bei der State Police im Verkehrsdezernat angefangen und sich dann hochgearbeitet. Vor drei Jahren, als sie gerade im Dienst des Dezernats für Informationsbeschaffung war, hatte sie eine landesweite verdeckte Ermittlung geleitet, in deren Verlauf sie eine weitverzweigte Kokain-Triade hochgehen ließen, deren Soldaten die Hälfte ihrer Informanten und vier verdeckte Ermittler der Polizei ermordet hatten. Resultat: Beförderung zum Captain und Belobigungen vom Gouverneur und vom Leiter der DEA sowie eine Versetzung zum begehrten DGV. Die Einheit dort ließ sie alleine arbeiten, ihre eigenen Entscheidungen treffen und stellte ihr die Spurensicherung und deren technische Labors zur unmittelbaren Verfügung. Von den bisher 17 in ihre Zuständigkeit gefallenen kritischen Morden hatte Helen 16 aufgeklärt – die höchste Aufklärungsrate in der Geschichte des Dezernats. In einem Jahr würde sie für den Posten des Deputy Chiefs, des stellvertretenden Polizeichefs, zur Debatte stehen.
Mit anderen Worten: Sie legte eine großartige Karriere hin. Doch großartig wäre das letzte Wort gewesen, mit dem sie beschrieben hätte, wie sie sich fühlte. Ich bin 42und meiner Blutuntersuchung zufolge schon in den Wechseljahren, dachte sie trocken. Hinter ihr lagen eine lausige Ehe und ein halbes Dutzend ebensolcher Beziehungen. War es das Alter oder einfach nur die Welt? Diese Welt war wie ein Vampir, der ihr mit jedem verstreichenden Jahr etwas mehr Lebenskraft aussaugte – eine Welt der Mörder und Kinderschänder, des pränatalen Kokain-Syndroms, der Gruppenvergewaltigung und des Scheiterns. Sie hatte schon seit 20 Jahren nicht mehr wirklich die Sonne scheinen sehen. Stattdessen umgaben sie die Dunkelheit und Schwärze des menschlichen Geistes.
Das gesammelte Licht einer Vielzahl tragbarer Scheinwerfer explodierte förmlich vor ihr, als Helen am Tatort eintraf. Die herumwuselnden Techniker von der Spurensicherung sahen aus wie scharlachrote Phantome. Sie trugen rote Ganzkörperanzüge aus Polyester, sodass zufällig verlorene Fasern und Haare von den zuständigen Kriminaltechnikern im Labor nicht irrtümlich als Tatortrückstände eingestuft werden konnten.
Die kalte Luft würgte Helen regelrecht, als sie der Wärmekapsel ihres Wagens entstieg. Ihr Atem verwandelte sich in kleine trübe Wölkchen. Eine lange Landstraße, etwas erhöht und makellos gerade, schien sich in die Unendlichkeit zu erstrecken. Ein paar alte Ford Tempos vom Sheriffbüro in Dane County waren auf einem großen Feld abgestellt, dessen Getreide bereits vor einigen Monaten geerntet worden war, und beleuchteten mit ihren Scheinwerfern die Absperrung. Auch drei Fahrzeuge der State Police standen da. Bei Fällen, die potenzielle Kandidaten für das DGV waren, setzte die Zentrale grundsätzlich diejenigen Einheiten der State Police darauf an, die dem Tatort am nächsten waren, um der örtlichen Polizei bei der Sicherung zu helfen. Gleich danach waren die Leute von der Spurensicherung in einem blauen Van losgeschickt worden, der als mobiles forensisches Labor diente, außerdem standen ein paar Kombis der gleichen Farbe daneben. Die Uniformierten, sowohl die des Countys als auch die der State Police, schienen, was die Kälte anging, unempfindlich zu sein – sie lehnten ohne Jacken an ihren Streifenwagen.
»Captain Closs?«, ertönte eine Stimme.
Ein Corporal, ein junger Bursche der Autobahnpolizei, näherte sich Helen und sie zeigte ihm Marke und Ausweis.
»Ist Beck hier?«, fragte sie, während sie den Kragen ihrer Jacke hochstellte.
»Ja, Ma’am.« Er zeigte auf den erleuchteten Abgrund der Böschung neben der Straße. »Da unten. Es ist …«, er zögerte.
»Was denn, Corporal?«
»Es ist ziemlich schlimm, Ma’am.«
Helen ignorierte die Bemerkung und wandte sich den County-Fahrzeugen zu. Ein paar der Männer rauchten. »Sagen Sie diesen Idioten aus Dane, sie sollen die Zigaretten ausmachen und die Stummel einstecken! Herrgott im Himmel, das hier ist ein Tatort!«
»Ja, Ma’am.«
»Und sollte ich hier Cops von der State Police rauchen sehen, nehme ich sie mir zur Brust! Dann wird die böse Hexe des Westens neben mir wie die kleine Waise Annie aussehen. Verstanden?«
Der Corporal nickte, das Gesicht kalkweiß von der Kälte. Oder vielleicht wirklich vom Schock. Schließlich lag nicht weit von hier entfernt ein totes Kleinkind.
Helen blinzelte wieder zu den County-Cops hinüber – ein trübseliger, bunt gemischter Haufen. »Ich meine, wer sind die da drüben? Die Keystone-Cops?«
»Die Jungs vom Sheriff-Büro. Die wissen nicht, wie sie vorgehen sollen, deswegen haben sie das DGV angefordert, als sie den Leichnam gefunden haben.«
Der Leichnam, erinnerte sich Helen schließlich wieder an den Grund, warum sie hier war. Das Baby. »Wer hat hier die Leitung? Sie?«
»Nein, Ma’am.« Der Corporal zeigte phlegmatisch zur Böschung. »Sergeant Farrell, gleich da drüben.«
Helen wandte sich ohne ein weiteres Wort ab. Farrell kauerte neben dem Van der Spurensicherung auf einem Knie, eine Hand vor dem Gesicht.
Sie sah, dass er sich übergeben hatte. »Alles in Ordnung mit Ihnen, Sergeant?«
Farrell blickte auf und blinzelte ein paarmal. »Ich …«
»Hoch mit Ihnen, stehen Sie gerade!«, befahl Helen. Sie konnte sich gar nicht anders verhalten. Wenn sie nicht ständig auf knallhart machte, würden diese Kinder sie niemals ernst nehmen.
»Das ist ein richtig schlimmer 64, Captain.«
»Ich weiß, dass es ein schlimmer 64 ist, Sergeant. Ich weiß, dass es ein Baby ist, aber wir sind alle hier draußen, um unsere Arbeit zu machen. Wir sollen hier den Laden schmeißen, und da kann ich es nicht brauchen, dass meine Leute am Tatort zusammenklappen wie ein Haufen Grünschnäbel frisch von der Polizeischule. Sie sind ein Beamter der Wisconsin State Police, also verhalten Sie sich auch so! Wenn Sie arbeitsunfähig sind, sagen Sie es, dann lasse ich Sie ablösen.«
Farrell, groß und schlank, richtete sich auf. Er schluckte ein paarmal. Seine Verlegenheit war nicht zu übersehen. »Was soll ich tun, Ma’am?«
Wahrscheinlich hat er selbst Kinder, vermutete sie. Sie kannte diesen Gesichtsausdruck. Wahrscheinlich sogar noch ein Baby … »Halten Sie sich einfach nur aufrecht und sichern Sie den Tatort, mehr ist gar nicht nötig.«
Der Mond schien wie ein fahles Gesicht über dem abgemähten Kornfeld. Helen verließ den asphaltierten Untergrund und marschierte etwas unbeholfen die Böschung hinunter. Sie kam sich ein wenig albern vor. Dies war der ländliche Schauplatz eines Mordes, und sie trug Pumps von Nine West, einen 400-Dollar-Burberry-Mantel und ein Mantelkleid von Carole Little. Dass du mir nur nicht stolperst und die Böschung hinunterfällst, warnte sie sich selbst und kam sich noch idiotischer vor. Diese Landeier würden sich eine Woche lang scheckig lachen.
Zwar hatte Helen noch nicht ergründen können, warum es so war, aber sie merkte sofort, dass Jan Beck, die Einsatzleiterin der Spurensicherung, sie nicht leiden konnte. Zum Beispiel weigerte diese sich, Helen beim Vornamen zu nennen, wie es für zwei Frauen derselben Gehaltsklasse absolut normal gewesen wäre. Doch dann wurde ihr klar, dass sie eigentlich abgesehen von Olsher und dem Rest der hohen Tiere im Dezernat niemand leiden konnte. Helen kümmerte das nicht mehr.
»Hi, Jan«, sagte Helen zu der schmächtigen Gestalt im roten Overall. Jan Becks Silhouette schien vom grellen Licht der Lampen regelrecht ausgespien zu werden. Sie trug eine Brille mit dicken Gläsern und hatte wuschelige krause Haare wie eine Hexe.
»Captain Closs.«
»Und? Wie sieht’s aus?«
Hinter Jan wuselten noch immer ihre Phantomkollegen mit ihren tragbaren UV-Lampen herum. »Ein weißes männliches Kleinkind, ungefähr ein Jahr alt. Am ganzen Körper Prellungen und Quetschungen. Sieht nach Aufpralltod aus.«
»Totgeschlagen meinen Sie?«
»Nein, das glaube ich nicht. Für mich sieht es so aus, als wäre das Baby aus einem fahrenden Wagen geworfen worden.«
Helens Blick richtete sich auf die arbeitenden Spurensicherer. »Was machen die dann mit den UV-Lampen?«
»Sie überprüfen die Haut, bevor wir den Leichnam zur Obduktion bringen.«
»Irgendwelche Spuren von Gewalt?«
Beck runzelte die Stirn. »Abgesehen davon, aus einem fahrenden Wagen geworfen worden zu sein?«
»Keine Anzeichen auf Misshandlungen, keine Anzeichen auf sexuellen Missbrauch? Kommen Sie, Jan, Sie wissen genau, was ich meine.«
»Dazu kann ich wirklich erst etwas sagen, wenn ich das Baby in meinem Labor im St. John’s Hospital habe.«
Helen wusste, worauf Beck hinauswollte. Für mich gelten Regeln, und an die muss ich mich halten. »Jan, ich kann diesem 64 unmöglich DGV-Status geben …«
»Ach, hören Sie doch auf, Captain!«, schnauzte Beck. »Hier geht es um ein einjähriges Baby, Herrgott noch mal! Irgendein Bauerntrampel aus dem Dane County hat ein nacktes Baby aus einem fahrenden Wagen geworfen!«
»Das ist mir bewusst«, erwiderte Helen, ohne ihren Tonfall zu verändern. »Aber Sie kennen die Regeln. Ich kann den DGV-Status nur dann genehmigen, wenn es sich um eine aus mehreren Zuständigkeitsbereichen bekannte Vorgehensweise, einen mehrfachen Mord, ein Sexualverbrechen oder um eine Tat in Verbindung mit mutmaßlichem Mord an einem Polizeibeamten handelt.« Helen biss sich auf die Unterlippe. »Wenn ich diesem Fall DGV-Priorität gebe, wirft Olsher den Papierkram noch vor seinem ersten Morgenkaffee zerrissen in den Müll. Wir können uns nicht um jeden Fall kümmern, Jan. Dane County hat ein Sheriff-Büro und Personal. Sie müssen diesen Fall selbst untersuchen. Mir gefällt das genauso wenig wie Ihnen, und sollte ich den Kerl schnappen, der das hier getan hat, würde ich gern den Vorderreifen meines Autos auf seinem Kopf parken – aber Sie kennen die Regeln.«
Beck verkniff sich jegliche negative Gefühlsregung in ihrer Mimik, was sie sehr gut konnte. »Was soll ich also machen? Kann ich den Leichnam des Babys wenigstens in unsere Pathologie transportieren lassen?«
»Nein«, ordnete Helen an. »Packen Sie Ihr Zeug und Ihr Team zusammen. Dane County muss den Leichnam in sein eigenes Krankenhaus bringen und ihn von seinem eigenen Gerichtsmediziner obduzieren lassen, und zwar, wie ich hinzufügen möchte, auf Kosten ihrer eigenen Steuergelder.«
»Großartig. Sie sind der Boss. Werden Sie es den Dane-Leuten sagen oder muss ich das auch noch machen?«
»Das übernehme ich, Jan.« Helens Gesicht rötete sich plötzlich vor Verlegenheit und Selbstekel. Aber sie machte nur ihre Arbeit. Warum konnte Beck das nicht verstehen? Olsher würde dieser Sache direkt am nächsten Morgen einen Riegel vorschieben – sich darüber zu streiten, wäre pure Zeitverschwendung. »Ich kann nichts machen, Jan. Und das wissen Sie auch. Also hören Sie auf, mir die Hölle heißzumachen.«
Beck nickte kaum merklich. »Ach … das alles macht mich nur manchmal so fertig.« Sie warf einen Blick hinter sich auf ihr Team, das mit dem Baby beschäftigt war. »Ich kann nicht glauben, wozu die Leute fähig sind.«
»Ich auch nicht«, erwiderte Helen kleinlaut.
Beck gelang ein schiefes Lächeln. »Na ja, zumindest hatten wir heute auch mal was zu lachen, nicht?«
»Was meinen Sie?«
»Sie wissen schon. Die Dahmer-Geschichte.«
Helen fröstelte in einer eisigen Windbö. »Was denn? Was ist mit Dahmer? Der Hurensohn sitzt für die nächsten tausend Jahre hinter Schloss und Riegel.«
»Haben Sie’s nicht mitbekommen?«, fragte Jan. »Es kam heute Morgen für alle per Telex rein.« Sie schien in der Kälte regelrecht aufzublühen und von ihr belebt zu werden – oder vielleicht wurde sie auch nur durch die Neuigkeit belebt.
»Jeffrey Dahmer«, erklärte sie, »ist heute im Gefängnis ermordet worden.« Noch ein winziger Anflug eines Lächelns. »Er wurde von einem Mithäftling zu Tode geprügelt.«
2
»… wurde von einem Mithäftling zu Tode geprügelt«, quäkte es aus dem Radio. »James Dipetro, der Direktor der mit 676 Insassen besetzten Strafvollzugsanstalt Columbus County, in der der berüchtigte kannibalische Mörder eine Haftstrafe von 936 Jahren verbüßte, sagte zu Reportern, er befürchte, der Verdächtige, ein gewisser Tredell W. Rosser, könnte nun bei anderen Minderheitsinsassen in den Status einer Berühmtheit aufgestiegen sein. ›Wir befürchten‹, sagte Dipetro, ›dass Rosser jetzt so eine Art Gefängnis-Volksheld wird, und zwar nicht nur für die Häftlinge in Columbus County, sondern für jeden afroamerikanischen und lateinamerikanischen Gefängnisinsassen im ganzen Land …‹«
Helen, die mitten im Stoßverkehr des frühen Morgens steckte, wechselte den Sender. Dahmer, Dahmer, Dahmer, stöhnte sie gedanklich genervt auf. Die Nachricht beherrschte jeden Radiosender, den sie einschaltete, selbst das Frühstücksfernsehen hatte nichts Besseres anzubieten. Mein Gott, ist das alles, was die Leute interessiert? Dahmer? Ich bin es so leid, von ihm zu hören!
Doch wenn das wirklich so war, warum fuhr Helen dann gerade ins staatliche Leichenschauhaus, um sich den Leichnam anzusehen?
Der Mann geht die sonnenbeschienene Straße in Madison, Wisconsin, entlang. Strahlendes Licht, aber kalt wie sein Herz. Die kühle Luft schlägt ihm ins Gesicht, und doch ist ihm auf eine dumpfe Art warm. Die Stadt scheint ihn zu umschwärmen, sie ist kein Teil von ihm und er kein Teil von ihr. Aber so ist es immer. Er verdrückt sich, will nicht zu lange auf der Straße sein. Er will nicht gesehen werden.
Einige Zeit später findet er sich auf einer Treppe wieder. Jeder Schritt ist langsam, schwerfällig, bedächtig. Er fühlt sich jetzt anders, als sei ein sonderbarer Schalter in seinem Gehirn umgelegt worden. Nichtsdestoweniger bringt ihn jeder Schritt nach oben weiter zurück …
BATH, OHIO, MAI 1971
Der Junge aus Bath, Ohio.
Was für ein dämlicher Name für eine Stadt, fand er schon immer. Aber im Augenblick dachte er an weitaus wichtigere Dinge.
Die Frühlingshitze briet seinen Rücken. Der Schweiß tränkte sein kurzärmliges kariertes Hemd, während er in der Hoffnung heimwärts rannte – ja, trotz der brennenden Hitze rannte er, um vor seinem Vater nach Hause zu kommen. Jeden Tag nahm er von der Schule nach Hause den langen Weg durch die Hinterhöfe, weil er es nicht ertragen konnte, von den anderen Kindern gehänselt zu werden. Schwuli nannten sie ihn. Schlaffi. Im Turnunterricht hatten die Mannschaftsführer ihre Mitglieder gewählt. Gil Valeda, der wahrscheinlich beste Sportler der fünften Klasse, wenn nicht sogar der ganzen Summerset Grundschule, hatte gelacht, als der Junge die Hand hochriss, weil er zur Abwechslung auch mal einer Siegermannschaft angehören wollte. »Auf keinen Fall«, hatte Valeda gesagt. »Du bist ein Schwächling, ein kleiner Schwuli.« Der Junge war von der anderen Mannschaft gewählt worden, als Letzter. Sie hatten das Softballspiel elf zu null verloren. Natürlich hatten seine Mannschaftskameraden ihm die Schuld dafür gegeben, weil er als Schlagmann dreimal nicht getroffen und dann auch noch einen Ball im rechten Feld fallen gelassen hatte.
Er tat so, als höre er es nicht und mache sich nichts daraus.
Aber er machte sich sehr wohl etwas daraus.
Und eines Tages, das wusste er, würde er es ihnen allen zeigen …
Ich bin frei, denkt er.
Und er ist hungrig.
»… mit einem Besenstiel zu Tode geprügelt«, verkündete ein anderer Radiosprecher mit der tonlosen Stimme einer Bandansage. »Vonseiten der Behörden heißt es, der Mord habe gestern Morgen gegen acht Uhr in den Fitnessräumen der Strafvollzugsanstalt Columbus County stattgefunden, wo Dahmer als Teil einer Putzkolonne tätig gewesen sei. Gefängniswärter hätten einen blutigen Besenstiel in der Nähe gefunden, außerdem sei ein anderer Häftling, angeblich ein Freund Dahmers, ebenfalls geschlagen worden und liege gegenwärtig in kritischem Zustand im St. John’s Hospital in Madison. Augenzeugen berichten, Dahmers Gesicht sei so zerschlagen gewesen, dass …«
Helen wechselte noch einmal den Sender, während sie langsam zum Parkplatz für Staatsangestellte fuhr. Tom hatte ihr eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter hinterlassen. »Hi Helen, ich bin’s. Ich kann heute Morgen doch nicht um sieben Uhr Feierabend machen, sondern habe die Anweisung zu bleiben. Du wirst es nicht glauben, aber Greene ist im Urlaub, also bin ich in seiner Abwesenheit der Chefpathologe. Damit will ich sagen, dass ich derjenige bin, der Dahmers Leichnam obduzieren wird! Also bis heute Abend!«
Selbst Tom schien von dem Virus befallen zu sein. Was war so faszinierend daran? Vielleicht lag es an Helens Job, dass das Thema sie langweilte. Sie begegnete dem Tod jeden Tag, für sie waren Mörder alle ein und dasselbe: aktive Statistiken in einer makabren gesellschaftlichen Tabelle, Zahlen, die andere Zahlen produzierten. Sie konnte nicht anders darüber denken: Opfer konnten von einem Mordermittler ebenso wenig vermenschlicht werden wie Täter – andernfalls würde ein Mordermittler nach einem oder zwei Jahren ausgebrannt sein und jeden Tag an Selbstmord denken. Der 64 der letzten Nacht war dafür ein gutes Beispiel. Würde Helen von dem Toten als dasBaby, das Kind, ein junger Mensch