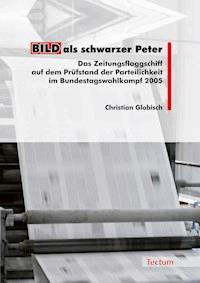
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Tectum
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
"Unabhängig und überparteilich" - so verkauft sich Europas mit rund 3,3 Millionen Exemplaren auflagenstärkste Tageszeitung ihren 11,6 Millionen Lesern. In Werbespots kokettiert BILD sogar gezielt damit, indem sie potenzielle Kritiker zu Wort kommen lässt. Doch ist das Boulevard-Blatt wirklich tendenzfrei, wie der Axel-Springer-Verlag behauptet oder ein Organ der gezielten Meinungsbildung, wie Skeptiker sagen? "Bild dir deine Meinung", fordert das Blatt in der Eigenwerbung - Christian Globisch nimmt BILD beim Wort und prüfte deren Berichterstattung im heftigen Bundestagswahlkampf 2005. Wurde damals zugunsten einer Partei, einer Koalition oder eines Spitzenkandidaten berichtet? In einer quantitativen Inhaltsanalyse, in Beispielen qualitativ unterfüttert, zeigt er eindeutig: BILD ist einer klaren Farbenlehre gefolgt. Das Blatt hat Front gemacht zugunsten von CDU/CSU und FDP, zugunsten Angela Merkels (CDU) und Guido Westerwelles (FDP) und für einen Wechsel der Regierung von "Rot-Grün" zu "Schwarz-Gelb".
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 144
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Christian Globisch
BILD als schwarzer Peter. Das Zeitungsflaggschiff auf dem Prüfstand der Parteilichkeit im Bundestagswahlkampf 2005
© Tectum Verlag Marburg, 2010
ISBN 978-3-8288-5651-6
Bildnachweis Cover: istockphoto.com © anutik
(Dieser Titel ist zugleich als gedrucktes Buch unter der ISBN 978-3-8288-2240-5 im Tectum Verlag erschienen.)
Besuchen Sie uns im Internet unter www.tectum-verlag.de
www.facebook.com/Tectum.Verlag
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Angaben sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar.
INHALT
1 Einleitung
2 Die Rolle der Massenmedien im Wahlkampf
2.1 Massenmedien
2.2 Massenmedien und Wahlen in Deutschland
2.2.1 Der große Stellenwert des Fernsehens im Wahlkampf
2.2.2 Die Printmedien
2.3 Macht der Medien und Macht der Politik
2.3.1 Agenda-Setting
2.3.2 Die Theorie der Schweigespirale
3 Die Analyse der Stellung der Bildzeitung in der Medienlandschaft
3.1 Daten zur Bildzeitung
3.2 Die Relevanz der Bildzeitung
4 Die Ausgangssituation der Bundestagswahl 2005
5 Inhaltsanalyse der Bildzeitung
5.1 Forschungsfrage und Methode
5.2 Vorgehensweise bei der Untersuchung
5.2.1 Beschreibung der Untersuchung
5.2.2 Reliabilität und Validität der Messung
6 Ergebnisse und Diskussion
6.1 Untersuchung der Beitragsebene der Inhaltsanalyse
6.1.1 Wahlkampfbezug der Beiträge
6.1.2 Untersuchung von formalen Merkmalen der Wahlkampf-Berichterstattung
6.1.3 Untersuchung von inhaltlichen Merkmalen der Wahlkampfberichterstattung
6.1.4 Haupt- und Nebenakteure der Berichterstattung
6.1.5 Koalitionsmöglichkeiten
6.2 Untersuchung der Aussagenebene der Inhaltsanalyse
6.2.1 Betrachtung der Gesamtberichterstattung
6.2.1.1 Bewertung der Spitzenkandidaten bzw. Kanzlerkandidaten
6.2.1.2 Bewertung der Parteien
6.2.1.3 Bewertung der Koalitionsblöcke
6.2.1.4 Bewertung auf der Titelseite der Bildzeitung
6.2.1.5 Die positiven und negativen Themen für die Parteien
6.2.1.6 Die Bewertungsdimensionen der Urteile
6.2.2 Bewertung der Aussagen der Bildzeitung
6.2.2.1 Bewertung der Spitzenkandidaten
6.2.2.2 Bewertung der Parteien
6.2.2.3 Bewertung der Koalitionsblöcke
6.2.3 Die letzte Ausgabe vor der Wahl
6.2.4 Berichterstattung über Große Koalition und Linksregierung
6.2.5 Determinanten der Bewertung der Koalitionsblöcke
7 Fazit und Ausblick
8 Literaturverzeichnis
9 Anhang
9.1 Codebuch
9.2 Umkodierungen zentraler Variablen der Inhaltsanalyse
9.3 Weitere Tabellen
1 Einleitung
Der ehemalige Bundeskanzler Gerhard Schröder, SPD, der zu Beginn seiner Amtszeit angeblich die Aussage getätigt haben soll, dass „er zum Regieren nur BILD, BamS [Bild am Sonntag, d. Verf.] und Glotze brauche” (Schümann, 2002), kritisierte am 18. September 2005 nach den ersten Prognosen und Hochrechnungen in einer ersten Stellungnahme im Willi-Brandt-Haus und in der darauf folgenden Berliner Runde der ARD vehement die Medienlandschaft: „Ich bin stolz auf eine demokratische Kultur, mit der bewiesen worden ist, dass Medienmacht und Medienmanipulation das demokratische Selbstbewußtsein nicht erschüttern kann” (ngo-online e.V., 2005a). Damit nahm er Bezug auf eine von ihm als unfair und parteiisch wahrgenommene Berichterstattung in den populären Medien, insbesondere während der Wahlkampfzeit. In dieser beklagte Schröder eine „Verwilderung der Sitten” (ngo-online e.V., 2005b) durch die Medien und befand, dass „viele Journalisten [...] eine ,Schere im Kopf‘ [hätten und, d. Verf.] immerzu daran [dächten, d. Verf.], was Verleger und Intendanten wohl lesen und sehen möchten” (Müller-Vogg, 2005, S. 2). An Schröders Statement lässt sich eine vermutete Abhängigkeit der Politik von populären Massenmedien ablesen.
Der Wahlkampf 2005 war durch die besonderen Gegebenheiten (vgl. Kapitel 4 in dieser Studie) der kürzeste Wahlkampf aller Zeiten und ein reiner Sommerwahlkampf. Die „heiße” Wahlkampfphase, also die letzten vier bis sechs Wochen vor dem Wahltag, dem 18. September 2005, fiel wie gewöhnlich zum Teil in die Sommerferien – in denen es wegen der Urlaubszeit für die Parteien nicht leicht ist, die Wähler mit politischen Themen zu erreichen (Holtz-Bacha, 2006, S. 5). Die Bildzeitung ist für einen Großteil der Bevölkerung während ihres Urlaubs die einzig verfügbare Tageszeitung oder gar das einzig genutzte Massenmedium. Wegen des kurzen Wahlkampfes, welcher in diese Ferienzeit fiel, könnte der Bildzeitung eine besondere Rolle in der Wahlkampfberichterstattung zugekommen sein. Auch wenn eine Kausalität zwischen der medialen Repräsentation und dem „Kreuz der Wähler” nicht unterstellt werden soll und die Wirkung von vielerlei zusätzlichen Faktoren abhängig ist, erscheint aufgrund der genannten Bedingungen eine intensive Auseinandersetzung mit der BILD gerade in diesem Wahlkampf lohnenswert.
Während in der bisherigen kommunikationswissenschaftlichen Forschung bei den Printmedien vorwiegend Qualitätszeitungen, wie die Süddeutsche Zeitung, die Frankfurter Allgemeine Zeitung, die Welt oder die Frankfurter Rundschau im Zusammenhang mit Wahlen untersucht wurden (vgl. Kindelmann, 1994 und Wilke/Reinemann, 2000), blieb der Einfluss der Bildzeitung bisher weitestgehend unbeleuchtet.
Neben dem „TV-Duell” der Kanzlerkandidatin und des Kanzlerkandidaten, einem weiteren „TV-Duell” der Spitzenkandidaten der fünf Parteien im Bundestag, einem erstmals stattfindenden „Radio Duell” zwischen Gerhard Schröder (SPD) und Angela Merkel (CDU) und den Duellgesprächen zwischen Edmund Stoiber (CSU) und Oskar Lafontaine (Linkspartei), welche in der Zeitschrift „Spiegel” abgedruckt waren, ist anzunehmen, dass die Bildzeitung aufgrund ihrer Auflagenzahl und Verbreitung (vgl. Kapitel 3 dieser Untersuchung) sehr stark an der Konstruktion der Parteienbilder beteiligt war, d.h. also daran, welche Informationen über und von Parteien und deren politischen Akteuren verbreitet wurden und damit den Mediendiskurs entscheidend mitbestimmte. Dies legte auch der Bundesvorsitzende des Deutschen Journalistenverbandes DJV, Michael Konken, nahe, der behauptete, dass „die ,Bild‘-Zeitung als Leitmedium eine mediale Führungsaufgabe übernommen hat” (Konken, 2005, S. 32). Umso überraschender ist es, dass in der bisherigen kommunikationswissenschaftlichen Forschung im Hinblick auf Massenmedien und Wahlen über die Bildzeitung wenige Studien vorliegen.
Mit der vorliegenden Studie soll daher versucht werden, einen genaueren Blick auf den bisher lückenhaft untersuchten Zusammenhang zu werfen. Zentrale Fragestellung ist die nach den verschiedenen Parteienbildern, welche die Bildzeitung im Bundestagswahlkampf 2005 konstruierte. Entscheidend wird dabei zu untersuchen sein, ob die BILD im Bundestagswahlkampf 2005 nach dem sich selbst auferlegten Grundsatz der Unparteilichkeit berichtete – auf der Titelseite jeder BILD stehen die Schlagwörter „unabhängig” und „überparteilich” – der ob die Berichterstattung der größten deutschen Tageszeitung nicht nach diesem Prinzip, sondern zugunsten einer Partei oder Koalition erfolgt ist. Interessant ist hierbei insbesondere, welches Bild die Zeitung von der bestehenden Koalition zeichnete, wie sie sich zu einem Umbruch bzw. Wandel in der Regierung positionierte und wenn ja, mit welchen Parteien sie dieses Änderungsszenario beschrieb. Hierfür ist daher sowohl von Bedeutung, wie über die damaligen Regierenden (SPD, Grüne) sowie über die Oppositionsparteien (CDU/CSU, FDP, PDS) berichtet wurde. Die Berichterstattung über die neue Linkspartei verdient außerdem Aufmerksamkeit, weil auch sie als potentieller Koalitionspartner während der Wahlkampfzeit im Gespräch war und einer ihrer Spitzenkandidaten Oskar Lafontaine offen den Konfrontationskurs mit seiner ehemaligen Partei, der SPD, bei der er sogar Parteivorsitzender gewesen ist (vgl. Kapitel 4), suchte.
Neben der Berichterstattung über die Parteien dürfte zudem wichtig sein, wie die Urteile in der BILD über die Spitzenkandidaten der einzelnen Parteien ausfielen, da diese im Laufe der vergangenen Jahre, vor allem aufgrund einer zunehmenden Popularisierung und Modernisierung von Wahlkämpfen (vgl. Kapitel 2.2) einen größeren Stellenwert zugesprochen bekommen haben.
Die Analyse dieser Fragestellungen erfolgt mithilfe einer Inhaltsanalyse der Berichterstattung der Bildzeitung über den Bundestagswahlkampf 2005. Dieser empirische Teil mit der Diskussion der Ergebnisse soll den Schwerpunkt dieser Studie bilden. Davor werden die theoretischen Grundlagen geklärt, welche für die Annäherung an die Fragestellung notwendig sind. Dies betrifft den Begriff des Massenmediums, den Begriff der Macht und grundlegende Zugänge der kommunikationswissenschaftlichen Wirkungsforschung. Außerdem erfolgt eine Einordnung der Stellung der Bildzeitung in der Medienlandschaft. Um den Kontext der Berichterstattung besser erschließen zu können, wird zudem vor der empirischen Untersuchung die Ausgangssituation der Wahl kurz beleuchtet. Am Ende der Studie stehen ein Fazit und ein kurzer Ausblick für mögliche anschließende Forschungen.
2 Die Rolle der Massenmedien im Wahlkampf
Bevor es möglich ist, sich mit der Rolle der Massenmedien im Wahlkampf zu beschäftigen, soll zuerst der Begriff des Massenmediums geklärt werden.
2.1 Massenmedien
„Massenmedien sind als – Träger der Massenkommunikation – jene Medien, die Informationen dauerhaft (über eine Vielzahl an Themen) an ein großes, unabgeschlossenes bzw. disperses Publikum verbreiten” (Strohmeier, 2004, S. 27; Gerhards, 1994, S. 85).
Die Printmedien sowie die Medien des Rundfunks (Fernsehen und Hörfunk) werden in der modernen Mediengesellschaft als „klassische” Massenmedien, die Online Medien bzw. das Internet als neue Medien bezeichnet (Strohmeier, 2004, S. 27).
Die Massenmedien haben wichtige politische Funktionen inne. Die wichtigste von ihnen ist die Herstellung von Öffentlichkeit. Außerdem sollen Massenmedien informieren und eine Kritik- und Kontrollfunktion in einem demokratischen System erfüllen. An diesen Aufgaben zeigt sich, dass sie eine unmittelbare (Medien-) Wirkung haben. Ihnen wird weiterhin politische Meinungs- und Willensbildungsfunktion zugesprochen, womit sie an Bildung, Erziehung und Sozialisation von Individuen beteiligt sind. An den Folgen der genannten Funktionen lassen sich auch mittelbare Wirkungen der Massenmedien erkennen (Strohmeier, 2004, S. 73).
2.2 Massenmedien und Wahlen in Deutschland
Wahlkämpfe sind eine der beliebtesten Untersuchungsobjekte in der kommunikationswissenschaftlichen Forschung (Holtz-Bacha, 1996, S. 9). Dies resultiert aus der Tatsache, dass es in Demokratien unter anderem von Wahlen abhängt, welche politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Veränderungen es in dem jeweiligen Land gibt. Demzufolge spielt es eine Rolle, welche Funktion Massenkommunikation in Wahlkämpfen erfüllen (Wilke, 2000, S. 79).
Nachdem in der „People’s Choice-Studie” von Lazarusfeld, Berelson & Gaudet (1944) den Medien ein Einfluss auf die Wahlentscheidung größtenteils abgesprochen wurde und dieser Studie, obwohl sie regional begrenzt war und das Medium Fernsehen noch nicht berücksichtigen konnte, auch in Deutschland ein großer Stellenwert zugeschrieben wurde, lag die Wirkungsforschung zu Medien und Wahlen erst einmal brach.
Erst mit der von Noelle-Neumann entwickelten Theorie der Schweigespirale (vgl. Kapitel 2.3.2 in dieser Untersuchung) in den siebziger Jahren kam die Forschung zum Verhältnis von Massenmedien und Wahlen in Schwung (Holtz-Bacha, 1996, S. 9). Des Weiteren haben sich aufgrund starker Veränderungen im Mediensystem seit dem zweiten Weltkrieg auch der Umgang und die Berichterstattung der Massenmedien mit Wahlkämpfen verändert. Zwei entscheidende Entwicklungen führten zu neuen Chancen, Herausforderungen und Problemen im Wahlkampf und zu einer gesteigerten Beachtung des Zusammenhangs von Massenmedien und Wahlkämpfen in der Kommunikationswissenschaft: zum einen die Einführung des Fernsehens, das nach einiger Zeit Leitmedium wurde und zum anderen die verstärkte Kommerzialisierung des Rundfunkmarktes (Holtz-Bacha, 2002b).
Es lassen sich vier verschiedene Phasen des Wahlkampfes in Deutschland seit dem zweiten Weltkrieg unterscheiden (Holtz-Bacha 2002b, S. 215ff. und Dörner & Vogt, 2002, S. 13-14):
Von 1949-1953 spielte das Fernsehen noch keine Rolle. Hier dominierten die Print- und Bildmedien, insbesondere Zeitungen und Plakate. Das Fernsehen gewann in der zweiten Phase ab 1957 langsam an Bedeutung, hatte aber noch einen sehr geringen Stellenwert für den Wahlkampf und für die Wahlkämpfer. Die dritte Phase von 1972-1983 wurde vom öffentlich-rechtlichen Fernsehen dominiert, das ab Mitte der siebziger Jahre zum meistgenutzten Medium wurde und das meiste politische Informationsangebot hatte. In der vierten Phase (seit 1987) geht es vor allem um den Wahlkampf im dualen Rundfunksystem, der durch eine Pluralisierung der Anbieter und eine weitgehende Kommerzialisierung Tendenzen einer „Amerikanisierung” bzw. „Modernisierung” beinhaltet und seit 1998 das Entertainment immer mehr in den Vordergrund stellt, da in der Unterhaltung das größte Publikum erreicht werden kann (Holtz-Bacha 2002a, S.27). Der häufig verwendete Begriff „Medialisierung” bezeichnet „die generelle Bedeutungssteigerung der Massenmedien” (Esser, 2003, S. 162). Es wird auch von einer „Mediatisierung der Politik” gesprochen, d.h. dass die Politik und das politische Handeln „medieninfiziert” (Sarcinelli, 2000, s. 24) werden. Ob Infizierung dabei die passende Beschreibung darstellt, sei dahingestellt. Dass Medien für die Politik eine zunehmende Bedeutung gewonnen haben, erscheint jedenfalls plausibel.
„Amerikanisierung bedeutet in diesem Kontext die allmähliche Angleichung europäischer Wahlkampfführung an die Art und Weise, wie in den USA Wahlkampf betrieben wird” (Holtz-Bacha, 1996, S. 11). Nach der Amerikanisierungsthese haben die politischen Akteure das Ziel, die Bevölkerung bei ihrer Wahlentscheidung mithilfe der Massenmedien zu beeinflussen und für sich zu gewinnen. Dies geschieht durch eine – wie in den USA schon länger stattfindende – professionalisierte Anpassung an die Gesetzmäßigkeiten des Mediensystems, welches zum Beispiel durch die Personalisierung der Kampagne oder dem „negative campaigning”, d.h. die Diskreditierung des politischen Gegners, erreicht werden kann (Schulz, 1997, S. 186). Im wissenschaftlichen Kontext wird der Begriff der „Modernisierung” dem der „Amerikanisierung” vorgezogen (Holtz-Bacha 2002a, S. 27), da die Phänomene zwar in den USA am stärksten ausgeprägt sind, jedoch aus Modernisierungsprozessen in der Gesellschaft, der Politik und dem Mediensystem resultieren (Dörner & Vogt, 2002, S. 9). Geisler und Sarcinelli kommen zu dem Fazit, dass aufgrund der unterschiedlichen Kulturen und Bedingungen „(...) sich die Mittel der politischen Kommunikation und speziell die Art der Wahlkampfführung in Deutschland bestenfalls als ‚zeitgemäß amerikanisiert‘ [präsentieren, d. Verf.], sie (...) aber noch längst nicht ,amerikanisch‘ [sind, d. Verf].” (Geisler & Sarcinelli, 2002, S. 61).
Ob in der Zukunft neben den klassischen Massenmedien das Internet im Wahlkampf weiter an Bedeutung gewinnen wird – wie es 2002 und vor allem 2005 zum Beispiel durch so genannte Weblogs, d.h. durch oftmals aktualisierte Internetseiten mit persönlichen Meinungen und Inhalte in umgekehrter chronologischer Reihenfolge (Ott, 2006, S. 213) versucht wurde – wird sich in der Zukunft zeigen. Hiermit könnte eine neue Phase des Wahlkampfs in den Medien und der Wahlkampfführung eingeleitet werden (Dörner, 2002, S.35). Es ist vorstellbar, dass aufgrund der weiteren Ausdifferenzierung der Gesellschaft die Parteien in Zukunft ihren Wahlkampf noch stärker auf die einzelnen Zielgruppen ausrichten, beispielsweise mithilfe zunehmender Verwendung des „Direct Mailing”, einer Art personalisierter Serienbriefe per Computer (Holtz-Bacha, 2002a, S. 28).
In den bisherigen Wahlkämpfen spielten die neuen Medien jedoch noch keine dominante Rolle. Zu bemerken ist außerdem, dass das Medium Internet, die Aktivität des Nutzers voraussetzt und damit nur in Grenzen für die persuasive Kommunikation geeignet ist (Holtz-Bacha 2002b, S. 228). Die bisherige Wahlkampfforschung hat sich fast ausschließlich mit den klassischen Massenmedien, vor allem dem Fernsehen und den Printmedien beschäftigt, weshalb im Folgenden auf die bisherigen Ergebnisse dieser Forschungen eingegangen werden soll, um sie möglicherweise für diese Studie produktiv zu nutzen.
2.2.1 Der große Stellenwert des Fernsehens im Wahlkampf
Vor allem durch die Untersuchungen von Elisabeth Noelle-Neumann zur Theorie der Schweigespirale (vgl. Kapitel 2.3.2 in diesem Buch) gewann das Fernsehen besonders an Aufmerksamkeit. Demzufolge fokussierten sich die Studien zum Medieneinfluss bei Wahlen vor allem auf das Fernsehen und führten insbesondere in Deutschland sogar dazu, dass sowohl die politische wie auch die wissenschaftliche Diskussion um Massenmedien und Wahlen sich allein mit dem Medium Fernsehen auseinander setzten (Schönbach 1983b, S. 106). Die Massenmedien und dabei besonders das Fernsehen wurden zum „[...] principal means by which political parties project themselves and shape their popular images”1 (Bean & Mughan, 1989, S. 1165). Das Fernsehen erlangte demnach für die politischen Akteure und Partei allerhöchste Bedeutung in den Wahlkampfstrategien.
In der Regel erreicht das Fernsehen mehr Menschen als die Printmedien. Die Bevölkerung informiert sich am meisten über Politik mithilfe des Fernsehens (Kepplinger & Maurer, 2005, S. 58ff.). Dies könnte an der visuell ausgerichteten Kultur (post-) moderner Gesellschaften liegen, in welcher viele Konsumenten nach bildlich präsentierten und schematisierten Informationen verlangen. Andererseits könnte es auch an der oben angesprochenen „Modernisierung” der Medienlandschaft liegen, dass Personen samt ihrem Aussehen und ihrem Unterhaltungswert in den Mittelpunkt des Interesses rücken bzw. versucht wird, mit ihnen Politik zu machen. Ein weiterer Vorteil des Fernsehens gegenüber den Printmedien ist seine Aktualität (Strohmeier, 2004, S. 40) und hohe Glaubwürdigkeit (Blödorn & Gerhards, 2004, S. 11), da es die „größte Realitätsnähe verspricht” (Tenscher & Nieland, 2002, S. 158) und weil es beim Zuschauer den Eindruck erweckt, „etwas mit eigenen Augen zu sehen” (Radunski, 1980, S. 67). Das Fernsehen, das vor allem zur Unterhaltung genutzt wird, hat leichter die Möglichkeit, Politik lebendig zu vermitteln und in Nachrichtensendungen auch Leute mit geringerem politischen Interesse zu erreichen (Strohmeier, 2004, S. 42). Für die Kampagnen der politischen Akteure ist es auch deswegen so interessant, weil es „besonders empfänglich für Inszenierungen und für spektakuläre Aktionen” (Schulz & Zeh, 2006, S. 277) ist. Nach Peter Radunski, dem ehemaligen Wahlkampfmanager der CDU, können gar Wahlkämpfe „im Fernsehen gewonnen oder verloren werden” (Radunski, 1996, S. 36).
Es gibt aber auch kritische Stimmen gegen die herausragende Stellung des Mediums Fernsehen in der kommunikationswissenschaftlichen Betrachtung von Politik, Wahlen und Massenmedien. Amerikanische Studien aus den 60er und 70er Jahren haben zum Beispiel gezeigt, dass es weder in der Wissensvermittlung, noch beim Agenda-Setting2, bei Imageveränderungen und bei Einstellungswandel Hinweise darauf gibt, dass das Fernsehen das Leitmedium ist (Schönbach, 1983b, S. 108). Bei der Vermittlung von Kenntnissen und der politischen Aktivierung haben Tageszeitungen sogar Vorteile (Schönbach, 1983a, S. 42-50).
2.2.2 Die Printmedien
Trotz der erläuterten Vorzüge bezüglich des Unterhaltungswertes und der visuellen Rezipierbarkeit des Fernsehrundfunks stellt die Presse, insbesondere die Tagespresse, nach wie vor das inhaltliche Basismedium dar, weil sie „breitere” bzw. „tiefere” Informationen als der Rundfunk liefern kann (Strohmeier, 2004, S. 28): „Etwa 15 000 Zeichen kann eine Sprecherin in fünfzehn Minuten Tagesschau verlesen; der Nachrichtenanteil einer überregionalen Tageszeitung umfasst ca. 150 000 Zeichen, also das Zehnfache” (Kamps, 1999, S. 128). Außerdem bieten die Printmedien wegen der besseren Strukturierung der Presselandschaft hinsichtlich der Leser Vorteile bei der Ansprache von Wählergruppen (Strohmeier, 2002, S. 121). Die Süddeutsche Zeitung beispielsweise ist auf eine links-liberale, die Nationalzeitung auf eine rechts-nationale Leserschaft ausgerichtet. Die Printmedien können in Bezug auf ihre Rezipienten bevorzugte Themen streuen. Das Fernsehprogramm zielt in der Regel dagegen auf ein breiteres Publikum. Des Weiteren kann die Presse große Mengen detaillierter Informationen besser vermitteln, und sie kann intensiver genutzt werden (Kindelmann, 1994, S. 25). Außerdem ist eine flexiblere und selektivere individuelle Informationsaufnahme mit den Printmedien möglich, und durch die Verwendung gedruckter sprachlicher Zeichen werden eine kognitive Verarbeitung einerseits und eine kritisch-distanzierte Wahrnehmung andererseits begünstigt. Dadurch wird zwangsläufig die Medienwirkung der Printmedien im Vergleich zu Hörfunk und Fernsehen – beides kann mit weniger Aufwand oberflächlich und unvermittelt wahrgenommen werden – eingeschränkt (Strohmeier, 2004, S. 29 ff.). Aufgrund der Nachteile bezüglich der Aktualität im Gegensatz zu den anderen Massenmedien wird die intensive Zweitberichterstattung als wichtigste Funktion der Printmedien gesehen (Wilke, 1998, S. 150).





























