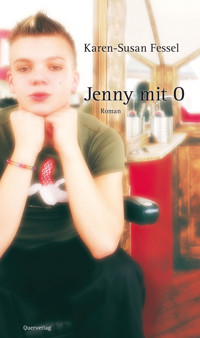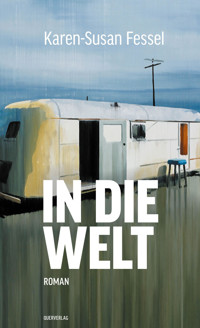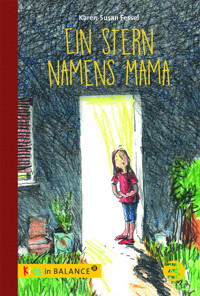Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Querverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Theas Welt fehlt ein Fixpunkt, ein ruhender Pol. Kindheit, Jugend, die ersten Erwachsenenjahre sind für die Einzelgängerin ein ständiges Suchen, Loslassen, Weiterziehen – sich bloß nicht zu lange auf eine Person einlassen, keine Bindungen eingehen. Plötzlich wirft die Begegnung mit der faszinierenden Reisefotografin Suzannah Thea aus der Bahn: Suzannah fordert nichts, lässt Thea Zeit und Raum, denn Suzannah weiß: Theas unstetes Leben wird sie immer wieder zu ihr zurückführen. Suzannahs Anziehungskraft bietet die Sicherheit und Geborgenheit, vor der Thea all die Jahre geflohen ist. Nach langem Wiederstreben lässt sie sich darauf ein. Und mit der Zeit erkennt sie, dass Suzannah ein Teil ihrer Welt geworden ist. Doch auch Suzannah ist eines Tages fort, und dieser plötzliche Verlust kündigt ein neues Kapitel in Theas Leben an, ein Kapitel, in dem sie sich an dem festhält, was ihr von dieser einzigartigen Liebe geblieben ist: Gedanken, Erinnerungen und die vielen Bildern von ihr, von Suzannah. Thea verlässt Berlin und geht nach Paris, Suzannahs Heimatstadt. Hier, fern von den Freunden, ihrem schwulen Onkel Paul und all den Vergnügen, denen sie sich jahrelang hingegeben hat, ordnet Thea ihr Leben neu. Und hier entsteht ein Buch, dieses Buch. Karen-Susan Fessel gräbt tief, in aufwühlenden Bildern fordert sie Gefühle ans Tageslicht, sondiert die Verlustängste, Freuden, Wünsche, Hoffnungen ihrer Figuren mit einer Kraft und Intensität, die diese Geschichte einer großen Liebe einzigartig erscheinen lassen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 594
Veröffentlichungsjahr: 1996
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
© Karen-Susan Fessel
© für die deutschsprachige Ausgabe Querverlag GmbH, 1996
Erste Auflage September 1996, zweite Auflage 1997
Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Umschlag und graphische Realisierung von Sergio Vitale unter
Verwendung von vier Fotografien der Autorin
ISBN 978-3-89656-543-3
Bitte fordern Sie unser Gesamtverzeichnis an:
Querverlag GmbH, Akazienstraße 25, D-10823 Berlin
www.querverlag.de
gewidmet
Anna Karstens 1943 – 1995
I
Sie fehlt mir. Immer noch fehlt sie mir. Sie fehlt mir auf eine Art, daß es mir die Kehle zusammenschnürt, eng und heiß wird sie mir, das Schlucken wird schwer und schwerer, bis es ganz unmöglich scheint. Aber ich reiße mich zusammen.
„Trage es mit Fassung“, hat meine Tante Krüpp zu mir gesagt. Tante Krüpp ist in Wirklichkeit nicht meine Tante, aber ich habe sie immer so genannt. Sie wohnte neben uns, neben meiner Mutter und mir, als ich noch ein Kind war und dann, später, ein junges Mädchen. Tante Krüpp ist die einzig wahre Tante, die ich je hatte. Tante Krüpp, alt, klein und mit leicht verkrümmten Gelenken, die ihr das Aufstehen und das Verrichten alltäglicher Hausarbeiten immer schwerer machen; Tante Krüpp scheint ein Relikt aus einer Vergangenheit, die nicht nur weit an Jahren zurückliegt, sondern auch meine eigene ist. Auch diese liegt weit zurück.
„Trage es mit Fassung“, hat Tante Krüpp gesagt. Ich kann das nicht. Ich habe nie Zeiten gekannt, in denen ich etwas mit Fassung tragen mußte. Ich habe alles so getragen.
Als ich das letzte Mal in Berlin war, traf ich eine alte Bekannte, die ich seit langer Zeit nicht mehr gesehen hatte. Ihr Lachen, als sie mich sah, in einer Bar, die wir früher oft gemeinsam besucht haben, machte mich verdammt froh. Irgendwann fragte sie mich, ob ich noch mit Suzannah zusammen bin. Es hat mir wieder die Sprache verschlagen. Wie oft ist mir diese Frage in den letzten beiden Jahren schon gestellt worden? Immer noch verschlägt es mir die Sprache. Ich konnte nur den Kopf schütteln. Sie gab ihrem Bedauern Ausdruck, und ich fügte hinzu: „Suzannah ist gestorben“.
Ich weiß nicht, warum ich immer diesen Ausdruck benutze, anstatt zu sagen: „Suzannah ist tot.“ Tot – das klingt so viel klarer, direkter. Und härter. Vielleicht ist es mein Empfinden, das mich dazu bringt, es weicher auszudrücken, weich von der Art einer kratzigen Bastmatte auf einem abgeschabten Fliesenboden. Aber „gestorben“ klingt, als sei es erst vor kurzem gewesen, und so ist mir auch: als sei es erst vor kurzem geschehen.
Suzannah ist vor nicht ganz zwei Jahren gestorben, genauer gesagt, vor einem Jahr, acht Monaten und fünfundzwanzig Tagen.
Ich war nicht dabei.
Es ist so still hier. Es ist still, nur manchmal kann ich das Rascheln der Vorhänge hören, oder besser: Ich sehe es. Ich sehe, wie sie sich bauschen in einem kleinen Luftzug, der durch die angelehnten Fenster in die Wohnung dringt. Die Vorhänge sind aus weißem, durchsichtigen Stoff und reichen von der Decke bis auf den Fußboden, eigentlich noch darüber hinaus. Wenn es weht, schleifen sie über das Parkett und werden mit der Zeit grau am Saum. Aber das stört mich nicht. Früher habe ich niemals Vorhänge besessen. Die Vorstellung war mir fremd. Aber hier, in dieser Wohnung, hier liebe ich sie. Ich genieße den Anblick. Und sie schützen mich. Sie verbergen die Stadt, die draußen vor meinem Fenster bebt und pulsiert wie ein einziges großes lebendiges Gewebe.
Es ist still. Die Stille lastet nicht, sie schweigt, flüssig, wie Luft. Sie ist so still wie meine Finger, deren trockene Haut. Ich kann lange Zeit so dasitzen und meine Finger ansehen. Obwohl Sommer ist, seit Monaten, ist die Haut meiner Finger hell. Ich habe von Natur aus helle Haut, aber im Moment wirkt sie fahl. Mir gefällt das. Es entspricht meiner Stimmung, meiner inneren Verfassung. Meiner Seele. Auch sie ist trocken.
Ich weiß nicht, ob das stimmt.
Mein Denken aber hat nichts Fahles an sich. Ich kann gut denken. Besser als lange Zeit, klarer. So klar wie ein Sommermorgen.
Manchmal bewege ich meine Finger. Ich nehme meinen Stift, drehe ihn herum und lege ihn wieder hin. Meine Hände kommen mir in diesen Momenten vor wie eigenständige Wesen, deren Trennung von meinem Körper ich einfach nicht wahrgenommen habe. Aber ich weiß, daß das nicht stimmt. Die Zeit, in der ich das Wissen um mich selbst und meine Körperlichkeit nicht wahrgenommen habe, liegt schon eine Weile zurück. In jener unbewußtem Nebelzeit. Nachdem Suzannah gestorben war.
Das leise Rascheln der Vorhänge knistert in meinen Ohren und erinnert mich an das Gefühl, als ich mit meinen Händen einen anderen Körper berührt habe. Jenen Körper. Suzannahs.
Zwischen beidem – dem Berühren und dem Rascheln – liegt gar kein so großer Unterschied: Es sind Grüße, Grüße aus der Vergangenheit und aus der Zukunft. Und auch sie sind eins. Meine Gegenwart. Ich denke an die Vergangenheit, ich fühle in der Vergangenheit, ich hänge in der Vergangenheit, aber ich lebe für die Zukunft. Die Wohnung, in der ich sitze, die Stadt, in der ich wohne, die Luft, die ich atme, die Bewegungen, die ich mache – all das ist jetzt, aber zugleich nur ein Zustand, ein Übergleiten. Wirklich, aber unbedeutend. Erst die Zukunft wird wieder bedeutend sein.
Es ist so still hier.
Suzannah hatte wunderschöne Füße. Wunderschön, wirklich. Ich finde, es waren außergewöhnliche Füße, ebenso wie ihre Hände. Das Besondere an ihnen war die Verbindung von Kraft und Zierlichkeit, die ihnen eine ganz spezielle Anmut verlieh.
Suzannah war groß, einssiebenundsiebzig, und alle ihre Gliedmaßen waren lang und schlank, auch ihre Hände und Füße, aber anders: Die Gelenke und Knöchel waren kräftig und gleichmäßig, Finger und Zehen liefen nicht, wie bei so vielen anderen Menschen mit langen Gliedmaßen, an den Enden spitz zu, sondern sie behielten ihre Form bei, bis hin zu den sanft gerundeten Kuppen. Als mein Blick das erste Mal auf diese kräftigen Hände fiel, an jenem heißen Tag im August, spürte ich so etwas wie ängstliche Faszination. Ich saß da, nervös und verlegen, und sah auf diese Hände, die mit geschickten Bewegungen die abgeschabte Mappe mit meinen Zeichnungen darin öffneten, und ich fragte mich, wie diese langgliedrige Frau zu solch großen, kräftigen Händen kam, wie sie es schaffte, sie so leicht und flink zu bewegen, ohne dabei plump zu wirken, und ich fragte mich, wie es sich anfühlen mochte, wenn diese Finger mich berühren würden.
Und immer wieder, auch als ich längst wußte, wie es sich anfühlte, immer wieder fragte ich mich, wie es sich für Suzannah anfühlen mochte, mit diesen Fingern zu arbeiten, auf den Auslöser ihrer Kamera zu drücken, die glatte Fläche eines Belichtungsmessers zu umfassen. Woher wußte sie, wie fest sie zugreifen, an welchem Punkt das Gewicht ihrer Knöchel liegen mußte, wie weit sie die Finger zu biegen hatte?
Der starke Kontrast zwischen ihren langen Gliedmaßen und den großen, kräftigen Fingern war so auffällig, daß ich immer eine gewisse Ungeschicklichkeit in ihren Handbewegungen erwartete. Aber ich habe nie erlebt, daß Suzannah etwas zerbrach oder versehentlich zerriß. Sie war unglaublich geschickt mit ihren Händen.
Auch mit den Füßen: Wie oft habe ich zugesehen, wie sie ein Kleidungsstück zielsicher mit den Zehen vom Boden angelte und mir hinhielt. Sie amüsierte sich selbst darüber: „Meine ursprünglichen Fähigkeiten trainieren“ nannte sie das. Es gelang ihr sogar, die einzelnen Zehen zu krümmen, ohne daß die anderen sich mitbewegten. Das klingt einfach, aber es ist nahezu unmöglich. Ich habe es oft genug versucht, ohne jeglichen Erfolg.
Ich habe ihre Füße geliebt, den flachen Spann und die weiche Rundung der Ballen, die geraden langen Zehen, von denen einzig der kleine am linken Fuß leicht gekrümmt war, als Folge eines Bruchs, den sie sich als Kind zugezogen hatte. Der zweite Zeh war an beiden Füßen fast genauso lang wie mein kleiner Finger. Und fast genauso beweglich. Verrückt.
Ich erzähle das, weil ich mit bloßen Füßen am Schreibtisch sitze, ein Bein über das andere geschlagen, und der leichte Luftzug, der durch das halbgeöffnete Fenster zieht, streichelt sanft über meine Fußsohle. Es ist ein weiches Gefühl, wie eine Liebkosung, und wenn ich meine Hand über die Sohle lege, kommt es mir vor, als schnitte ich eine Berührung ab, deckte sie zu, und mir fällt auf, als wie intim ich die Berührung der Fußsohle empfinde. Ich glaube, nein, ich weiß, daß niemand mehr meine Fußsohlen berührt hat, seit Suzannah es das letzte Mal tat. Ich kann mich nicht genau erinnern, wann das war; ich wüßte es gern, aber ich weiß es nicht, und es fällt nicht allzu schwer ins Gewicht.
Ich wäge ab, erinnere mich, vergleiche, lege das Gute und das Schlechte nebeneinander, und das Gute, das ist alles, was Suzannah mir gab und ich ihr, und das Schlechte das, was ich ihr nicht gab. Was ich versäumte. Mir ist klar, daß ich mir damit keinen Gefallen tue. Ich könnte ewig so weitermachen, und die schlechten Dinge, die Versäumnisse, die Fehler, sie würden sich anhäufen und anhäufen, mit jedem Tag, mit jeder Sekunde, denn immer mehr kommt dazu, mit jedem Tag, der verstreicht, häufen sie sich an, weil jeder Tag, den ich lebe, einer ohne Suzannah ist, ein Tag, an dem ich ihr etwas hätte geben können, aber ich kann es nicht mehr, es geht nicht, und deshalb muß ich damit aufhören. Ich muß damit aufhören, aber ich kann es nicht, noch nicht. Ich brauche diese Zeit, ich brauche die Erinnerung und das Bewußtsein um das, was mir fehlt, was mir fehlt.
Es gab diesen Moment, diesen winzigen Moment im Sommer 1988. Wir kannten uns schon zwei Jahre, es war ungefähr um die Zeit, als ich aufhörte wegzulaufen, als ich aufhörte, mich zu wehren, immer weiter zu wehren gegen sie, gegen die Gefahr, die ich spürte. Suzannah hat erst später gemerkt, daß ich da war und ja gesagt hatte. Sie hat erst viel später gemerkt, daß ich mich nicht mehr wehrte. Ich habe es ihr lange Zeit nicht gezeigt; ich wollte nicht, daß sie es wußte, und so wähnte sie mich noch auf der Flucht, während ich schon ruhig neben ihr stand. Es dauerte noch ein Jahr, bis sie es merkte. Nicht, weil sie unaufmerksam oder begriffsstutzig war, ich habe es ihr einfach nicht gezeigt. Ich habe noch ein Jahr so weitergemacht. Ein weiteres Jahr bin ich weggerannt, habe aufbegehrt, um mich geschlagen und sie fortgestoßen. Und so kam es, daß ich drei Jahre gegen sie gekämpft habe und vier Jahre mit ihr.
Nein, nicht gegen sie. Gegen mich.
Um diese Zeit, als ich aufhörte wegzulaufen, im Sommer 1988, da gab es diesen winzigen Moment, in dem ich erkannte, daß ich sie liebte.
Es war in Suzannahs erster eigener Wohnung in der Grolmannstraße, in jener Wohung, in der sie lebte, während ich mein zermürbendes Katz-und-Maus-Spiel mit ihr trieb und kam und ging und immer wieder kam. An jenem Tag war ich am frühen Abend bei ihr aufgetaucht, müde und wachsam zugleich. Ich weiß nicht mehr, wo ich mich herumgetrieben hatte, jedenfalls klingelte ich, sie machte mir auf, wie meist in dieser heißen Jahreszeit mit einem viel zu großen T-Shirt und Trainingshosen bekleidet und schwarzen, ausgebleichten Ballettschuhen an den Füßen. Sie mochte Ballettschuhe, sie trug sie zu Hause oder auch im Atelier, wenn sie nicht barfuß lief. Sie spürte gern den Boden, auf dem sie ging. Die Härte von Strukturen unter ihren Füßen. Ich habe lange gebraucht, um mich an diese Ballettschuhe zu gewöhnen, ich fand sie uncool, zu feminin, viel zu fein. Wie in aller Welt, fragte ich mich manchmal, kann man etwas mit einer Frau haben, die Ballettschuhe trägt?
Sie machte mir auf, lächelte mich an, drehte sich um und sagte im Weggehen: „Ich muß noch was fertigmachen.“ Sonst nichts. Typisch. Und ich, mißtrauisch und fügsam zugleich, schlenderte hinter ihr her, nahm die Flasche Wasser entgegen, die sie mir aus der Küche reichte, setzte mich ins Wohnzimmer und lehnte den Kopf gegen das Polster des Sofas, während sie im hinteren Teil der Wohnung verschwand.
Ich schloß die Augen und hörte zu, wie sie in ihrer zu einem Fotolabor umfunktionierten Speisekammer kramte, mit Papieren raschelte, Schüsseln leerte, und langsam verschwand meine Unruhe. Ich saß da und sog die Stille in mich auf, diese einmalige Stille, die von den leisen Geräuschen, die Suzannah verursachte, nur noch untermalt wurde. Müdigkeit und Hitze flossen aus mir heraus, und nach und nach entspannte ich mich. So sehr, daß ich kaum hörte, wie sie hereinkam. Als ich die Augen öffnete, legte sie gerade einen Packen Fotopapier in eine Ecke des Zimmers, mitten hinein in die übliche Unordnung, mitten hinein zwischen Fotos, Papierschnipsel, Objektive, Bildbände und Kleidungsstücke, die über den glatten Dielenboden verstreut lagen, und dann setzte sie sich mir schräg gegenüber in den großen Sessel und kratzte sich am Ohr, während sie mich nachdenklich ansah.
„Kannst du eigentlich richtig mit zehn Fingern tippen?“ fragte sie und schlug die Beine übereinander, indem sie den Knöchel des einen auf das Knie des anderen legte.
Ich verschränkte die Arme hinter dem Kopf. Meine Gelenke knackten. „Ja. Wieso?“
Sie zuckte die Achseln und sah auf ihren Fuß. „Nur so“, sagte sie. „Ich hab nur gerade daran gedacht. Ich hab mich gefragt, ob du das wohl kannst.“ Sie beugte sich vor, umfaßte ihren Knöchel mit beiden Händen und betrachtete ihre Fußsohle.
Ich sah ihr zu. Die Sekunden verstrichen, alles war still, nur das Brummen vorüberfahrender Autos und entferntes Kinderlachen drangen durch die geöffneten Fenster; ich sah ihr zu, sah zu, wie sie ihre Fußsohlen besah, mit diesem selbstvergessenen Ausdruck im Gesicht, friedlich und ruhig, voller Vertrauen, daß ich dasaß und sie gewähren ließ und daß von mir keine Gefahr drohte. Ich sah ihr zu, und in diesem Moment spürte ich das erste Mal so rein und klar, wie dankbar ich ihr war für dieses Vertrauen, für die Hingabe, mit der sie sich in meiner Gegenwart ganz sich selbst überlassen konnte; ich spürte, wie sich mein Herz weitete, und da, in diesem Moment, in diesem winzigen Moment, erkannte ich, daß ich sie liebte.
Es ist immer wieder dieser Moment, an den ich mich erinnere. Mir kommt es vor, als hätte da alles begonnen. Aber so war es nicht, nicht eigentlich. Es hat schon vorher begonnen, viel früher, nicht zwei Jahre früher, als ich Suzannah das erste Mal begegnet bin, auch nicht, als ich mich endlich aus der düsteren Enge meines jugendlichen Lebens befreite und nach Berlin ging, sondern noch früher. Vielleicht hat es begonnen, als ich klein war, ein kleines Mädchen, als ich das erste Mal Abschied nehmen mußte, als ich vier war und mein Vater starb. Oder noch früher?
Damals, an jenem Sommertag in Suzannahs Wohnung, hatte ich keine Ahnung, welche Tragweite dieser Moment haben, wie sehr sich mein Leben dadurch verändern würde. Aber was ich wußte, was ich verstand, als ich dasaß und Suzannah zusah, war, daß etwas begann, etwas Neues und sehr Bedeutsames, und daß dieses Neue untrennbar mit Suzannah und dem, was sie für mich war, verbunden sein würde, und daß ich es wollte, dieses Neue. Der Weg, der mich bis zu diesem Punkt geführt hatte, war lang und verschlungen, doch er hatte mich hierhin geführt, und jetzt würde es weitergehen, weiter, sehr weit irgendwo hinein, und ich hatte den Verdacht, daß dieses Irgendwo mir sehr gefallen würde.
Ich mag diesen Ort. Ich bin gerne hier. Paris gefällt mir, diese riesige, immer lebendige Stadt, die im melodischen Klang der weichen Sprache schwingt, die ich mittlerweile fast fließend spreche. Mir gefällt meine Wohnung, und mir gefällt die Einsamkeit darin. Sie füllt die Räume aus, das große sechseckige Zimmer mit den zwei überdimensionalen Fenstern, den schmalen, leeren Flur, das Bad und die Küche. Seit mehr als einem halben Jahr lebe ich nun hier in dieser Wohnung, und jedesmal, wenn ich hereinkomme, ist mir, als ob ich nur für ein paar Tage vorbeischauen würde. Ich habe kaum etwas mitgebracht, als ich gekommen bin. Zwei Koffer mit Papieren, Fotos, Büchern, Kleidungsstücken und ein paar Gegenständen, von denen ich mich nicht trennen wollte. Gegenstände wie der Kerzenleuchter aus Messing, den ich besitze, seit ich neunzehn bin. Der kupferne Armreif, den Suzannah mir geschenkt hat. Oder die kleine Kiste aus Holz, die leer herumsteht, weil ich mich nicht entscheiden kann, was ich hineintun soll. Und Theos Halsband, nicht jenes, welches er immer getragen hat, sondern eins, das mein Onkel Paul für ihn aus den Staaten mitgebracht hatte; es ist grün und aus dickem Leder. Ich habe es ihm einmal umgelegt, aber er sah seltsam aus damit, geschniegelt, es paßte einfach nicht zu ihm. Ich habe es trotzdem aufbewahrt. Ich habe immer gedacht, daß ich es noch mal gebrauchen kann, und das denke ich immer noch. Manche Dinge verändern sich nicht.
Als ich hier ankam, hatte ich die Wohnung noch nie gesehen; alles war ohne mein Zutun arrangiert worden: Suzannahs Mutter hatte gehört, daß einer der Tänzer vom Theater nach Amerika ging und seine Wohnung untervermieten wollte; sie hatte ihrer jüngsten Tochter Edna Bescheid gesagt, und Edna hatte Kontakt zu dem Tänzer aufgenommen, sich die Wohnung angesehen und mich angerufen.
„Sie ist genau das richtige für dich“, sagte Edna, und ihre Stimme klang frisch und nur leicht gedämpft durch die Entfernung aus dem Hörer. „Also, ich miete sie jetzt einfach. Du mußt sie nehmen. Du mußt! Glaub mir: Sie ist genau das richtige.“
Und so ist es auch. Die Wohnung ist in der Tat genau das richtige für mich. Das Zimmer ist riesig, und wie die anderen Räume besitzt es roh verputzte und weiß gestrichene Wände. Wenn ich hineinkomme, sehe ich genau auf das kurze Stück Mauer zwischen den beiden großen Fenstern. Die Frontwände sind zur Mitte des Zimmers hin abgewinkelt, zu ihren Seiten knickt der Raum wiederum zu der Wand hin ab, in die die Tür eingelassen ist. Die ungewöhnliche Form des Zimmers hat eine beruhigende Wirkung auf mich, ich fühle mich wohlaufgehoben darin, und es ist groß genug, um meine spärlichen Habseligkeiten so zu verstauen, daß sie kaum auffallen.
Das einzige, was auffällt, ist der große Tisch mit dem Holzstuhl davor. Wenn ich daran sitze, blicke ich aus dem rechten Fenster, wenn ich mich nach hinten lehne und den Kopf ein wenig zur Seite drehe, kann ich aus dem anderen hinaussehen. Falls ich die Vorhänge beiseite gezogen habe. Was ich oft nicht tue.
Rechts von der Tür liegt die große Matratze, die Edna mir schon in die Wohnung gelegt hatte, als ich ankam. Sie ist dick genug, daß ich nicht friere auf den blanken Holzdielen. Links von der Tür lagern meine Koffer, daneben ein Haufen Kleidungsstücke. Auf eine gewisse Art sieht dieser verwühlte Haufen sogar ordentlich aus. Alles liegt und steht eben ordentlich herum.
Das Bad ist klein. Waschbecken und Badewanne sind aus weißem Emaille. Die Armaturen sind uralt und messingfarben, ebenso wie die dicken verzierten Füße, auf denen die Wanne steht, und wie die Kette, die an dem Toilettenkasten befestigt ist. Das einzige, was neu ist in diesem Raum, das ist der Spiegel, den Michelle mir vor zwei Monaten angeschleppt hat, weniger aus Fürsorglichkeit, wie ich vermute, sondern damit sie sich selbst besser betrachten kann, wenn sie sich zum Ausgehen fertigmacht. Sie will unbedingt, daß ich eine Lampe darüber anbringe, sie meint, das Licht aus der Glühbirne an der Decke gäbe nichts her, aber ich weigere mich. Ich will nichts an den Wänden befestigen, nichts installieren, ich will, daß alles hier ein Provisorium bleibt. Michelle ärgert sich immer wieder darüber, aber ich bleibe hart. Sie legt ohnehin viel zuviel Wert auf ihr Äußeres, finde ich. Dabei ist sie schön, und am besten gefällt sie mir, wenn sie ungeschminkt ist. Aber das ist ihre Sache, ich mische mich da nicht ein.
Auch das trägt dazu bei, daß meine Wohnung ein Provisorium bleibt: Es ist nichts an den Wänden, kein Haken, kein Regal, auch in der Küche nicht. Alles, was ich habe, ist in dem großen Schrank verstaut oder liegt in der Spüle, auf dem Holztisch oder den drei Stühlen. Die Wände aber sind frei.
Nein, nicht ganz. In meinem Zimmer, an der Wand links von der Tür, ist ein Nagel. Dort habe ich ein Foto aufgehängt. Nein, nicht Suzannah ist darauf zu sehen. Aber sie hat es gemacht. Es ist ein Foto von mir, eine Porträtaufnahme, die mein Gesicht im Halbprofil zeigt. Ich sehe mit leicht gesenktem Kopf in die Kamera, meine Haare sind kurz und liegen wie Flaum am Kopf an, meine Haut ist faltenlos und glatt. Auf dem Foto sehe ich sehr jung aus, lange Zeit habe ich gedacht, daß Suzannah es nicht richtig entwickelt hat, aber das stimmt nicht; damals habe ich so ausgesehen, sehr jung, viel jünger, als ich es jetzt bin. Das Foto ist etwa sieben Jahre alt, es stammt noch aus unserer Anfangszeit, es stammt noch aus der Zeit vor jener, die begann, nachdem ich Suzannah zusah, wie sie ihre Fußsohlen betrachtete. Es stammt weit aus der Vergangenheit, aber ich erkenne mich darin wieder, und ich erkenne auch mein jetziges Ich darin wieder.
Meine Wohnung liegt im dritten Stock eines alten Hauses mit stuckverzierter Fassade. Die Straße ist ruhig und eng; direkt gegenüber kann ich in die Stube eines alten Ehepaares sehen, das jeden Abend damit verbringt, schweigend in den Fernseher zu starren. Schräg gegenüber liegt ein winziger Park, in dem sich abends zuweilen Liebespaare treffen. Ich brauche nur die Straße hinaufzulaufen, und schon beginnt die leichte Steigung, die sich im Gewirr kleiner Gassen und breiter Straßen hinauf zum Montmartre erhebt. Von außen sieht das Haus wie ein ganz normales Pariser Wohnhaus aus, aber der Anblick täuscht: Innen ist alles verwinkelt und widerspricht jeglichen statischen Berechnungen; die Treppe verläuft in unregelmäßigen Abständen gebogen, an unbenutzbaren Nischen und Wohnungstüren entlang, von denen nicht zwei auf einer Höhe liegen. Es gibt eigentlich keine richtigen Stockwerke, sondern jede Tür liegt ein paar Stufen höher als die vorhergehende. Ich weiß nicht, was der Architekt sich dabei gedacht hat, aber kein Hausbewohner kann in seine Wohnung gelangen, ohne erst ein paar Stufen hinauf- oder hinuntersteigen zu müssen. Auch bei mir ist das so: Wenn ich meine Wohnungstür öffne, muß ich drei Stufen hinaufsteigen, um den Flur zu erreichen. Man denkt, jetzt hat man es geschafft, und dann geht es noch höher hinauf – oder wieder tiefer hinunter.
Aber so ist es eben im Leben. So ist es oft.
Vor ein paar Monaten hat eine frühere Arbeitskollegin in Berlin – wir haben beide eine Zeitlang in derselben Kneipe bedient – mir etwas gezeigt, worauf sie enorm stolz ist. Mehr noch, es bedeutet ihr so viel, daß sie ihr ganzes Leben damit zubringen will.
Sie schaute mich mit einem bedeutsamen Blick an, der besagte, daß sie sich die Entscheidung, es mir zu zeigen, reiflich überlegt hatte, dann sagte sie: „Schau mal!“ und knöpfte ihr Hemd auf. Langsam, dabei den Blick erwartungsvoll und zugleich wissend auf mein Gesicht gerichtet, öffnete sie vier Knöpfe und zog das Hemd ein wenig zur Seite. Darunter trug sie ein schwarzes T-Shirt mit dem Schriftzug „You are leaving the American Sector“, wie sie früher, bevor die Mauer fiel, in Mode gewesen waren. Auf dem Rücken steht dieser Satz groß in drei Sprachen untereinander, vorne nur in einem kleinen Kästchen auf der linken Brust. Ihr Finger zeigte genau auf dieses Kästchen.
„Was?“ fragte ich.
Sie sagte: „Fühl mal“ und drückte meinen Daumen auf die Stelle. Ich dachte, sie wolle mich auf die Beschaffenheit der gummierten Buchstaben aufmerksam machen, aber dann spürte ich eine schmale, längliche Erhebung unter dem Hemd.
„Schorf“, bemerkte ich, aber sie schüttelte den Kopf. Auf mein Verlangen hin zog sie das T-Shirt nach unten, um mir eine glatte, vier oder fünf Zentimeter lange Narbe zu zeigen, die noch nicht ganz verheilt war. Ich nickte.
„Rasiermesser?“
„Nein“, sagte sie, und ihre Mundwinkel sanken vor Stolz ein wenig nach unten, „Skalpell. Lea ist die erste Frau, von der ich mich habe schneiden lassen.“ Ich nickte erneut, aber da interessierte es mich schon nicht mehr.
Ich konnte ihren Stolz, ihr Gefühl, eine extrem bedeutungsvolle Erfahrung gemacht zu haben und am eigenen Leibe sichtbar für alle lebendige Ewigkeit zu tragen, erkennen, bestätigen, sogar mitfühlen, aber es interessierte mich nicht. Es erschien mir wie ein verschwommenes Relikt aus meiner eigenen Vergangenheit, wenngleich ich diese Erfahrung gar nicht gemacht habe. Es hätte passieren können, vielleicht, wenn es wichtig gewesen wäre. Dinge, die hätten passieren können, und Dinge, die geschehen sind, gleichen sich im Rückblick aneinander an, so daß es keinen Unterschied mehr macht, ob oder ob es nicht geschehen ist. Alles, was ich mir mit Suzannah hätte vorstellen können, ist geschehen. Ich trage ungeheuer viel mit mir herum. Manchmal, wenn ich zufällig mein lächelndes Spiegelbild in einer Schaufensterscheibe entdecke, sehe ich mich, wie ich Suzannah angelächelt habe. Früher habe ich mich nie so gesehen. Aber sie hat mich so gesehen.
Was ich am meisten vermisse? Das ist eine dieser Fragen, die ich am liebsten auf die Müllhalde der menschlichen Sprache werfen würde. Am meisten vermissen … läßt sich das je so klar beantworten? Am meisten gibt es nicht. Es gibt nur viel, viel und noch mal viel. Dennoch stelle ich mir diese Frage selbst immer wieder. Ich war glücklich mit ihr.
Sie hat mir gutgetan, sie war gut mit mir. Natürlich war ich ihr nah, so nah, wie Liebende sich sein können. So nah, wie Menschen sich sein können? Das heißt nicht viel, denn ich weiß, daß man sich, egal wie groß die Liebe ist, nie sehr nahe sein kann. Am nächsten war ich ihr in jenen Momenten, wenn ich in ihre Armbeuge gekuschelt dalag, nackt und warm, oder wenn ich meine Wange an ihre legte, mein Gesicht an ihrem Hals vergrub und ihren Duft tief einatmete, ganz tief, bis nichts mehr in meine Lungen hineinging. Dann hielt ich den Atem an und lauschte auf mein Herz, in der Gewißheit, daß mit jedem Pochen aus meinen Lungen Sauerstoff in mein Blut transportiert wird, Sauerstoff aus der Luft, die nur aus Suzannahs Duft besteht, Sauerstoff, der durch mein Blut in mein Herz und da hindurch getragen wird. So habe ich immer wieder einen Teil von Suzannah in meinem Herzen getragen. Wie kann es größere Nähe geben?
Diese erste Nacht. Diese erste Nacht, die wir miteinander verbracht haben. Ich muß immer wieder daran denken. Jetzt, aus dem Abstand der Jahre heraus, von diesem immer noch fremden Ort aus kann ich sehen, wie sich schon in jener Nacht die Fäden zwischen uns verdichteten, jene Fäden, die mit der Zeit zu einem fest verwobenen Seil wurden, das uns eng und stark aneinander binden sollte. Alles war bereits da, in dieser ersten Nacht – die Nähe, die Angst, das Glück und auch die Trauer. Es war alles da.
Wir saßen uns an dem runden Holztisch gegenüber, von dem die Reste unserer Mahlzeit schon abgeräumt waren, und schwiegen, zum erstenmal in den vergangenen vier Stunden. Mir war heiß, das T-Shirt klebte mir am Rücken, und meine Hände zitterten leicht. Ich hoffte, daß sie es nicht sah; ich war ohnehin schon verlegen genug. Sie drückte ihre Zigarette im Aschenbecher aus, der bis an den Rand gefüllt war mit den unzähligen Kippen, die wir gemeinsam geraucht hatten, blickte auf und sagte: „Gehen wir?“
Ich nickte, unfähig, einen Ton hervorzubringen, und stand etwas zu hastig auf, so hastig, daß mein Stuhl ins Wackeln geriet und ich ihn nur mit einer schnellen Bewegung festhalten konnte. Ich wurde rot, einen Moment fühlte ich mich haltlos, der Situation nicht gewachsen, eine namenlose Angst schoß in mir auf, ich spürte, wie sich meine Finger um die Stuhllehne krampften. Feucht waren sie und irgendwie taub, das geschnitzte Muster der Lehne preßte sich schmerzhaft in meine Handflächen, ich bekam keine Luft; nein, dachte ich, nein, das geht nicht, ich kann das nicht, laß es sein, das hier ist gefährlich; ich schloß die Augen, versuchte, mich zu sammeln, und als ich sie wieder öffnete, sah ich direkt in Suzannahs Gesicht, in ihre dunkelgrün schimmernden Augen, die mich eindringlich und doch auch unaufdringlich musterten. Ich sah das leichte, ruhige Lächeln, das sich um ihre Lippen kräuselte, und im nächsten Augenblick fing ich mich wieder. Sie stand mir gegenüber, in der für sie typischen, vollkommen entspannten Haltung, die Schultern gerade und die Arme locker herabhängend, und sah mich an. Gequält verzog ich die Lippen, ihr Lächeln vertiefte sich, und dann sah sie zur Seite, zur Bar, wo der Kellner, der gerade bei uns abkassiert hatte, damit beschäftigt war, unsere Rechnung in die Kasse einzutippen. Ich betrachtete Suzannahs Profil, und ich wußte, daß ich nicht davonlaufen würde, weil es gar nicht mehr ging.
Ich hatte sie einen Tag zuvor kennengelernt. Es war August; natürlich weiß ich das genaue Datum, ich habe das nicht vergessen, es war der 14. August. Damals dachte ich noch, daß aus mir eine halbwegs passable Zeichnerin werden würde, und an diesem Tag sollte ich erstmals Gelegenheit bekommen, meine Arbeiten dem Redakteur einer ziemlich bekannten Illustrierten vorzustellen. Sowohl Dennis, mein Mitbewohner, als auch mein Onkel Paul hatten mich seit Monaten gedrängt, etwas in dieser Hinsicht zu unternehmen. Sie waren meine andauernde Stubenhockerei leid und wohl auch die nicht versiegen wollende Aneinanderreihung von mehr oder minder ausgearbeiteten Zeichnungen, die sie immer wieder beurteilen sollten. Paul hatte mir eines Tages eine Liste von Zeitschriftenverlagen auf den Schreibtisch geknallt. „Entweder du rufst jetzt überall an und versuchst, einen Vorstellungstermin zu bekommen, oder du verbrennst deine Sachen und redest nie wieder davon, daß du Zeichnerin werden willst.“
Ich glaube, im Grunde war niemand, ich selbst eingeschlossen, wirklich davon überzeugt, daß ich es mit meinem neuentdeckten Talent zu etwas bringen würde, aber einen Versuch schien es mir wert. Und so kam es, daß ich an diesem heißen Sommertag mit meiner Zeichenmappe unterm Arm vor dem Verlagsgebäude stand und zögerte, die Treppe hinaufzugehen. Dort oben, hinter den weiß gestrichenen Holztüren, saß der erste fremde Mensch, der meine Zeichnungen zu Gesicht bekommen würde, und von seinem Urteil hing einiges für mich ab. Ich wußte genau, daß seine Einschätzung mehr bedeutete als die erste in einer langen Reihe von kommenden; ich wußte, daß ich nicht genug Energie haben würde – und auch nicht genug Ehrgeiz –, um mein Glück immer wieder aufs neue zu versuchen. Es war verdammt gut möglich, daß ich, wenn dieser Redakteur meine Zeichnungen für schlecht befand, die Mappe zuklappen und für alle Zeiten in der hintersten Ecke meines Schrankes begraben würde. So war es kein Wunder, daß ich, als ich endlich die Treppe hinaufstieg, am liebsten wieder umgekehrt wäre; und weil das nicht ging, weil mein Stolz das nicht zuließ, schleppte ich mich also hinauf, und dabei kam es mir vor, als ob ich rückwärts ginge, so als seien Gewichte an meinen Fersen befestigt, die meine Füße unweigerlich wieder nach hinten zogen, wenn ich sie vorwärts setzte.
Drinnen empfing mich eine wohltuende Kühle. Dunkel gemusterter Teppich bedeckte den Boden der weißgestrichenen Halle, von der rechts und links Türen abgingen. An den Wänden hingen großformatige Bilderrahmen, die ausgewählte Titelbilder aus den letzten zwei Jahren zur Schau stellten. Es gab keinen Empfangstresen, dafür aber prangte an der Tür ganz rechts ein Messingschild mit der Aufschrift „Anmeldung“. Ich holte tief Luft, klopfte an und trat ein. Eine Blondine mittleren Alters mit einer goldgeränderten Brille, die bedrohlich weit vorne auf ihrer Nasenspitze saß, blickte lächelnd von ihrem Schreibtisch auf. Das Lächeln zerbröckelte allerdings leicht, als sie mich näher in Augenschein nahm.
„Ja bitte?“
Ich nannte meinen Namen, erklärte mein Anliegen und blickte betont gleichgültig aus dem Fenster, während sie mit spitzen Fingern einen Knopf auf ihrer Gegensprechanlage drückte und mit zuckersüßer Stimme hineinsprach. Ohne hinzusehen, wußte ich, daß sie mich abschätzend musterte. Ich hatte mich extra feingemacht und mir auf Dennis’ Anraten hin eins seiner taubenblauen Jacketts ausgeliehen. Aber da waren immer noch meine ausgetretenen Cowboystiefel, die zerrissene, wenngleich saubere Jeans und meine viel zu kurzen Haare, und als die Sekretärin ihr Gespräch beendet hatte und ich wieder zu ihr hinsah, war mir klar, daß ich, wenn es nach ihr gegangen wäre, auf dem schnellsten Wege wieder hätte verschwinden sollen. So aber setzte sie erneut ein brüchiges Lächeln auf und bat mich zu warten, bis der Herr Schuhmacher mich hereinbitten würde.
Draußen ließ ich mich benommen auf einen der umherstehenden Freischwinger fallen und trommelte ungeduldig auf meiner Mappe herum. Was versprach ich mir eigentlich von diesem Vorstellungsgespräch? Wollte ich wirklich ernsthaft versuchen, mich in einem Metier zu etablieren, in dem sich andere, weitaus fähigere Leute gegenseitig auf die Füße traten? Ich hatte noch nicht einmal eine Kunsthochschule besucht, geschweige denn irgend etwas veröffentlicht, von ein paar Comics in meiner alten Schülerzeitung einmal abgesehen. Alles, was ich vorzuweisen hatte, waren ein paar Zeichnungen und eine seit genau vier Monaten bestehende Begeisterung, mich eingehend mit Bleistift und Radiergummi zu beschäftigen. Ich saß da und fühlte, wie mir der Mut sank, wie jene Unbeständigkeit, die mich seit Jahren durchs Leben trieb, von mir Besitz ergriff, da öffnete sich eine der Holztüren, und eine Frau trat heraus. Und augenblicklich vergaß ich alles, worüber ich mir gerade noch Gedanken gemacht hatte.
„Ja“, rief sie nach hinten in den Raum hinein, „ich melde mich, wenn ich zurück bin, aber diesmal wäre ich Ihnen dankbar, wenn Sie mir die Andrucke schneller zuschicken würden. Bis dann!“ Ihre Stimme war angenehm dunkel und leicht kratzig, so als wäre sie kürzlich heiser gewesen und hätte sich noch nicht ganz davon erholt. Sie zog die Tür zu und setzte sich in Bewegung, wobei die Fototasche, die ihr von der Schulter hing, schwer hin und her baumelte. Ich starrte sie unverhohlen an. Vielleicht war es ihr Gesicht, dessen scharfgeschnittene Züge auf aufregende Weise mit den schmalen, aber weich geschwungenen Lippen in Kontrast standen, vielleicht waren es ihre lässigen Bewegungen, vielleicht war es auch einfach ihre ganze Ausstrahlung, die einer weltgewandten, energischen und irgendwie geheimnisvollen Frau Anfang Dreißig; auf jeden Fall war ich fasziniert. Im Vorbeigehen warf sie mir einen kurzen Blick zu, und etwas in meinen Augen mußte sie alarmiert haben, denn an der Tür hielt sie inne, drehte sich langsam um und kam zurück.
Unmittelbar vor mir blieb sie stehen, und ich sah zu ihr auf. Plötzlich war ich mir der Schäbigkeit meines Aufzugs nur zu deutlich bewußt, und liebend gern hätte ich meine alte, abgeschabte Mappe, die Jörn, Pauls Freund, gestern für mich herausgekramt hatte, gegen eine neue, ordentliche ausgetauscht.
„Entschuldige, wenn ich dich einfach anspreche“, sagte sie und fuhr sich mit einer Hand durch ihr schulterlanges Haar, „aber vielleicht hast du Lust, mit mir einen Kaffee trinken zu gehen?“
Vor Überraschung blieb mir die Sprache weg. „Ich kann nicht“, brachte ich nach einem Moment mühsam hervor.
Sie blieb abwartend stehen und sah mich an. Das war eine ihrer herausstechenden Charaktereigenschaften, wie ich später noch feststellen sollte: Sie wartete immer solange ab, bis ich mich von selbst erklärte.
„Ich hab einen Termin“, fügte ich schließlich hinzu. Unter ihrem durchdringenden Blick, der nicht die Spur eines Lächelns zeigte, schoß mir das Blut ins Gesicht.
„Und danach?“
„Danach hab ich Zeit, also, ich …“ Ich fing an zu stottern. Endlich lächelte sie.
„Wenn du Lust hast“, sagte sie und schulterte ihre Fototasche noch mal, „schräg gegenüber ist ein Café, da bin ich die nächste Stunde über zu finden.“
Die Tür hinter ihr ging auf, und ein grauhaariger, aber noch recht junger Mann schaute heraus.
„Frau Liersch?“
„Ja!“ Eilig sprang ich auf. Sie grinste mich an.
„Viel Glück“, sagte sie, drehte sich um und ging. Und ich rannte hastig auf die Tür zu, so hastig, daß ich fast über meine eigenen Füße gestolpert wäre.
Herr Schuhmacher blickte mir mit hochgezogenen Augenbrauen entgegen, und ich glaube, in diesem Moment war es schon fast entschieden. Alles war entschieden in diesem Moment.
Er sah sich meine Zeichnungen gar nicht richtig an. Zügig blätterte er eine nach der anderen um, nur manchmal verweilte sein Blick etwas länger, und währenddessen fragte er mich langsam aus. „Und bisher haben Sie …“
Ich schwieg, weil ich nicht wußte, was ich darauf antworten sollte. Unter meinem Hintern machte der glatte Ledersitz ein quietschendes Geräusch, als ich unbehaglich ein Stück nach vorn rutschte.
„Äh … was hatten Sie bisher noch gleich gearbeitet?“ setzte er noch einmal an.
„In der Gastronomie.“
„Ah ja.“ Seine Miene war undurchdringlich.
Das Rascheln der Blätter erfüllte den Raum. Ich sah aus dem Fenster, hinter dem sich zwei schlanke, zarte Birken in einer leichten Sommerbrise wiegten, und ich fragte mich, ob diese Frau wirklich auf mich warten würde.
Der Redakteur klappte meine Mappe zu und legte seine gefalteten Hände darauf. Die Geste hatte etwas Abschließendes, und noch bevor er den Mund aufmachte, wußte ich, was er sagen würde, und auch, daß es mich gar nicht mehr interessierte.
„Tja, Frau Liersch, ich kann Ihnen nicht viel Hoffnung machen. Sie sehen ja, wir haben eine sehr begrenzte Auswahl an Illustrationsmöglichkeiten jeden Monat. Und es gibt natürlich auch schon andere Illustratoren, die für uns tätig sind. Aber Ihre Zeichnungen haben durchaus etwas Vielversprechendes, und ich würde vorschlagen, wir verbleiben so, daß ich Sie anrufe, wenn sich etwas ergibt.“
Kurz darauf stand ich wieder in der Halle. Herr Schuhmacher hatte mich artig hinauskomplimentiert, und noch bevor die Tür hinter mir zugefallen war, hatte ich ihn bereits wieder vergessen. Natürlich wußte ich da noch nicht, daß sein Gerede nicht nur leeres Geschwätz gewesen war; nein, ein paar Wochen später hörte ich tatsächlich von ihm, er rief mich an und gab mir einen Auftrag für eine Zeichnung, die Illustration einer Umfrage. Es sollte der einzige Auftrag sein, den ich je erhalten würde. Aber an diesem 14. August, als ich da in der Halle stand, mit durchgeschwitztem Hemd und verstrubbeltem Haar, berührte mich die Frage meiner zeichnerischen Laufbahn schon gar nicht mehr sonderlich. Was mich berührte, war der Gedanke an diese Frau mit den dunklen, zurückgeworfenen Haaren, diese unglaublich schöne Frau, die, wenn sie es sich nicht anders überlegt hatte, im Café schräg gegenüber auf mich wartete.
Ich wollte nicht hierbleiben, in der Halle, wo jeden Moment die Sekretärin oder, schlimmer, der Redakteur die Tür öffnen konnte. Aber ich wollte auch noch nicht in das Café gehen. Ich war einfach noch nicht bereit dazu. Das einzige, was mir einfiel, war schließlich, mein Jackett auszuziehen und tief durchzuatmen. Augenblicklich fühlte ich mich wohler. Ich zog mein T-Shirt ein Stück weit aus dem Bund meiner Jeans, atmete noch einmal tief durch und trat ins Freie.
Die grelle Sonne traf mich wie ein Schlag ins Gesicht. Ich hatte vergessen, wie heiß es war, und die trockene Luft schien sich bei jedem Atemzug tief in meine Lungen zu brennen. Unablässig donnerten Autos und Lastwagen auf der vierspurigen Straße vorüber, Motorräder knatterten dröhnend Auspuffgase in den Himmel, und die Fußgänger liefen, gedrängt von dem Wunsch, der Hitze zu entkommen, eilig vorbei. Schräg gegenüber, von ausgedörrten Rosenbüschen eingerahmt, die in quaderförmigen Betonkästen ihr Dasein fristeten, lag das Café. Die rot-weiß gestreifte Markise war voll ausgefahren, und an den kleinen weißen Plastiktischen drängelten sich die Gäste. Ich schirmte die Augen mit der Hand ab und sah hinüber. Sie war nicht da. Einen Moment überlegte ich, ob ich mich davonmachen sollte, aber dann siegte meine Neugier. Ich wartete eine Lücke im fließenden Verkehr ab, rannte über die Straße und trat in das schattige Dunkel des Cafés.
Sie saß an einem der hinteren Tische und betrachtete konzentriert und mit einem selbstvergessenen Ausdruck im Gesicht ein paar Fotos, die sie vor sich ausgebreitet hatte. Ich stand still da und ließ ihren Anblick auf mich wirken. Sie wäre mir auch an jedem anderen Ort der Welt aufgefallen, und das lag nicht nur an der Art, wie sie leicht vornübergebeugt dasaß: die langen Beine in den verblichenen Cordhosen übereinandergeschlagen, einen Ellbogen auf dem Tisch aufgestützt, rührte sie mit einer Hand in ihrem Kaffee, mit der anderen fuhr sie sich nachdenklich durchs Haar. Der Moment währte nur kurz, denn im nächsten Augenblick hob sie den Kopf und sah direkt zu mir herüber, und ich setzte mich in Bewegung und ging langsam auf sie zu, wobei mir das laute Klacken meiner Absätze auf den glatten Fliesen nur zu deutlich bewußt war.
„Hallo“, sagte sie und machte eine einladende Geste mit der Hand. „Setz dich. Das ging ja schnell.“
Ich zuckte mit den Schultern und ließ mich auf dem Stuhl ihr gegenüber nieder. Plötzlich fragte ich mich, worüber wir sprechen sollten. Ich für meinen Teil hatte nicht das Gefühl, in der Lage zu sein, irgendwelche Belanglosigkeiten austauschen zu können.
Aber dazu kam es auch gar nicht. „Ich hoffe, ich hab dich nicht allzusehr überfallen“, sagte sie und schob die Fotos zu einem Haufen zusammen. „Es ist nicht unbedingt meine Art“, sie blickte zu mir auf und hob die Augenbrauen, „aber es hat mich einfach so überkommen.“ Sie sah mich abwartend an, und als ich mit den Schultern zuckte, begann sie zu grinsen. „Was möchtest du trinken?“
„Eine Cola, bitte.“ Ich wich ihrem Blick aus, und während sie beim Kellner, der wie aus dem Nichts aufgetaucht war, bestellte, betrachtete ich unauffällig das oberste Foto auf dem Haufen. Es zeigte eine Gruppe dunkelhäutiger Kinder beim Baden in einem Fluß.
„Atlanta“, sagte sie.
Ertappt lehnte ich mich zurück und tastete nach meinem Jackett. In der Innentasche fand ich meinen Tabak, zog ihn hervor und öffnete das Päckchen.
„Nur zu“, sie hörte nicht auf, mich zu mustern, „du kannst sie dir gerne ansehen.“
„Vielleicht später.“ Ich spürte, wie ich unter den Achseln zu schwitzen begann. Verlegen drehte ich mir eine Zigarette. Immer noch spürte ich ihren forschenden Blick auf mir.
Sie schnalzte leise mit der Zunge, lehnte sich ebenfalls zurück und zog eine Schachtel Zigaretten aus ihrer Westentasche. Es war eine von diesen Westen aus grobem Stoff, auf denen Unmengen von Taschen aufgenäht sind, so eine, wie sie Fotografen im Fernsehen tragen.
„Du bist Fotografin“, stellte ich fest.
„Ist nicht zu übersehen, wie?“ Sie lachte. „Ja. In der Hauptsache mache ich Reisereportagen. Wie findest du Schuhmacher?“
Überrumpelt sah ich auf und direkt in ihre Augen. Sie waren grün, ein erstaunlich dunkles Grün, so dunkel, daß es fast ins Blaue tendierte, und im hellen Licht der Nachmittagssonne erkannte ich die kleinen goldenen Sprenkel in der Iris.
„Ganz in Ordnung“, sagte ich langsam. „Aber irgendwie hat er etwas Schleimiges.“
„Das liegt an der Art, wie er sich immer leise räuspert, bevor er zum Sprechen ansetzt.“ Sie beugte sich vor, um mir Feuer zu geben, und unsere Finger berührten sich flüchtig. Ein Schauer durchlief mich, und ich hatte Mühe, mich auf das zu konzentrieren, was sie gesagt hatte. Vorhin war mir das gar nicht aufgefallen, aber jetzt, wo sie es erwähnte, fiel mir wieder ein, wie jeder Satz, den Schuhmacher hervorgebracht hatte, von einem leisen Räuspern eingeleitet wurde, so als müßte er immer erst einen Kloß im Hals herunterschlucken, bevor er sprechen konnte. Ich grinste.
„Stimmt. Gut beobachtet.“
Sie lachte amüsiert und leckte sich leicht mit der Zunge über die Oberlippe, und ich spürte, wie mir der Schweiß ausbrach.
Der Kellner brachte meine Cola. Sie schmeckte abgestanden, aber das war mir egal. Gierig trank ich in großen Schlucken, und dabei hatte ich das Gefühl, um ein Haar vor dem Verdursten gerettet worden zu sein.
„Ich habe mich gar nicht vorgestellt“, sagte sie, wieder ernst geworden. „Ich bin Suzannah Hugo.“
Ich verstand ihren Namen nicht auf Anhieb. Sie mußte das erwartet haben, denn sie lächelte verschmitzt und erklärte: „Suzannah vorne mit S, in der Mitte mit Z und hinten mit H. Und Hugo wie der französische Schriftsteller, falls dir das was sagt.“
„Bist du Französin?“
„Ja. Aber ich bin als Kind viel in Deutschland gewesen. Meine Mutter ist Deutsche.“ Sie streckte eine Hand über den Tisch, und ich sah verdutzt darauf nieder, bevor ich meine eigene hineinlegte.
„Thea … Liersch.“ Es war lange her, daß ich mich bei einem privaten Anlaß mit Vor- und Zunamen vorgestellt hatte.
„Ganz schön förmlich, wie?“ Sie hielt immer noch meine Hand, und die Berührung mit ihrer kühlen, glatten Haut verursachte ein leises Kribbeln in meinem Bauch.
„Allerdings“, sagte ich. Wir sahen uns in die Augen, und nach einem Moment ließ sie meine Hand los und fuhr sich wieder durchs Haar.
„Na ja, das kann man ja ändern. Am besten fangen wir gleich damit an.“ Sie lächelte, und ich lächelte zurück.
Und es änderte sich wirklich. Es dauerte nicht lange, da waren wir in ein angeregtes Gespräch vertieft. Ich erfuhr, daß sie neunundzwanzig war, ursprünglich aus Paris kam, seit einem Jahr in Bremen wohnte und vorhatte, in Kürze nach Berlin zu ziehen. Und sie erfuhr, daß ich mich mit Gelegenheitsjobs durchschlug und daß meine Karriere als Zeichnerin soeben offensichtlich beendet worden war, noch bevor sie überhaupt begonnen hatte. Während die Sonne langsam sank und der Feierabendverkehr zu- und wieder abnahm, während sich die Tische um uns herum leerten und wieder von neuen Gästen in Beschlag genommen wurden, redeten und redeten wir, und jedesmal, wenn wir uns in die Augen sahen – und das geschah immer häufiger –, verdichtete sich in mir die Gewißheit, daß ich dabei war, eine ganz außergewöhnliche Bekanntschaft zu machen. In jeder Hinsicht außergewöhnlich.
Schließlich sah ich mir tatsächlich ihre Fotos an. Ich betrachtete Landschaften, in denen ich nie gewesen war, und Menschen, die ich nie kennenlernen würde, und dabei lauschte ich ihrer rauhen Stimme, die von Situationen und Begebenheiten erzählte. Ich sah ihren Fingern zu, wie sie auf die eine oder andere Stelle tippten und mit weichen Bewegungen über das glatte Papier strichen. Am Ende überwand ich sogar meine Scheu und zeigte ihr meine Mappe, und ich genoß es, ihren zurückhaltenden Kommentaren zu folgen, aus denen nur zu deutlich hervorging, daß sie meine Arbeit nicht schlecht, aber auch nicht gerade umwerfend fand.
Irgendwann schlug sie meine Mappe zu und sah auf ihre Armbanduhr.
„Oh, ich muß gehen. Ich habe eine Verabredung.“
Sie begann ihre Sachen zusammenzuräumen, dann hielt sie inne.
„Thea. Würdest du morgen mit mir essen gehen?“
„Ja“, sagte ich, viel zu schnell.
„Gegen acht? Ich könnte dich abholen. Bis dahin überlege ich mir was. Oder hast du einen Wunsch?“
„Nein.“
„Und wo finde ich dich?“
Ich dachte kurz nach. Schließlich schrieb ich ihr Pauls Adresse und Telefonnummer auf.
Sie musterte den Zettel und sah fragend zu mir auf. „Paul?“
„Das ist mein Onkel. Wenn was ist, kannst du mich dort am besten erreichen. Ich stehe morgen um acht vor der Tür.“
Sie wollte etwas sagen, aber dann schien sie es sich anders zu überlegen. Sie sah mich an, und wenn ich bis dahin noch einen Zweifel gehabt hatte, in welcher Hinsicht sie sich eigentlich für mich interessierte, dann wurde er in diesem Moment endgültig ausgeräumt. Es ist schwer, so etwas zu beschreiben: den plötzlichen Moment der Erkenntnis, daß es beiden um das gleiche geht, das instinktive Begreifen, aus einem Spiel mit lauter unbekannten Faktoren auf einmal in eine ernsthafte Gleichung hinübergeglitten zu sein. Sie sah mich eine ganze Weile an, und dann begann sie langsam zu lächeln. Ich lächelte zurück.
Draußen verabschiedeten wir uns hastig voneinander. Es war, als ob das milde Licht der Abendsonne uns beide verlegen machte.
„Bis morgen“, sagte sie. Ich nickte, und dann drehten wir uns gleichzeitig um und gingen schnell in entgegengesetzte Richtungen davon. Hinter der nächsten Straßenecke hielt ich an und atmete tief aus. Die Luft hatte sich ein wenig abgekühlt, und ich blieb eine ganze Weile stehen, reglos, mit wackeligen Knien und vor Anspannung leicht verkrampften Muskeln. Ich fühlte mich benommen und unwirklich. Das Blut schoß mit rasender Geschwindigkeit durch meine Adern, und mein Herz schlug schnell und kraftvoll.
In dieser Nacht schlief ich schlecht; immer wieder wachte ich auf und sah ihr Gesicht vor mir, und als ich am Morgen erwachte, wußte ich undeutlich, daß ich von ihr geträumt hatte. Irgendwie schlug ich mich durch den Tag, bemüht, cool zu bleiben, aber es gelang mir nicht. Ich besuchte Dennis auf der Arbeit, ging bei meiner besten Freundin Dörthe vorbei und auf einen Sprung ins Swing, aber ich war nicht in der Lage, mich auf irgend etwas oder jemanden zu konzentrieren. Die Stimmen und Gesichter rauschten an mir vorbei, der Boden, auf dem ich stand oder ging, schien nachzugeben und immerzu zu beben, und ich war heilfroh, als die Sonne endlich ihren langsamen Abstieg zum Horizont begann. Um sechs ging ich zu Paul, wo ich niemanden außer Theo antraf, der schwanzwedelnd an mir hochsprang. Ich duschte lange und so heiß, wie es ging, dann zog ich mich an und nahm Theo mit auf einen kleinen Spaziergang durch den nahegelegenen Park, und dann war es endlich acht Uhr.
Ich hatte kaum zwei Minuten vor dem Haus gestanden, als ein klappriger cremefarbener Citroën um die Ecke bog und vor dem Haus hielt. Suzannah beugte sich über den Beifahrersitz und stieß die Tür auf, und meine Beine begannen zu zittern. Sie schien genauso nervös zu sein wie ich, denn sie sah mich nur kurz an und dann wieder zur Seite, gab Gas, kaum daß ich die Tür geschlossen hatte, sah mich wieder an, und dann ließ sie die Kupplung zu schnell kommen. Das Getriebe knirschte vernehmlich, der Wagen hustete und stotterte und blieb mit einem gewaltigen Ruck mitten auf der Straße stehen. Hinter uns hupte ein wütender Taxifahrer, aber Suzannah reagierte nicht. Sie drehte sich zu mir um und betrachtete mich in aller Ruhe. Langsam ließ sie ihren Blick über mein Gesicht schweifen, und dann sagte sie: „Du bist also wirklich gekommen.“
„Du ja auch.“
Sie fing an zu lächeln, und ich grinste zurück. Das Taxi rauschte in einem rasanten Bogen an uns vorbei. Und Suzannah startete den Wagen erneut und fuhr los.
Die Zeit verging wie im Fluge. Stunde um Stunde saßen wir uns gegenüber, aßen, sprachen, sahen uns an; jeder ihrer Blicke war wie ein Streicheln, ihre Stimme wie ein Bett, auf dem ich ruhte, jedes ihrer Worte wie ein Anker, den sie mir zuwarf, ich hielt ihn fest und warf ihn zurück, und als wir aufbrachen, war unter all der Aufregung, all dem Begehren ein Gefühl der Nähe und Verbundenheit gewachsen, das mich beruhigte und zugleich zutiefst erschreckte.
In den vergangenen Stunden hatte es geregnet, und ein feiner Nebel hing in der Luft. Diesmal würgte Suzannah den Wagen nicht ab. Schweigend fuhren wir die kaum belebten Straßen entlang und lauschten dem satten Zischen der Reifen auf dem nassen Asphalt. Als wir die Yorckbrücken passierten, legte ich den Kopf in den Nacken und sah durch das Seitenfenster in den fahlen Himmel, den die mächtigen Brückenpfeiler in ungleichmäßige Rechtecke zerrissen.
Die Bautzener Straße ist eine ruhige Seitenstraße, die zwischen den Yorckbrücken und der Monumentenbrücke an den S-Bahngleisen entlangführt. Auf der rechten Seite erhebt sich eine lange Reihe von vierstöckigen Mietshäusern; gegenüber verläuft eine niedrige Mauer, in die in unregelmäßigen Abständen Tore eingelassen sind, die zu verschiedenen Handwerksbetrieben und Werkstätten führen. Aus verschmutzten Laternen fiel schwaches Licht auf den verlassenen Bürgersteig, als wir aus dem Wagen stiegen. Ich fühlte mich benommen und unwirklich. Suzannah schloß ab und kam um die Kühlerhaube herum zu mir.
„Es ist nicht besonders komfortabel bei mir“, sagte sie und steckte die Hände in die Hosentaschen. Langsam gingen wir nebeneinander her. Ich hätte sie gerne berührt, aber ich traute mich nicht. Unsere Schultern waren einen halben Meter voneinander entfernt, ein halber Meter, angefüllt mit Fremdheit, Distanz und Begehren.
„Es ist eine Art Kelleratelier, das einem Freund von mir gehört. Wenn ich hier bin, schlafe ich dort. Karl ist ein ziemlich unordentlicher Typ; ich hoffe, das stört dich nicht.“ Sie blieb vor einer Holztür zu ebener Erde stehen, von der grüner Lack in dicken Schichten abblätterte. Auf der rechten Seite hing neben einem durch ein verrostetes Gitter geschützten Fenster ein windschiefer Briefkasten, der mehrfach aufgebrochen worden war, den vielen Dellen und Kratzern nach zu urteilen. Das Türschloß sah aus, als wäre es seit Ewigkeiten nicht benutzt worden.
„Nett“, sagte ich.
„Wart’s ab, bis du drinnen bist.“ Sie steckte den Schlüssel ins Schloß, und mit einem leisen Quietschen öffnete sich die Tür.
Es dauerte einen Moment, bis Suzannah den Lichtschalter fand. Ein Geruch nach Farbe, Terpentin und Staub hing schwer in der Luft. Fahles Licht fiel aus einer nackten Glühbirne an der Decke. Wir standen auf einer kleinen Plattform, von der drei Stufen nach unten in einen quadratischen Raum führten. Neugierig sah ich mich um. Über den gesamten Holzfußboden verstreut lagen Kleidungsstücke, Werkzeuge und Zeitschriften. Unter dem Fenster stapelten sich Unmengen von Fotos, Papieren, Kamerazubehör, Schreibzeug und anderen Materialien auf einer einfachen Holzplatte von überdimensionalen Ausmaßen. An den Wänden, von denen der Putz abbröckelte, hingen Fotos in verschiedenen Größen, deren Ecken sich nach außen wölbten. Zu meiner Rechten, im Schatten eines verbogenen Regals, dessen Bretter unter der Last der achtlos hineingestopften Kleidungsstücke gefährlich durchhingen, lag eine schmale Matratze auf dem Fußboden. Eine dunkelrote Wolldecke war sorgsam darüber gebreitet. Am Kopfende stand eine altmodische schwarze Ledertasche mit silbernen Schnallen. Daneben war eine morsche Holztür in die Wand eingelassen.
Vorsichtig folgte ich Suzannah dorthin. Der kleine Raum dahinter diente offensichtlich als Küche, links lehnte neben einem uralten Kühlschrank ein wackeliger Spültisch an einen ziemlich verdreckten Gasherd, rechts waren zu meiner Überraschung eine Reihe blitzsauberer Chrombecken an der Wand befestigt.
„Unser Labor“, erklärte Suzannah. „Für Schwarzweiß-Entwicklungen.“
„Das machst du selber?“
Sie schmunzelte. „Ja, für gewöhnlich schon. Du kennst dich damit nicht aus, oder?“
„Nein. Ich kann gerade mal eine Polaroid-Kamera bedienen, aber wenn ich ehrlich bin, weiß ich noch nicht mal, wie ich da einen Film einlegen soll.“
Unschlüssig blieb ich stehen. Suzannah griff nach oben und schaltete eine Lampe ein, die über den Becken hing. Ein leises Summen ertönte, und die Küche wurde in ein rötliches Licht getaucht. Schlagartig begann ich zu schwitzen. Das Gefühl der Ruhe, das mich, seit wir das Restaurant verlassen hatten, begleitet hatte, war verflogen, und ich wußte auch warum. Wir würden miteinander schlafen, wir waren kurz davor, und ich hatte Angst. Weil sie mir so sehr gefiel.
Suzannah öffnete den Kühlschrank auf und holte zwei Bierflaschen heraus.
„Möchtest du ein Bier?“
Ich nickte. Sie öffnete beide Flaschen und reichte mir eine. Ich nahm sie und hielt mich daran fest. Die Flasche war eiskalt.
Suzannah drückte die Kühlschranktür mit dem Absatz zu und lehnte sich dagegen. In dem rötlichen Licht sah sie unwirklich aus, so unwirklich, wie ich mich fühlte.
„Auf uns“, sagte sie leise und hob ihr Bier. Nach einem Moment tat ich es ihr gleich. Über unsere Flaschen hinweg sahen wir uns an. Langsam ließ ich meinen Blick über ihr Gesicht wandern, von den Augen hoch zur Stirn, auf der sich bereits die ersten Ansätze jener Falten zeigten, die sich mit den Jahren immer mehr vertiefen würden, über die hohen Wangenknochen bis hinunter zu ihrem energischen Kinn, über die fein geformten Lippen und die gerade geschnittene Nase wieder hinauf zu ihren Augen, die mich immer noch unverwandt ansahen. Jeden Zentimeter Haut, jeden Flecken ihres Gesichts prägte ich mir ein, und wenn es einen Knopf gegeben hätte, mit dem ich mir ihren Anblick tief in die Netzhaut hätte einbrennen können, so hätte ich ihn in diesem Moment gedrückt. Denn plötzlich fürchtete ich, sie nach dieser Nacht nie wiederzusehen. Ich wußte bereits, daß ich mehr von ihr wollte. Mehr, als ich mir vorstellen konnte, und mehr, als ich in diesem Augenblick zu glauben bereit war. Als mir aufging, in welchen Dimensionen ich da gerade dachte, setzte ich hastig die Flasche an die Lippen und trank. Eiskalt und würzig rann mir das Bier die Kehle hinunter in meinen aufgewühlten Magen.
Suzannah streckte einen Arm aus und legte mir die Hand um den Nacken. Einfach so. Und ich bewegte mich, wie von Schnüren gezogen, auf sie zu. Sie legte ihre Arme um mich; ich stellte meine Flasche irgendwo hinter ihrem Rücken ab, mit halbem Ohr hörte ich, wie sie umfiel und das Bier leise gluckernd hinauslief, aber das störte mich nicht. Ich zog Suzannah fest an mich, spürte mit meinen Fingern ihre Rückenmuskeln, die sich dehnten und wieder zusammenzogen, als sie mich noch enger an sich preßte. Ich roch den süßen und herben Duft nach Hitze und Schweiß, und dann küßte ich ihren Hals, ließ meine Lippen über die zarte Haut gleiten, über ihre Wange hinauf bis zu ihrem Ohr. Sie fühlte sich unglaublich weich an, so weich, daß mir schwach in den Knien wurde, und dann drehte sie ihren Kopf zu mir, und nach einem Moment, nach einem kurzen Moment des Zögerns küßten wir uns. Und ich versank in ihrem Mund.
Es ist nie wirklich einfach beim ersten Mal, nicht, wenn man verliebt ist. Die Vorstellung, die Liebe, die frisch entflammte Liebe befähige uns zu einem perfekten Liebeserlebnis, bei dem jeder Handgriff, jede Berührung stimmt, bei dem es kein Zögern, keine Unsicherheit, keine Angst gibt, sie ist eine Mär. Es ist immer ein Wandern auf unsicherem Weg, und jedes Stocken, jedes Verharren wird zu einem Stein, über den man zu stolpern droht und es so manches Mal auch tut. Und warum sollte es auch anders sein? Der Mensch, den man so sehnlich begehrt und endlich in den Armen hält, ist einem fremd, seine Vorlieben und Wünsche sind einem unbekannt, sein Körper hat Berührungen erfahren – und gemocht oder als unangenehm empfunden –, die wir nicht im geringsten erahnen können. Und so ist immer eine Art zarter Unbeholfenheit dabei in jeder ersten Nacht. Und so war es auch mit Suzannah.
Wie im Fieber fühlte ich mich, als wir, Arme und Beine fest ineinander verschlungen, die paar Schritte von der Küche zum Bett taumelten. Mir war heiß, meine Kleider klebten mir am Leibe, und die Luft schien aus warmfeuchtem Nebel zu bestehen, der bei jedem Atemzug sirrend durch meine Kehle zischte. Es gab einiges Gerangel, als wir, behindert durch die rote Wolldecke, in der sich unsere Beine verfangen hatten, versuchten, uns gegenseitig auszuziehen. Meine Finger verhakten sich in ihren Gürtelschlaufen, und als sie mir das Hemd über den Kopf zog, wurde mein Ohr unsanft nach oben gequetscht. Wir sprachen kein Wort, und ich glaube, ihr Gesicht, gerötet von der Hitze und Aufregung, spiegelte denselben ernsthaften, erregten und auch ein wenig ängstlichen Ausdruck wider wie meins.
Es dauerte eine Ewigkeit, bis wir endlich nackt waren, und die ganze Zeit über hörte ich ihren Atem, leise zunächst, dann immer heftiger, bis er sich zu einem Stöhnen verstärkte. Ich sog ihren Duft in mich ein, spürte ihren Körper, der sich straff und fest in seiner weichen Hülle aus zarter Haut auf und an mir bewegte, und unser Schweiß vermischte sich und machte uns rutschig und glatt. Und dann saß sie auf mir, ihre kleinen runden Brüste reckten sich vorwärts, aus halbgeschlossenen Augen sah sie auf mich hinab, und endlich wich der Ernst aus ihren Zügen, sie lächelte, lächelte mich an, „Thea“, sagte sie, „langsam, mach langsam“, und noch während sie sprach, während ich zusah, wie ein Tropfen Schweiß ihre Schläfe hinunterlief, am Kinn entlang und von dort aus auf meinen Bauch fiel, während ich zusah, wie ihre Schultern sich spannten, wie sie ihren Kopf zurückwarf und ihre Hüften nach vorn gleiten ließ, währenddessen schob ich meine Hand sanft unter ihren Hintern, zwischen ihr Fleisch und meins, und langsam, langsam ertastete ich feuchte Haut und Locken und Lippen, glitt weiter und weiter, und einen Moment verharrte ich, sie warf den Kopf herum, sah mich an, ihre dunklen Augen loderten auf, und dann war ich in ihr.
Nach und nach nahm ich die Außenwelt wieder war. Immer noch brannte die Glühbirne an der Decke und warf ihr fahles Licht in den Raum. Der Kühlschrank schnaufte und verstummte dann. Sie lag matt und heiß neben mir, einen Arm über meine Brust gelegt, ihr Kinn nur einen Fingerbreit von meiner Schulter entfernt. Ich spürte mein Herz klopfen, immer noch schnell. Als sie sprach, war ich fast erschrocken, so sehr war ich in meiner eigenen Welt versunken.
„Nimm mich in den Arm“, flüsterte sie. Ich sah sie an. Ihre Augen waren schwer, trunken von satter Lust, und als ich mich halb zu ihr drehte und meine Arme um sie legte, schmiegte sie sich an mich und seufzte auf. Ich konnte ihr Lächeln an meiner Wange spüren. „Thea“, sagte sie leise. Und dann schlief sie ein.