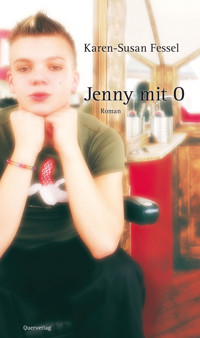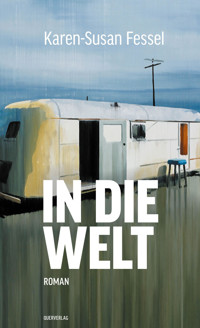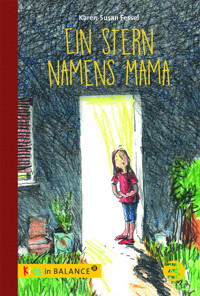Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Querverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Endlich! Als Noni im Netz eine Gruppe von trans* Jugendlichen entdeckt, passen die Puzzleteile auf einmal zusammen und das Leben scheint jetzt in genau die richtigen Bahnen zu gleiten. Zum ersten Mal fühlt Noni sich zugehörig und verstanden, bekommt nicht nur von der Familie, sondern auch von Fachleuten Unterstützung, und dann taucht auch noch Mirna auf ... und plötzlich wird alles dann doch wieder ganz anders … Einfach nur Noni bricht ein ganz neues Tabu und erzählt die Geschichte einer beginnenden Transition. Doch Noni muss den bereits eingeschlagenen Weg noch einmal neu überprüfen und dabei erneut gegen Widerstände, Vorurteile und Rollenvorstellungen ankämpfen – und sich den elementaren Fragen stellen: Wie erkennen wir, was wir wirklich sind? Und ist es nicht manchmal schwerer, den vermeintlich einfacheren Weg zu gehen? Und was, wenn dieser bereits eingeschlagene Weg sich als falsch erweist?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 341
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Arbeit der Autorin am vorliegenden Buch wurde vom Deutschen Literaturfonds e.V. gefördert.
Die Handlung, die Figuren und manche Schauplätze dieses Romans sind fiktiv. Ähnlichkeiten mit lebenden und toten Personen sind unbeabsichtigt.
© Querverlag GmbH, Berlin 2023
Erste Auflage September 2023
Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Umschlag und grafische Realisierung von Sergio Vitale.
ISBN 978-3-89656-691-1
Bitte fordern Sie unser Gesamtverzeichnis an:
Querverlag GmbH
Akazienstraße 25, 10823 Berlin
www.querverlag.de
Kapitel 1
Mir ist schlecht.
Mir ist richtig schlecht.
Ich hole tief Luft und kneife die Augen zu. Eine ganze Weile lausche ich meinem Herzschlag, dann mache ich sie wieder auf. Die Wand vor mir ist hellgelb gestrichen, die Decke weiß. Fast so wie in Mirnas Zimmer. Ich mache die Augen wieder zu.
Wenn sie mich jetzt sehen würde. Himmel.
Die Tür geht auf, meine Augen auch.
„Herr Grimme?“
Eine der Sprechstundenhilfen steht in der Tür. Eine, die ich noch nicht kenne, dünn, dunkelhaarig, gestresstes Gesicht. Unglaublich. Wie viele Sprechstundenhilfen arbeiten denn hier?
„Herr Grimme, einen Moment noch, Doktor Schreiber kommt gleich.“
„Okay“, sage ich. Sie nickt, sieht mich noch einen Moment lang an, dann schließt sie wieder die Tür.
Ich muss fast lachen. Deswegen hat sie jetzt reingeguckt? Wegen dieser völlig überflüssigen Information? Oder wollte sie mich einfach sehen? Mal gucken, wie der neue Transjunge so aussieht?
Ich baumele einen Moment mit den Beinen, dann strecke ich mich probehalber auf der Liege aus. Auf dem Bauch natürlich.
Mann, ist die hart. Wie können die Leute im Krankenhaus nur stundenlang auf so was liegen?
Was für eine blöde Frage – weil sie müssen. Weil sie krank sind und untersucht werden müssen. Oder behandelt werden müssen.
Ich allerdings muss nicht. Ich will.
Oder muss ich doch?
Will ich? Muss ich?
Mist.
Der harte Schaumstoff drückt mir in die Wange, und ich setze mich wieder hin und baumele mit den Beinen.
Mir ist immer noch schlecht.
Die Tür geht auf, und Doktor Schreiber kommt herein, mit energischem Schritt. „Noni!“, ruft er und lächelt mich an, während er einen Hefter auf seinem Tisch ablegt. Dann streckt er die Hand aus und drückt meine, ziemlich fest. „So, heute ist also der große Tag. Wie fühlst du dich?“
Ich zucke mit den Schultern. Plötzlich will ich nicht mehr auf der Liege sitzen. Ich stehe auf, aber jetzt weiß ich nicht, wohin mit meinen Händen. „Mir ist ein bisschen schlecht“, sage ich, obwohl ich gar nicht vorhatte, das zu sagen.
Doktor Schreiber sieht mich genauer an. „Aufgeregt? Das ist ja vollkommen verständlich. Es ist ja auch aufregend.“ Er lächelt, dann legt er den Kopf schief. „Oder ist es eine andere Art von Übelkeit?“
„Nein“, sage ich, „nein, schon okay. Ich bin vielleicht wirklich etwas aufgeregt.“
„Ja, ja“, sagt Doktor Schreiber. „Ja, das ist durchaus normal. Nun, dann lass uns mal sehen …“ Er schlägt den Hefter auf und liest darin. Ich lehne mich wieder an die Liege und beobachte ihn.
Doktor Schreiber ist ziemlich groß, schlank und total energisch. Tatkräftig, hat Mama gesagt, nachdem wir das erste Mal zusammen bei ihm waren. „Ein tatkräftiger Mann. Bei so einem hat man immer das Gefühl, dass er genau weiß, was er tut.“ Die Pause, die sie danach einlegte, hat mir allerdings verraten, dass Mama davon nicht ganz überzeugt war.
Aber ich hab sie nicht weiter danach gefragt.
Doktor Schreiber lächelt mich an, sieht in seinen Hefter und schiebt ihn ganz an den Rand des Tisches, um die Hände vor sich zu falten. Er blickt mich nachdenklich an, dann lächelt er. „So, du weißt ja über alles Bescheid. Wir schreiten dann am besten gleich zur Tat, damit die Spannung nicht ins Unerträgliche steigt.“ Er lächelt noch einmal und richtet sich auf. „Leg dich bitte da hin, auf den Bauch, und ziehe deine Hose ein Stückchen runter.“
Ich stehe auf und gehe zur Liege rüber, während Doktor Schreiber seine Sprechstundenhilfe hereinruft. Vorsichtig lege ich mich hin, greife nach hinten und zerre meine Jogginghose halb über den Hintern. Ich habe extra diese angezogen, weil sie so bequem ist.
Hinter mir murmeln Herr Schreiber und seine Sprechstundenhilfe etwas, und ich höre ein Klimpern. Geräusche.
„Herr Schreiber“, sage ich. Meine Stimme klingt seltsam, irgendwie heiser.
„Ja, bitte?“ Doktor Schreiber tritt in mein Blickfeld.
„Kann ich vielleicht doch lieber dieses Gel kriegen? Also, keine Spritze?“
Doktor Schreiber stutzt und sieht mich kurz fragend an, dann nickt er. „Natürlich“, sagt er. „Das geht auch. Aber das würde ich dann doch gern zusammen mit deiner Mutter besprechen.“
„Die ist draußen im Wartezimmer.“
„Wir holen sie mal rein.“ Doktor Schreiber nickt seiner Sprechstundenhilfe zu. „Setz dich dann bitte auf den Stuhl da drüben. Wir reden noch mal.“
Ich falle fast von der Liege, als ich mich aufrichte, und spüre, dass ich rot angelaufen bin, während ich mir die Hose wieder hochziehe. Ist das peinlich. Wieso habe ich nicht vorher gefragt?
Doktor Schreibers Gesicht ist ausdruckslos, als er sich zur Tür dreht, durch die meine Mutter hereinkommt. Sie sieht irritiert aus, aber irgendwie auch erleichtert.
Ich sitze stumm neben ihr, während Doktor Schreiber uns beiden genau erklärt, wie ich das Gel anwenden soll und in welcher Apotheke ich es bekomme.
Dann gehen wir.
Draußen sieht Mama mich an. Und ich kann diese ganzen, ganzen Fragen in ihren Augen sehen.
All diese Fragen, auf die ich keine Antwort habe.
Ich stecke die Fäuste tief in meine Hosentaschen, und Mama kneift die Augen zusammen und streichelt mir kurz über die Wange.
„Wollen wir zur Apotheke und dann ein Eis essen?“, fragt sie. Und hinter ihr scheint die Sonne.
* * *
Nach dem allerersten Besuch bei Doktor Schreiber damals haben wir hinterher auch Eis gegessen, obwohl es Februar war und nicht Mai und ziemlich kalt.
Auf dem Hinweg ging Mama neben mir her wie auf Stelzen, total steif. Sie war furchtbar nervös, aber ich war es auch.
Die Praxis sah okay aus, normal eben, hell, viel Licht und diese schicken, aber unbequemen Sitzschalenstühle im Wartebereich, in dem nur zwei Leute saßen, ein älterer Mann und eine ziemlich junge Frau. Mama meldete uns am Empfang an und sprach dabei so leise, dass ich fast nichts verstand, obwohl ich direkt neben ihr am Tresen lehnte. Die Sprechstundenhilfe nickte und lächelte erst Mama und dann mich freundlich an.
„Dann bräuchte ich mal die Versichertenkarte, bitte“, sagte sie zu mir.
Klar. Und jetzt würde sie meinen Mädchennamen sehen und mir einen zweiten, forschenden Blick zuwerfen. Genauso hatte ich es mir vorgestellt.
„Die kannst du hier selbst einlesen“, fügte sie hinzu.
Ich atmete erleichtert aus und schob meine Karte in das Lesegerät auf dem Tresen.
„Das war’s schon. Nehmen Sie doch bitte da drüben im Wartezimmer Platz“, sagte sie und hantierte geschäftig mit ihren Unterlagen.
Mama und ich setzten uns nebeneinander direkt vor das Fenster. Ich konnte richtig spüren, dass sie von Minute zu Minute nervöser wurde. Mir ging es genauso. Um mich abzulenken, versuchte ich, die anderen Wartenden verstohlen zu beäugen. Warum die wohl hier waren?
„Familie Grimme?“ Plötzlich stand ein großgewachsener Mann mit leicht ergrauten Schläfen im Durchgang und sah mit scharfem Blick zu Mama und mir. Mama stand auf, aber ich blieb verdutzt sitzen.
„Sind wir schon dran?“, fragte ich und merkte sofort, dass ich rot anlief. Ich sprang ebenfalls auf und trabte hinter Mama und dem Arzt her. Sie waren beide gleich groß, das fiel mir auf.
In seinem Zimmer setzte sich Doktor Schreiber hinter den Tisch und bedeutete Mama und mir, in den beiden Sesseln davor Platz zu nehmen. Dann verschränkte er die Hände und lehnte sich zurück.
„Schön, dich kennenzulernen – ich darf dich doch duzen, oder? Was führt dich her?“, sagte er und nickte mir zu.
Ich holte Luft. Levi hatte mich gut vorbereitet auf das, was jetzt kommen würde, aber trotzdem wusste ich auf einmal nicht, was ich sagen sollte. Oder besser, wo ich anfangen sollte.
„Mein … Noni möchte gern Hormone nehmen“, sagte Mama.
Doktor Schreiber nickte und sah weiterhin mich an. „Und seit wann hast du diesen Wunsch?“, fragte er freundlich. Seine Stimme war ruhig und angenehm, aber trotzdem fühlte ich mich nicht imstande, sofort zu antworten.
Ich holte noch mal Luft, dann setzte ich mich anders hin. „Also, ich … ich … eigentlich schon echt lange. Also bestimmt zwei Jahre oder so“, sagte ich.
Mama drehte ruckartig den Kopf und starrte mich kurz an, bevor sie die Fassung wiedergewann.
„Zwei Jahre, das ist ja schon eine ganze Zeit“, sagte Doktor Schreiber und klappte meine Krankenakte auf und wieder zu. „Du bist jetzt sechzehn. Das heißt, du fühlst dich in deinem dir bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht nicht zu Hause, seit du ungefähr vierzehn bist, ist das richtig?“
Ich zögerte. Dann nickte ich. „Ja, ungefähr, ja.“
Doktor Schreiber nickte erneut, dann legte er die Akte vor sich auf den Tisch. „Und warum kommst du erst jetzt?“, fragte er ruhig.
Ich sah auf meine Hände hinunter. Dann kratzte ich mich im Nacken und dann, erst dann, sah ich kurz zu Mama rüber.
Mama erwiderte meinen Blick. „Also, ich glaube, ich war noch nicht so weit“, sagte sie leise.
* * *
Als wir eine gute halbe Stunde später wieder aus der Eingangstür ins Freie traten, war ich so durcheinander wie nie zuvor in meinem Leben. Und gleichzeitig tiefenentspannt. Doktor Schreiber hatte sich richtig viel Zeit genommen, um uns die ganze Prozedur genau zu erklären, die womöglich auf mich zukam, wenn ich mich für diesen Weg entscheiden sollte. Von all den medizinischen Fachbegriffen schwirrte mir der Kopf, aber zugleich hatte ich das Gefühl, einen riesigen Schritt in die richtige Richtung gemacht zu haben.
Endlich hatte ich es ausgesprochen, mich erklärt, und das nicht nur meiner Familie, Levi und den anderen Tranxkidz gegenüber, sondern vor einem Fachmann. Doktor Schreiber war Endokrinologe, ein ausgewiesener Spezialist auf diesem Gebiet. Er wusste, wie das alles ging. Er würde mir helfen.
Endlich war da ein Erwachsener, der mich ernst nahm und auf meiner Seite stand. Endlich war ich nicht mehr auf mich gestellt.
„Wollen wir ein Eis essen?“, fragte Mama.
„Klar, können wir machen.“ Ich hüpfte über eine achtlos fallengelassene Coladose hinweg und steckte die Hände tief in die Hosentaschen.
Endlich ging es voran.
Das Eiscafé war eines der wenigen, die das ganze Jahr über geöffnet haben, und trotz der kalten Witterung war es gut besucht. Zum Glück wurde ganz vorn an der Tür gerade ein Tisch frei, als wir reinkamen, und Mama und ich setzten uns so, dass wir freien Blick auf die Fußgängerzone hatten.
Mama sah total traurig aus, als sie in ihrem Eiskaffee rührte. Ich saß da, löffelte mein Eis im Rekordtempo und betrachtete die muskelbepackten Jungs, die draußen vorbeischlenderten. Gleich in der Nähe musste ein Fitnessstudio sein, denn die meisten von ihnen hatten Sporttaschen in der Hand und frischgegelte Frisuren, wenn sie nicht gerade Mützen trugen.
Fitness. Ob ich mich doch in einem anmelden sollte?
Ich nahm mein Basecap ab und drehte es in der Hand. Plötzlich spürte ich, dass Mama mich immer wieder von der Seite ansah.
„Mama“, sagte ich schließlich. „Guck mich doch nicht andauernd so an.“
Mama seufzte. „Ni…“, sagte sie, „Noni. Wann hat das alles eigentlich angefangen, was denkst du?“
Ich sah sie an und dann weg. „Ich glaube, ich möchte noch einen Schokoeisbecher“, sagte ich, und dafür kann ich mich heute immer noch nicht leiden.
Mama sah so verdammt verletzt aus, und das konnte ich ihr echt nicht verdenken. Aber es ging irgendwie nicht anders. Ich konnte einfach nicht darüber reden. Ich konnte nur blöde Sprüche machen oder vom Thema ablenken. Und das noch nicht mal gut.
„Ja, dann“, sagte Mama. „Also, wenn du die Kellnerin siehst, dann wink ihr mal, ja?“
* * *
Wann es angefangen hatte?
Schwierige Frage. Es gibt eine Unmenge von Momenten, in denen mir ein Licht aufging, mal ein kleines, mal ein größeres. Aber das Problem ist: Alles ließ sich auch immer irgendwie anders deuten.
Auch heute noch. Ich meine, was genau bedeutet es, wenn ein kleines Mädchen sich kreischend und schreiend dagegen wehrt, einen Rock anziehen zu müssen? Was heißt es, wenn es lieber Fußball spielen will statt Gummitwist hüpfen? Partout keine langen Haare tragen will? Blaue Pullis anziehen will statt rosafarbene? Hiphop tanzen will statt Ballett? Keine Lust hat, Mama beim Kochen zu helfen, und lieber zuguckt, wie der große Halbbruder sein Moped repariert?
Ist das Mädchen deswegen gleich ein Junge? Oder eben ein Mädchen, das gern Fußball spielt, gern blaue Pullis trägt und kurze Haare?
Und bitte, wer soll das schon genau beantworten können?
Also, ich jedenfalls weiß nicht genau, wann es angefangen hat. Ich hab das Gefühl, ich war schon immer so wie jetzt – kein richtiges Mädchen, sondern eher ein Junge. Obwohl, das „eher“ kann man ja auch streichen.
Aber richtig angefangen hat es wahrscheinlich, als ich vor einem guten halben Jahr im Netz unterwegs war und diese Videoclips sah.
Ich kann mich immer noch ganz genau daran erinnern. Es war ein milder Abend Anfang September, und ich hatte einen ganzen langen Sommer voller Frust und Hass auf meinen beschissenen Mädchenkörper hinter mir, der absolut nicht so wollte wie ich. Ein ganzer langer Sommer, in dem ich meine immer größer werdenden Brüste hinter ebenfalls immer größer werdenden langärmligen T-Shirts verbarg, einen großen Bogen ums Schwimmbad machte und jeden Abend duschte, ohne an mir herunterzusehen. Ein Sommer, in dem ich meine Tamponpackung vor Wut in die Ecke pfefferte und kurz darauf wieder zähneknirschend einsammelte. Ein Sommer, in dem ich fast die gesamte Ferienzeit auf Omas Dachboden verbrachte und nicht ans Handy ging, wenn Svea oder Emil anriefen. Ein total übler, verschissener Sommer, der schlimmste meines Lebens.
Ich hatte mir gerade aus Opas Keller eine kalte Orangenlimonade geholt und mich wieder in den großen alten Ohrensessel gefläzt, der ganz hinten in der Ecke auf dem Dachboden steht. Dort hatte ich schon immer gern gesessen, in diesem Sommer aber war der Sessel auf dem ruhigen, halbdunklen Dachboden mein absoluter Lieblingsplatz geworden, mein Rückzugsort, meine Rettung an Tagen, an denen ich das ganze Gequatsche nicht mehr aushielt. Auch nicht mein eigenes.
Das WLAN ist da oben nicht so richtig gut, aber es reicht, um ein bisschen im Netz unterwegs zu sein und sich mit YouTube die Zeit zu vertreiben. Von draußen aus der Siedlung drangen leise Kinderstimmen zu mir herauf, das satte Aufprallen eines Balls auf der Hauswand gegenüber, hin und wieder von weit entfernt ein Hupen. Ich lehnte mich tief in den Sessel zurück und zog mein Handy raus.
Mädchen Hose
Junge Vorteile
Lieber ein Junge sein
Vor mir ploppte ein Video über einen Zwölfjährigen auf, der sich im falschen Körper geboren fühlte und nun mithilfe seiner Mutter alles tat, um als Junge rüberzukommen. Ich sah eine Weile zu, wie der Kleine sich beim Friseur eine Igelfrisur schneiden ließ, dann rief ich das nächste Video auf. Ein Elfjähriger erzählte einer Journalistin davon, dass er viel lieber mit anderen Mädchen spielte als mit Jungs.
Ich seufzte und scrollte weiter runter. Diese Filme – oder so ähnliche – hatte ich schon zigmal angesehen, aber so richtig gepackt hatten sie mich trotzdem nicht. Eigentlich wusste ich selbst nicht so genau, was ich suchte. Nur, dass das Thema Junge sein oder trans* mich irgendwie interessierte. Dass es irgendwas mit mir zu tun hatte.
Plötzlich hielt ich inne. Auf dem Display grinste ein ziemlich süßer Typ in meinem Alter in die Kamera, dann drehte er sich zur Seite und ließ seinen Bizeps spielen. Ich klickte an.
„Hi, ich bin Kalle“, sagte er mit einer leicht kieksigen, aber ziemlich tiefen Stimme. „Und ich wette, ihr könnt es kaum glauben, aber bis vor einem Dreivierteljahr hätte jeder gedacht, dass ich ein Mädchen bin. Jeder, echt!“
Von draußen war Hundegebell zu hören, dann eine laute, böse klingende Männerstimme. Ich starrte Kalle an.
Er sah total gut aus.
Genau so wollte ich auch gern aussehen.
„Tranxkidz, den Treff für alle trans*kids und trans*teens, gibt es fast überall in jeder größeren Stadt“, sagte Kalle direkt in die Kamera. Direkt zu mir. Mir ins Gesicht. „Geh einfach mal hin, wenn du das Gefühl hast, dass du zu uns gehörst. Wir lassen niemanden hängen. Trau dich, komm mal vorbei!“
Ich drückte die Pausetaste und atmete tief durch. Dann spielte ich das Video noch mal ab.
Mann, was hatte der für ein süßes Lächeln!
„Trau dich, komm mal vorbei!“, sagte Kalle. Ich schloss die Augen und lehnte den Kopf zurück.
Von unten hörte ich etwas klappern, dann rief Oma: „Nina! Abendessen! Kommst du runter?“
Ich machte die Augen wieder auf. Schräg über mir fiel ein winziger Sonnenstrahl durchs Dachgebälk und warf einen kleinen Sonnenkreis auf den leicht staubigen Holzboden.
Tranxkidz. Ob es das auch hier gab? Natürlich nicht in Eden. Aber in der Stadt?
„Kommst du, Nina?“
Ich steckte das Handy ein, stand auf und ging mit langsamen Schritten zur Treppe rüber. Von unten waren die Stimmen meiner Großeltern zu hören, die sich mit Felice, meiner kleinen Schwester, unterhielten. Als ich den Fuß auf die oberste Stufe setzte, hörte ich Mama lachen. Dann klappte die Haustür, und mein Vater begrüßte Pippo, Opas Kater.
Ganz langsam ging ich die Treppe hinunter, und noch bevor ich unten angekommen war, spürte ich, dass ich lächelte. Alles kam mir auf einmal so unwirklich vor. Vielleicht hatte ich die Lösung gefunden.
* * *
„Wollen wir los?“, fragt Mama und schiebt ihr leeres Milchkaffeeglas beiseite. Die Sonne steht jetzt schräg am Himmel, nicht mehr lange, bis die Dämmerung anbrechen wird. Ich nicke und schiebe meinen leeren Eisbecher ebenfalls zur Seite. Für einen kurzen Moment sehen wir uns an, dann stehen wir gleichzeitig auf.
Schweigend laufen wir nebeneinander her zur S-Bahn-Station. Das Gel brennt in meinem Rucksack. Es ist Freitagnachmittag, der Feierabendverkehr mischt sich schon mit den Wochenendbesuchern. Ganz in der Nähe ist eine Mall, und Gruppen von Jugendlichen schlendern dorthin, grölend und kichernd.
Auch auf dem Bahnsteig ist es voll. Mama stellt sich dicht neben mich, und als unsere Bahn einfährt, bahnt sie uns zielstrebig den Weg durch die Menge.
Ab Schönholz leert sich die Bahn langsam, und Mama und ich bekommen zwei Sitzplätze nebeneinander. Ich lehne den Kopf ans Fenster und sehe hinaus.
Das Gleisbett ist dichtbewachsen, hochgewachsene Büsche flankieren die Strecke, ab und zu blitzt ein Stück Mauer hindurch, gelegentlich ein Weg, der ins Unterholz getrampelt wurde, von Tieren oder auch Menschen, die eine Abkürzung suchen.
Mama neben mir schweigt. In Wilhelmsruh steigen die drei Kids aus, die vorher die ganze Zeit über an der Tür gelärmt haben. Wittenau, Waidmannslust, Hermsdorf.
In Frohnau steigt niemand zu, auch in Hohen Neuendorf nicht. In Birkenwerder dreht sich Mama zu mir und fragt: „Geht es dir gut?“
Ich nicke. Kurz werfe ich ihr einen Blick zu. Sie ist blass und sieht immer noch traurig aus. „Mama“, sage ich, aber dann weiß ich nicht weiter.
Mama lächelt mich an und streicht mir über die Wange. „Das wird schon alles“, sagt sie, aber ich bin mir nicht sicher, ob sie damit mich oder eher sich beruhigen will.
Denn ich habe keine Ahnung, ob das alles schon wird. Ich weiß nur, dass ich auf dem Weg bin.
* * *
Auf der Bernauer ist Stau, deshalb brauchen wir über zwanzig Minuten vom Parkplatz am Bahnhof bis nach Eden. Auf der Fahrt reden wir immer noch wenig, obwohl Mama jetzt nicht mehr ganz so gestresst wirkt.
Als wir schließlich den Kanal queren und nach Eden reinfahren, habe ich plötzlich das Gefühl, dass meine Augen viel schärfer sehen als sonst. Das Blumengeschäft zur Linken, das kleine Umspannwerk an der Ecke zur Goethestraße, das winzige, weißgestrichene Haus auf der anderen Straßenseite, in dem dieser große, schlaksige Junge wohnt, der ein bisschen älter als ich ist und aufs Gymnasium geht und dessen Namen ich immer noch nicht weiß – alles sieht auf einmal ganz anders aus, viel klarer, gleichzeitig fremd.
Ich habe mein ganzes Leben hier in Eden verbracht, und doch fühle ich mich auf einmal wie ein Tourist, wie jemand, der die Siedlung zum ersten Mal sieht. Diese Siedlung mit der ganz besonderen Geschichte, auf die ihre Bewohner so stolz sind. Eden, das grüne Gartenparadies mit der eingeschworenen Gemeinschaft. Die kleinen Häuer mit den blühenden Gärten drumrum, der ehemalige Kindergarten aus den zwanziger Jahren mit seinen hohen Türmchen, die Mosterei, die schon so lange nicht mehr in Betrieb ist – jedes einzelne Gebäude, jeden Baum, jeden Strauch kenne ich, seit ich denken kann, jeden Weg hier bin ich unzählige Male entlanggelaufen, aber jetzt, heute, erscheint mir alles fremd und unbekannt.
Oder vielleicht ist es ja genau andersherum: Nicht die Siedlung ist fremd, sondern ich bin es. Ich habe das Gefühl, ein ganz anderer Mensch zu sein.
Vielleicht ist das ein Vorgeschmack? Vielleicht werde ich mich so fühlen, wenn ich endlich wirklich Noni bin?
„So, da sind wir“, sagt Mama überflüssigerweise, fährt mit Schwung in die Einfahrt und zieht die Handbremse an. Ich will meine Tür öffnen, aber Mama legt mir die Hand auf den Arm. „Noni?“
„Ja, was ist?“
Mama guckt mich an. „Bist du …“, beginnt sie, dann unterbricht sie sich selbst. „Ach, egal. Alles gut so. Du hast dich entschieden. Ich stehe dir auf deinem Weg bei, immer, das musst du wissen. Aber …“ Sie zögert, dann greift sie in ihren Rucksack und zieht etwas heraus. „Hier, das ist für dich. Ich war mir die ganze Zeit nicht sicher, ob ich es dir geben soll, aber ich glaube, es ist richtig.“
Ich betrachte das in roten Stoff eingebundene Heft, das sie mir hinhält, dann nehme ich es. „Was ist das?“
„Das ist eine Art Tagebuch. Für dich. Ich kann dir manches nicht sagen, deshalb … deshalb habe ich es aufgeschrieben.“
„Das Mama-Buch“, sage ich und lache.
Sie nickt. „Das Mama-Buch, genau.“ Sie zuckt mit den Schultern. „Es steht nicht allzu viel drin. Aber ein bisschen darüber, was ich denke und fühle, und auch vielleicht ein paar Dinge, die du jetzt nicht hören wollen würdest. Du kannst es lesen oder auch nicht. Aber es gehört dir.“ Mama lächelt, irgendwie schwach, so als wäre bei ihr total die Puste raus. Für einen Moment möchte ich sie umarmen, aber dann greife ich nach dem Türgriff.
„Danke, Mama.“ Ich steige aus und klappe die Tür hinter mir zu.
„Nina!“ Feli flitzt auf mich zu. Sie hat sich rote Striche auf die Wangen gemalt und ihre Ringelsocken an, ich wette, sie hat heute wieder ihren Pippi-Langstrumpf-Tag. „Spielst du mit mir? Papa hat das Planschbecken aus dem Schuppen geholt und Wasser reingetan!“
„Ist es überhaupt schon warm genug dafür?“
„Ja!“, ruft Feli. „Ja, es ist gaaaanz warm!“ Sie schwenkt die Arme vor und zurück, zieht eine Bettel-Grimasse und versucht mit allen Mitteln, mich zu erweichen.
Normalerweise hätte sie auch Erfolg damit. Aber heute nicht. Ich kann jetzt nicht mit meiner kleinen Schwester im Planschbecken hocken. Ich muss nachdenken. Und mir diese Gelpackung genauer ansehen, die in meinem Rucksack immer noch wie Feuer brennt.
„Bitte!“ Sie läuft hinter mir her zur Tür und ins Haus.
„Sorry, Feli, heute nicht. Morgen, okay?“
Feli zieht die Brauen herunter und stampft auf. „Du bist gemein“, mault sie. „Nie spielst du mit mir!“
Was überhaupt nicht stimmt. Ich spiele ziemlich oft mit ihr. Na ja, vielleicht in letzter Zeit nicht mehr.
„Dann frage ich Tilli“, sagt Feli und trabt beleidigt davon, durchs Wohnzimmer hinaus in den Garten. Kurz darauf höre ich ihre helle Stimme und dann Tills dunkle. Scheinbar hat Feli Erfolg, denn sie kichert beglückt und jubelt. Ich mache zwei große Schritte zur Treppe rüber und nehme sie mit drei Sätzen. Noch zwei Schritte, dann bin ich in meinem Zimmer und schließe die Tür hinter mir zu.
Ich werfe Mamas Heft auf den Tisch, lasse ich mich aufs Bett fallen und verschränke die Arme hinter dem Kopf. Ich wusste gar nicht, dass Till da ist. Sein Auto stand nicht vor der Tür. Und irgendwie passt es mir überhaupt nicht. Nicht heute. Nicht an diesem so wichtigen Tag.
Till ist dreizehn Jahre älter als ich und mein Halbbruder, aus einer früheren Beziehung von Papa. Früher waren Till und ich richtig eng miteinander; ich freute mich immer tierisch, wenn er zu Besuch kam. Aber irgendwann hat sich das verändert.
Irgendwann wurden mir Tills blöde Sprüche zu viel.
Irgendwann? Nein, nicht irgendwann. Ich weiß genau, wann.
Unten an der Tür klingelt es. Ich höre Schritte im Flur und dann Mamas Stimme. Einen Moment später ruft sie nach mir.
„Noni? Besuch für dich!“
Ich seufze, setze mich hin und überlege einen Moment, bevor ich nach Mamas Heft greife und es zusammen mit meinem Handy in meinen Rucksack packe.
Unten steht ein grinsender Levi vor der Tür.
„Hi!“ Er klatscht mich ab und grinst noch breiter. „Na, geschafft? Biste jetzt schon ein ganzer Kerl?“ Er boxt mich leicht in den Bauch und legt den Kopf schief. „Kommst du mit raus?“
Ich schiebe ihn vor mir her und schließe die Tür hinter mir. Levi sieht mich forschend von der Seite an, als wir die Straße hinunterlaufen.
„Was ist? Wie war die Spritze?“
„Ich hab keine bekommen“, sage ich und schultere meinen Rucksack neu. Am Wegesrand liegt zwischen dem sprießenden Gras noch ein bisschen Laub vom Vorjahr, löcherige Kastanienblätter, braun und verschrumpelt. Dabei ist doch schon Mai.
„Was? Wieso das denn nicht?“
Ich muss Levi gar nicht ansehen, um zu wissen, dass sein Gesicht ein einziges Fragezeichen ist. „Ich wollte lieber Gel“, sage ich ruhig und kicke einen kleinen Zweig aus dem Weg. Vor dem Kindergarten liegt ein umgefallener Stuhl im Garten, und weiter unten an der Straße toben drei Jungs mit einem Ball herum.
„Warum?“, fragt Levi und steckt die Hände in die Hosentaschen.
Ich zucke mit den Schultern. „Weiß nicht. Hatte Angst vor der Spritze.“
„Gel dauert aber länger“, sagt Levi, und ich kann die leichte Missbilligung in seiner Stimme heraushören.
„Weiß ich“, sage ich trotzig. Levi lacht und klopft mir auf die Schultern. „He. Wenn ich das den anderen erzähle …“ Er schlingt einen Arm kumpelhaft um meine Schultern, drückt mich kurz an sich und lässt mich wieder los. „Fuck it, Noni. Schisser.“
„Ach, leck mich“, sage ich, aber ich muss lächeln. Ich bin ja auch ein Schisser. Na und?
Ein Signalton erklingt, und Levi zieht sein Handy raus und studiert im Gehen das Display. „Siehste! Nasti will wissen, ob du schon einen Bart hast. Und Skandi gratuliert zum ersten Piks. Wenn die wüssten …“ Er sieht mich herausfordernd an. Seine braunen Augen glitzern in der Sonne, als er das Handy schräg vor sein Gesicht hält. „He, ihr schlaffen Gockel, leider hat Noni den noch nicht vorhandenen Schwanz eingekniff…“
Ich drücke das Handy nach unten, und nach einem kurzen Gerangel habe ich es in der einen Hand und halte Levi mit der anderen auf Abstand. Ein Klick, dann spreche ich selbst hinein. „Hi, allerseits, hier spricht Noni“, sage ich. „Kann einer von euch kommen und mir diese Nervbratze vom Leib halten?“
Levi jault lachend auf und langt nach dem Handy, aber ich bin schneller. „Und zu allem anderen: kein Kommentar“, sage ich und klicke auf Senden.
„Spielverderber“, sagt Levi, als ich ihm das Handy wieder in die Hand drücke. Wir lächeln uns an.
Levi ist genauso groß wie ich und nur ein knappes Jahr älter, aber mir um Längen voraus, was die Sache mit der Transition angeht. Er wusste schon in der ersten Klasse, was mit ihm los war, und bedrängte seine Mutter seitdem, mit ihm zum Kinderpsychiater und zur Beratung zu gehen. Hat sie auch gemacht, und deshalb bekam Levi auch schon mit elf Pubertätsblocker. Seit gut einem Jahr ist er auf Testo, sieht voll aus wie ein Typ, mit Bartwuchs und tiefer Stimme, und wenn er sich nicht gerade nackt auszieht, merkt garantiert kein Mensch, dass er im Körper eines Mädchens auf die Welt gekommen ist. Nur die Hände und Füße sind ein bisschen zu klein geraten, aber das fällt vielleicht auch nur mir auf, keine Ahnung. Gibt ja auch Bio-Männer mit Schuhgröße 40.
„Ehrlich, ich sag den anderen, dass du ein total aggressiver Oberschisser bist“, sagt Levi und grinst mich an, während er sein Handy hebt.
„Mach doch“, sage ich und laufe weiter. Levi folgt mir, das weiß ich, ohne hinzusehen. Und ich weiß auch, ohne hinsehen zu müssen, dass er lacht.
Levi und ich sind wirklich Best Friends. Seit dem Tag, an dem wir uns kennengelernt haben.
Und die anderen, das sind Kim, Nasti und Skandi aus der Tranxkidz-Gruppe.
* * *
Noch am selben Abend, an dem ich die Tranxkidz-Website entdeckt hatte, verzog ich mich wieder auf den Dachboden, kaum, dass das Abendessen vorbei war. Mama schüttelte zwar den Kopf, aber sie ließ mich ohne Kommentar ziehen. Immerhin waren die Ferien noch nicht lange vorbei, und sie war gnädig gestimmt. Bald schon würde das wieder anders sein, dann würde sie mich Tag für Tag auf ihre unnachahmlich nervige Art damit löchern, ob ich schon Spanisch-Vokabeln oder für Chemie gelernt hätte. Im letzten Jahr waren meine Noten in den Keller gerauscht, aber ich konnte selbst nicht sagen, woran das eigentlich lag. Dass ich zu viel mit Freunden rumhing, daran jedenfalls nicht. Ich hatte kaum noch welche.
Jetzt aber nickte Mama nur, als ich ihr erklärte, dass ich noch mal nach oben ginge.
„Kann ich mit?“, rief Feli und zog eine Flunsch, als ich den Kopf schüttelte.
„Kleines Fräulein“, sagte Opa und wuschelte ihr durchs Blondhaar. „Lass deine Schwester in Ruhe, die braucht auch mal ein bisschen Privatsphäre, was, Nina?“ Er lächelte mich an, schnipste einen Finger an Felis Nase entlang und zeigte ihr den Daumen, den er zwischen Mittel- und Zeigefinger aufblitzen ließ. „Hab ich deine Nase!“
Feli lachte vergnügt, und Opa kitzelte sie und führte sie davon, während er mir zublinzelte.
„Ich geh dann mal rüber zum Sportplatz“, sagte Papa und griff nach seiner Sporttasche. „Bis später!“
Ich kletterte die Treppe rauf. Mein Sessel war schon besetzt, von Pippo, aber er sprang widerstandslos herunter und hinterließ mir eine warme Kuhle. Ich zog die Beine an und klopfte auf das bisschen freie Fläche, das ich Pippo gelassen hatte, aber er würdigte mich keines Blickes mehr und lief auf leisen Pfoten hinter den Schornstein.
Ich zog mein Handy heraus und rief die Seite auf, die ich zuletzt geladen hatte. Tranxkidz. Dauerte ein bisschen, bis sie sich aufbaute. Drei Jugendliche lächelten mich vom Startbildschirm an. Jungs? Mädchen? Nonbinär? Inter? Einfach trans? Oder was? Atemlos scrollte ich herunter.
Erfahrungsberichte, aufklärende Texte über Trans, noch mehr Fotos, aber nicht viele. Auf den meisten sah man die Leute nur von der Seite oder von hinten.
Eine Seite mit Sprüchen.
Was bist du denn?
Zwitter, hau ab!
Du bist du. Aber ich bin noch mehr.
Dann eine Seite mit Adressen, nach den Anfangsbuchstaben der Orte geordnet. Unter A gab es gar keine Gruppe, dafür gleich zwei in Berlin, eine in Bremen … Ich scrollte so schnell runter, dass ich auf einmal bei S angelangt war. Mit zitterndem Finger fuhr ich wieder hoch.
Und erstarrte.
Tatsächlich. Es gab eine Gruppe hier am Ort. Hier! Die Adresse kannte ich. Das heißt, die Straße, sie lag nicht weit vom Bahnhof entfernt, in der Nähe des Sees.
Treffen jeden ersten Dienstag im Monat um 18 Uhr.
Ich rief den Kalender auf. Heute war Freitag, der 8. Der erste Dienstag im Monat lag genau drei Tage zurück.
Wie viel Pech konnte man denn überhaupt haben!
Ich ließ mich so heftig in den Sessel zurückfallen, dass Pippo hinter dem Kamin hervorsprang und mich argwöhnisch ansah.
„Schon gut, Pippo. Reg dich ab.“ Ich machte die Augen zu und wieder auf. Pippo verschwand gerade erneut hinter dem Kamin.
Noch fünfundzwanzig Tage. Fünfundzwanzig Tage!
Aber dann musste ich lächeln. Konnte man auch anders sehen. Nur noch fünfundzwanzig Tage. In fünfundzwanzig Tagen würde ich vielleicht Leute kennenlernen, die mich nicht komisch oder schräg oder irre fanden.
Leute, die vielleicht selber komisch oder schräg oder irre waren.
Oder auch nicht, keine Ahnung.
Auf jeden Fall hatte ich jetzt eine Adresse. Nun musste ich mich nur noch trauen, auch hinzugehen.
* * *
„Willste?“ Levi hält mir die Kippe hin. Ich schüttele den Kopf, wie meistens. Ich zieh höchstens manchmal, und es ist auch eigentlich keine Kippe, sondern ein Joint, aber ein so kleiner mit so wenig drin, dass er gerade noch so als Kippe durchgeht.
Levi zuckt mit den Schultern und saugt den Rauch ein, während er die Geltube betrachtet. „Ich glaub, Jack hatte die auch“, sagt er und bläst den Rauch wieder aus. „Und aus dem ist auch was geworden.“
Vor uns laufen ein paar andere Jugendliche über den Sportplatz. Zwei kenn ich vom Sehen – einer von den Jungs ist, glaube ich, auch hier aus Eden, der andere hängt manchmal mit einigen aus meiner Schule ab –, aber das Mädchen, das mit den beiden unterwegs ist, hab ich noch nie gesehen. Sie hat blaurotgefärbte Haare und ein krasses Septum, das kann ich sogar aus der Entfernung sehen.
Levi schnippt die Kippe weg und streckt sich gähnend. „Ich muss mal los“, sagt er und drückt mir die Tube wieder in die Hand. „Bin noch mit meiner Mutter zum Essen verabredet.“ Levis Mutter ist Sozialarbeiterin, genau wie Mama, ein witziger Zufall. Aber Levis Mutter arbeitet in einer Grundschule am Ort, während Mama in einem Berliner Frauenhaus angestellt ist. Keine Ahnung, was besser ist.
„Und morgen?“
Die drei laufen quer über den Sandplatz und dann schräg übers Bocciafeld. Das Mädchen guckt zu uns rüber. Ich seh weg und kratz mich im Nacken.
„Morgen, mal gucken“, sagt Levi. „Morgen ist Vatertag, aber der kommt doch sowieso wieder nicht.“
Levis Eltern sind schon geschieden, seit Levi im Kindergarten war. Seit sein Vater keine Tochter mehr hat, sondern einen Sohn, macht er sich noch rarer als ohnehin schon.
Da hab ich es ja besser.
Levi rutscht von der Bank, und ich seh, dass er den dreien hinterherguckt. „Ich ruf an, wenn er nicht kommt, okay? Vielleicht können wir was machen.“
„Klar.“
Er bleibt stehen und guckt mich an. „Kommst du nicht mit?“
„Ich bleib noch was.“
Levi zieht fragend eine Braue hoch, dann klatschen wir uns ab, und ich sehe ihm nach, wie er zur Straße läuft und dann nach einem letzten Winken um die Ecke verschwindet. Ich lasse mich nach unten rutschen, bis ich mit dem Hintern auf der Bank lande, und stecke die Tube wieder in meinen Rucksack. Die Luft ist mild, und eine Amsel hoch oben in einem der Bäume flötet laut ihr Abendlied.
Vorsichtig ziehe ich das rote Heft heraus und betrachte den Einband. Sieht aus, als wenn Mama es selbst eingeschlagen hätte, in roten, weichen Stoff. Ich streiche mit den Fingern darüber, dann schlage ich die erste Seite auf. Die Sonne ist zwar schon untergegangen, aber es ist gerade noch hell genug, dass ich Mamas gestochen saubere Handschrift lesen kann.
Noni steht in kleinen Druckbuchstaben auf der ersten Seite. Nur dieser Name, sonst nichts.
Ich hole tief Luft, dann blättere ich um.
Dieses Heft ist für dich, mein liebes Kind. Mein zweites Kind, meine erstgeborene Tochter Nina, aber so möchtest du ja nicht mehr heißen.
Ich würde lieber mit dir reden, anstatt dir zu schreiben, aber im Moment kann ich es nicht. Noch nicht. Ich glaube, du willst es auch gar nicht, jedenfalls jetzt noch nicht. Das muss ich vielleicht erst mal hinnehmen.
Vorgestern hast du uns gesagt, dass du ab jetzt als Junge leben wirst. Wirst, nicht möchtest. Aus heiterem Himmel, beim Abendessen, einfach so. Du hast Luft geholt und deinen leeren Teller weggeschoben und uns angesehen, erst mich und dann Arndt und dann Felice und dann wieder mich. Und dann hast du schief gelächelt und gesagt: „Ich muss euch was sagen. Ich möchte, dass ihr mich ab jetzt Noni nennt. Denn ich werde ab jetzt als Junge leben.“
Felice hat die Stirn gerunzelt und „hä?“ gesagt und sich noch eine Scheibe Brot geangelt. Arndt hat die Augen zusammengekniffen und genickt, während ich einfach nur still dagesessen habe und meine Tochter angestarrt habe, die auf einmal mein Sohn sein will.
Ich war einfach nur schockiert. Ich hatte das Gefühl, dass ein Zug mit großem Getöse direkt an mir vorbeirauscht, und ich habe ihn nicht einmal kommen hören. Irgendwie habe ich offenbar etwas ganz Wesentliches verpasst, etwas ganz Wesentliches in deinem Leben.
Klar habe ich mitbekommen, dass es dir in letzter Zeit oft nicht gut gegangen ist, dass du ab und zu furchtbar traurig warst und dich sichtlich unwohl mit dir selbst gefühlt hast. Ich habe dich immer mal wieder darauf angesprochen, aber du hast nichts gesagt. Nur, dass ich dich nicht nerven soll. Und dass ich dich einfach mal in Ruhe lassen soll und dass du schon sagen wirst, wenn du reden willst.
Jetzt hast du geredet. Nicht viel, aber immerhin etwas.
Ich habe mit allem Möglichen gerechnet. Aber ich wäre nie drauf gekommen, dass es das ist, was dich bewegt. Nie im Leben. Und das, obwohl mir das Thema gar nicht so absolut fremd ist. Ich meine, ich habe Soziale Arbeit studiert und mich mit allen möglichen Facetten menschlicher Identitäten befasst, ich lese viel zu Gender-Thematiken und feministischen Themen, letztes Jahr habe ich eine Fortbildung zu Trans*identität in der Mädchen- und Jugendarbeit gemacht … aber dass das Thema meine eigene Familie betrifft, damit habe ich einfach nicht gerechnet.
Warum nicht?
Ich schlage das Heft wieder zu. Eine ganze Weile starre ich in die Abenddämmerung vor mir. Die Amsel singt immer noch, und auf einmal kommt mir ihr Gesang furchtbar traurig und einsam vor.
Stimmen reißen mich aus meinen Gedanken. Die beiden Jungs und das Mädchen kommen wieder zurück. Miteinander ins Gespräch vertieft, laufen sie quer über den Sportplatz. Als sie auf meiner Höhe sind, hebt das Mädchen den Kopf und sieht zu mir herüber. Für einen Augenblick habe ich den Eindruck, dass sie lächelt, aber das kann auch täuschen.
Dann sind sie verschwunden, und auch ihre Stimmen sind nicht mehr zu hören. Nur die Amsel singt immer noch ihr trauriges Lied.
Ich schiebe das Heft wieder in den Rucksack zurück und mache ihn zu. Dann rutsche ich von der Bank.
Kapitel 2
Ich schlage die Augen auf. Die Decke über mir ist weiß, genau in der Mitte hängt meine Lampe herunter. Eine einfache Birne in einer Holzhalterung. Sie hängt erst seit diesem Januar da. Ich hatte Mama damit gelöchert, dass ich endlich diesen komischen Lampenschirm loswerden will. Hat geklappt. Ist zwar nur eine Lampe, aber irgendwie ist es mir total wichtig, überflüssiges Zeug loszuwerden und vor allem Sachen, die nicht mehr zu mir passen.
Wie meine Brüste.
Aber die kann man ja nicht einfach abschrauben.
Ich drehe mich auf die Seite und nehme mein Kissen in den Arm. Draußen strahlt die Sonne von einem wolkenlosen Himmel. Jeden Tag wird es wärmer, schon fast so warm wie im Sommer ist es. Und dabei haben wir erst Mitte Mai.
Mein Handy fängt an zu vibrieren, und ich greife danach, schalte den Wecker aus und setze mich hin.
Okay. Ein neuer Tag. Tag 6.
Ob man schon was merkt?
Also, die anderen?
Ich schließe die Augen, fühle in mich hinein und mache sie wieder auf. Ich jedenfalls merke noch nichts. Nur, dass ich aufgeregt bin.
Ich ziehe mein Shirt aus und werfe es neben mich, dann reiße ich einen Testobeutel auf. Papa hat ein Magengel, das ähnlich riecht, ganz leicht nach Gummi, aber das ist okay. Ich drücke es aus dem Beutel auf meine Handfläche und verteile das Zeug ganz vorsichtig auf meinen Unterarmen und meinen Schultern. Dann warte ich mit geschlossenen Augen.
Und erst jetzt, während ich da so sitze und warte, höre ich die Stimmen von unten. Mama, Papa und Felice, die sich in der Küche unterhalten. Oder besser gesagt, Felice, die sich mit Mama und Papa unterhält. Ihre helle Stimme klingt eifrig, wie immer morgens. Feli ist echt ein Wirbelsturm, der schon frühmorgens losbläst und erst zur Ruhe kommt, wenn es Bettzeit ist.
Und dann auch nicht immer.
Mama sagt, ich sei früher auch so gewesen. Aber das kann ich irgendwie nicht so richtig glauben.
Ich hab das Gefühl, dass ich immer schon viel weniger als Feli geredet hab. Und in der letzten Zeit sowieso noch weniger.
Das Gel ist eingezogen, die Haut vollkommen trocken, als ich mit dem Finger darüberfahre. Also los, anziehen.
Unschlüssig betrachte ich die Klamotten, die ich mir gestern schon hingelegt hab. Schwarze Chinos, weites T-Shirt, Socken, Boxer, Sport-BH, den engen, der fast so gut wie ein Binder hält. Und meine Stiefel, die eigentlich eine Nummer zu groß sind. Mama hat deswegen total gemeckert, aber ich hab mich durchgesetzt. Größe 41 geht zwar auch durch, aber 42 ist besser. Wobei ich echt Glück hab, die meisten anderen haben 39 oder sogar noch kleiner. Nicht gut. Da sieht man doch gleich, was Sache ist.
Die Hose ist okay, aber das T