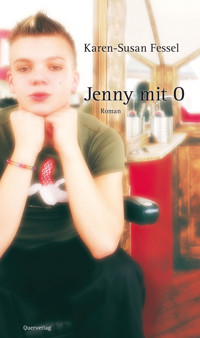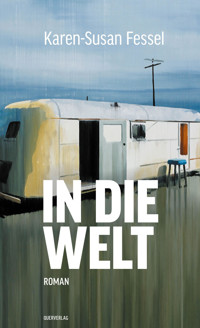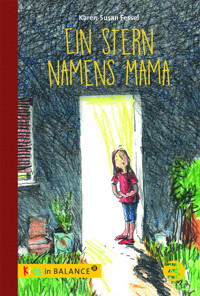Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Querverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Gunn ist rastlos. Lange Jahre hat sie in ihrem Beruf als Hebamme gearbeitet, sich mit ihrer besten Freundin Greta ins Berliner Nachtleben gestürzt, reihenweise Frauen erobert – jetzt aber genügt ihr das alles nicht mehr. Sie braucht eine Auszeit. So beschließt die charismatische Butch, allen und allem für eine Weile den Rücken zu kehren. Sie streift die von ihr erwarteten, auch selbst kultivierten Rollen ab: die der zuverlässigen Geburtshelferin, der kumpelhaften Trinkkumpanin, der unwiderstehlichen Verführerin. Doch je näher der Abschied rückt, desto mehr zweifelt Gunn. Und gerade, als alles so richtig aus den Fugen gerät, macht Gunn eine verstörend-aufregende Bekanntschaft und neue Zweifel an der Entscheidung machen sich breit. Ein erotisch-literarischer Roman von Karen-Susan Fessel.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 256
Veröffentlichungsjahr: 2004
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Unter meinen Händen ist ein Roman. Das bedeutet, dass Handlung und Personen erfunden sind. Die Örtlichkeiten hingegen entsprechend zum Teil der Wirklichkeit.
Mein Dank gilt dem Geburtshaus Kreuzberg und all den Hebammen, Müttern und Vätern, die mir geduldig und bereitwillig Auskünfte und Informationen gegeben und damit sehr geholfen haben, allen voran Bärbel und Eva. Etwaige Unrichtigkeiten in der Darstellung gewisser (geburtstechnischer wie physischer) Abläufe sind jedoch keinesfalls meinen InformantInnen, sondern mir anzulasten.
© Querverlag GmbH, Berlin 2004
Erste Auflage März 2004
Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Umschlag und grafische Realisierung von Sergio Vitale unter Verwendung einer Fotografie von Anja Müller.
ISBN 978-3-89656-545-7
Bitte fordern Sie unser Gesamtverzeichnis an:
Querverlag GmbH, Akazienstraße 25, D-10823 Berlin
querverlag.de
I
Montag
Rasmus ist erst einen Tag alt, aber sein Vater scheint ihn schon sehr gut zu kennen.
„Das hat er nicht so gerne“, sagt Luis, als ich Rasmus an den Füßen fasse und er zu schreien beginnt.
Ich schiebe meine freie Hand unter den kleinen, kräftigen Körper, hebe ihn an und bette den Jungen an meine Brust. Sofort hört Rasmus auf zu weinen und sieht mich aus hellblauen Augen verwundert an. Ich blicke zu seinem Vater.
„So, das hat er also nicht so gern?“
Luis zuckt mit den Schultern. „Nein, eigentlich nicht“, sagt er und lächelt verlegen.
Rasmus zieht die winzige Stirn kraus. „Uh“, macht er und strampelt mit den Beinen. Dann seufzt er und verzieht den Mund. Ich fahre mit einem Finger über seine kaum vorhandenen Augenbrauen und schnalze mit der Zunge. Rasmus starrt mich an. Er schielt, wie fast alle Neugeborenen.
„Siehst du aber intelligent aus, mein Kleiner!“, sage ich und wiege ihn leicht.
Rasmus gluckst bestätigend.
Neben mir wechselt Luis das Standbein. Ich spüre, dass er den Kleinen nur zu gern aus meinen Armen nehmen und selber halten möchte. Aber noch muss er sich gedulden.
„Wo ist die Waage?“, frage ich.
Luis stolpert fast über die eigenen Füße, als er mich durch den Flur ins Bad führt, wo die Waage auf der geliehenen Wickelkommode steht. Durch die offene Tür kann ich Vera sehen, die im Bett liegt und schläft. Sie sieht sehr mitgenommen aus, genau wie Luis auch. Im Geiste notiere ich mir, dass ich mich nachher noch um eine Haushaltshilfe für die beiden kümmern werde.
Rasmus protestiert mit ärgerlichem Gejammer, während ich seine Nabelschnur untersuche, seine Temperatur messe und ihn wiege. Er hat zehn Gramm abgenommen seit gestern, aber das ist normal. Ansonsten ist er gesund. Klein und mickrig zwar, aber gesund. Noch keine Anzeichen von Gelbsucht, normal entwickelte Lungen. Die Atmung ist gut.
Als ich ihn wieder hochnehme und sein Gewicht spüre, bin ich für einen Moment sehr gerührt. Wie hilflos er ist, dieser winzige Mensch in meinen Händen, der sein Leben noch vor sich hat. Jedes Mal wieder rührt mich das an.
Ich blicke zu Luis. „Hast du gut gemacht“, sage ich und grinse.
Luis wird rot. „Ach“, sagt er und windet sich, ohne den Jungen aus den Augen zu lassen. „Ach, ich … Ich hab doch gar nichts gemacht. Leider.“
Ich reiche ihm den Kleinen und sehe zu, wie Luis mit der typischen ängstlichen Unsicherheit aller frisch gebackenen Väter das Neugeborene entgegennimmt und vorsichtig in die Armbeuge bettet.
„Natürlich hast du. Das ist dein Sohn.“
„Ich wünschte, es wär so“, sagt Luis mit einem Anflug von Traurigkeit und betrachtet den Kleinen, der jetzt, erschöpft von der Anstrengung, die Augen geschlossen hat und dabei ist, einzuschlafen. „Ich wünschte, es wär so.“
Draußen ist es schwül. Die Wolkendecke, die seit Tagen über der Stadt hängt, ist aufgebrochen, und die Sonne strahlt durch den Dunst wie durch ein Brennglas auf die Straßen hinunter.
Als ich den Wagen aufschließe, strömt mir aufgehitzte Luft entgegen. Ich bleibe einen Moment stehen und betrachte die Häuserzeile gegenüber, den Park am Ende der Straße, das Stück diesigen Sommerhimmel darüber. Weit oben schleppt ein Zeppelin seine Werbebotschaft durch die Luft. Die Werbefahne hängt schlaff herunter, ich kann nur wenige Buchstaben entziffern.
Eine dunkelhaarige Frau geht dicht an mir auf dem Bürgersteig vorbei, mit träge klappernden Absätzen. Als ich sie ansehe, blickt sie zur Seite. Etwas in ihren Augen erinnert mich an Kim.
Dann ist die Frau fort, und mit ihr die Erinnerung. Ich lege den Kopf in den Nacken und merke, dass ich Hunger habe.
Heute ist Montag. Noch zwei Wochen. Noch genau vierzehn Tage, dann lasse ich all das hinter mir – die brütende Hitze der Stadt, ihre Staub und Dreck ausschwitzenden Straßen, die angestrengten Gesichter ihrer Bewohner, die spätgebärenden Mütter darunter und ihren Nachwuchs.
Noch zwei Wochen. Aber noch immer weiß ich nicht, wo ich dann hingehen werde. Und was danach kommt.
Als ich einsteige, spüre ich die schmerzhafte Stelle in meinem Rücken. Ich schiebe den rechten Fuß nach vorn und verlagere das Gewicht, und der Schmerz geht. Zeit für Inga. Aber nicht heute.
Ich fahre die Kreuzbergstraße hinunter und dann in die Bergmannstraße. Jetzt, wo die Sonne sich hervorgekämpft hat, sind auch die Leute aus ihren Löchern gekrochen. Eine Traube von Touristen hängt vor einem Souvenirladen und betrachtet die aushängenden Postkarten. Der Gemüsehändler ein Stück weiter preist lautstark seine Waren an, und an den Tischen der Cafés ringsum hocken sonnenbebrillte Gäste und versuchen so auszusehen, als betrieben sie hier seit den Morgenstunden Müßiggang. Vor dem japanischen Imbiss langweilt sich ein Sushi-Koch, und beim Thailänder ein Haus weiter sind fast alle Bänke besetzt. Aber die letzte ist frei. Und der Parkplatz direkt davor auch.
Die Sonne verschwindet wieder hinter den Wolken und wirft gnädigen Schatten über mich, als ich mein Essen auf den Tisch stelle und mich in die Sitzbank schiebe. Gebratene Garnelen mit Gemüse, heiß, scharf, köstlich. Ich genieße jeden Bissen, ohne den Blick vom Teller zu heben. Als ich fast fertig bin, stützen sich plötzlich zwei Hände rechts und links davon flach auf dem Tisch auf. Frauenhände, schlank und gepflegt.
Mein Blick fährt an nackten Oberarmen empor und hält bei einer verspiegelten Sonnenbrille inne. Das von einer blonden Mähne eingerahmte Gesicht dahinter kenne ich. Tanja.
„He, da hat aber jemand Hunger gehabt.“ Sie richtet sich auf und schiebt ihre Sonnenbrille nach oben. Ihre grünen Augen blitzen mich an. „Wie geht’s dir denn so?“
„Bestens. Und selbst?“ Und dann, während Tanja fragend auf den Platz mir gegenüber deutet und ich nicke, dann fällt mir auch der Name ihres Sohnes ein. Ein kräftiger Kerl mit einem Wahnsinnsorgan, der pünktlich zur Welt kam und sofort losschrie. „Und Laszlo?“
„Wächst und gedeiht“, sagt sie und setzt sich. „Dass du dir den Namen gemerkt hast!“ Sie schiebt ihre gefalteten Hände nach vorne. Schon damals haben die mir gefallen. Genau wie die ganze Frau.
Was durchaus auf Gegenseitigkeit beruht hat. Selten hat mich eine Patientin so angebaggert wie Tanja. Aber für mich war sie natürlich tabu. Meine eigene goldene Regel.
„Klar hab ich das“, sage ich und lächele Tanja an. Sie lächelt zurück, einen Tick zu lang. Dann schiebt sie sich die Sonnenbrille tiefer ins Haar, ohne mich aus den Augen zu lassen.
„Wo steckt der Kleine? Wie alt ist er jetzt, vier? Oder fünf?“
„Fünf. Er ist gerade für zwei Wochen mit Zoran in Kroatien. Zoran ist sein Vater, das weißt du ja vielleicht noch.“
Ich nicke. „Lebt ihr noch zusammen?“
Tanja schüttelt den Kopf. Natürlich. Fünf Jahre später hat die Welt sich ziemlich oft um sich selber gedreht.
„Aber du wohnst noch in der Fidicin, oder?“, frage ich.
Jetzt ist es Tanja, die nickt. „Laszlo ist ein ganz Süßer, echt“, sagt sie, wie um die Scharte auszuwetzen, die ihre gescheiterte Beziehung hinterlassen haben könnte. „Aber ziemlich quirlig manchmal, puh.“
„Genau wie er rausgekommen ist. Die wichtigsten Eigenschaften zeigen sich eben meistens sofort.“
Sie lächelt, und ihre grünen Augen tasten mein Gesicht ab. Ich spüre, wie sich etwas in meinem Bauch zusammenzieht.
Tanja ist genau der Typ Heterofrau, um den ich normalerweise einen großen Bogen mache: gut aussehend und gut situiert, elegant mit einem Schlag ins Biedere, gelangweilt vom Leben und permanent notgeil. Im Bett aber, das hab ich in früheren Jahren ziemlich zügig gelernt, ist bei solchen Frauen sehr schnell die Luft raus.
Doch bei Tanja vermute ich mehr. Sie könnte bestimmt eine ganz heiße Nummer hinlegen. Das interessiert mich. Immer. Und im Moment ganz besonders.
„Ich hab manchmal an dich gedacht in den fünf Jahren“, sagt Tanja unvermittelt, und ihre Stimme ist eine Nuance tiefer geworden. „Wie es dir wohl so geht.“
„Ach?“ Ich hebe eine Braue, schiebe meinen Teller zur Seite und beuge mich vor.
„O ja“, sagt sie und lächelt lasziv. Ich bin ihr so nah, dass ich den leichten Schweißfilm auf ihren Schlüsselbeinen sehen kann. Augenblicklich bekomme ich Lust, meinen Finger dort hinübergleiten zu lassen. Ich möchte sehen, wie Tanja unter meiner Berührung erschauert.
„Und du möchtest, dass ich dir jetzt erzähle, wie es mir geht, ja?“, frage ich leise. Tanja steigt drauf ein.
„Oder bei einer anderen, einer besseren Gelegenheit“, sagt sie, lehnt sich zurück und sieht mich herausfordernd an.
Eine Schar lachender Kinder läuft dicht an unserem Tisch vorbei, und an der Kreuzung quietschen Bremsen. Tanja und ich schweigen, während ich meinen Blick langsam an ihr heruntergleiten lasse. Ihr Dekolleté bietet einen reichlich tiefen Einblick. Sieht so aus, als wären ihre Brüste gut in Form geblieben.
Ich muss daran denken, dass ich ihren Körper ziemlich gut kenne. Ich weiß, wie sie aussieht. Ich habe sie an vielen Stellen berührt. Und in ihr drin war ich auch schon.
Als ich ihr wieder in die Augen sehe, merke ich, dass sie an genau dasselbe gedacht hat wie ich. Ich merke es an der Art, wie sie mich ansieht. Eine Spur zu intensiv. Sie legt es wirklich drauf an.
Wenn sie es so haben will – bitte. „Okay“, sage ich und lächele ihr zu. „Dann lieber bei einer besseren Gelegenheit. Wie ist es, hast du Lust, in den nächsten Tagen etwas trinken zu gehen?“
„Und ob“, sagt Tanja und lächelt zurück.
„Gib mir deine Nummer. Ich rufe dich an.“
Sie nickt und sieht mir tief in die Augen. Um ihre Mundwinkel herum zuckt es ganz leicht. „Deine hab ich ja noch“, sagt sie schließlich und lacht.
Einer der Geburtsvorbereitungskurse für Paare ist gerade zu Ende gegangen. Die Teilnehmenden kommen mir auf der Treppe entgegen, ein Lesbenpärchen ist auch darunter. Die Schwangere von beiden erkenne ich sofort. Mit einem leicht verklärten Lächeln geht sie die Treppe hinunter, während ihre nervöse Freundin mit verkniffenem Gesicht neben ihr hermarschiert, nach dieser anstrengenden Stunde im Kreise glücklicher Heteropaare instinktiv auf Abwehr gedrillt. Als sie mich entdeckt, wirft sie mir vorsorglich einen finsteren Blick zu. Ich erwidere ihn, indem ich ihr zuzwinkere.
Frauenpaare sind immer noch selten, aber allmählich werden es mehr. Genau wie die jüngeren Schwangeren, ein Nebeneffekt der steigenden Arbeitslosenzahlen vermutlich. Zwischen den vielen Spätgebärenden, die ihrem gut verdienenden Zweit- oder Drittpartner noch neues Lebensglück schenken wollen, heben sie sich wohl tuend hervor.
Überhaupt, eine andere Klientel wäre mir manchmal lieber – Frauen, die es sich nicht leisten können, die Geburt und Aufzucht von Kindern als Luxus zu betrachten, den man sich auf den letzten Drücker dann doch noch gönnt. Aber mittellose Teenagermütter habe ich hier so gut wie nie gesehen.
Im Flur hilft ein bärtiger Mittvierziger seiner kaum jüngeren Partnerin betont fürsorglich in den Sommermantel und nickt mir mit feierlichem Ernst zu, als ich vorbeigehe. Ich nicke knapp zurück.
Manchmal ist mir die Heiligkeit, die Inbrunst zuwider, mit der manche Paare, gerade ältere, ihre Leibesfrüchte schon vor der Geburt anbeten. Ein deutliches Alarmsignal, ich weiß. Höchste Zeit für eine Pause.
Hedi sitzt im Büro, den Kopf zwischen den Händen. „Hallo, Gunn.“
„He, Hedi. Ich mach nur ein paar Anrufe und hol einige Sachen.“
„Schade“, sagt sie und ringt sich ein Lächeln ab. „Ich dachte, du löst mich ab.“ Ihr schwäbischer Akzent ist ausgeprägter als sonst. Hedi ist müde.
„Ich hab doch gar keine erste Bereitschaft mehr, Hedi.“
„Ja ja. Ich weiß doch, war ja nur ein Scherz.“ Sie macht ein argloses Gesicht und sieht zu, wie ich die Schreibtischschublade aufziehe und darin herumkrame. „Aber ich versteh immer noch nicht, warum du aufhörst“, sagt sie in ihrem singenden Tonfall und schüttelt den Kopf. „Wir sind doch so ein gutes Team.“
„Du bist einfach nur an mich gewöhnt, Hedi. Mich kann jede ersetzen“, antworte ich. „Sag mal, hast du die Haushaltshilfenliste gesehen?“
Hedi deutet mit dem Kinn zum anderen Schreibtisch. Im gleichen Moment klingelt das Telefon. „Kannst du rangehen?“, fragt sie erschöpft.
Ich fische die Liste vom Tisch und nehme den Hörer ab. „Geburtshaus Wartenburgstraße, Gunn Bartoldi am Apparat.“
Ein Japsen ist zu hören, dann schnappt jemand nach Luft. Ich schalte den Lautsprecher ein, und Hedi blickt hoch.
„Hier ist Petra Dörrmann. Ich glaube, mein Baby kommt. Ist die Mara da? Ihr Piepser ist …“ Die Frau ringt nach Luft, und ich sehe zu Hedi, die mit den Lippen ein paar Worte formt und mir fünf Minuten anzeigt. „… ist aus“, keucht die Frau am anderen Ende des Hörers.
„Mara kommt jeden Moment“, sage ich. „Aber vielleicht kann ich dir kurz helfen?“ Ich lege so viel Beruhigung in die Stimme, wie ich kann. „Wie oft kommen die Wehen?“
„Alle paar Minuten“, japst sie.
„Gut. Und wie lange dauern sie ungefähr?“
„Ich weiß nicht, vielleicht …“
Im Hintergrund höre ich Gemurmel, dann übernimmt ein Mann den Hörer. „Ich hab gestoppt“, sagt er aufgeregt. „Eine knappe Minute dauern die Wehen jetzt.“
„Fein. Dann solltet ihr jetzt herkommen“, sage ich ruhig. „Ist Mara eure Hebamme?“ Hedi nickt heftig und gestikuliert wild, und ich drehe mich halb zur Seite.
„Ja, und wir wollen auch unbedingt Mara, weil …“
„Geht klar. Ihr wollt Mara, ihr kriegt Mara“, sage ich, und das Lächeln in meiner Stimme scheint ihn zu beruhigen. „Kommt jetzt bitte her. Aber ganz ruhig bleiben, ja?“
Als ich auflege, stöhnt Hedi. „Auch das noch. Die ist zwei Wochen zu früh dran! Und heute hatte ich schon zwei Geburten.“
„Gut gegangen?“
Hedi nickt. Ich fahre mit dem Finger die Liste hinab und bleibe einen Moment bei Anitas Namen hängen. Nein, zu temperamentvoll. Nichts für Vera und Luis. Mein Finger gleitet weiter hinunter. An der Tür klingelt es.
„O nein!“, seufzt Hedi. „Die Voruntersuchung! Und jetzt kommt doch gleich die Geburt! Wo Mara bloß bleibt?“
„Keine Chance, Hedi“, sage ich, ohne sie anzusehen. „Wirklich nicht. Ich hab noch zu tun. Ich kann nicht übernehmen, tut mir Leid.“
Hedi schweigt beharrlich. Mein Finger macht bei Lisa Altenburg Halt. Nicht ideal, aber das könnte was werden.
Hinter mir seufzt Hedi. Ich richte mich auf. „Okay“, sage ich und seufze auch. „Na gut. Aber zum letzten Mal, Hedi.“
„Du bist ein Schatz!“, sagt sie in breitestem Schwäbisch. „Danke!“
Hedi und ich sind uns eigentlich von Anfang an nicht sonderlich grün gewesen, aber die Jahre gemeinsamer Arbeit haben uns dennoch zusammengeschweißt. Mittlerweile mag ich sie fast. Hedi ist eine verdammt gute Hebamme, aber nicht sehr belastbar. Mit ihrer ab und an durchscheinenden Hilflosigkeit weckt sie immer wieder meinen Beschützerinstinkt.
Und manchmal schafft sie es sogar, mich zu etwas zu überreden.
„Ich übernehme keine Betreuung von Neuschwangerschaften mehr, Hedi“, hatte ich damals gesagt. „Du weißt doch, dass ich gehe.“
„Wann war das noch mal?“, hatte Hedi leutselig gefragt. „Wann hörst du auf?“
„Mitte August.“
Hedi hatte genickt und geseufzt. „Aber guck dir die Frau wenigstens mal an. Sie hat nach dir gefragt. Du bist ihr empfohlen worden. Bitte, Gunn!“
Ich kniff die Lippen zusammen. „Na gut“, sagte ich. „Ich seh sie mir an. Aber das ist auch alles.“
Als ich die Tür zum Wartezimmer öffnete, glaubte ich im ersten Moment, ein lesbisches Paar vor mir zu haben.
Die blonde, kurzhaarige Frau, die mir nervös vom Sofa aus entgegensah, war eindeutig eine Lesbe. Aber der Typ, der lässig ans Fensterbrett gelehnt dastand, war ebenso eindeutig ein Heteromann.
„Guten Tag“, sagte ich und zog die Tür hinter mir zu. „Ich bin Gunn. Ihr wolltet mich sprechen?“
Sie nickte. „Hallo. Ich bin Vera, und das“ – sie sah zu ihrem Partner am Fenster hinüber – „das ist Luis, mein Freund.“
Ich nickte ihm zu, und er nickte förmlich zurück, einen dunklen Ausdruck in seinen Augen.
„Du bist mir empfohlen worden“, sagte Vera. „Eine Freundin von mir hatte dich als Hebamme, vor zweieinhalb Jahren. Vielleicht erinnerst du dich an Sarah Warnke?“
Ich durchkramte mein Gedächtnis, aber der Name blieb ohne Echo. „Wie heißt das Kind?“
„Felix“, sagte sie.
Ich weiß nicht, wie vielen Felix’ ich in den letzten zehn Jahren auf die Welt geholfen habe. Es müssen an die Hundert gewesen sein.
Die Blonde studierte mein ratloses Gesicht. „Der Junge ist schwarz. Also, halbschwarz natürlich.“ Sie lächelte verlegen.
„Okay“, sagte ich. „Jetzt hab ich’s. Der Vater war aus Ghana, nicht wahr?“
„Genau.“ Sie lächelte wieder. Ihr Lächeln machte sie hübsch, obwohl sie ansonsten nicht besonders gut aussah. Blass, etwas teigige Haut, eng zusammenstehende Augen und eine auffällige Himmelfahrtsnase. Aber ihr Lächeln war hübsch. Allmählich begann sie mir sympathisch zu werden.
„Jedenfalls“, sagte sie, „Sarah war so begeistert von dir. Und da dachte ich … dachten wir … Und sowieso …“
Sie sprach, als müsste ich instinktiv wissen, was sie meinte. Aber mit diesem „sowieso“ wusste ich nichts anzufangen. Ich sah von ihr zu ihrem Typ. Er lehnte immer noch unbeweglich am Fensterbrett, die muskulösen Arme vor der Brust verschränkt, und blickte aufmerksam zu mir herüber, einen bitteren Zug um den Mund. Ich fragte mich, wie die beiden zusammengefunden hatten. Was in aller Welt hatten diese Lesbe und dieser Macho-Kerl miteinander zu schaffen?
„Tja, tut mir Leid, Vera. Aber ich muss dich enttäuschen. Ich kann keine Betreuungen mehr übernehmen. Mitte August höre ich hier auf. In welcher Woche bist du?“
„In der achtundzwanzigsten“, sagte sie unsicher, als hätte sie ihren neuen Zustand noch selbst kaum realisiert, was sicherlich auch der Fall war. Ich rechnete nach.
„Das wird knapp“, sagte ich und hob bedauernd die Schultern. „Zu knapp, nehme ich an. Tut mir Leid. Ich kann euch aber wirklich ein paar sehr gute Kolleginnen empfehlen.“
Vera schwieg und sah auf ihre gefalteten Hände herab. Ich blickte zu Luis. Er starrte mich an, immer noch diesen dunklen Ausdruck in seinen Augen. Plötzlich begriff ich, was es war. Traurigkeit. Dieser Mann da drüben war traurig und versuchte es zu verbergen.
Irgendwo hupte ein Auto. An der Tür klingelte es. Im Flur näherten sich Schritte. Dann war Stimmengemurmel zu hören, das sich langsam entfernte, bis es verklang.
Vera betrachtete ihre Fingernägel. Luis starrte mich immer noch an. Dann senkte er langsam den Kopf.
Einen Moment lang war es ganz still. Dann hörte ich mich sagen: „Okay, ich mach es.“ Ich sah das erleichterte Lächeln, mit dem Luis seine Stiefel bedachte. An der Tür klingelte es erneut. „Aber wenn das Kind bis Mitte August nicht auf der Welt ist“, fügte ich hinzu, „übernimmt jemand anders. Überlegt euch das gut.“
„Das brauchen wir nicht“, sagte Vera. „Wir haben schon genug überlegt.“
Warum manche gerade mich wollen? Genau weiß ich es natürlich nicht, aber vielleicht ist es meine robuste, zupackende Art, die einige anspricht.
Viele bevorzugen zarte, sanfte Stimmen, ebensolche Hände, fließende Gesten, beruhigendes Gemurmel aus weichen Mündern.
Ich habe nichts dergleichen zu bieten. Das Leben ist nicht so, finde ich. Und ich bin auch nicht so. Die Kinder, die ich auf die Welt zu bringen helfe, werden mit Schwung empfangen.
Sie sollen es ruhig wissen. Von Anbeginn an. Und möglichst schon vorher.
Nicht alle kommen mit meiner Art zurecht. Aber manchen hilft sie, sich fallen zu lassen. Ich weiß, dass ich etwas an mir habe, das die Frauen dazu bringt, mir zu vertrauen, sich in meine Hände zu begeben. Wenn ich sie untersuche, liegen sie dann ruhig da, mit geschlossenen Augen, und vertrauen darauf, dass ich ihnen helfe und für sie sorge. Und das versuche ich auch. So gut ich es kann.
In meinem Briefkasten stecken ein paar Umschläge. Ich stopfe sie mir hinten in die Hosentasche und laufe in flottem Tempo die Treppen hinauf. Mein tägliches Training, besonders dann, wenn ich es nicht ins Sportstudio schaffe. In dieser Woche war ich kein einziges Mal dort.
Meine Wohnung ist ruhig und angenehm kühl. Trotzdem reiße ich die Fenster auf und bleibe davor stehen. Weit hinten versinkt der glutrote Sonnenball über der Stadt. Von unten dröhnt das Rattern der S-Bahn zu mir hoch. Ich atme tief ein. Es riecht nach Staub, mit einem Hauch von Gras. Trockenem Gras. Zum ersten Mal an diesem Tag kann ich mein eigenes Herz klopfen spüren.
Als ich die Post auf den Küchentisch werfe, rutscht zwischen den Rechnungen und Reklamesendungen eine Ansichtskarte hervor. Ich nehme sie hoch.
Eine langbeinige Blondine räkelt sich verführerisch auf goldgelbem Strand, nur mit einem knappen Bikini bekleidet. Einen Moment lang sehe ich Tanjas Lächeln vor mir, dann wische ich es fort und betrachte die Karte genauer. Der Bikini zeigt das Muster der schwedischen Fahne. Schmunzelnd drehe ich die Karte um.
Hej, Gunn! Da siehst du, was du verpasst hast, weil du mich nie hier besucht hast. Aber jetzt ist es zu spät. Ich komme Ende des Monats zurück. Freue mich auf dich – Bo
In der Ecke steht ein eilig hingekritzelter Nachsatz, den ich kaum entziffern kann. Dann doch: Besorg mir schon mal ’nen Kerl zum Eingewöhnen, ja?
Ich lege die Karte zurück und sehe wieder zum Fenster. Bo kommt also endlich zurück. Fast drei Jahre war er jetzt da oben und nur zweimal zwischendurch in Berlin. Gelegentlich haben wir miteinander gesprochen, aber nicht oft. Wir telefonieren beide nicht gerne. Briefeschreiber sind wir leider allerdings auch nicht.
Weit hinten ist die Sonne jetzt fast ganz hinter den Dächern verschwunden. Einen Moment lang habe ich das Gefühl, dass sie mich alleine zurücklässt. Ich frage mich, wo Greta wohl steckt. Zu Hause vermutlich, mit Dolly vielleicht. Und dann frage ich mich, was Inga gerade macht. Und ob Rasmus schläft, zwischen Luis und Vera gebettet, die selbst im Schlaf über ihn wachen.
Wo Kim ist, weiß ich genau.
Ein Zucken geht durch meinen Bauch, als ich an sie denke. Ich sehe zur Uhr. Kurz vor halb zehn. Eine günstige Zeit. Im Dornbusch ist noch nicht allzu viel los. Wenn ich mich mit dem Duschen beeile, schaffe ich es locker bis halb elf.
Die letzten Tage stecken mir in den Knochen. Ich bin unruhig und müde zugleich, und eigentlich brauche ich Schlaf. Aber das kann noch warten.
Ich ziehe den Pieper von meinem Gürtel und lege ihn auf den Tisch. Ich werde nicht lange fort bleiben.
Es ist doch nach elf, als ich im Dornbusch ankomme. Ich habe lange unter der Dusche gestanden und das laute Prasseln des lauwarmen Wassers genossen. Manchmal beruhigt mich das, manchmal regt es mich an. Heute machte es beides mit mir, und das dauerte länger.
Vor dem Eingang hängen ein paar schwule Youngster herum und beäugen sich gegenseitig. Ein Lesbenpärchen knutscht selbstvergessen am Straßenrand, und drei südländisch aussehende Touristen, Spanier vielleicht, blättern in ihrem Reiseführer, während sie mit einer Mischung aus Misstrauen und Neugier die Fassade des Dornbusch betrachten. Maik, einer der Barmänner, steht breitbeinig und mit verschränkten Armen in der Tür und beobachtet mit unbewegter Miene das rege Treiben auf der Oranienstraße. Als er mich sieht, verzieht sich sein breiter Mund zu einem erkennenden Lächeln.
„Hi, Maik. Schon was los?“ Ich schiebe mich an ihm vorbei.
Er zuckt mit den Achseln. „Lauter Touristen. Sommer, du weißt schon.“ Er nickt zu den Spaniern, die sich jetzt lautstark beratschlagen.
„Wetten, die gehen weiter ins SO?“
Er grinst. „Wette dagegen. Zwei Euro?“
„Lieber ein Bier.“
Wir sehen zu den Spaniern hinüber. Der Größte von ihnen klappt den Reiseführer zusammen, schüttelt den Kopf und deutet aufs SO. Dann geht er los. Die anderen folgen ihm schweigend.
„Shit“, sagt Maik grinsend. „Na, willst du ein Bier?“
„Ich komm drauf zurück.“
Drinnen ist es erstaunlich voll. Normalerweise beginnt die Stoßzeit im Dornbusch erst weit nach Mitternacht, aber schon jetzt ist die Bar gut gefüllt. Am dicht besetzten Tresen drängen sich die Gäste, und als ich einen Blick in den hinteren Raum werfe, sehe ich auch dort zahlreiche Gestalten rund um die Tanzfläche und an der hinteren Bar. Ich schlucke einen Anflug von Ärger hinunter. Ungünstig, klar. Aber auch das hat seinen Reiz. Wieder zuckt es in meinem Bauch.
Ich lehne mich gegen die Wand und sehe zum Tresen. Kim steht dahinter und gießt Tequila in Gläser, mit dem Rücken zum Eingang. Im dunkel getönten Spiegel sehe ich ihr konzentriertes Gesicht. Café del Mar perlt über ihr aus den Boxen, tropft in das Stimmengewirr.
Kim greift nach oben, ihr sehniger Arm zieht eine Flasche aus dem Regal. Dann beugt sie sich vor, und ihr Gesicht verschwindet hinter den Gläsern. Ich hole tief Luft.
Die Musik macht eine Pause. Jemand lacht laut, neben mir zischt ein Feuerzeug. Dann setzt ein melodiöser Bass ein, und Kims Gesicht taucht wieder im Spiegel auf. Eine Junglesbe, die lauernd neben ein paar Ledermännern am Tresen hängt, versucht ihren Blick aufzufangen, aber Kim ignoriert sie.
Wieder einmal versuche ich, genauer zu spüren, was ich für sie fühle. Zuneigung. Wärme – und auch einen Teil echte Faszination. Der Rest ist verschwommen. Nur die Lust sticht deutlich daraus hervor. Aber das ist ja klar.
Kim sieht klasse aus. Etwas größer als ich, sehr schlank, dunkelhaarig, mit dunklen Augen und einer auffälligen Narbe über dem rechten Mundwinkel. Sie hat ziemlich lange gebraucht, um mich auf sich aufmerksam zu machen. Aber sie hat es geschafft. Irgendwann konnte ich ihren auffordernden Blick nicht mehr ignorieren.
„Hier. Zum Wohl!“ Maik drückt mir ein eiskaltes Becks in die Hand, nickt mir zu und geht zum Tresen.
Als er sich an Kim vorbeischiebt, blickt sie auf und entdeckt mich im Spiegel. Einen Moment verharrt sie mitten in der Bewegung, dann lächelt sie leicht und senkt wieder den Kopf. Aber ich habe das Glimmen in ihren Augen gesehen.
Um mich herum wird es voller und voller. Zunehmend strömen die Gäste herein, Schwule jeglicher Couleur, aufgedonnerte Transen, ein paar Lesben, viele Touristen. Kim hat mächtig zu tun. Geduldig sehe ich zu, wie sie Gläser füllt und Flaschen über den Tresen schiebt, während die Spannung in meinem Bauch zusehends wächst. Kims Bewegungen sind lässig, sie weiß, dass ich sie taxiere. Ab und zu sieht sie zu mir herüber, jedes Mal zieht ein verhaltenes Lächeln über ihr Gesicht.
Auch Maik blickt ein- oder zweimal zu mir her. Ich weiß, dass er genau verfolgt, was passiert. Und das gefällt mir.
Irgendwann dreht der DJ im hinteren Raum den Sound auf, und die Touristen drängen hinüber. Der Tresen lichtet sich rasch, bevor neues Volk nachströmt, nur für ein paar Minuten, das kenne ich schon. Aber die müssen reichen.
Ich stelle mein leeres Bier auf den Tisch und stoße mich von der Wand ab. Kim dreht sich um und sieht mich an. Unsere Blicke verhaken sich ineinander. Ich stecke die Hände in meine Hosentaschen und starre sie an. Dann nicke ich zum Flur hinüber.
Selbst in der schwachen Beleuchtung sehe ich, dass Kim errötet. Langsam stellt sie die Bierflaschen ab, die sie gerade aus dem Kühlschrank geholt hat. Dann beugt sie sich zu Maik, flüstert ihm etwas ins Ohr und kommt um den Tresen herum auf mich zu. Wortlos geht sie an mir vorbei, nur das Flackern in ihren Augen verrät sie. Bevor ich ihr folge, sehe ich, dass Maik sich umgedreht hat und zu uns hersieht. Auch die Junglesbe auf dem Hocker gafft uns nach, allerdings, ohne zu kapieren, was vor sich geht. Unwillkürlich muss ich lächeln. Unschuldige Jugend.
Kim geht dicht vor mir her durch den lang gestreckten Flur, in ihrer typisch aufrechten Haltung. Ein paar Transen treten zur Seite, als wir vorbeikommen, und zwei kräftige Schwule in Chaps machen uns Platz. Kims Status als Barfrau verleiht ihr Respekt, unwillkürlich teilt sich die Menge, wenn sie das Dornbusch durchquert. Das amüsiert mich jedes Mal wieder.
Dann sind wir auch schon bei den Toiletten. Kim lässt sie links liegen und zieht die Tür zum Lagerraum auf. Als sie hineingeht, greife ich nach ihr und drehe sie zu mir herum. Bevor die Tür hinter mir zufällt, stemme ich einen Fuß in die Öffnung. Ich will ihr Gesicht sehen.
Kim kneift die Augen zusammen, das Licht aus dem Flur scheint sie zu blenden. „Gunn. Schön, dich zu sehen.“
„Das will ich hoffen.“ Meine Hand liegt locker auf ihrer Hüfte, mein Daumen drückt sich leicht in ihren Bauch. Sie ist mir so nah, dass ich sie riechen kann. Von Anfang an hab ich ihren Duft gemocht.
„Aber natürlich“, sagt Kim. Die Narbe über ihrem Mundwinkel zuckt. Ich beuge mich vor und lecke mit der Zungenspitze darüber. Kim stößt überrascht die Luft aus. Ihre Augen leuchten im Schatten.
„Wie geht’s meiner Kleinen?“, frage ich leise.
Kim sieht auf meinen Mund. „Ich bin nicht deine Kleine“, antwortet sie langsam.
Ich drücke meinen Daumen tief in ihren Bauch und ziehe sie blitzschnell am Kragen zu mir heran. „Bist du doch“, flüstere ich ihr ins Gesicht. „Und ob du das bist.“
Kim nickt atemlos. „Okay“, flüstert sie zurück. „Ich bin deine Kleine, okay.“ Das Leuchten in ihren Augen schießt mir bis in den Bauch. Und noch tiefer.
Ich setze den Fuß vor, und die Tür fällt hinter uns zu.
Schwaches Laternenlicht scheint von draußen durch ein winziges, vergittertes Fenster in den vollgestellten Lagerraum. Prall gefüllte Regale reihen sich an den Wänden bis zur Decke, in den Ecken stehen Kisten, mannshoch übereinander gestapelt. Neben der Tür ist ein Waschbecken befestigt; jetzt, da der Lärm aus dem Flur verebbt ist, höre ich das Tropfen des undichten Hahnes.
Kim steht bebend vor mir. Mit schnellen Zügen atmet sie ein und stößt die Luft wieder aus. Ich kann ihre Aufregung spüren. Sie wartet. Sie wartet auf mich. Auf das, was ich mit ihr tue. Kim wartet auf meine Wünsche.
Und auf meine Befehle.
„Dreh dich um“, sage ich ruhig. Kim stößt wieder die Luft aus, dann dreht sie sich um. Ich trete dicht an sie heran.
„Heb die Arme über den Kopf“, flüstere ich.
Kim hebt die Arme und verschränkt ihre Hände im Nacken. Blind greife ich nach ihrem Hosenbund und öffne die Knöpfe ihrer Hose. Zwei, drei schnelle Bewegungen, und schon rutscht ihr der dünne Stoff über die Hüften. Kims Bizeps zittert, als sie den Kopf nach hinten legt und ihre Lippen meine Wange berühren.
Ich weiche ihr aus. „Hab ich das erlaubt?“, frage ich rau.
„Nein“, flüstert Kim und dreht den Kopf nach vorn. Meine Hände gleiten unter ihr eng anliegendes Hemd und schmiegen sich um ihre Brüste. Sie sind nicht gerade groß, aber durchaus wohl geformt. Wie Kims ganzer Körper.
Nur dünner dürfte sie nicht werden, sonst verlöre sie an Substanz. Ohnehin ist sie hart an der Grenze dazu.
Aber das hat andere Gründe.