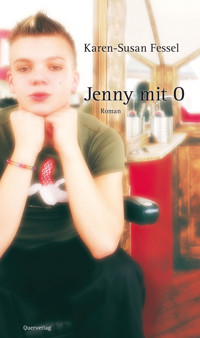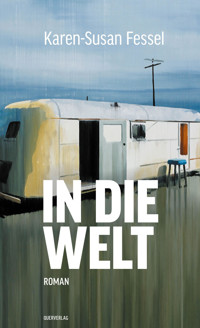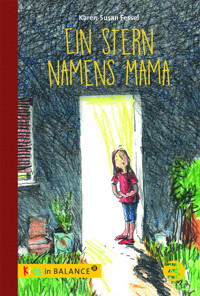Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Querverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die junge Berliner Autorin Edna Linse erhält ein Stipendium auf Gut Gerdelmann, einem Landgut im Emsland, und trifft dort auf eine bunt zusammengewürfelte Künstlerschar: Da sind die Künstlerin Andrea, die Edna nicht kalt lässt, Marek Meister, der Maler, geplagt von niedrigem Selbstwertgefühl, Geldsorgen und Pechsträhnen, und der sexsüchtige Jungdichter Steffen Mißfeld. Die Künstler, die der kauzige Leiter für die besten des Landes hält, konkurrieren, intrigieren, verbünden sich, und da ist außerdem der Hunger nach Liebe. Das bunte Treiben in einem Künstlerdorf – welch ein Thema für die ironisch-spitze Feder von Karen-Susan Fessel!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 485
Veröffentlichungsjahr: 2005
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Nur die Besten! ist ein Roman. Das bedeutet, daß die Handlung und die Personen erfunden sind. Wer sich wiederzuerkennen glaubt, hat selber schuld. Die Örtlichkeiten hingegen entsprechen zu weiten Teilen der Wirklichkeit. Ein Gut Gerdelmann gibt es zwar nicht, aber wer weiß, eines Tages …
© Querverlag GmbH, Berlin 2005
Erste Auflage September 2005
Nur die Besten! erschien 2001 als Originalausgabe bei Piper Verlag GmbH, München.
Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Umschlag und grafische Realisierung von Sergio Vitale unter Verwendung einer Fotografie von getty images.
ISBN 978-3-89656-547-1
Bitte fordern Sie unser Gesamtverzeichnis an:
Querverlag GmbH, Akazienstraße 25, D-10823 Berlin
querverlag.de
Für Stefan und Jan,
Martina und Annette,
Jochen und Matthias,
… und für Rolfrafael, natürlich!
Oktober
Sie wartet in Berlin, sie wartet in Hannover, und sie wartet in Rheine. Sie wartet auf Züge, Anschlüsse und Verbindungen, und als sie in Meppen angekommen ist, wartet sie schon wieder. Diesmal auf einen jungen Mann mit dem Namen Martin Schultejans, und obwohl sie ihn noch nie zuvor gesehen hat, erkennt Edna ihn sofort, als er schließlich die Treppe aus der Bahnhofsunterführung heraufhastet. Keuchend läuft er auf sie zu.
„Warten Sie schon lange?“ ruft er, noch bevor er ganz herangekommen ist, und Edna setzt ihren Koffer ab und streckt die Hand aus.
„Nein. Guten Tag.“
Er holt tief Luft und ergreift ihre Hand. „Edna Linse, nicht wahr? Ich bin Martin Schultejans. Guten Tag. Willkommen im schönen Emsland.“
„Bis jetzt habe ich noch nicht so viel davon gesehen, aber ich hoffe, daß Sie recht haben. Ich meine, damit, daß es schön ist“, sagt Edna.
Martin Schultejans wischt sich den Schweiß von der Stirn und bückt sich nach ihrem Koffer, und Edna betrachtet fasziniert den schnurgeraden Seitenscheitel in seinem kurzgeschorenen Haar.
„Wie haben Sie denn den Scheitel hingekriegt? Ich meine, wie hält denn der?“
Einen Moment lang starrt er sie fragend von unten herauf an, dann versteht er und faßt sich ins Haar. „Der ist rasiert“, erklärt er und errötet leicht.
„Ach so“, sagt Edna.
Für einen Moment verstummen beide. Schließlich hebt Martin Schultejans Ednas Koffer an und richtet sich auf. „Jedenfalls, was das Emsland betrifft – es kann hier ganz schön sein. Ehrlich.“ Er lächelt Edna an, und Edna lächelt zurück.
Martin Schultejans ist jung, viel jünger, als Edna bei einem Referenten für Öffentlichkeitsarbeit erwartet hat. Er ist mindestens sechs, sieben Jahre jünger als sie, und Edna ist dreiunddreißig, was in ihren Augen auch ziemlich jung ist. Jedenfalls für eine ausgewiesene Lyrikerin.
Aber abgesehen von seiner Jugend und dem einrasierten Scheitel sieht Martin Schultejans ziemlich genau so aus, wie Edna sich einen Referenten für Öffentlichkeitsarbeit einer renommierten Künstlerstätte vorgestellt hat. Er trägt einen gut geschnittenen, hellgrauen Anzug mit einem offenen Sporthemd darunter und frisch geputzte, schwarze Halbschuhe, und sein scharf konturiertes Gesicht mit den hellen, eng zusammenstehenden Augen wirkt freundlich und distinguiert zugleich. Edna folgt ihm den Bahnsteig entlang, die steile Treppe hinunter und durch die Betonunterführung, die vom Rumpeln und Dröhnen des abfahrenden Zuges erzittert. Am Ausgang steht ein grauer Golf.
„Hier“, sagt Martin Schultejans und reißt die Beifahrertür weit auf. „Und jetzt bringe ich Sie zu Ihrem Schriftstellerstübchen.“
Während der Fahrt durch das kleine, in der Oktobersonne wie ausgestorben daliegende Städtchen starrt Edna schweigend aus dem Fenster. Die Gebäude in dieser Gegend bestehen nahezu ausnahmslos aus roten Klinkern, was ihr schon während der letzten halben Stunde der Zugfahrt ins Auge gestochen ist. Es gibt kleine und große Häuser in den verschiedensten Rottönen, umrahmt von adrett gestutzten Hecken und ordentlich geharkten Vorgärten, in denen noch einige verwelkte Blumen an den vergangenen Sommer erinnern.
Vor einem Drogeriemarkt steht eine alte Dame in einem beigefarbenen Herbstmantel und hantiert mit verärgerter Miene an ihrem Fahrradschloß. Mitgefühl schießt in Edna hoch; das Problem kennt sie: wenn das Schloß einfach nicht zugeht, egal wie einfühlsam und vorsichtig man es auch versucht. Edna dreht sich um, als der Wagen den Drogeriemarkt hinter sich läßt. Die alte Dame schüttelt ihren graumelierten Kopf und schlägt frustriert mit der Faust auf den Sattel. Langsam kippt das Fahrrad um.
„Die kleinen Tragödien des Lebens“, sagt Martin Schultejans trocken und überholt einen am Straßenrand geparkten Lieferwagen, der Edna schließlich die Sicht versperrt. Sie sieht ihren Fahrer an. Er lächelt ihr zu, dann nimmt er eine Zigarette aus der Schachtel, die auf dem Armaturenbrett liegt, und wedelt damit fragend in Ednas Richtung. „Stört es Sie, wenn ich rauche?“
„Aber nein.“
„Darf ich Ihnen auch eine anbieten?“
Edna nickt, obwohl sie die Sorte eigentlich nicht mag. Als Martin Schultejans ihr Feuer gibt, weiß sie bereits, daß ihr gleich schwindlig werden wird, aber es ist schon zu spät. Tapfer atmet sie den Rauch ein und beißt die Zähne zusammen.
„Bin ich eigentlich die Erste?“ fragt sie, nur um sich von der Übelkeit abzulenken. Erst nach einem Moment merkt sie, daß Martin Schultejans verstohlen in sich hineinschmunzelt, und kurz darauf kommt ihr die Zweideutigkeit ihrer Frage ins Bewußtsein.
„Nein“, sagt er. „Eine bildende Künstlerin ist schon eingetroffen, Andrea Franke. Und eine Dichterin, Daria Kechter. Sie soll hochgeistige Lyrik schreiben, ich selbst habe allerdings noch nichts von ihr gelesen. Kennen Sie die eventuell?“
Edna schüttelt den Kopf. Ihr ist immer noch übel, und sie konzentriert sich darauf, die Tankstelle, an der sie gerade vorbeifahren, zu fixieren.
„Zwei oder drei Ihrer Kollegen kommen ebenfalls heute an, die anderen werden im Laufe der Woche erwartet. Ach ja, und der General ist schon da. Das ist ein Gastschreiber aus Sarajevo.“
„Gastschreiber?“
Martin Schultejans setzt den Blinker und biegt von der Hauptstraße ab. „Außer den zehn festen Stipendiatenplätzen verfügt Gut Gerdelmann noch über ein Gastapartment, in dem jeweils ein Schriftsteller für zwei Monate untergebracht wird“, erklärt er geduldig. „Das wird aus Mitteln der Stiftung Deutsche Literatur finanziert.“
„Ach so. Und warum dann ein General aus Sarajevo?“
Martin wirft Edna einen amüsierten Seitenblick zu. „Er ist ebenfalls Lyriker. Fragen Sie mich nicht, warum er sich so nennt.“
Der Wagen passiert einen Fußballplatz und setzt über eine Brücke, und Edna entdeckt eine alte Mühle, die offensichtlich erst vor kurzem renoviert worden ist, den neuen Dachschindeln nach zu urteilen.
„Das ist die Kossenmühle, ein ganz altes Stück. In dem Hofgebäude dahinter ist eine Kneipe, nur zur Information. Leider ist die Mühle selbst zur Zeit aufgrund der Instandsetzungsarbeiten nicht zu besichtigen.“ Martin Schultejans verlangsamt das Tempo und fährt vorsichtig über eine in die Straße eingelassene Schwelle, vorbei an einem kleinen Edeka-Markt, vor dessen Fensterfront einige Kisten mit Äpfeln in der späten Oktobersonne glänzen.
„Schade“, sagt Edna, die ohnehin kein großes Interesse an historischen Gebäuden hegt.
„Aber vielleicht interessieren Sie sich ja auch gar nicht für historische Gebäude“, sagt Martin Schultejans ruhig.
Edna sieht ihn vorsichtig von der Seite an.
„Das wäre natürlich wirklich schade. Denn viel mehr Zerstreuung hat das Emsland nicht unbedingt zu bieten. Abgesehen von der Natur. Mögen Sie die Natur?“ Er schmunzelt. Er versucht es zwar zu verbergen, aber Edna sieht genau, daß er schon wieder schmunzelt. Ein nervöses Prickeln breitet sich zwischen ihren Schulterblättern aus.
„Na ja, doch. Eigentlich schon. Aber ich bin ja auch nicht zur Zerstreuung hier, sondern zum Arbeiten“, sagt sie langsam.
Der Wagen fährt unter einer Brücke hindurch und durch ein kleines, sonnendurchflutetes Waldstück, und dann eröffnet sich eine schnurgerade Straße vor ihnen, die sich zwischen endlosen Stoppelfeldern am Horizont verliert. Edna schließt die Augen und öffnet sie wieder, aber der Anblick bleibt unverändert. Die reinste Ödnis liegt vor ihr.
„Ja“, sagt Martin Schultejans und lacht. „So muß man es sehen. Aber es kann ganz schön hier sein. Ehrlich.“
Vierzig Kilometer vor Meppen heult der Motor auf. Ein tiefes Dröhnen läßt den R4 erzittern, und dann spürt Marek, wie der Motor erstirbt.
„Scheiße“, murmelt er und tritt das Gaspedal durch. Sein Fuß in dem schmutziggrauen, arg ramponierten Tennisschuh trifft auf keinerlei Widerstand, und die Tachonadel strebt zitternd der Null zu. „Scheiße!“
Der holländische Lastwagen im Rückspiegel, der Marek seit Osnabrück dicht auf den Fersen ist, wird größer und größer. Marek flucht, tritt ein letztes Mal aufs Gaspedal, dann setzt er den Warnblinker. Fieberhaft sucht er den Straßenrand nach einer Haltemöglichkeit ab. Soweit er sehen kann, zieht sich ein schmaler Graben längs der Fahrbahn entlang. Weit und breit ist keine Straßenmündung in Sicht, nicht mal ein unscheinbarer Feldweg, geschweige denn ein Parkplatz. Der Laster hupt, und das ohrenbetäubende Geräusch fährt Marek durch Mark und Bein.
„Scheiße“, murmelt er. „Scheiße, Scheiße, Scheiße.“ Jetzt ist nur noch der Kühlergrill im Rückspiegel sichtbar. Das Hupen wird immer lauter, und die Straße verengt sich zusehends in Marek Blickfeld. „Mama“, sagt Marek laut. „Mama, Scheiße, Mama, Scheiße. Pups Kacke Scheiße.“ Der R4 wird langsamer und langsamer. „Nicht jetzt! Nicht jetzt, ausgerechnet jetzt, wo ich einmal, ein einziges Mal Glück habe!“
Der Asphalt ist grau. Dunkelgrau. Marek mag kein Grau. Er hat Grau noch nie gemocht. Und er hat es bislang auch noch nie verwendet.
Der Laster blendet auf, und Marek schließt die Augen. Im nächsten Moment hört er ein tiefes Dröhnen, dazwischen ein helles Sausen, das sich in immer höhere Frequenzen steigert. Marek kneift die Augen fest zu und faßt das Lenkrad fester.
„Scheiße, Mama“, flüstert er. „Scheiße. Scheiße.“ Das Dröhnen hört auf, und mit ihm verklingt das Sausen. Marek macht die Augen wieder auf. Der Laster setzt ein Stück weiter vorne soeben wieder auf die rechte Fahrbahn zurück. Eine Abgasschwade hängt schwer in der Luft und beginnt bereits wieder, sich aufzulösen. Die Sonne scheint auf die abgeernteten Kornfelder rechts und links der Straße. In der Ferne ist ein Waldstück zu sehen und dahinter ein Schornstein, und der R4 steht. Marek preßt sich in seinen Sitz, nimmt die Hände vom Lenkrad und atmet tief aus.
„Danke“, sagt er leise.
Der rechte Vorderreifen ist nur wenige Zentimeter neben dem Straßengraben zum Stehen gekommen und hat sich ein Stückchen in die Grasnarbe hineingefressen. Ein paar längst vertrocknete Grasbüschel hängen über den Grabenrand. Marek geht langsam um den Wagen herum. Schließlich öffnet er den Kofferraum und holt das Warndreieck heraus. Während er am Straßenrand entlangmarschiert, so dicht am Graben, wie es nur geht, denkt er an Lisa. Lisa hätte gelacht. Nein, korrigiert er sich. Lisa hätte erst gelacht, dann hätte sie mit dem Kopf geschüttelt, und dann hätte sie Marek angesehen, mit einem strafenden Blick, in dem sich Verachtung mit Ärger mischte. „So einen Pechvogel wie dich gibt es kein zweites Mal auf der Welt“, hätte sie gesagt. „Ich weiß nicht, wie ich es mit dir aushalte.“
Sie hatte es ja auch nicht mit ihm ausgehalten. Sie hatte nach gut einem Jahr ihren Ersatz-Kosmetikkoffer genommen und war gegangen, aus Mareks schmutziger Fabriketage und seinem Leben hinaus, mit festen, weit ausholenden Schritten, wie es so ihre Art ist.
Marek bleibt stehen und stellt das Warndreieck auf den dunkelgrauen Asphalt. Dann holt er tief Luft und seufzt laut auf. Das einzige, was ihm seit Lisas furiosem Abgang Auftrieb gegeben hat, ist die Tatsache, daß er ein Stipendium bekommen hat. Er, Marek Meister, hat ein Stipendium bekommen. Er hat zwar keine Freundin mehr, keinen Job, kein Geld, keine Fabriketage – der befristete Mietvertrag ist zum Monatsende ausgelaufen – und damit auch kein Atelier. Aber dafür hat er ein Stipendium. Und Schulden.
Und ein kaputtes Auto, wie es aussieht.
„Schön“, sagt Edna und betrachtet wohlgefällig das Gästebett in ihrem Apartment. „Da kann man ja getrost Besuch kriegen hier.“ Sie beugt sich herunter und prüft mit der flachen Hand die Beschaffenheit der Matratze, und dann setzt sie sich probeweise hinauf. Die Matratze federt ein bißchen, aber nicht zu sehr, sondern gerade richtig.
„Man kann die Betten auch problemlos zusammenschieben, das geht wirklich ganz einfach“, sagt Martin Schultejans. Er steht im Türrahmen und sieht Edna bei ihrer Inspektion zu, und als sie zu ihm aufblickt, glaubt sie zu sehen, daß er ihr zublinzelt.
„So, so“, sagt sie kühl. „Sie wollen doch wohl nicht behaupten, daß Sie das schon ausprobiert haben?“
Martin Schultejans versteift sich. „Nein, nein, das nicht. Ich meine nur, die bisherigen Stipendiaten haben das berichtet.“
„Wer hat denn zuletzt hier gewohnt?“ Edna geht zum Fenster an der Stirnseite des Raumes und blickt hinaus. Von diesem Fenster kann sie direkt in den dichten, buntblättrigen Mischwald sehen, der sich östlich an das Gutshaus anschließt. Aus dem anderen Fenster in der Mitte des Zimmers hingegen hat sie freie Sicht auf ein paar Birken, die den kleinen Garten seitlich des Hauses begrenzen, die kleine Straße, die über den Hof führt, und die Feldlandschaft dahinter. Edna ist höchst zufrieden mit der Unterbringung. Das Zimmer ist geräumig, trotz der Hitze draußen angenehm kühl und mit einer effektiv gestalteten Arbeitsecke, zwei Betten und einer modernen Kochnische samt Sitzgarnitur sehr edel und zweckmäßig eingerichtet, und das kleine Bad blitzt vor Sauberkeit.
Das ganze Haus ist wunderschön. Martin Schultejans hat sie überall herumgeführt. Im Untergeschoß liegt die Tenne, ein großer Aufenthalts- und Veranstaltungsraum, der seinen plattdeutschen Namen einer alten Bauerntradition verdankt. Daneben befinden sich der Medienraum, eine gut ausgestattete Gemeinschaftsküche sowie die Bibliothek und ein extra Tagungszimmer. Beim Anblick all dieses Komforts hat Edna sich ganz merkwürdig gefühlt. So, als sei sie versehentlich ausgewählt oder ihr Name schlichtweg vertauscht worden.
Edna ist solcherlei Luxus nicht gewohnt. In ihrer Berliner Wohnung, die sie mit einer Freundin teilt, gibt es weder Zentralheizung noch Warmwasser. Im Bad ist kein Waschbecken vorhanden, sondern nur eine veraltete Badewanne auf Füßen, und um den Badeofen betreiben zu können, gehen Edna und ihre Mitbewohnerin abwechselnd auf die Suche nach Holzresten, vorrangig nachts und auf ungesicherten Baustellen. Das ist zwar vorsintflutlich und verboten, aber umsonst.
„Wer hier zuletzt gewohnt hat? Ja, da muß ich mal nachdenken“, überlegt Martin Schultejans. „Ich will nichts Falsches sagen, aber ich glaube, es ist Dunja Reiter.“
„Dunja Raiter? Sehr komisch.“
„Reiter mit e, nicht mit a. Eine Literatin. Sie heißt wirklich so“, erklärt er.
Edna mustert ihn. Sie ist sich nicht sicher, ob er sie nicht doch auf den Arm nehmen will. Überhaupt weiß sie nicht so recht, was sie von Martin Schultejans und seinem trockenen Humor halten soll. Sie wird sich erst daran gewöhnen müssen.
Edna steht auf, geht mit raschen Schritten zum Arbeitsstuhl und setzt sich. Die Federn geben unter ihrem Gewicht nach, und plötzlich wird ihr bewußt, daß hier schon so manch ein Kollege oder eine Kollegin die Nächte schreibend und dichtend durchwacht hat. Aber mit welchem Erfolg?
„Ist die bekannt, die Dunja Reiter?“ fragt sie.
Martin Schultejans zuckt mit den Achseln. „Da bin ich überfragt. Ich persönlich habe sie jedenfalls vorher nicht gekannt. Aber das muß nicht viel heißen. Ich bin nicht besonders bewandert in Lyrik.“
Das trifft auf die meisten Leute zu, und Edna hat sich vorgenommen, sich nie darüber zu ärgern. Sie ist Lyrikerin, und zwar eine nahezu unbekannte Lyrikerin, und wenn die Menschheit weiterhin vorhat, so gut wie keine Lyrik zu lesen, dann bleibt Edna eben für den Rest ihres Lebens eine unbekannte Lyrikerin.
„Aber Sie haben sie ja auch nicht gekannt“, setzt Martin Schultejans hinzu, und Edna ärgert sich sofort. Eifrig macht sie sich daran, die Schreibtischschubladen zu untersuchen.
„Sie wohnen übrigens genau über dem Chef“, sagt Martin Schultejans. Edna macht die Schubladen wieder zu – außer ein paar Heftklammern in der obersten liegt ohnehin nichts drin – und sieht alarmiert zu ihm auf. Aber Martin Schultejans schüttelt den Kopf. „Keine Angst“, sagt er. „Der hört nichts, was er nicht hören soll. Eher hören Sie ihn. Oh, sehen Sie, da draußen, sehen Sie die junge Frau dahinten?“ Aufgeregt zeigt er aus dem Fenster.
Edna schwingt sich auf dem Drehstuhl einmal ganz herum und sieht hinaus. Zwischen den sonnenbeschienenen Bäumen schleicht sich soeben eine dunkelgekleidete Gestalt davon.
„Das ist Ihre Kollegin, Daria Kechter. Ich kann Ihnen nicht garantieren, daß Sie je mehr von ihr zu Gesicht bekommen werden.“
„Aber das war doch nur ein Huschen.“
„Ja“, sagt Martin Schultejans. „Ich denke, sie huscht ausgesprochen gern.“ Er grinst, und auf einmal glaubt Edna, daß sie sich doch recht bald an ihn und seinen Humor gewöhnen wird.
„Also, ich weiß nicht. Irgendwie finde ich diese Landschaft ein bißchen ...“ Gina beugt sich nach vorne und späht angriffslustig durch die Windschutzscheibe. „Öde.“ Sie kneift die Lippen zusammen und sieht zu Walter hinüber, und Walter zuckt müde mit den Schultern.
„Sie ist zumindest grün. Mehr kann man nicht unbedingt verlangen.“ Gina zieht unwirsch ihre gebatikte Bluse zurecht und sieht dann wieder nach vorne, wo sich die schnurgerade Straße in der Ferne zwischen den Getreidefeldern verliert. „Du gibst dich ja mit wenig zufrieden, das muß ich schon sagen, Walter. Was ist los mit dir? Macht das Alter dich mürbe?“
Walter lächelt gequält. Seit sie die Autobahn verlassen haben, ist es mit Ginas Laune ständig bergab gegangen. Walter kennt sie nicht besonders gut, nur von gelegentlichen Treffen im Schriftstellerverband her und von einigen gemeinsamen Leseveranstaltungen. Über einen gemeinsamen Bekannten haben sie erfahren, daß sie beide für ein Aufenthaltsstipendium auf Gut Gerdelmann in Meppen ausgewählt worden sind, und kurzerhand die gemeinsame Hinreise beschlossen. Aber Walter ist nahe daran, es zu bereuen. Denn eines ist ihm jetzt bereits klar: Regina, genannt Gina Lüpke, Kölns unangefochtene Spoken-Poetry-Königin, braucht ständige Aufmerksamkeit und Unterhaltung. Walter hingegen ist eher der Typ, der auf Autofahrten gerne schweigt.
„Du sagst ja gar nichts“, sagt Gina. Sie beschleunigt, um einen Traktor zu überholen, und zieht den Wagen hektisch nach links. Walter preßt instinktiv die Fersen in die Fußmatte.
„Was ist denn?“ fragt Gina und sieht zu ihm herüber. Walter starrt geradeaus, wo in nicht allzu weiter Entfernung gerade ein Wagen aufgetaucht ist.
„Da kommt ein Auto“, murmelt er, und Gina dreht den Kopf ruckartig nach vorn und kneift entschlossen die Lippen zusammen, während sie das Gaspedal ganz durchtritt. An Walters Seitenfenster fliegt der Traktor vorbei, und Walter erhascht einen Blick auf das miesepetrige Gesicht des Bauern.
„Das kommt nicht, das Auto. Es steht da einfach so rum“, sagt Gina und schert wieder rechts ein.
Walter stellt fest, daß sie recht hat. Aber erleichtert fühlt er sich nicht. Das Auto steht zwar tatsächlich, allerdings auf ihrer Seite, und Gina schießt mit unverminderter Geschwindigkeit darauf zu. In den letzten zweieinhalb Stunden hat Walter schon einige Male gedacht, daß sie den Golf überschätzt, was seine Höchstgeschwindigkeit einerseits und seine Bremsen andererseits angeht, aber er hat sich gehütet, das auszusprechen. Walter Wagenbrenner besitzt nämlich keinen Führerschein, aber das ist ein gutgehütetes Geheimnis. Und er hat nicht vor, es jemals zu lüften.
„Guck mal, da steht ein Typ und winkt“, sagt Gina und beugt sich vor. Der Golf schießt immer noch auf das stehende Auto zu, und Walter krallt seine Hände in die Seiten seines Sitzes.
„Ich wäre dir sehr dankbar, wenn du bei Gelegenheit das Tempo ein wenig drosseln würdest“, krächzt er, und Gina lacht laut auf und tritt auf die Bremse. Abrupt verliert der Golf an Tempo. Walter atmet aus. Jetzt kann er den jungen Mann deutlicher erkennen, der im klaren Licht der Oktobersonne am Straßenrand steht und mit einer halb hilflosen, halb resignierten Geste den linken Arm durch die Luft schwenkt. Er ist ungefähr Ende Zwanzig, trägt zerfetzte Jeans und eine verwaschene, weinrote Bomberjacke, und sein struppiges Blondhaar steht ihm in allen Richtungen vom Kopf ab. Hinter ihm wartet ein uralter R4 auf bessere Zeiten, die vermutlich höchstens in Gestalt einer Schrottpresse kommen werden.
„Mann, sieht der abgeranzt aus. Wenn das die emsländischen Männer sind, na dann – gute Nacht.“ Gina verzieht höhnisch die Mundwinkel nach unten, dreht das Lenkrad herum und tritt wieder aufs Gaspedal. Der junge Mann schüttelt mutlos den Kopf und läßt den Arm sinken, als der Golf an ihm vorbeirauscht.
„Warum hältst du denn nicht an?“ fragt Walter und verrenkt den Kopf, um nach hinten zu sehen. Der Bursche dauert ihn.
„Wieso denn? Meinst du, ich will jetzt stundenlang irgendwelche Aktionen starten, um so einen Bengel auf irgendein Kuhkaff zu schaffen? Nee!“ Gina schüttelt vehement ihren hennaroten Lockenkopf, und dabei sieht sie in den Rückspiegel. Mit einem eindeutig triumphierenden Gesichtsausdruck, wie Walter schockiert feststellt.
„Aber vielleicht braucht er Hilfe.“ Er dreht sich auf seinem Sitz nach hinten, so weit er kann. Sehr weit kommt er nicht. Er leidet unter extremen Schulterverspannungen, die ihm im Laufe der Jahre die Halssehnen verkürzt haben. Das Alter, denkt er. Ich werde wirklich alt. Ich bin einundfünfzig und alt.
„Papperlapapp. Soll er doch einen Trecker anhalten. Davon wimmelt es hier ja nur so.“ Gina kichert, und Walter fällt auf, daß ihr Kichern verblüffende Ähnlichkeit mit dem Meckern einer Ziege besitzt.
Eine Viertelstunde später hat sich die Landschaft immer noch nicht verändert. Die einzige Abwechslung hat in einer mit Fahnen geschmückten, überdimensionalen Trucker-Tankstelle bestanden, die urplötzlich hinter einer Kurve aufgetaucht ist. Walter hatte anhalten wollen, weil er ein dringendes Bedürfnis verspürte, auf Toilette zu gehen, aber Gina hat abgewinkt.
„Nein, jetzt halte ich nicht mehr an. Wir sind doch gleich da!“
„Das hast du vor zehn Minuten auch schon gesagt.“
„Was denn, drückt die Prostata? Das ist aber doch ein ausgesprochenes Altherrenleiden, oder nicht?“ Gina kichert, und Walter schweigt gekränkt. Sie biegen nach links auf eine Umgehungsstraße ein, und nachdem Gina waghalsig zwischen zwei schweren Lastwagen eingeschert ist, sieht sie zu ihm hinüber. „Jetzt sei doch nicht beleidigt, Walter. Erzähl mir lieber, woran du eigentlich zur Zeit sitzt. Was hast du eigentlich vor zu arbeiten, da in diesem Meppen?“
Walter sieht Gina aus den Augenwinkeln an. Eigentlich sieht sie ziemlich gut aus, findet Walter. Allerdings würde sie noch besser aussehen, wenn sie nicht immer so angestrengt dreinblickte. Bereits jetzt, mit Ende Dreißig, zeigen sich tiefe Kerben zu beiden Seiten ihrer Nase und eine in der Mitte der Stirn, hat Walter beobachtet. Und meistens zieht Gina zu alledem noch auf eine höhnisch wirkende Art die Mundwinkel herunter. Trotzdem sieht sie gut aus, findet er. Sie hat sehr schöne grüne Augen, sie ist schlank und bewegt sich leichtfüßig, und ihre Brüste sind erstaunlich fest für ihr Alter, soweit er bisher hat sehen können. Nur ihre Aufmachung gefällt ihm nicht. Walter steht nicht auf den Retro-Look der Seventies. Walter bevorzugt elegante Kleidung, bei Männern wie Frauen. Und Ginas Schlaghosen und die Batikbluse findet er einfach albern, ganz zu schweigen von der dämlichen Pelzjacke.
„So, das ist jetzt die dritte Frage innerhalb von fünf Minuten, und du hast mir bislang auf keine einzige geantwortet. Muß ich das allmählich persönlich auffassen?“
„Nein“, sagt Walter. „Es ist nur, ich bin so abgelenkt. Für mich ist das immer ziemlich komisch, woanders zu leben, und sei es auch nur für eine Zeit.“
„Ach ja? Wieso das?“
„Die Umstellung. Alles ist neu. Das kostet viel Energie. Findest du nicht?“
„Pfff. Nö.“ Gina verzieht höhnisch die Mundwinkel, und Walter bereut sofort, ein wenig aus sich herausgegangen zu sein.
„Ich habe Veränderungen gern. Das macht für mich das Leben aus“, erklärt Gina. „Und jetzt sag schon, woran sitzt du gerade?“
Walter hat diesen Ausdruck noch nie leiden können – „an etwas sitzen“, das sagen nur Schriftsteller. Vermutlich, weil es wichtig tönt. In Walters Ohren klingt diese Phrase allerdings eher wie ein Hinweis auf die Tatsache, daß Schriftsteller in der Regel Sesselfurzer sind. „Ich weiß noch nicht“, sagt er, und Gina wendet ihm ruckartig das Gesicht zu.
„Das stimmt nicht. Du weißt es bestimmt. Du willst es bloß nicht erzählen.“
Walter wird rot.
„Ich klau dir schon nichts, schon gar nicht deine Ideen. Außerdem interessiere ich mich überhaupt nicht für das, was du schreibst, keine Angst.“
„Danke“, sagt Walter sarkastisch. Gina starrt ihn einen Moment böse von der Seite an, bevor sie ihre Augen zu Walters großer Erleichterung wieder auf den Gegenverkehr richtet, der jetzt aus mehreren dicht hintereinanderher schlingernden Lastwagen mit holländischen Kennzeichen besteht.
„Ich rede einfach nicht so gerne über ungelegte Eier“, versucht Walter einzulenken, dem eingefallen ist, daß er Gina in den nächsten fünf Monaten vermutlich täglich zu Gesicht bekommen wird.
„Hach, weißt du, Walter, es ist wirklich egal. Du bist ein traditioneller Erzähler, ich mache poetry, da liegt eine Welt dazwischen, das läßt sich einfach nicht miteinander vergleichen.“
„Ja, und?“ fragt Walter ratlos. „Was willst du damit sagen?“
„Nichts. Da vorne geht’s ab!“ Walter sieht nach vorn, aber da ist kein Aufruhr zu entdecken. Nur ein Schild mit der Aufschrift „Schlagbrücken“.
„Das stand auf der Skizze, die mir dieser Wolf geschickt hat“, sagt Gina.
„Wulf. Wulf, nicht Wolf.“ Gina lacht ihr meckerndes Lachen, biegt mit rasantem Schwung in die Kurve ein und rattert über eine schlecht ausgebesserte Straße, bevor sie endlich Gas wegnimmt. Walter spürt, wie er sich sofort wieder ein wenig entspannt. Ihm ist ein bißchen übel, aber das wird sich legen, hofft er.
Eine Weile tuckert der Wagen durch kleine Nadelwälder und zwischen abgemähten Feldern hindurch, bevor die Straße schließlich über eine holperige Brücke führt. Und dann sind sie plötzlich mitten auf einem weitläufigen asphaltierten Hof, der von zwei großen Scheunen flankiert wird, während an der Stirnseite ein herrschaftliches Gutshaus von riesigen Ausmaßen thront.
„Das isses“, sagt Gina und würgt den Motor ab. Einen Moment bleiben beide wie erschlagen in ihren Sitzen hocken, bevor sie gleichzeitig ihre Türen öffnen und aussteigen. „Nicht übel.“ Gina knallt die Fahrertür zu und verschränkt die Arme vor ihren wohlgeformten Brüsten.
Walter sieht an der mit Efeu bewachsenen Vorderfront des Gutshauses hoch. Im oberen Stockwerk sind offensichtlich erst vor kurzem neue Fenster eingesetzt worden, und Walter zählt sie instinktiv durch. Sechs weiße, unbewegliche Vorhänge verwehren den Einblick in das Innere des Hauses, nur der siebte scheint sich leicht zu bewegen. Walter blinzelt gegen das Sonnenlicht. Er vermeint ein weißes Gesicht zu sehen, das reglos zu ihm herunterstarrt, aber als er erneut blinzelt, ist es verschwunden.
„Hoffentlich ist das hier nicht außen hui und innen pfui.“ Gina tritt ein paar Schritte vor und stemmt die Arme in die Hüften, und Walter muß sich ein Grinsen verkneifen. Sie sieht aus wie das Standbild einer grimmigen Hauswartsfrau aus den Fünfzigern, und daran kann auch ihre ganze um Jugendlichkeit bemühte Aufmachung nichts ändern.
„Bist du so nett, Walter, bringst du meine Tasche mit?“ Gina will sich eben in Bewegung setzen, als sie zusammenzuckt. Direkt neben ihr ist plötzlich ein Mann aufgetaucht. Er trägt einen grauen Arbeitskittel, ausgebeulte Cordhosen und ausgetretene Latschen, und sein außer Form geratener Herrenkurzhaarschnitt verbirgt nur mühsam seine enormen Segelohren. Das Auffälligste an ihm ist allerdings seine vollkommen ausdruckslose Miene. Auf Anhieb weiß Walter, daß dies der phlegmatischste Mensch ist, den er je zu Gesicht bekommen hat.
Für ein paar Sekunden ist es, als ob die Zeit stillsteht. Niemand bewegt sich, und keiner sagt etwas. Dann räuspert sich Walter. „Guten Tag“, sagt er.
Der Mann betrachtet ihn ausdruckslos, dann nickt er langsam und richtet seinen Blick auf Gina, die immer noch mit offenem Mund dasteht und ihn anstarrt.
„Wir möchten zu Herrn Wulf“, sagt Walter, dem Ginas Verhalten unangenehm ist.
Der Mann steckt die Hände in die Taschen seines Arbeitskittels und sieht wieder Walter an.
„Ist der Herr Wulf denn da?“ fragt Walter schließlich, um das peinliche Schweigen erneut zu durchbrechen.
„Hm“, brummt sein Gegenüber, und während Walter noch zu ergründen versucht, ob das eine Zustimmung oder Verneinung signalisieren soll, nickt er und deutet mit halb erhobenem Arm zum Gutshaus hinüber. „Da drüben drinne.“
Walter stößt Gina an, die nicht reagiert, und lächelt freundlich. „Wunderbar. Dann werden wir mal guten Tag sagen. Ich bin übrigens Walter Wagenbrenner aus Köln, und das hier ist Regina Lüpke. Wir gehören zu den diesjährigen Stipendiaten.“
Die kleinen, eng zusammenstehenden Augen des Mannes schweifen träge von Walter zu Regina. Dann sieht er in die Luft, aber als Walter seinem Blick folgt, ist da oben am Himmel nichts zu sehen. Noch nicht mal die allerkleinste Wolke. Nur die Sonne, deren Licht bereits schwächer zu werden beginnt.
„Gut“, sagt Walter und faßt Gina, die keine Anstalten macht, sich zu bewegen, leicht am Arm. Unwillig entzieht sie sich ihm, funkelt ihn verärgert an und stolziert ohne ein weiteres Wort eilig auf das Gutshaus zu. „Gut“, wiederholt Walter. „Ich geh dann auch mal. Darf ich fragen, wer Sie sind?“
Der Mann im Kittel löst langsam seinen Blick vom Himmel und sieht Walter müde an. „Duve, Ansgar. Der Hausmeister.“ Er verzieht seinen Mund zu einem kurzen Grinsen, das eine Reihe schnurgerader, erstaunlich winziger Zähne entblößt. Ansgar Duve zuckt mit den Schultern, dann beugt er sich unvermittelt vor und flüstert leise: „Der Meister fehlt noch.“
Walter kriecht augenblicklich eine Gänsehaut über den Rücken. Er muß an schwarze Messen und Satanismus und dergleichen denken. Ist nicht der Zulauf zu solchen Sekten auf dem Lande viel größer?
„Der Meister?“ flüstert er fragend.
„Eina müßte noch komm’n“, sagt Ansgar Duve. „Der Meister. Mirko Meister oder so, aus Dresden. Hatta vielleicht ne Panne. Passiert ja, so was. Ne?“
„Ja, sicher, so was kann passieren.“ Walter wischt sich erleichtert über die Stirn und stellt fest, daß sie feucht ist. „Bis später, Herr Duve.“
„Könn’ Se ruhig Ansgar sagen.“ Ansgar Duve sieht erneut zum Himmel auf, und Walter setzt sich in Bewegung. Als er an der Treppe zum Gutshaus angekommen ist und noch einmal zurückblickt, steht Ansgar Duve immer noch da und sieht in den Himmel.
Edna stößt die Fahrertür mit dem Hintern zu und bemüht sich, dabei nicht das Gleichgewicht zu verlieren. In den Armen hält sie einen schweren Karton mit ihren Einkäufen aus dem Edeka-Markt, und während sie die ersten, schwankenden Schritte auf die Eingangstür des Gutshauses zu macht, sieht sie sich vorsichtig um. Der Hof liegt menschenleer da, und bis auf das Auto mit Kölner Kennzeichen, das vorher noch nicht da gewesen ist, hat sich in Ednas Abwesenheit nichts verändert. Als sie sich langsam wieder zum Gutshaus umdreht, spürt sie plötzlich, wie müde sie ist. Müde und völlig verschwitzt, trotz der recht kühlen Herbstluft. Sie braucht unbedingt eine Dusche und dann ein eiskaltes Bier.
Martin Schultejans hat sie im Anschluß an die Besichtigung ihres Apartments durch das ganze Gelände geführt und ihr alle weiteren Gebäude gezeigt. Neben dem riesigen Gutshaus, in dem Edna sowie fünf weitere Stipendiaten untergebracht sind, gibt es noch das zurückgesetzt im Garten liegende Hausmeisterhäuschen sowie zwei große, ausgebaute Scheunen zu beiden Seiten des Hofes. In der linken, der sogenannten Büroscheune befinden sich außer den Büro- und Wirtschaftsräumen und der Ausstellungshalle die Apartments der übrigen vier bildenden Künstler, in der Scheune gegenüber, der Atelierscheune, sind die Werkstätten und Atelierräume untergebracht. Die von Pappeln gesäumte Allee zum Gut führt in einer schnurgeraden Linie zwischen ausgedehnten Pferdekoppeln hindurch von der Hauptstraße mitten auf den Hof, um sich rechts neben dem Gutshaus wieder hinauszuschlängeln, zwischen Feldern und kleinen Wäldchen hindurch bis in die Stadt. Edna weiß das, weil sie sich gerade eben dort verfahren hat. Martin Schultejans hatte ihr angeboten, ihr sein Auto für den ersten Großeinkauf zu leihen, und Edna hatte dankend angenommen, nachdem sie erfahren hat, daß der Bus oben an der Hauptstraße nur alle drei Stunden verkehrt, allerdings nur in der Zeit von zehn bis neunzehn Uhr. Genau gesagt heißt das, daß der Bus insgesamt viermal hält, wie Edna ausgerechnet hat.
„Das ist schon viel! Das haben die Stadtväter extra für Gut Gerdelmann geändert!“ hat Martin Schultejans gesagt. „Letztes Jahr hat der Bus nur zweimal täglich gehalten. Aber Sie können sich wirklich gerne mein Auto leihen. Ich habe noch ein paar Stunden hier zu tun.“
„Ach, Sie wohnen nicht hier auf dem Hof?“
„Nein.“ Martin Schultejans schüttelte heftig den Kopf. „Da würde ich wahnsinnig werden. All diese Künstler!“ Er ließ einige Sekunden verstreichen, bis er anfing zu grinsen, und Edna war ziemlich überrascht, als sie merkte, daß sein kleiner Scherz ihr einen unbehaglichen Schauder den Rücken hinunter bescherte. Für einen Moment fühlte sie sich einsam und schrecklich verloren, und als sie den Blick über den Hof schweifen ließ, dessen Asphalt grau in der Sonne leuchtete, da überkam sie eine Ahnung dessen, was womöglich in den nächsten fünf Monaten hier auf sie warten mochte – nicht unbedingt nur ungestörte Schaffensfreude und anregende Künstlergesellschaft.
„Aber keine Bange, Sie werden mich fast täglich zu Gesicht bekommen“, sagte Martin Schultejans freundlich, und Edna war gleich ein wenig getröstet.
Sie war also mit seinem Golf zum Edeka-Markt gefahren, an dem sie auf der Hinfahrt vorbeigekommen waren, und hatte einen ganzen Einkaufswagen voller Grundnahrungsmittel eingekauft. Und dann hatte sie auf der Rückfahrt eine Abzweigung zu früh genommen, wie ihr eine Weile später langsam gedämmert war. Sie war mehrere morastige Waldwege hinein- und rückwärts wieder herausgefahren, hatte auf zwei Bauernhöfen, von bellenden Schäferhunden verfolgt, mühsam gewendet und schließlich den Weg zurück auf die Hauptstraße gefunden. Und jetzt ist es kurz nach fünf, langsam beginnt es zu dämmern, und Edna ist unendlich müde.
Ganz oben auf dem Karton in Ednas Armen liegt ein Six-Pack Bier, und während sie vorsichtig auf die große Glastür im Gutshaus zuschwankt, hofft sie inständig, jetzt niemandem in die Arme zu laufen, vor allem nicht dem Leiter der Stipendienstätte. Nicht jetzt, wo sie wie eine versoffene Dichterin wirken muß, die offensichtlich nichts Besseres zu tun hat, als unverzüglich große Mengen Bier in ihr neues Domizil zu schleppen.
Aber Edna hat gerade den Karton besser gefaßt und mit einem Seufzer ihr Haar nach hinten geworfen, als sie einen großen, dicklichen Mann in einem karierten Jackett entdeckt, der, von der anderen Seite kommend, ebenfalls auf die Glastür zustrebt. Rasch sieht sie sich nach einem Fluchtweg um, aber es ist zu spät. Er hat sie ebenfalls gesehen. Gleichzeitig erreichen sie die Glastür. Edna lächelt freundlich, aber ihr Gegenüber sieht sie bloß ernst an. Seine Augen schweifen von dem Sechserpack in Ednas Armen zu ihrem Gesicht und wieder zurück, und Edna glaubt, deutliche Mißbilligung in seinen Zügen zu erkennen. Sie beschließt, die Flucht nach vorne anzutreten.
„Sie sind sicher Herr Wulf!“ ruft sie betont munter. Er betrachtet sie verblüfft, bevor er seinerseits langsam zu lächeln beginnt. Edna mustert ihn genauer, während sie versucht, den schweren Karton in eine bequemere Position zu hieven. Für den Leiter einer Stipendienstätte sieht er erstaunlich ungepflegt aus, findet sie. Sein langes Haar, das sich auf der Stirn bereits deutlich zu lichten beginnt, ist fettig und ungekämmt, seine Schuhe sind ausgetreten und ungeputzt, und auf dem Revers seines verschlissenen Jacketts befinden sich ein paar unappetitlich aussehende Flecken. Aber vielleicht, denkt Edna, während sie krampfhaft weiterlächelt, vielleicht gehört das ja zu seinem Image?
„Ich bin Edna Linse!“ stößt sie schließlich hervor und streckt ungeschickt eine Hand unter dem Karton aus.
Zögernd greift ihr Gegenüber danach, drückt sie kurz, bevor er sie wieder fallen läßt, murmelt etwas, das so ähnlich wie „Neral“ klingt, und dann gerät der Karton in Ednas Armen ins Rutschen. Hastig umfaßt sie ihn wieder mit beiden Händen, aber da rutscht das Six-Pack auch schon hinunter, direkt in die Hände des schweigsamen Chefs. Im selben Moment geht die Glastür von innen auf.
„Teuerste!“ sagt eine sonore Stimme, und ein hochgewachsener Mann mit schlohweißem, wohlfrisierten Haar, das ihm bis über die in ein feines Jackett gehüllten Schultern reicht, lächelt Edna an. „Der General will Ihnen doch wohl kein Bier anbieten? So etwas Schnödes verschmähen Sie doch sicher, nicht wahr? Wie wäre es statt dessen mit einem Begrüßungsschnäpperchen?“ Er streckt die Hand aus. „Guten Tag erst mal. Ich bin Till Philipp Wulf. Aber nennen Sie mich doch einfach Phil!“
Im schwindenden Sonnenlicht hält endlich ein Wagen. Marek steht seit geraumer Zeit an den Kofferraum gelehnt da, die Bomberjacke fest um den Körper gewickelt, und starrt in den dämmerigen Himmel. Die kälter werdende Luft macht ihm schon seit einer halben Stunde zu schaffen, aber er hat einfach keine Lust, den Kofferraum aufzumachen und sich seinen dicken Winterpullover herauszuholen. Das würde ihm wie ein endgültiges Eingeständnis vorkommen, ein Eingeständnis der Tatsache, daß es Marek Meister noch nicht einmal gelingt, unbeschadet seine Stipendienstätte zu erreichen.
Als er das Brummen des nahenden Autos hört, blickt er nicht mal mehr hin. Resigniert streckt er den Arm aus. In den vergangenen zweieinhalb Stunden ist eine ganze Reihe Autos vorbeigefahren, aber keines hat gehalten. Nicht ein einziges. Nur ein Trecker ganz zu Anfang, aber da hat Marek noch an die Illusion des hilfsbereiten Autofahrers geglaubt und das Angebot des Bauern, ihn mitzunehmen, dankend abgelehnt. Marek lauscht mit halben Ohr, wie der Motor des nahenden Wagens gedrosselt wird, aber er hält seinen Blick weiter gen Himmel gerichtet, an dem sich der Sonnenuntergang gerade anzukündigen beginnt. Seit jeher ist Marek von den Farben der Sonne fasziniert. Dieses leuchtende Orange, das milchige Gelb, das mit dem Dunkel des Himmels verschwimmt. Marek malt mit Vorliebe Sonnenuntergänge; sie sind sogar eines der zentralen Themen seiner Arbeit, aber das vermag kaum jemand zu erkennen. Die meisten Leute halten Mareks Bilder für abstrakte Kunst.
Eine Autotür klappt, und Marek fährt zusammen und reißt seinen Blick vom Himmel.
„So, junger Mann, und was bemüßigt uns, hier einfach so auf der Landstraße zu parken?“ Ein recht beleibter Polizist kommt um einen Streifenwagen herum auf Marek zu. Ein zweiter, merklich dünnerer in Mareks Alter folgt ihm langsam, während er seine Mütze aufsetzt und gewichtig zurechtrückt.
„Ich, äh, ich parke nicht. Es ist nur so, mein Wagen ist kaputtgegangen.“ Marek hat sofort ein schlechtes Gewissen, aber das geht ihm immer so, wenn er einen Polizisten sieht. DDR-geschädigt, redet er sich gerne ein, doch er weiß, daß er bloß einfach Angst vor Autoritäten hat. Er stellt sich aufrecht hin und versucht, rechtschaffen auszusehen. Ein Golf fährt vorüber, und Marek spürt die neugierigen Blicke der Insassen.
„Das sagen sie alle“, erwidert der dicke Polizist und schlendert gemächlich einmal um den R4 herum. „Soso, aus Dresden kommt der Herr. Aha“, sagt er nach einem Blick aufs Kennzeichen.
Marek schluckt. „Genau.“ Das ist kein Verbrechen, sagt er sich. Du hast nichts Falsches getan. Aus Dresden zu kommen ist nun wirklich erlaubt.
Am linken Kotflügel bückt sich der Polizist und rüttelt an etwas, das außerhalb Mareks Blickfeld liegt, und dann richtet er sich wieder auf. „Kaputt ist gut.“ Er streckt eine Hand aus, und Marek braucht einen Moment, bis er den Gegenstand darin erkennt: Was da so unverfänglich im Dämmerlicht glänzt, ist ein Teil der Stoßstange. „Kaputt ist gar kein Ausdruck. Junge, Junge, ob du mit dieser Rostlaube überhaupt noch fahren durftest?“
„Ich hab TÜV bis Ende Dezember“, sagt Marek heiser. Der jüngere Polizist, dessen karottenrotes Haar mit dem Orange des Sonnenuntergangs dahinter konkurriert, bückt sich, um die TÜV-Plakette zu inspizieren, und gibt einen Grunzlaut von sich. Dann murmelt er in Mareks Richtung: „Führaschein un’ Fahrzeuchpapiere, bidde.“
Ein paar Minuten später, in denen Marek stocksteif an die Fahrertür gelehnt dasteht, interessiert von den dunklen Augen des Dicken beäugt, kommt der jüngere Polizist wieder vom Streifenwagen zurück und überreicht ihm seine Papiere.
„Sin’ in Ordnung“, sagt er und tippt sich an die Mütze.
„Na, dann“, sagt der Dicke und grinst Marek an, „dann woll’n wir mal Gnade vor Recht ergehen lassen. Wo drückt der Schuh?“
„Ich weiß nicht, ich kenn mich nicht so richtig gut aus mit Autos“, gibt Marek zu.
„Aber ich“, erwidert der dicke Polizist. „Ich hab nämlich in meinem früheren Leben mal eine Kfz-Mechanikerlehre angefangen.“ Er krempelt die Ärmel seiner Uniformjacke hoch, wobei er zwei dilettantisch ausgeführte Tätowierungen auf seinen Unterarmen entblößt, und klopft auf die Kühlerhaube. „Mach mal auf, Junge. Los, los, los, ich hab nicht den ganzen Tag Zeit. Unsereins muß auch noch Verbrecher jagen.“
Marek wirft einen irritierten Blick auf den Rothaarigen, der ihm aufmunternd zunickt, und dann greift er ins Auto und entriegelt die Kühlerhaube.
Eine weitere Viertelstunde später klappt der Dicke die Haube wieder herunter und wischt sich die ölverschmierten Hände an dem Laken ab, das Marek kurzerhand von einem seiner Bilder im Kofferraum gezogen hat.
„Tja, tut mir leid, Junge“, sagt er. „Ich denke, das ist ein Fall für die Schrottpresse. Kann man nichts machen. Komplett hinüber, die Karre. Kolbenfresser.“
„Das gibt’s doch nicht! Ich hab den Wagen doch erst vor einem halben Jahr gekauft!“
„Und ob es das gibt. Pech gehabt, Junge.“ Der Dicke gibt Marek das Laken zurück und wirft einen Blick auf seinen Kollegen, der es sich mit einem Comic-Heft im Streifenwagen bequem gemacht hat. „Werner, ruf mal die Zentrale an. Sollen den Borchers vorbeischicken, aber dalli.“
„Borchers?“ fragt Marek.
„Das ist unser Abschlepper. Bringt deine Kiste gleich zur Presse.“ Der Dicke zieht sich die Hose hoch und mustert Marek genauer. „Ist der Günstigste, weit und breit, kannst du mir ruhig glauben.“
„Ja“, sagt Marek und schiebt die Hände in die Taschen seiner Jeans. „Aber wie komm ich denn jetzt nach Meppen?“
Der Dicke wirft ihm einen mitfühlenden Blick zu. „Mit dem Bus. Aber heute nicht mehr. Werner?“ ruft er nach hinten. „Sag der Zentrale, sie sollen noch ein Zimmer reservieren, bei Kerckhoffs. Die sind die Preiswertesten hier in der Gegend“, erklärt er Marek. „Und da gibt es ein prima Frühstück.“
Marek zuckt ergeben mit den Schultern. „Aber mit dem Bus morgen kann ich nicht fahren. Ich hab meinen ganzen Hausstand dabei. Und ein paar von meinen Bildern.“
„Werner? Der Borchers soll ’ne Mietfuhre klarmachen. Für morgen früh nach Meppen.“
„Ich glaub nicht, daß ich das bezahlen kann“, wirft Marek ein. Ein vorüberziehender Lastwagen weht eine Abgaswolke in sein Gesicht, und er wischt sich über die Stirn.
Der Dicke mustert ihn nachdenklich. „Zeig mal her, deine Bilder.“
Marek macht den Kofferraum auf und stopft das schmutzige Laken in eine Ecke. Ein paar Taschen, Kartons und Kisten sind eng nebeneinander gequetscht. Davor lehnen die Bilder, zuoberst Mareks jüngstes Werk, eine Kakophonie aus Gelb- und Orangetönen.
„Sieht ja aus wie ein Sonnenuntergang“, sagt der Dicke. „Gefällt mir. Was soll das denn kosten?“
Marek starrt ihn verblüfft an. Das runde Gesicht des Polizisten scheint mit dem Dämmerlicht zu verschmelzen, und für einen Moment kommt Marek alles ganz unwirklich vor. Dann sagt der Dicke: „Wie wär’s damit: Einmal Auto abschleppen und verschrotten, ein Zimmer bei Kerckhoffs, eine Fuhre nach Meppen und ein Fuffi dazu?“
Oben an der Decke ist ein kleiner Fleck. Er hat die Form eines Herzens, und als Walter die Augen zusammenkneift, glaubt er ein paar Buchstaben in der Mitte zu sehen. Aber sicher ist er sich nicht. Er hat den Fleck schon gestern abend vor dem Zubettgehen entdeckt, aber da hat das Licht nicht ausgereicht, um Genaueres zu erkennen. Jetzt scheint die strahlende Oktobersonne ins Zimmer hinein, und Walters Herz klopft schnell und erwartungsvoll.
„Auf geht’s!“ ruft er laut und schlägt die Decke zurück. Er hat prächtig geschlafen, so gut wie schon lange nicht mehr. Mag sein, daß der ungestörte Genuß der guten Flasche Wein, die er eigens zu diesem Anlaß aus Köln mitgebracht hat, dazu sein übriges getan hat, auf jeden Fall fühlt Walter sich hervorragend. Frisch, munter und ausgeruht, und – was vielleicht am wichtigsten ist – voller Tatendrang. Er setzt sich aufrecht hin und streckt sich, dann springt er federnd von der Bettkante auf. Geht doch prima. Wie hat Gina gestern noch gehöhnt? „Was ist los mit dir? Macht das Alter dich mürbe?“ Nichts da. Von nun an wird alles anders werden. Heute beginnt eine neue Phase in Walters Leben, und Walter wird dafür sorgen, daß es eine ausgezeichnete Phase wird.
Fünf Minuten später läuft er leichtfüßig die Treppe hinunter. Sein nagelneuer Jogginganzug fühlt sich innen noch ganz flauschig an, und Walter nimmt sich vor, ihn in den nächsten Wochen mehrfach zu waschen, damit er etwas abgetragener aussieht. Mit den Turnschuhen hingegen ist er zufrieden. Sie sind sichtlich gebraucht. Kein Wunder, immerhin stammen sie noch aus Walters Studentenzeit, die mittlerweile an die dreißig Jahre zurückliegt.
Damals schickte Walter sich gerade an, der Shooting-Star der Apo-Literaturszene zu werden. Die Frauen lagen ihm ob seines sprühenden Witzes und seiner Sensibilität zu Füßen, und als Walters zweites Buch, eine von erotischen Szenen gespickte Politbibel, den Erfolg des ersten noch übertraf, ist des Ruhmes kein Halten gewesen. Schlank, redegewandt und von den ausgedehnten Indienaufenthalten tief gebräunt ist Walter der König der Szene gewesen. Damals hatte er keinen Finger rühren müssen, um sich in Form und bei den Frauen begehrt zu halten.
Das sieht heute ganz anders aus. Heute hat Walter einen Bauchansatz, der von seiner Vorliebe für Bier herrührt, und erfolgreiche Politbibeln schreibt er schon lange nicht mehr.
Locker läuft er durch die geräumige Diele und ohne innezuhalten zwischen den offenstehenden Flügeln der Glastür hindurch die Vortreppe hinunter und auf den Hof. Dort bleibt er kurz stehen, um sich zu orientieren.
„Morgen!“ Der Referent für Öffentlichkeitsarbeit schließt eben sein Auto ab und winkt Walter zu, und Walter winkt zurück. „So früh am Morgen schon so fleißig?“
„Klar. Mein Morgensport“, ruft Walter und beugt sich nach vorne, um seine Wadenmuskeln zu dehnen. Das hat ihm seine letzte Geliebte, Veronika, gezeigt. Walter hat immer gefunden, daß diese Übung sehr anmutig aussah, aber jetzt, während er sie im grellen Sonnenlicht ausprobiert, fragt er sich, ob es nicht vielmehr Veronika war, die anmutig ausgesehen hat, und weniger die Übung.
„Ich hab’s nicht so mit Sport“, sagt Martin Schultejans achselzuckend. „Sport ist Mord, hab ich schon in der Schule gefunden.“ Er winkt noch einmal, dann geht er über den Hof zur Büroscheune und verschwindet in der Tür, nicht ohne Walter noch ein freundliches Lächeln zu schenken.
Walter richtet sich mühsam wieder auf. Sein Rücken schmerzt von der ungewohnten Haltung, und er braucht einen Moment, um wieder Luft zu bekommen. Er stemmt die Arme in die Seiten, aber gleich darauf läßt er sie wieder sinken. Wenn ihn jetzt jemand sieht, fliegt gleich auf, daß seine Sportlichkeit nur Attitüde ist. Walter strafft die Schultern und setzt sich in Bewegung, aber im nächsten Moment schießt ein scharfer Schmerz seine Wade hinauf bis in den Schenkel. Walter krümmt sich zusammen, verlagert das Gewicht aufs andere Bein und hüpft schnell vorwärts, um nicht umzufallen. Vielleicht hat Gina recht, denkt er und stöhnt, als er die endlos erscheinende Allee vor sich erblickt. Vielleicht ist er wirklich alt. Und vielleicht hat auch Martin Schultejans recht. Vielleicht ist Sport tatsächlich Mord.
Es ist zehn nach neun, als Heike den Hof erreicht. Seit einem Jahr ist sie auf Gut Gerdelmann als Sekretärin angestellt, und seit einem Jahr kommt sie Morgen für Morgen zu spät, und zwar immer genau zehn Minuten. Heike hat alles versucht: Sie hat den Wecker früher gestellt, ihren Morgenrhythmus geändert – erst duschen, dann Kaffee statt andersherum –, sie hat den Weckdienst bestellt und Joris, ihren Mann, überredet, mit ihr aufzustehen, aber genützt hat nichts. Morgen für Morgen kommt sie zehn Minuten zu spät. Bislang hat das niemanden gestört, am allerwenigsten sie selbst. Aber heute ist es anders. Heute ärgert sie sich über die Verspätung, weil sie so unglaublich viel zu tun hat, daß es auf jede Minute ankommt. Und außerdem kann sie es kaum abwarten, die neuen Stipendiaten kennenzulernen.
„Raudi, jetzt sei doch mal still!“ Sie wedelt mit einer Hand nach hinten, um Raudi, ihren gelbbraungefleckten Mischlingsrüden, zu beruhigen. Seit sie den erschöpften Jogger überholt haben, der sich auf der Pappelallee schwer atmend und humpelnd in Richtung Hof dahingeschleppt hat, seitdem hat Raudi nicht mehr zu bellen aufgehört. Heftig wedelnd springt er auf der Rückbank umher und starrt unentwegt nach hinten, und ab und zu streift sein buschiger Schwanz durch Heikes frisch gefönte Haare und bringt sie durcheinander.
„Raudi! Hör auf!“ Raudi bellt weiter, und Heike seufzt entnervt. Sie liebt Raudi, aber sein lautes Gebelle raubt ihr manchmal den letzten Nerv. Einen Moment zögert sie. Dann entscheidet sie sich, kurzen Prozeß zu machen. Sie holt tief Luft, tritt wuchtig auf die Bremse und gibt gleich darauf Vollgas. Raudi, der erst gegen die Vordersitze und dann unsanft nach hinten geschleudert wird, verstummt verdutzt. Heike greift höchst selten und nur in Notfällen zu dieser rabiaten Methode, aber sie wirkt jedesmal. Raudi grunzt und rollt sich dann mürrisch auf dem Rücksitz zusammen, und Heike, erfreut über die plötzliche Stille im Wagen, fährt schwungvoll auf den Gutshof, stellt den Motor ab und läßt den Polo zentimetergenau auf ihren angestammten Parkplatz vor der Büroscheune rollen.
Martins Auto steht bereits da. Zwei weitere Wagen sind daneben geparkt, ein Golf mit Kölner Kennzeichen und ein Kadett aus Rostock. Als sie sich umschaut, entdeckt Heike noch einen Wagen vor der Atelierscheune, einen angerosteten Geländewagen mit Leipziger Kennzeichen. Heikes Herz beginnt aufgeregt zu schlagen. Voller Elan steigt sie aus dem Auto und klappt den Vordersitz vor, um Raudi herauszulassen. Raudi gähnt herzhaft, bevor er geruht, aufzustehen. Er würdigt Heike keines Blickes. Gemächlich rutscht er aus dem Wagen, schnuppert kurz in die Runde und eilt dann in Richtung Gutshaus davon, wie jeden Morgen. Heike vermutet, daß Ansgar ihm immer etwas zu essen hinstellt, aber sie hat es noch nie mit eigenen Augen gesehen. Raudi ist grundsätzlich schneller als sie, und Ansgar starrt sie immer ausdruckslos an, wenn sie ihn danach fragt. Dabei hat Heike noch nicht einmal etwas dagegen. Auch, wenn Raudi nun wirklich nicht gerade unter Magerkeit leidet. Im Gegenteil, er verfügt über eine beträchtliche Leibesfülle, die sich jetzt, im Alter, nur noch vergrößert. Aber wenn er eben als dicker Hund alt werden will – bitte sehr. Heike jedenfalls hat nicht vor, ihm seine letzten Lebensjahre durch übermäßige Strenge oder etwaige Diäten zu vermiesen. Heike hat selbst genug Diäten hinter sich, und sie hält nichts mehr davon.
Heike wirft einen letzten Blick auf Raudi, der eben mit hochaufgerichtetem Schwanz, dessen Spitze erwartungsfroh zuckt, um die Ecke verschwindet, dann angelt sie ihre Tasche vom Beifahrersitz, schlägt die Autotür zu und eilt frohgemut auf die Büroscheune zu. Als erstes wird sie sich einen Kaffee aufsetzen, die Post durchsehen und dann – dann wird sie warten, bis die Stipendiaten hereinkommen. Bis auf Andrea Franke hat sie nämlich noch keinen von ihnen kennengelernt.
Das ist das Aufregendste an ihrer Arbeit: Die Stipendiaten kennenzulernen und zu sehen, ob sie dem Bild entsprechen, das Heike sich in den Wochen zuvor von ihnen gemacht hat. Aber fast noch aufregender ist der Tag gewesen, an dem sie die frisch auserkorenen Stipendiaten telefonisch benachrichtigt hatte. Es war, als würde sie Glücksgöttin spielen. Im vorigen Jahr hatte der Chef höchstpersönlich bei den Stipendiaten angerufen, aber diesmal hatte Heike ihn dazu gebracht, die Sache ihr zu überlassen. Ihre Hände waren schweißnaß vor Aufregung gewesen, als sie die erste Nummer gewählt hatte, und ihre Stimme hatte gezittert, als sie die frohe Botschaft verkündet hatte. Und dann – die Stipendiaten! Marek Meister, der sich zweimal räusperte, bevor er ein heiseres „Echt?“ in den Hörer stieß. Edna Linse, die zunächst eine ganze Weile verstummte, bevor sie ungläubig nachfragte. Gina Lüpke, die einfach „Aha“ sagte und dann mit schneidender Stimme fragte, was für ein Atelier sie denn bekäme und wie es sich mit den sanitären Anlagen verhielte.
Walter Wagenbrenner war da ganz anders gewesen. Walter Wagenbrenner hatte erst mal gelacht. Und dann hatte er gefragt: „Das macht bestimmt Spaß, solche Nachrichten mitzuteilen, nicht wahr?“
Zufrieden betritt Heike ihr Büro, wirft ihre Tasche schwungvoll auf den Drehstuhl und stößt die Tür zum Nebenzimmer auf. „Morgen, Martin. Ist das nicht ein wunderschöner Tag?“
Martin schiebt seine Füße vom Tisch und steht auf. Das mag Heike an ihm – seine vollendeten Umgangsformen, die er auch beibehält, wenn er jemanden Tag für Tag sieht. „Guten Morgen, Herzblatt. Gut, daß ich keine Wetten abschließe. Sonst hätte ich jetzt verloren.“
„Wieso?“
Martin grinst. „Ich hätte gewettet, daß du heute so aufgeregt bist, daß du ausnahmsweise mal pünktlich kommst. Wenn nicht heute, dann kommt sie nie pünktlich, habe ich mir überlegt.“
„Genau“, sagt Heike. „Nie. Schon einen von den Neuen gesehen heute morgen?“ Sie wirft einen forschenden Blick durch das Fenster auf den Hof, aber dort regt sich nichts.
„Nein. Dabei sind gestern fast alle eingetroffen. Es fehlen nur noch Detlef Kapusta, der Alefeld und dieser Marek Meister, der eigentlich gestern schon kommen wollte. Er hat eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter hinterlassen. Sein Wagen ist bei Haselünne liegengeblieben.“
„Ach je“, sagt Heike mitfühlend, obwohl sie nicht ganz bei der Sache ist. Der Gedanke, daß Martin fast alle Stipendiaten schon kennengelernt hat und sie nicht, versetzt ihr einen Stich. Martin macht Anstalten, sich wieder in seinen Bürostuhl zu setzen, aber im nächsten Moment richtet er sich kerzengerade auf. „Da kommt jemand die Treppe runter“, flüstert er. Heike dreht sich ruckartig um und starrt wie gebannt auf die Tür.
Die Treppe knarrt auf der vorletzten Stufe. Gestern abend hat Andrea zunächst geglaubt, daß es an ihren Schuhen läge, schwarzen, eleganten Pumps, die sie kurz vor der Abreise noch erstanden hat. Aber nachdem sie, um ihre Langeweile zu vertreiben, mehrfach hinauf und hinunter gelaufen ist, hat sie herausgefunden, daß es an der Treppe selbst liegt. Die vorletzte Stufe knarrt erbärmlich. Martin Schultejans und die Sekretärin starren ihr aus dem Büro entgegen, und Andrea bleibt im Türrahmen stehen und setzt ein entschuldigendes Lächeln auf.
„Müßte man mal ölen, vielleicht. Guten Morgen.“
„Morgen. Bitte, was sollte man ölen?“ fragt Martin Schultejans.
„Die Treppe. Wenn das geht.“
Martin Schultejans zuckt mit den Schultern. „Ich bin nicht so ’ne Handwerkliche.“ Er errötet leicht und korrigiert sich umgehend. „Handwerklich geschickt, meine ich. Aber man könnte ja Ansgar Bescheid geben, unserem Hausmeister.“
„Ansgar, ach was!“ Heike Hölscher schüttelt den Kopf. „Ansgar hat doch keine Ahnung von Treppen! Der guckt höchsten noch Löcher rein.“ Sie lächelt Andrea zu. „Das kriegen wir schon. Ich kenn’ da so einen alten Trick: Bohnerwachs drauf und kräftig hüpfen.“
„Ach?“ Heike Hölscher scheint durchaus einen Sinn für Praktisches zu haben, vermutet Andrea. Sie sieht aber auch so aus: kräftig, robust, mit breiten, starkknochigen Händen, die das Zupacken gewohnt scheinen. Trotz ihres leichten Übergewichts wirkt sie ausgesprochen flink, und das liegt sicher nicht nur an den blitzenden Augen.
„Doch“, sagt Heike Hölscher. „Das hilft todsicher. Möchten Sie einen Kaffe?“
„Gerne. Ich hab noch nicht gefrühstückt.“ Während Andrea Heike Hölscher in das größere der beiden nebeneinanderliegenden Büros folgt, sinnt sie darüber nach, wer von ihnen beiden wohl älter ist. Sie würde der Sekretärin, die ihr ausgesprochen sympathisch ist, nämlich gerne das Du anbieten, und dem Referenten auch, aber wenn Heike Hölscher älter ist als sie selbst, dann könnte sie das womöglich als Beleidigung auffassen. Das geräumige Büro geht auf den Hof hinaus, und Andrea starrt interessiert aus dem Fenster. „Das ist ja ein toller Ausblick. Hier läßt es sich sicher gut arbeiten.“
„O ja. Ich fühle mich pudelwohl hier.“ Heike Hölscher verschwindet mit der Kanne in der Küche auf der anderen Seite des Flurs.
Andrea nutzt die Gelegenheit. „Wie alt ist sie eigentlich?“ flüsterte sie Martin Schultejans zu, der mit ins Zimmer gekommen ist und bereits in der Sitzgruppe Platz genommen hat. Er blickt sie erstaunt an.
„Ich meine“, flüstert Andrea noch eindringlicher, „ist sie jünger oder älter als ich?“
Martin Schultejans sieht ratlos drein und zupft verlegen an seinem Hemdkragen. „Ich weiß nicht, also für mich sehen Sie beide jung aus, ich könnte gar nicht sagen, wer von Ihnen jetzt jünger oder älter aussieht ...“
„Nein, ich meine, es geht mir um das Du!“
„Das Du“, wiederholt Martin Schultejans, noch ratloser denn zuvor. Er blickt hilfesuchend zur Tür, und Andrea kommt nicht mehr dazu, ihn weiter aufzuklären, denn schon erscheint Heike Hölscher wieder, diesmal mit wassergefüllter Kanne.
„Und jetzt gibt’s erst mal Kaffee. Meinen Sie, Sie werden sich hier wohl fühlen?“
„Ja“, sagt Andrea. „Ich hoffe. Es ist schon – recht ungewohnt.“ In Wirklichkeit hat sie die halbe Nacht kein Auge zugemacht, weil sie mit der veränderten Situation nicht zurechtkommt. Im letzten Jahr ist alles so verdammt schnell gegangen – erst der Abschluß des Studiums, dann die paar Monate, die sie in ihrem vormaligen Beruf als Buchhändlerin gearbeitet hat. Anschließend die Verlobung mit Tom in England, Andreas unvermittelte Arbeitslosigkeit und jetzt auf einmal das Stipendium hier. Und dann noch die verpatzte Ausstellung in Bochum und die Frage, was sie überhaupt in Zukunft mit ihrem Leben anfangen soll. Eigentlich hat Andrea das Gefühl, irgendwo im Laufe des letzten Jahres aus Versehen in den falschen Zug gestiegen zu sein, der sie in rasendem Tempo bis hierhin gebracht hat, ohne daß sie irgendeinen Einfluß darauf hat nehmen können. Und jetzt sitzt sie mitten auf dem flachen Land und weiß nicht mehr, was sie will.
„Aber das ist ja sicher auch das Spannende daran“, sagt Heike Hölscher und setzt sich zu Martin Schultejans in die Sitzgruppe. „Ich denke, es wird eine Zeit dauern, aber wenn Sie erst mal angefangen haben zu arbeiten, dann wird es Ihnen bestimmt gut gefallen.“
„Ja, das hoffe ich“, erwidert Andrea und starrt wie blind auf den Tisch. Arbeiten, das ist ja gerade das Problem. Momentan fühlt sie sich überhaupt nicht danach. Erstens hat sie nicht die geringste zündende Idee, und zweitens hadert sie ohnehin mit ihrem Künstlerdasein. Sie ist erst spät, nach Buchhändlerlehre und Architekturstudium, zur Kunst gekommen. Auf der Akademie war sie bei weitem die älteste Studentin, und sie hatte permanent das Gefühl, nicht mithalten zu können, jedenfalls, was das Tempo anging. Während die anderen drei, vier Ausstellungen hintereinander bestückten, hat Andrea sich mit einer einzigen Arbeit abgemüht – dem eingefärbten Gummiabdruck eines ausgestopften Esels, der ihr am Ende noch gerissen ist. Ihr Meisterschülerstück, eine überlebensgroße Ente aus Latex, ist ebenfalls mißglückt, da das eingegossene, aus Antennen gebaute Skelett das Gewicht der Skulptur nicht ausgehalten hatte und zusammengeknickt war. Andrea hatte die Skulptur am Ende zerhackt und die Stücke fotografiert, und damit hatte sie sich dann um das Stipendium beworben. Daß sie sowohl die Prüfung bestanden hat als auch auf Gut Gerdelmann angenommen worden ist, betrachtet sie weniger als Erfolg ihrer künstlerischen Arbeit als vielmehr ihres ausgesprochen eleganten Auftretens. Es gab an der ganzen Akademie keine Künstlerin, die sich so elegant zu kleiden verstand wie Andrea. Sie hat überhaupt noch nie eine Künstlerin getroffen, die derart auf ihr Äußeres achtete. Niemand sonst in diesen Kreisen trägt schwarze oder graumelierte Schneiderkostüme mit passenden Pumps und Mänteln darüber aus feinem Stoff. Andrea seufzt, während sie immer noch auf Heike Hölschers Schreibtisch starrt. Als Künstlerin nichts zu taugen, sondern nur als Vorzeigemodell einer Künstlerin, das ist eine ihrer größten Ängste.
Plötzlich fällt ihr auf, was sie die ganze Zeit über eigentlich vor Augen hat. Direkt vor ihrer Nase steht ein Bilderrahmen mit dem Foto eines lachenden Teenagers, ebenso pummelig und rotgelockt wie Heike Hölscher.
„Ihre Tochter, nicht wahr? Wie alt ist sie denn?“
„Fünfzehn“, sagt Heike Hölscher, und während Andrea noch fieberhaft rechnet, um herauszufinden, wie alt Heike dann mindestens sein mußte, fügt sie hinzu: „Wollen wir uns nicht einfach alle duzen? Das ist nicht so umständlich, finde ich.“
„Oh, gerne“, sagt Andrea erleichtert.
„Also, dann, ich bin der Martin.“ Der Referent wirft einen Blick auf die sprudelnde Kaffeemaschine und holt drei Becher aus dem Schrank darunter heraus.
Andrea nimmt dankbar eine dampfende Kaffeetasse aus seiner Hand entgegen. „Wann geht denn hier eigentlich der Betrieb so los? Bis auf einen etwas ramponierten Jogger vorhin habe ich noch niemanden gesehen.“
„Stimmt, wo bleibt eigentlich Tiffi?“ Martin streckt seine langen Beine behaglich aus und nippt an seiner Tasse.