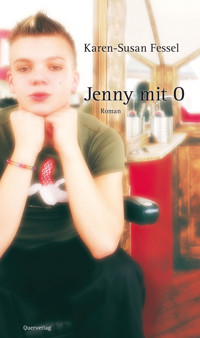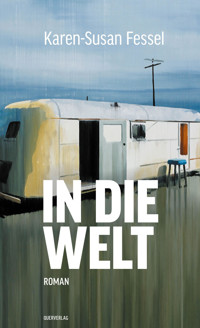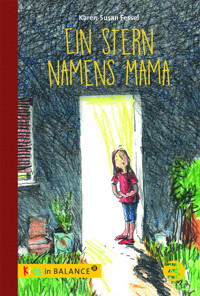Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Querverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Visby, 1984. Marthe verreist das erste und einzige Mal in ihrer Kindheit und Jugend; ihre Tante lädt sie ein auf die schwedische Ferieninsel Gotland. Die Tage dort schmecken nach Freiheit. Und eine besondere Erinnerung nimmt Marthe mit in die folgenden Jahre: das Bild einer Klavierspielerin im Erdgeschoss der Pension und die sanft schwingenden Melodien ihres Spiels, die Marthe Abend für Abend in die Träume geleiten. Berlin, 1994. Marthe arbeitet inzwischen als Hilfskraft im Funkhaus und bekommt den Auftrag, eine Komponistin vom Flughafen abzuholen. Sie hat dunkle Haare und dunkelblaue Augen und etwas an sich, das Marthe sowohl fasziniert als auch irritiert. Aber bevor sie dem nachgehen kann, ist die Musikerin auch schon wieder verschwunden. Zwei Jahre später sieht Marthe sie wieder, und damit beginnt eine anregende, aufrührende und intensive Beziehung zwischen Marthe, dem Freigeist, und Ebba, der ruhigen, melancholischen Musikerin. Bis Ebba von etwas eingeholt wird, das schon längst überwunden geglaubt schien. Leise Töne ist ein Buch über Musikverständnis, über Einsam- und Gemeinsamkeit und das Leben auf Inseln, im wörtlichen wie auch im übertragenen Sinn. Karen-Susan Fessel erzählt von der Frage nach Schuld und Verantwortung, für sich selbst und für andere, von der Suche nach dem richtigen Platz. Noch immer ist die Frage umstritten, ob das Recht auf Selbsttötung zu den fundamentalen Menschenrechten gehört; aktive und passive Sterbehilfe sind ein grundsätzliches Thema in der Politik und Gesellschaft, dem sich Karen-Susan Fessel in diesem bewegenden Roman widmet.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 670
Veröffentlichungsjahr: 2010
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Impressum
Erste Auflage der Printausgabe September 2010
Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Umschlag und grafische Realisierung von Sergio Vitale unter Verwendung eines Fotos von plainpicture (Jens Haas).
ISBN 978-3-89656-50
Bitte fordern Sie unser Gesamtverzeichnis an:
Querverlag GmbH und Salzgeber & Co. Medien GmbH
Akazienstraße 25, 10823 Berlin
www.querverlag.de - www.salzgeber.de
Prolog
Mit fünfzehn bin ich das erste und einzige Mal in meiner gesamten Kindheit und Jugendzeit verreist. Tante Josina nahm mich mit auf eine Reise nach Schweden.
Meine Eltern waren vermutlich froh, mich eine Weile aus dem Haus zu haben. Und auch ich freute mich, von ihnen und meinen Geschwistern fortzukommen. Allerdings hätte ich mir durchaus eine bessere Reisebegleitung vorstellen können als die strenge, wenig herzliche Cousine meiner Mutter. Und bis heute weiß ich nicht, was Tante Josina zu ihrem Angebot bewogen hat – weder war sie mir bis dahin und auch danach sonderlich zugetan, noch hatte sie sich jemals viel um mich gekümmert.
Vielleicht wollte sie die weite Reise nicht allein unternehmen, oder es hatte sie einfach ein Anfall von Barmherzigkeit überkommen – jedenfalls entschloss sie sich in diesem Sommer, als ich fünfzehn war, mit mir auf eine schwedische Insel zu fahren.
An die Fahrt selbst dorthin erinnere ich mich kaum noch, nur dass sie ewig zu dauern schien. Mit der Fähre ging es aufs Festland, dann weiter mit der Bahn nach Dänemark und von dort aus mit einem Reisebus quer durch Südschweden, um an der Ostküste wiederum die Nachtfähre zu nehmen. Tante Josina hetzte mich von Anschluss zu Anschluss, stets besorgt, zu spät zu kommen, und als wir an einem Julimorgen kurz nach Sonnenaufgang schließlich Gotland erreichten, hatte ich mich bereits endgültig an den harschen Befehlston meiner Tante gewöhnt.
Schlaftrunken folgte ich ihrem energischen Rücken zum Ausgang. Aber der erste Blick auf den Hafen und die im diesigen Sonnenlicht daliegenden mittelalterlichen Häuser weckte mich schlagartig auf. Und noch während wir über die metallene Gangway liefen, noch bevor ich mit einem Satz an Land sprang, bereits in diesen Augenblicken fühlte ich, was ich während der nächsten drei Wochen jeden Tag aufs Neue, in jeder wachen Minute fühlen würde: Hier, auf dieser sonnigen, friedlichen Insel, hier würde ich glücklich sein.
Auch heute noch, so viele Jahre später, kann ich mich an keine Zeit in meinem Leben erinnern, in der ich ein solches Gefühl von Sicherheit und Glück empfand wie damals.
Vielleicht ist Glück letztendlich nichts anderes als verdichtete Sicherheit, die Abwesenheit von Bedrohung – auf jeden Fall fühlte ich mich in den Tagen auf Gotland zum ersten Mal in meinem Leben ganz und gar unbelastet und unbeschwert. Niemand lauerte mir auf, keins meiner Geschwister versuchte mir zu schaden, keiner strafte mich mit missbilligenden Blicken. Und nicht einmal die Tatsache, mit der schnarchenden und mich von früh bis spät herumkommandierenden Tante Josina ein Zimmer teilen zu müssen, konnte meinen Frieden trüben. Mir ging es gut.
Untergebracht waren wir in einer kleinen Pension direkt an der Strandpromenade, die von einer hageren Deutschen geleitet wurde, eine Viertelstunde Fußweg von der Ringmauer entfernt. Morgen für Morgen scheuchte mich Tante Josina zu unsäglicher Zeit aus dem Bett und stundenlang durch die Sommerhitze, um möglichst viele der knapp hundert Kirchen und Kirchenruinen auf der Insel zu besichtigen. Die meisten stammten aus gotischer Zeit, und Tante Josina ließ es sich nicht nehmen, mir, bewaffnet mit einem Reiseführer, ellenlange Vorträge über deren Geschichte und Bedeutung zu halten. Das meiste vergaß ich unmittelbar wieder, aber was ich nicht vergaß, das waren die milde Wärme, die stets scheinende Sonne über mir und die Freundlichkeit der Menschen um uns herum.
Im Vergleich zu den wortkargen, manchmal etwas mürrischen Bewohnern meiner Heimatinsel Amrum waren die Menschen auf der Insel, Einheimische wie auch Touristen, entspannt und freundlich, und diese gelassene Geisteshaltung schien sogar auf Tante Josina abzufärben. Von Tag zu Tag taute sie auf, und als sie eines Mittags in ihrem gestreiften Badeanzug mit einem lauten Juchzen ins Meer hineinlief und sich wild platschend in die Fluten stürzte, da entdeckte ich zum allerersten Mal mit Staunen, dass auch sie unbeschwert und fröhlich sein konnte.
Später, als wir längst wieder zurück auf unserer Heimatinsel waren, später konnte ich manchmal noch einen Abglanz dieser Unbeschwertheit in ihrem Lachen erkennen oder in der Art, wie sie lässig und entspannt mit den Händen wedelte, wenn sie eine heitere Anekdote aus ihrer Pension zum Besten gab. Aber damals war die Entdeckung dieser hellen, freundlichen Seite an Tante Josina vollkommen neu für mich.
Auch die deutsche Wirtin unserer Pension war stets nett und behandelte uns mit zurückhaltender Freundlichkeit, allerdings nicht, ohne Tante Josina gelegentlich verstohlen mit einem skeptischen Blick zu bedenken. Vor allem, seit Tante Josina ihr erklärt hatte, dass sie selbst ebenfalls eine Pension besaß, ebenfalls am Meer, ebenfalls auf einer Insel. Vermutlich konnte die Wirtin sich schlecht vorstellen, wie das zusammenging: eine Pension in einem Ferienort zu leiten und dabei einen derart schroffen Ton am Leibe zu tragen. Heute frage ich mich das natürlich selbst auch. Aber damals war es für mich durchaus normal. Die anderen Mitglieder meiner Familie waren schließlich genauso.
Aber nun waren wir in den Ferien, in Schweden, und von früh bis spät unterwegs. Abends, wenn wir heimkamen und die Treppe zu unserem Zimmer im Obergeschoss hinaufstiegen, waren die Türen zum Wohnbereich der Wirtin in der unteren Etage immer geschlossen. Stets herrschte Stille, und auch aus den anderen Zimmern der Pension war kaum je ein Laut zu hören, obwohl sie alle vermietet waren.
In der dritten Woche unseres Aufenthaltes aber, kurz vor unserer Abreise, drang eines Abends leise Klaviermusik durch die geschlossenen Türen im Erdgeschoss. Ich blieb stehen, um zu lauschen, doch Tante Josina scheuchte mich weiter, wie stets darauf erpicht, nach unserer Rückkehr zügig ins Bad und dann ins Bett zu gehen. Später jedoch, als sie längst neben mir schnarchte und ich mein Ohr fest ins Kissen schmiegte, da konnte ich die Klaviermusik aus den unteren Räumen wieder hören, eine leise, getragene Melodie, die mich ganz sehnsüchtig werden ließ, wonach auch immer. Mit diesen Tönen im Ohr schlief ich ein.
Auch am nächsten Abend drang bei unserer abendlichen Rückkehr leise Klaviermusik durch die geschlossenen Türen im Erdgeschoss, diesmal eine heitere, beschwingte Melodie, die anschwoll und verebbte, wieder anschwoll und erneut verebbte, bevor sie verklang.
Am folgenden Abend stand die Tür ein wenig offen. Durch den kleinen Spalt schwebte Klaviermusik zu uns herüber, und ich erhaschte einen Blick auf helle Holzmöbel, weißgetäfelte Wände und ein dunkles, poliertes Klavier. Eine große, dunkelhaarige Frau saß darüber gebeugt, mit gerunzelter Stirn und gespreizten Fingern, die sich locker auf der Tastatur bewegten. Als hätte sie meinen Blick gespürt, sah sie auf, aber im selben Moment schloss jemand von innen die Tür, und Tante Josina schob mich ungeduldig weiter, die Treppe hinauf.
Noch lange Zeit lag ich wach und lauschte auf die leisen Töne, die von unten zu mir heraufdrangen.
Am nächsten Morgen reisten wir ab. Tante Josina und ich schleppten unsere Taschen die Treppe hinunter und betätigten die kleine Glocke an der Rezeption. Eine Weile tat sich nichts, und gerade, als Tante Josinas Gesicht diesen für sie typischen ungeduldigen Ausdruck annahm, öffnete sich die Tür zum Wohnbereich und die große, dunkelhaarige Klavierspielerin trat heraus.
„Wir reisen ab“, sagte Tante Josina barsch. „Bezahlt habe ich aber gestern Abend schon“, setzte sie hinzu und hielt triumphierend den Schlüssel hoch.
Die Dunkelhaarige nahm ihn ihr ab. „Ich hoffe, der Aufenthalt hier hat Ihnen zugesagt“, sagte sie in einem merkwürdig altmodischen Deutsch, und ich starrte sie neugierig an. Als sie ihre dunklen Augen für einen Moment auf mich richtete, wurde mir warm, und ich sah schnell zu Boden.
„Ja, doch.“ Tante Josina zog unheilverkündend die Brauen zusammen. „Die Bettdecken sind allerdings ein wenig dünn.“
Die Dunkelhaarige nickte, ohne zu lächeln. „Ich werde es notieren. Danke schön“, sagte sie sanft, hängte den Zimmerschlüssel hinter sich ans Brett, drehte sich um und richtete ihren dunklen Blick erneut direkt auf mich. Und dann schenkte sie mir ein umwerfendes Lächeln, bevor sie sich wieder Tante Josina zuwandte. „Gute Reise und bis zum nächsten Mal!“
Tante Josina sah wortlos von ihr zu mir und wieder zurück, dann nickte sie verkniffen. Die Dunkelhaarige trat zur Tür und öffnete sie für uns, und als ich an ihr vorbeiging, hinter Tante Josinas aufrechtem Rücken, da klopfte mein Herz so sehr, dass ich kaum Luft bekam. Draußen wartete der strahlend blaue Himmel mit seinem goldenen Sonnenschein auf uns, und als ich mich ein paar Schritte später noch einmal umdrehte, war die Tür bereits wieder geschlossen und die Dunkelhaarige fort, wie eine Erscheinung.
Hätte ich damals, als Jugendliche, die Wahl gehabt, so wäre ich ohne zu zögern auf der Insel geblieben. Aber diese Wahl hatte ich nicht, und so kehrte ich zurück in die beklemmende Enge meines eigenen Zuhauses, das nie wirklich eines für mich gewesen war und es auch nicht mehr lange bleiben sollte. Den Anblick der dunkelhaarigen Klavierspielerin aber und die Erinnerung an das klare Licht der Insel nahm ich mit in die dunklen Jahre, die folgten.
Kapitel 1
Berlin, Mai 1994
„Hier, fang auf!“
Ich drehte noch gerade rechtzeitig den Kopf, um den Autoschlüssel auf mich zufliegen zu sehen.
„Gute Reaktion!“ Berutti lächelte hämisch.
Ich zuckte mit den Schultern, dann betrachtete ich den Schlüssel in meiner Hand genauer. „Was, den Mercedes soll ich nehmen?“
„Ausnahmsweise“, sagte Berutti und warf einen bedauernden Blick auf sein Gipsbein. „Bendner fährt mit mir die Kabel abholen, dafür brauchen wir den VW.“ Er schwieg für einen Moment, und ich konnte ihm ansehen, dass ihm die Vorstellung, mir den besten Wagen des Fuhrparks anvertrauen zu müssen, nicht im Geringsten behagte. Frauen, und erst recht junge Frauen – das hatte er mehr als einmal verlauten lassen – waren seiner Ansicht nach nicht zum Autofahren geeignet. Und schon gar nicht dafür, einen Oberklassewagen zu fahren. „Aber fahr vorsichtig!“, setzte er dann mürrisch hinzu. „Eine Schramme, und du brauchst hier gar nicht erst wieder anzutanzen!“
„Ich tanze hier sowieso nie.“
Berutti brauchte einen Moment, um zu begreifen, dass ich einen Witz gemacht hatte, dann nickte er säuerlich und fuhr sich über sein schütteres Haar. „Also, du holst die Frau ab und bringst sie erst mal hierher“, erklärte er. „Wahrscheinlich geht der Chef dann noch vorm Konzert mit ihr etwas essen. Dahin musst du sie auch noch bringen, hinterher nimmt Rosch den Wagen selber. Aber man weiß ja nie. Jedenfalls, solltest du heute Abend etwas vorhaben, dann sag es lieber ab.“ Er studierte mit finsterer Miene mein Gesicht.
„Schon klar“, sagte ich lässig und ließ den Schlüssel in meine Hosentasche gleiten. Berutti seufzte kaum merklich und zog sich die Cordhosen hoch. Sie waren hellbraun, an den Säumen leicht speckig und an den Oberschenkeln abgewetzt. Mein Vater hatte ähnliche Hosen getragen, aber das war nicht das Einzige, was mich daran hinderte, Berutti zu mögen. Seit ich vor zwei Monaten angefangen hatte, im Funkhaus als Assistentin des Hausmeisters zu arbeiten, versuchte er nach Strich und Faden, mir das Leben schwer zu machen. Manchmal hatte ich den Eindruck, die Tatsache, dass er einfach nicht herausfand, was genau mit mir nicht stimmte, machte ihn zusehends nervöser. Jetzt flog sein Blick an mir herunter.
„Jeans sind nicht gerade das Richtige“, brummte er. „Rosch hätte bestimmt lieber, dass du was anderes trägst.“
„Hab ich aber nicht. Ich hab nur Jeans.“
Berutti nickte und seufzte, und die restlichen Haarsträhnen auf seiner Glatze wippten mit. „Also, beeil dich, die Frau kommt mit dem Flieger um fünfzehn fünfunddreißig. Du bist jetzt schon spät dran. Denk an den Berufsverkehr!“ Er warf mir einen letzten missbilligenden Blick zu, dann drehte er sich um.
„Äh, Berutti?“
„Was denn jetzt noch?“
„Wie erkenn ich sie denn?“
Berutti grinste, das erste Mal an diesem Nachmittag. „Gar nicht“, sagte er. „Sie erkennt dich. Du nimmst nämlich dieses Schild hier mit.“ Er deutete auf den Empfangstresen. Dort lag ein Schild, das ich zuvor gar nicht bemerkt hatte, ein rechteckiges, auf eine schmale Latte genageltes Pappschild: „Funkhaus Berlin“ stand darauf.
„Und dann weiß sie, dass sie gemeint ist?“, fragte ich skeptisch.
Berutti verdrehte die Augen, blies die Backen auf und prustete. „Natürlich! Die gute Frau mag zwar Lettin sein, aber blöd ist sie wahrscheinlich nicht. Sonst wäre sie kaum so erfolgreich!“
„Man kann auch erfolgreich sein und trotzdem blöd“, sagte ich und nahm das Schild hoch. Es war überraschend leicht. Für einen Moment wog ich es in der Hand, dann klemmte ich es mir unter den Arm. „Spricht die überhaupt Deutsch? Wenn sie Lettin ist?“
„Soviel ich weiß, ist die halb deutsch oder so“, sagte Berutti. „Also, sieh zu, dass du sie heil herbringst. Die Herlitz ist nämlich teuer.“
Jetzt
Wenn du mich sehen könntest.
Wenn du mich jetzt sehen könntest, wie ich hier liege, die Decke bis zu den Ohren hochgezogen, und versuche, die Geräusche auszublenden, die von der Straße hereindringen. Und die Geräusche ganz in meiner Nähe.
Wenn du mich jetzt sehen könntest. Ich glaube, du würdest lächeln. Du würdest lächeln, auf deine dir eigene, unnachahmliche Art, und den Kopf schütteln, ganz leicht nur, eher amüsiert denn tadelnd. Du würdest die Lippen verziehen, und ohne, dass du es beeinflussen könntest, würde deine Nase sich kräuseln, und dann würdest du nach der Bettdecke greifen und ganz leicht an ihr ziehen. Ohne etwas zu sagen.
Du hast oft geschwiegen, sehr oft, auch in Situationen, in denen ein paar Worte erlösend gewesen wären. Aber du hast dich davon nie beirren lassen. Du hast dann gesprochen, wenn du fandest, dass es Zeit dafür war.
Manchmal hat mich das wütend gemacht. Aber das hat nichts geändert. Auf deine Art warst du stur.
Und der großzügigste Mensch, den ich jemals gekannt habe.
Ein leises Brummen ertönt, das sich zu einem Grollen steigert und mit einem voluminösen Grunzen endet. Rupert schnarcht. Und nicht gerade leise.
Ich drehe mich noch einmal auf die andere Seite und ziehe mir die Bettdecke bis ganz übers Ohr, aber es nützt nichts. Ich bin wach.
Sehr wach sogar.
Manchmal, wenn ich so wie jetzt im Bett liege, morgens, noch nicht angekommen im Tag und auch nicht mehr heimisch im Schlaf, oder wenn ich barfuß die alte Straße am Zaun entlanggehe, das Sonnenlicht von weit oben durch die Baumkronen fällt und glitzernde Punkte auf den rissigen Asphalt zaubert, dann frage ich mich, wie du all das hier fändest. Mein Leben. Das Leben, das ich jetzt lebe.
Wahrscheinlich würdest du den Kopf schütteln und lächeln.
Aber würdest du mich noch lieben?
In guten Stunden denke ich: auf jeden Fall.
In schlechten Stunden denke ich darüber nicht nach.
Aber ich vermisse dich.
Immerzu.
Und nichts und niemand kann daran etwas ändern.
Aber vielleicht kann ich lernen, damit zu leben.
„Bestimmt“, würdest du sagen.
Genau dafür habe ich dich geliebt. Für deinen unerschütterlichen Mut, dein Beharren auf der ultimativen Maxime: „Die Welt ist gut“, hättest du gesagt. Und du hast es gesagt, sogar oft.
Im Gegensatz zu mir hast du auch daran geglaubt.
Das Grunzen wiederholt sich und steigert sich noch. Rupert stutzt im Schlaf, grunzt, schmatzt und bewegt sich ein wenig. Dann, nach ein paar Sekunden, in denen ich hoffnungsvoll die Luft anhalte, setzt das Schnarchen wieder ein.
Ich gebe auf. Mit einem Stöhnen setze ich mich hin und schlage die Decke zurück. Rupert zuckt zusammen, hebt den Kopf und starrt mich verdutzt an. Dann klopft er zweimal freundlich mit dem Schwanz und kuschelt sich wieder in sein Kissen.
Gnädig betrachte ich seinen struppigen Schädel mit den beiden fransigen Ohren, die aussehen, als hätte sie jemand falsch herum angenäht. Von draußen höre ich Motorenlärm, ein Hupen. Jemand ruft etwas, eine andere Stimme antwortet. Ich stehe auf und recke mich, während Rupert wieder in seinen Althundetiefschlaf hineingleitet. Meine Schlafanzughose rutscht, und ich greife hastig nach ihr und ziehe sie wieder hoch, während ich auf nackten Füßen ins Badezimmer tappe.
Du hast dich immer über meine Schlafanzüge lustig gemacht. „Der ist doch viel zu groß, dein Pyjama!“, hast du gesagt und geschmunzelt, das Kinn in die Hände gestützt.
„Schlafanzug.“
„Wie bitte?“
„Ich trage Schlafanzüge, nicht Pyjamas.“
„Ist das nicht dasselbe?“
„Nein. Ich kann das Wort nicht leiden. Pyjama – das klingt so gestelzt. Nach altem Mann in Flanellwäsche.“
Du hast gelacht, jedes Mal. Und meinen Schlafanzug bei nächster Gelegenheit wieder als Pyjama bezeichnet.
Wie verbissen ich manchmal war. Warum war es mir nicht egal, wie du meine Schlafanzüge genannt hast?
Rupert brummt im Schlaf. Im Flur steht meine gepackte Reisetasche vor der Wohnungstür. Ruperts Quietschkotelett liegt daneben, als hätte er ebenfalls bewusste Reisevorbereitungen getroffen. Eine Decke für ihn habe ich auch eingepackt.
Auf dem Küchentisch liegt der Autoschlüssel und daneben ein Zettel, zweimal gefaltet und mit meinem Namen versehen. Er ist von Mai; obwohl ich alleine wohne, legt sie Wert darauf, Botschaften an mich nicht offen herumliegen zu lassen. Vielleicht ist das gar nicht so verkehrt, auch wenn sie nicht weiß, dass noch jemand außer mir den Schlüssel zu meiner Wohnung hat. Sie selbst besitzt keinen.
Vielleicht ist es gar nicht so verkehrt, Geheimnisse zu bewahren, Zeichen zu setzen.
Du hast beides getan. Bis ganz zum Schluss.
Es dauert eine Weile, bis der Espresso sprudelnd in der Kanne nach oben zischt und die Milch geschäumt ist. Als ich sie in meinen Becher gieße, beginnt im Schlafzimmer mein Handywecker zu klingeln.
Deine dunkle, sanfte Stimme ruft meinen Namen. Ich schließe die Augen und hole Luft, dann gehe ich hinüber und stelle den Wecker aus.
Ich hätte längst einen anderen Weckruf einstellen sollen. Aber ich habe es nicht über mich gebracht. Teils, weil es mir wie ein endgültiges Eingeständnis vorkäme, dich wirklich verloren zu haben. Und teils, weil ich meinen Wecker so gut wie nie brauche. Normalerweise wache ich von selbst auf. Spät allerdings, kaum je vor neun. Für mich müsste der Tagesablauf andersherum angeordnet werden: die Wachphase abends und nachts, schlafen dann morgens und mittags.
Denn morgens schlafe ich am besten. Das war schon immer so. Morgens, wenn der Tag zu dämmern beginnt und die tiefe, dunkle Nacht mit ihren Unwägbarkeiten hinter mir liegt, dann komme ich zur Ruhe. Die Finsternis der Nacht kann ich nur bannen, wenn ich ihr offenen Auges begegne.
Vielleicht wohne ich deswegen so gern in dieser Stadt und in meinem Haus: Wann immer ich aus dem Fenster sehe, irgendwo brennt immer Licht. Ich bin nicht die Einzige, die wach ist.
Wo dein Haus steht, ist das anders, ganz anders. Auch dort bin ich gern.
Unten auf der Straße rollen vereinzelt ein paar Wagen über den Asphalt. Einer der Nachbarn von gegenüber führt gähnend und in Pantoffeln seinen Hund aus, einen schmutzigweißen Labrador, den Rupert nicht leiden kann und bei jeder Begegnung mit verdrießlichem Gesichtsausdruck und einem ärgerlichen Grollen bedenkt.
Der Himmel über den Häusern ist gleißend hell, in ein fast weißes Licht getaucht, wie früher, in jenen Tagen, als ich so gerne aus meinem eigenen Leben geflohen wäre, um niemals zurückzukehren.
Genau das habe ich eines Tages dann ja auch getan.
Heute fliehe ich nicht. Aber ich werde eine Reise machen. Eine weite Reise. Vielleicht zum letzten Mal.
Und ich fürchte mich davor.
Ich nehme den Autoschlüssel vom Tisch. Für einen Moment wiege ich ihn in der Hand. Und schließe die Augen.
Wenn du mich jetzt sehen könntest.
Berlin, Mai 1994
Nicht nur die Herlitz war teuer, sondern auch der Wagen, mit dem ich sie abholen sollte. Vorsichtig strich ich mit einem Finger über den dunkelblau lackierten Kotflügel, der in der Maisonne glitzerte, bevor ich die Tür öffnete. Ein intensiver Geruch nach Ledersitzen, Reinigungsmitteln und Rauch schlug mir entgegen.
„Untersteh dich, da drin zu rauchen, hörst du!“, rief Berutti, der mich argwöhnisch von der Hintertür aus beobachtete. Ich ließ mich in den Fahrersitz gleiten, stellte den Rückspiegel ein und steckte den Schlüssel ins Zündschloss. Mit einem satten Brummen sprang der Motor an, und ohne zu zögern, legte ich den Rückwärtsgang ein. Lässig glitt ich aus der Parklücke, wendete mit Schwung und rollte an Berutti vorbei aus der Einfahrt. Im Rückspiegel sah ich, wie er mir skeptisch hinterherstarrte, und bevor ich endgültig um die Kurve bog, trat ich das Gaspedal im Leerlauf durch. Beruttis Mund klappte auf, dann war er verschwunden.
Der Feierabendverkehr hatte noch nicht eingesetzt, und die Seitenstraßen waren nahezu frei. Im klaren Licht der Maisonne schienen die hohen Platanen auf den Bürgersteigen zu funkeln. Glitzernde Lichtreflexe tanzten in den Baumkronen, und die Konturen der Autos am Straßenrand wirkten schärfer als sonst, fast wie gemeißelt. Satt und schwer lag der Wagen auf dem Asphalt, und ich spürte das Röhren des Motors, als ich auf die Autobahn einbog und beschleunigte.
Die Tachonadel glitt nach rechts, ohne zu zittern, und als ich auf die linke Spur wechselte und einen Lastwagen und dann eine alte Ente überholte, war ich schon fast zwanzig Stundenkilometer zu schnell. Die Sonne blitzte vom Himmel, der Wagen brummte zufrieden, und für einen Moment war ich versucht, das Gaspedal noch weiter durchzutreten. Aber dann dachte ich plötzlich an Ayrton Senna, der gestern beerdigt worden war, und an Beruttis hämisches Grinsen und seine spitzen Bemerkungen, die mir ein Strafzettel unweigerlich einbringen würde, und ich verringerte doch lieber das Tempo.
Es war nicht der erste Mercedes, den ich fuhr – dank meinem besten Freund Hannes hatte ich schon ziemlich viel Erfahrung darin –, aber mit Sicherheit der neueste und modernste. Das Armaturenbrett glitzerte staubfrei, und offenbar hatte Berutti die silbernen Einfassungen erst kürzlich poliert, so, wie sie schimmerten. Er kümmerte sich mit einer Hingabe um den Wagen, als gehörte er ihm und nicht dem Funkhaus. Unzählige Stunden verbrachte er mit der Autopflege, statt den Funksaal aufzuräumen und Kabel zu sortieren. Aber dafür gab es ja seine Assistentin.
Die jetzt allerdings gerade in einer nagelneuen Mercedes-E-Klasse unterwegs war, um eine lettische Klavierspielerin vom Flughafen abzuholen.
Während ich auf den Flughafenzubringer abbog, versuchte ich mich zu erinnern, was ich noch über meinen zukünftigen Fahrgast wusste außer der Tatsache, dass heute Abend ein Konzert mit ihr stattfinden würde. Eigentlich nur, dass sie mit einem Flug aus Stockholm ankommen würde. Um kurz nach halb vier.
Ich sah auf die Uhr. Und dann gab ich Gas.
Die Maschine aus Stockholm war bereits gelandet, und die ersten Passagiere kamen aus der Abfertigungshalle, als ich den Schalter erreichte. Ich stellte mich zu den anderen Wartenden hinter die Absperrung und hielt halbherzig das Schild hoch, während ich die Ankommenden musterte. Eine ganze Reihe von Geschäftsmännern in Anzügen strömte vorbei, ein junger Mann mit Sonnenbrille und Strohhut, eine gutaussehende Dunkelhaarige mittleren Alters in einem Hosenanzug, die einen dieser modernen Rollkoffer hinter sich herzog, dann eine ältere Frau mit einem Kleinkind an der Hand. Ein dickbäuchiger Mann mit einem weiteren Kleinkind folgte, dann kamen zwei Teenager mit mürrischen Gesichtern und Kopfhörern, eskortiert von ihrer entnervten Mutter.
Einer der Teenager entdeckte mich, fing an zu grinsen und stieß seinen Bruder an. Beide kicherten, als sie weitergingen, und sahen sich noch mehrfach nach mir um.
Ich straffte die Schultern und versuchte, unbeteiligt dreinzusehen, obwohl ich mir mit meinem Schild in der Hand ausgesprochen albern vorkam.
Eine Riege weiterer Geschäftsmänner ging vorbei, dann folgten zwei ältere Frauen. Ich hatte keine Ahnung, wie alt meine Pianistin sein mochte, und versuchsweise hielt ich mein Schild etwas höher. Aber die beiden Frauen waren derart in ein Gespräch vertieft, dass sie mich gar nicht bemerkten.
Dafür warf mir der junge Mann hinter ihnen einen belustigten Blick zu und ging grinsend weiter.
Missmutig ließ ich das Schild auf Brusthöhe sinken, aber als sich eine weitere Gruppe Geschäftsleute näherte, hielt ich es wieder ein Stückchen höher. Um kurz darauf erneut einen amüsierten Blick einzufangen, diesmal von einer jungen Frau in einem roten Kostüm, die ein Baby auf dem Arm trug.
„Vielleicht sollten Sie das Schild einmal umdrehen“, sagte eine dunkle Frauenstimme hinter mir.
Ich drehte mich um. Die Dunkelhaarige mit dem Rollkoffer stand vor mir. Mit einem leichten Lächeln nickte sie zu dem Schild hoch, das ich immer noch in der Hand trug. Und zwar verkehrt herum. Hastig nahm ich es herunter. „Sind Sie …“
Sie nickte. „Elisabeth Herlitz.“ Sie streckte die Hand aus. Ich nahm das Schild in die linke Hand und reichte ihr meine Rechte. Ihr Händedruck war fest und warm, und der auffordernde Blick, mit dem sie mich ansah, verwirrte mich.
Aber nicht nur der Blick. Sondern ihre Augen. Sie hatten einen ungewöhnlichen Farbton, den ich im grellen Neonlicht der Halle nicht recht bestimmen konnte, etwas zwischen dunkelblau und schwarzgrau.
Und außerdem kam sie mir bekannt vor. Offenbar hatte ich ihr Foto bereits im Veranstaltungskalender oder auf einem Plakat gesehen.
Sie ließ meine Hand los. „Und wer sind Sie?“, fragte sie. Ein paar Reisende schoben sich dicht hinter ihr vorbei, aber sie hielt ihren Blick unverwandt auf mein Gesicht gerichtet.
„Ach so, ich … ich bin vom Funkhaus. Ich soll Sie … ich fahre Sie. Also, erst ins Funkhaus und dann weiter.“
Elisabeth Herlitz nickte amüsiert. „Das ist gut“, sagte sie. „Aber haben Sie denn auch einen Namen?“
Ich spürte, wie mir die Röte ins Gesicht stieg. „Mart“, sagte ich hastig. „Also, Marthe eigentlich. Marthe Maan.“
„Marthe Maan“, wiederholte sie leise, und in der eigentümlich dunklen, melodischen Färbung ihrer Stimme klang mein Name wie der einer fremden, geheimnisvollen Person, von der ich nie zuvor gehört hatte. „Marthe Maan“, sagte sie wieder und lächelte leicht, wie in sich hinein. „Ein schöner Name.“
Ich zuckte mit den Schultern. „Na ja“, sagte ich. „Geht so. Wollen wir los?“
Auf der Fahrt zum Funkhaus sprachen wir nicht viel. Zügig steuerte ich den Wagen durch den dichter werdenden Verkehr, während sie neben mir saß und aus dem Fenster sah, die Beine übereinandergeschlagen, die Hände über einem Knie verschränkt.
Auf eine irritierende Weise war mir die körperliche Nähe zu ihr zugleich angenehm und unangenehm, und ich musste mich sehr konzentrieren, um nicht allzu oft zu ihr hinüberzusehen.
Eigentlich interessierte ich mich nicht sonderlich für Menschen jenseits der dreißig, aber sie hatte etwas an sich, das mich neugierig machte. Und sprachlos zugleich.
Als ich einen klapprigen VW-Bus überholte und mit Schwung wieder rechts einscherte, wandte sie plötzlich den Kopf und sah zu mir herüber. „Sind Sie Studentin?“
Überrumpelt schüttelte ich den Kopf. „Äh, nein.“
Sie musterte mich von der Seite. „Nein?“
„Nein“, sagte ich und setzte den Blinker. „Ich bin Hilfskraft des Hausmeisters.“
„Und haben Sie nette Kollegen?“
„Es geht so. Einige.“
Aus dem Augenwinkel sah ich, dass sie lächelte.
„Sie sind ehrlich“, stellte sie fest.
Jetzt musste ich ebenfalls lächeln. „Ja. Aber das kommt nicht immer gut an.“
„Kann ich mir vorstellen.“ Sie betrachtete ihre verschränkten Finger, dann sah sie zu, wie wir abbogen und an der roten Ampel am Ende der Ausfahrt hielten.
Plötzlich war mir das Schweigen unangenehm, und ich räusperte mich. „Und Sie“, setzte ich an und gab Gas, als die Ampel auf Grün wechselte, „Sie sind … Sie spielen Klavier?“
Sie lachte leise. „Manchmal“, sagte sie weich. „Aber nur noch zum Vergnügen. Ich bin als Komponistin tätig.“ Nach einem Seitenblick zu mir fügte sie hinzu: „Und als Dozentin. Heute Abend führen einige Stockholmer Studenten ein Stück von mir auf. Deshalb bin ich angereist.“
Ich nickte und versuchte, die verlegene Hitze zu ignorieren, die mir in den Nacken kroch. Das nächste Mal, nahm ich mir vor, würde ich mich auf jeden Fall ein wenig besser über den Gast informieren, den ich abzuholen hatte. Wenn es ein nächstes Mal gab. Immerhin war dies eine absolute Ausnahme, daran hatte Berutti keinen Zweifel gelassen.
Vor uns bremste ein Kleinwagen abrupt, um dann mit einem gewagten Schlenker einen Radfahrer zu überholen, und ich zog den Wagen scharf nach links. Elisabeth Herlitz musterte mich immer noch von der Seite, und ich warf ihr einen Blick zu, nachdem ich wieder eingeschert war.
Ihre Augen waren nicht einfach schwarzgrau, das konnte ich jetzt, im hellen Tageslicht, deutlich erkennen. Sie waren eher dunkelblau, mit einem Stich ins Königsblaue sogar.
Sie erwiderte meinen Blick, und dann zog ein ganz leichtes Lächeln über ihre Lippen.
Hinter uns hupte es wütend, und ich sah wieder nach vorn und gab Gas.
Von Berutti war nichts zu sehen, als ich auf den Parkplatz rollte und die Handbremse anzog. Dafür kam Roschs Assistent, Simon, ein dürrer, eilfertiger Typ mit Brille und Spießerhaarschnitt, mit langen Schritten aus dem Eingang und beugte sich zu mir herunter. „Ich bringe sie hoch, du sollst hier warten“, zischte er und lief dann zähnefletschend ums Auto herum, um mit Schwung die Beifahrertür zu öffnen.
Ich stieg aus, um das Gepäck aus dem Kofferraum zu holen, aber Simon machte mir wilde Handzeichen. „Nein, nein, das bleibt drin, du fährst die Dame hier und Herrn Rosch gleich zum Hotel und dann weiter zum Essen, und danach zum Konzert“, erklärte er in harschem Befehlston.
Ich nickte wortlos und klappte den Kofferraumdeckel wieder zu. Als ich mich umdrehte, fing ich Elisabeth Herlitz’ Blick auf. Sie nickte mir zu. Und ein bisschen war es, als hätte sie mich berührt, denn ein Schauer zog mir über den Rücken.
Eine halbe Stunde später, in der ich nervös ums Auto herumgewandert war, kam sie wieder herunter, in Begleitung des Intendanten. Rosch war nervös, auf der Fahrt zum Hotel redete er ununterbrochen auf sie ein, fuhr sich ständig mit dem Finger zwischen Hemdkragen und Hals und sah fahrig aus dem Fenster.
Vor dem Hotel musste ich erneut eine halbe Stunde warten. Ich vertrieb mir die Zeit damit, die an- und abreisenden Gäste und Rosch zu beobachten, der sich in der Hotelbar, gut sichtbar durchs das große getönte Fenster, zwei kurze Drinks genehmigte, um die Wartezeit zu überbrücken.
Als Elisabeth Herlitz wieder herunterkam, trug sie einen gestreiften Hosenanzug und einen dünnen Mantel über dem Arm.
Rosch war jetzt deutlich entspannter. Lässig lehnte er im Fond, den rechten Arm aufgestützt. „Es ist noch genug Zeit für ein angenehmes Abendessen“, sagte er, und eine schwache Alkoholwolke waberte zu mir nach vorn. „Wir haben hier in Berlin eine hervorragende Auswahl an Restaurants. Welche Küche bevorzugen Sie?“, fragte er auf seine unvergleichlich schleimige Art. „Koreanisch, indisch, französisch, deutsch?“
Elisabeth Herlitz nickte, während sie ruhig in den Berliner Frühlingsabend hinaussah. „Mir ist alles recht“, sagte sie. „Allerdings müsste es fleischlose Kost sein, denn ich bin Vegetarierin.“
Im Rückspiegel sah ich Roschs leicht entnervte Miene und daneben Elisabeth Herlitz’ dunkle Augen. Unsere Blicke begegneten sich, und sie hob eine ihrer schön geschwungenen Brauen und lächelte leicht.
Und nach einem Moment lächelte ich langsam zurück.
Vielleicht war es die altmodische Ausdrucksweise, vielleicht auch dein weicher Dialekt. Auf jeden Fall aber hättest du dir kein besseres Thema aussuchen können, um meine Aufmerksamkeit noch stärker auf dich zu lenken. Obwohl sie ohnehin schon ganz und gar auf dich gerichtet war.
Fleischlose Kost. Später haben wir oft darüber gesprochen, manchmal auch darüber diskutiert. Unsere Ansätze waren nicht identisch, aber wir haben immer einen Punkt gefunden, an dem wir uns einig waren. Im Grunde ging es uns um dasselbe: um Ethik. Und um die Liebe zu Tieren.
Im Gegensatz zu meiner war deine Tierliebe schon damals allumfassend. Das habe ich von dir gelernt, jedenfalls großteils; nicht unterschiedlich zu werten – kein Tierleben galt dir weniger denn ein anderes. Vor dir waren alle Tiere gleich; sogar Zecken und Mücken, die ich auch heute noch nicht am Leben lasse, wenn sie mir schaden, hast du verschont und ins Freie gesetzt.
Dir habe ich es zu verdanken, dass ich mein Unbehagen Insekten, und insbesondere Spinnen gegenüber, verloren habe. Du bist immer bereitwillig gekommen, um eine vielbeinige Spinne aus einer Zimmerecke zu klauben. Du hast sie in deine zu einer Kugel geformten Hände genommen, egal, wie furchterregend sie auch aussahen. Und hast sie mir gezeigt, die schreckerstarrten Gebilde. „Was kann sie dafür, dass sie so hässlich aussieht?“, hast du mit sanfter Stimme gesagt. „Sie ist einfach nur ein Tier. Und will dir bestimmt nichts tun. Im Gegenteil, sie hat Angst, sieh!“
Ich habe hingesehen, auch, wenn mir der Ekel zu Anfang kalte Schauer den Rücken hinuntertrieb. Später verlor sich der Ekel, wandelte sich in leichtes Unbehagen, um schließlich gänzlich zu verschwinden.
Irgendwann war ich diejenige, die Spinnen einfing und draußen aussetzte. Während du schliefst.
So hat es begonnen: mit einer Gemeinsamkeit. Fleischlose Kost.
Für die ich mich entschied, als ich zehn Jahre alt war.
Norddorf, August 1979
„Was machst du da, Marthe?“
„Hab mir schnell zwei Stullen geschmiert.“ Ich drehte mich um, während ich die beiden Käsebrote in meiner Umhängetasche verstaute. Meine Mutter stand im Türrahmen und legte sich gerade ihre Küchenschürze um. Sie sah müde aus, wie meistens, mit dunklen Rändern um die Augen herum. Die beiden letzten Tage hatte sie hauptsächlich im abgedunkelten Schlafzimmer verbracht, wegen ihrer Kopfschmerzen.
„Wohin gehst du denn?“, fragte sie mit matter Stimme und band die Schürze hinter ihrem Rücken zu.
„Baden mit Berend.“ Ich war überrascht, dass sie fragte.
Meine Mutter nickte und ging an mir vorbei zur Spüle. „Aber komm nicht zu spät nach Hause“, sagte sie. „Heute Abend gibt’s Kaninchenbraten.“
Mir ging erst auf, was sie gesagt hatte, als ich, die Hände voller Löwenzahn, hinten im Garten die offene Stalltür entdeckte. Die beiden unteren Ställe waren verschlossen, hinter dem Maschendraht hockte Peggy mit ihren Jungen, daneben Beppo, über ihm Gustav. Aber Tobis Tür stand weit offen.
„Das Grünzeug braucht der nicht mehr, das kannst du selber fressen!“, rief Uwe grinsend zu mir herüber. Er stand drüben am Holzklotz neben Vater, der eben das Beil hob.
Ich ließ den Löwenzahn fallen. „Nein! Nicht!“
Tobis samtweiche Pfoten zappelten in Uwes Griff, seine langen Schlappohren zitterten, diese warmen, flauschigen Ohren, die ich in den letzten Monaten so oft gekrault hatte. Ich machte einen Schritt vorwärts. „Nicht, Papa, bitte nicht Tobi! Bitte!“
Der unbarmherzige Blick meines Vaters flackerte zu mir herüber, als er innehielt. Ein Sonnenstrahl brach sich auf der Klinge des Beils. „Hab dich nicht so, Kind“, sagte er rau. „Die sind doch dazu da, dass sie von uns gegessen werden. Was meinst du denn, warum wir die Rammler so dick füttern? Also!“
Ein weiterer Sonnenstrahl blitzte auf, als er das Beil höher hob. Tobi zuckte, ich sah eins seiner Augen, den flehenden Blick. Ich wartete nicht ab, bis mein Vater das Beil fallen ließ, ich drehte mich um und rannte los, mit pochender, brennender Kehle, aber trotzdem hörte ich es, Uwes Lachen und das dumpfe Knacken, mit dem das Beil auf sein zappelndes Ziel traf.
„Los, jetzt du!“
„Oh, nee, nicht noch mal!“ Berends Augen leuchteten unternehmungslustig auf, aber er zog dennoch die Nase kraus und schüttelte den Kopf. Sommersprossen glänzten auf seinem Gesicht. „Ich muss doch nach Hause. Meine Mutter schimpft, wenn ich wieder zu spät bin!“
„Einmal noch! Komm, Berend, noch einmal!“ Ich piekste ihm in die Seite, und Berend kicherte vergnügt und sprang vorwärts. Wie üblich ließ er sich nicht lange bitten.
„Na gut!“ Er nahm seine Adidas-Tasche herunter und begutachtete mit schiefgelegtem Kopf den Rinnstein. Dann stellte er seinen nackten Fuß neben meinen auf die Bürgersteigkante und platzierte seine Tasche dahinter. „Bis wohin?“
Berends Fuß war größer als meiner, und schmutziger war er auch. Ich kniff die Augen zusammen und betrachtete die Häuserzeile zu unserer Rechten. Die spitzen Dächer duckten sich unter dem Sommerhimmel, der sich langsam ein wenig dunkler zu färben begann. Gegenüber zogen sich die Brachwiesen bis zum Deich, von der milden Abendsonne beschienen. Das helle Flöten der Kiebitze auf ihrem Anflug nach unten drang zu uns herüber, aus der Ferne war das Rauschen der Wellen zu hören. Es war spät, die Essenszeit schon fast vorbei. Berend hatte längst schon nach Hause gewollt, sich aber meinen Bitten gefügt. Wie so oft in den Ferien; es war schließlich August, lange Tage für uns, voller Sonne und Freiheit. Bis sich am Abend die Tür hinter mir schloss.
Und heute, gerade heute, zögerte ich den Abschied erst recht hinaus. Um keinen Preis wollte ich Tobis gehäuteten Körper sehen, aufgebahrt auf einer Servierschüssel, von meiner hungrigen Familie gierig beäugt.
Aber vielleicht waren von ihm auch nur noch die Knochen übrig. Knochen und Haut. Samtweiches Fell.
Ich schüttelte den Kopf, um die Bilder zu verdrängen, wie so oft an diesem Tag.
„Bis wohin denn, Marti?“, fragte Berend, der mir wie immer die Entscheidung überließ.
Ich streckte den Arm aus und deutete auf Köbens neuerbaute Pension, kurz vor Pedders Kneipe gelegen. Dahinter zogen ein paar Möwen ihre Kreise durch die Abendluft. „Bis da, wo der Zaun anfängt!“
„Und dann zurück!“
„Mann, logisch, du Knalltüte! Also: Eins, zwei …“
„Drei!“, schrie Berend und lief los, glucksend vor Vorfreude, mit einer Hand seine zu große Badehose haltend. Federleicht und behände setzte er einen schmutzigen Fuß vor den anderen und balancierte dabei mit den Armen, und ich rannte seitlich neben ihm her, um zu kontrollieren, ob er auch die Regeln einhielt. Schließlich konnte nur gewinnen, wer mit der vollständigen Fußsohle die Kante berührte.
„Schaffst du eh nicht!“, schrie ich.
„Jawohl!“
„Blödian! Schaffst du nicht! Runterfaller! Doofiknaller!“
Berend kniff die Lippen zusammen und lief unbeirrt weiter. Gekonnt setzte er einen Fuß vor den anderen.
„Pupsi-Berend!“ Wenn es mir gelang, ihn zum Lachen zu bringen, schaffte er es nicht. „Puuupsi!“ Ich streckte ihm die Zunge raus und machte Furzgeräusche. Ein Touristenpaar mit einem Kleinkind in einer Karre blieb stehen, um uns zuzusehen, aber Berend ließ sich nicht aus der Fassung bringen. Unbeirrt setzte er einen Fuß vor den anderen, den Blick stur nach unten gerichtet.
Ich schnappte nach seiner Badehose, aber Berend hielt sie eisern fest und schlug nach meiner Hand. Er geriet ins Schwanken, aber im nächsten Moment fand er sein Gleichgewicht wieder.
„Das gildet nicht!“, rief er empört und musste gleichzeitig kichern. „Du hast mich berührt!“
„Hab ich gar nicht! Hab ich nicht!“ Ich schnitt ihm eine Grimasse und hielt mir die Hände seitlich an die Ohren, während ich ihn nachäffte. „Du hast mich berührt, huhu!“
Berend lief rot an, so sehr musste er sich anstrengen, um nicht loszuplatzen. Aber immer noch setzte er einen Fuß vor den anderen. An Hansens Haus und der Pension Sieglinde waren wir bereits vorbei.
Wieder griff ich nach Berends Hose, und er wich nach links aus und quiekte auf. „Ej!“, schrie er lachend. „Mensch, Marti, jetzt hör auf! Das gildet nicht!“ Mit hochrotem Kopf balancierte er an der Touristenfamilie vorbei, passierte Sinemakers Bruchbude und begann aufgeregt zu kichern, als der Zaun von Köbens Pension in Sicht kam. „Bis zum Zaun, ja, Marti? Bis zum Zaun, ja?“
„Nee, bis zum Dach!“, rief ich wütend, und da begann Berend endlich zu lachen. Für einen Moment schwankte und zitterte er, dann streckte er reflexartig ein dünnes, sonnengebräuntes Bein zur Seite und riss die Arme in die Höhe.
Ich klatschte siegessicher in die Hände, aber da gelang es Berend wie durch ein Wunder, seinen Fuß wieder auf die Kante zu setzen und zwei weitere Schritte zu machen. Im nächsten Moment hatte er den Zaunanfang passiert und sprang jubelnd auf die Straße.
„Geschafft! Yeah! Geschafft! Ich hab’s geschafft!“ Strahlend wandte er sich mir zu. Seine leicht abstehenden Ohren leuchteten rot, und seine viel zu langen, blonden Haare glänzten fast golden im Sonnenlicht. „Ich hab’s geschafft! Jetzt bist du dran!“
„Und ob!“, sagte ich. Berend kreischte auf, als ich ihm in den Hosenbund griff und seine Badehose nach unten zu ziehen versuchte. Seine Finger umklammerten meine, und kichernd schubsten wir uns gegenseitig über den Weg. Aber plötzlich lockerte sich sein Griff, und seine Finger wurden schlaff.
„Guck mal“, sagte er mit einer seltsam ruhigen Stimme. Ich ließ seinen Hosenbund los und sah hoch.
Ein Stück vor uns waren eben zwei Männer aus Pedders Kneipe auf den Gehsteig getreten. Beide wankten bedenklich, und ihre lauten, aggressiven Stimmen waren deutlich zu vernehmen. Als der Linke von beiden schwankend die Faust hob, warf Berend mir einen hastigen Blick zu.
„Komm, hinten rum!“, flüsterte ich. Ich musste Berend nichts erklären, nie musste ich das. Es gab immer einen Grund, vor meinem Vater zu flüchten. Wir drehten uns um und rannten los, zurück zum Startpunkt und dann nach links in die kleine Gasse hinter Hansens Haus. Im Laufen schnappte sich Berend seine Adidas-Tasche und schlang sich hastig den Riemen über den Kopf. Bevor wir um die Ecke bogen, sah ich mich noch einmal um.
Mein Vater hatte die Faust wieder sinken lassen. Seine Arme hingen schlaff herab, und sein Kopf schien ein wenig zu wackeln. Der andere Mann stand schwankend neben ihm, die Hände seitlich in die Hüften gestützt, und sein hässliches, betrunkenes Lachen hallte durch die Abendluft.
Ich lief Berend nach, an Tante Josinas Pension vorbei, links um die Ecke und dann über den Hinterhof vom Hotel Gerdes, zwischen den geparkten Autos der Gäste hindurch. An der Durchfahrt zögerte Berend kurz, und ich deutete nach rechts. „Hinten rum!“
Dicht hintereinander flitzten wir an den Wäschecontainern vorbei zum Lieferanteneingang, wo Berend so ruckartig stehen blieb, dass ich gegen ihn prallte. „Mensch, Berend, spinnst …“
Zum zweiten Mal innerhalb weniger Minuten verstummte ich abrupt. Direkt vor uns stand der Lieferwagen, der das Fleisch für die Hotelküche brachte. Es war nicht das erste Mal, dass wir ihn sahen, aber das erste Mal aus dieser Nähe.
Die Türen waren weit geöffnet, und eine Reihe von Schweinehälften baumelte an einer Schiene unterhalb der Decke. Einer der Küchengehilfen hob soeben einen Metallstab und angelte eine der Schweinehälften herunter. Er hatte sichtlich Mühe damit, denn sein Gesicht war schweißgebadet, und seine Armmuskeln zitterten, als er die Schweinehälfte schließlich aus dem Wagen bugsierte. Dicht vor uns schwang er sie herum, und der zerschnittene Tierkörper drehte sich. Blutige Rippen, eingebettet in helles Fleisch, gehalten von Sehnen und Bändern, dann rosa Haut, schimmernde Borsten, ein Huf, ein herabhängendes Ohr, der klaffende Spalt der Schnauze darunter, ein Auge, blicklos, fast menschlich, dicht vor unseren Gesichtern.
Berend stand reglos vor mir, seine schmalen Schultern bebten, eingezwängt zwischen der Schweinehälfte und mir, und ich konnte das Zischen hören, als er zwischen den zusammengebissenen Zähnen hindurch Luft holte. Und ich konnte ihn riechen, seinen Jungsgeruch nach Sommer, Schweiß, Sonne. Und dann roch ich noch mehr: einen durchdringenden Gestank nach Blut, Fleisch und Tod. Als ich schluckte, schmeckte ich Sand zwischen meinen Zähnen, Sand vom Strand, an dem wir den Nachmittag verbracht hatten, Berend und ich, wir beide, einen Feriennachmittag fast ohne Schatten.
Jetzt aber war der Schatten dunkel und riesig geworden.
Und in diesem Schatten sah ich Tobis zuckenden Körper, seine flehenden Augen, das Beil in der Hand meines Vaters, die blitzende Klinge. Ich holte tief Luft und hörte das Röcheln in meiner Kehle.
Eine Ewigkeit schien es zu dauern, bis der tote Körper vor uns seine Drehung vollzogen hatte und langsam im Eingang verschwand.
„He!“, dröhnte eine Männerstimme. „Was macht ihr da? Weg da, aber sofort!“ Eine wuchtige Gestalt in hellkarierter Kleidung und blutbefleckter Schürze kam auf uns zu. Ich sah ein dickliches, teigiges Gesicht unter einer speckigen Schirmmütze, gequetschte Schlitze, aus denen helle Augen hervorstarrten, als wir losrannten, Berend und ich im Gleichschritt, schnell wie zwei lodernde Blitze. Und noch bevor wir den Hinterhof verlassen hatten, schon als wir den dunklen Durchgang erreichten und uns zwischen einer Schar überraschter Sommergäste hindurchzwängten, die die Speisekarten am Eingang studierten, schon da wusste ich, dass ich nie wieder Fleisch essen würde.
Berend schwieg, als wir schließlich aufhörten zu rennen und nur noch atemlos nebeneinander hertrabten, und er nickte wortlos, als ich ihn fragte, ob ich noch mit zu ihm kommen dürfte.
Gemeinsam ertrugen wir das kurze Geschimpfe seiner Mutter, das alsbald einem resignierten Kopfschütteln und dann einem Lächeln wich, gemeinsam wuschen wir uns die Hände und setzten uns zu Tisch.
Und gemeinsam schüttelten wir den Kopf, als seine Mutter uns fragte, ob sie uns noch ein paar Würstchen heißmachen sollte. Berend warf mir einen kurzen Blick zu, und den Ausdruck des Schattens in seinen Augen, das wusste ich damals schon, würde ich niemals vergessen.
Wir haben nie über das gesprochen, was wir an jenem Augustabend in Gerdes’ Hinterhof gesehen hatten. Und wir haben auch nie mehr über Tobis klägliches Ende gesprochen. Aber wir zogen beide Konsequenzen daraus. Ich für immer, Berend für ein paar Jahre.
Für ein paar gemeinsame Jahre. Bis ich die Insel verließ und damit auch ihn.
Berlin, Mai 1994
„He, coole Karre!“ Hannes steckte seinen Kopf durchs Beifahrerfenster und musterte anerkennend das Armaturenbrett. Dann stützte er sich vorsichtig mit den Unterarmen auf der Fensterleiste auf. „Haste geklaut, oder was?“ Er grinste mich an und wischte sich mit dem Handrücken über die verschwitzte Stirn. Sein Blaumann war wie immer ölverschmiert, die Farbe seiner Handschuhe kaum noch zu erkennen unter den Flecken.
„Nee, ich darf damit heute fahren.“
„Gibt’s doch gar nicht. Warum das?“
„Berutti hat doch ein Gipsbein. Und deshalb durfte ich eine Komponistin vom Flughafen abholen.“
Hannes pfiff durch die Zähne. „Klingt gut. Und, bist du schon geblitzt worden?“
„Ich doch nicht! Hannes, hast du den Tip da? Oder die Zitty? Irgendein Stadtmagazin?“
„Sicher.“ Er zog seinen Kopf aus dem Fenster und stieß sich von der Fensterleiste ab, wobei er darauf achtete, keine Schmutzspuren zu hinterlassen. Ich sah meinem besten Freund nach, als er durch das offen stehende Tor in die Werkstatt ging und im Büro verschwand. Der Overall schlackerte ihm um den Körper und hing ziemlich auf halb acht, aber Hannes war schon immer dünn gewesen. Obwohl er aß wie ein Scheunendrescher.
Entspannt lehnte ich mich zurück und sah mich um. Wie in jeder Werkstatt, in der Hannes arbeitete, lag auch hier nichts Überflüssiges herum; die momentan nicht benötigten Werkzeuge hingen fein säuberlich an der Wand aufgereiht. Nur in der Ecke, in der ein zweiter Geselle gerade an einem Ford herumschraubte, lagen diverse Teile auf dem Boden herum. Kein Wunder, dass Hannes auf eine eigene Werkstatt sparte.
„Hier! Willst du einen Kaffee?“ Hannes war zurückgekommen und reichte mir die Zitty durchs Fenster.
„Keine Zeit, ich muss gleich wieder los.“
Interessiert sah er zu, wie ich die Seite mit dem heutigen Datum nachschlug. „Kommst du denn nachher noch in die Megabar?“
„Vielleicht. Ich weiß noch nicht, ob ich es schaffe.“ Bei den Konzerttipps fand ich ein Foto von ihr. Elisabeth Herlitz. Deutschlettische Komponistin und Konzertpianistin. Deutschlettisch. Was immer das heißen sollte. Ihre dunklen Augen sahen mich ernst an. Im Rückspiegel hatte sie gelächelt. Sie kam mir wirklich vertraut vor, warum auch immer.
„Wieso, was heißt das, wenn du es noch schaffst?“, fragte Hannes. „Was hast du denn vor?“
„Auf ein Konzert gehen. Ein klassisches.“
Hannes lachte. „Du? Du spinnst. Übrigens, wenn du noch einen Job brauchst, ich hab da vielleicht was für dich. Könnte ein cooles Ding sein. Fahrerin. Für eine Geschäftsfrau.“
Ich sah Elisabeth Herlitz noch einmal in die Augen, dann schlug ich die Zitty zu und reichte sie Hannes zurück. „Im Moment nicht, danke. Solange ich solche Schlitten fahren kann …“
„Ist auch noch nicht akut“, sagte er. „Aber wenn, dann denk ich an dich.“
„Ich hoffe, das machst du sowieso.“ Ich ließ den Motor an. Hannes grinste mir zu und winkte mit der Zeitschrift. „Viel Spaß bei deinem Konzert. Und pass bloß auf, dass du nicht geblitzt wirst!“
Norddorf, August 1980
„He, passt mal auf! Nicht einschlafen, ihr drei! Vorwärts, macht mal die Tür frei!“ Ein griesgrämig dreinblickender Mann mit Schnauzbart stieß Berend zur Seite, dass er taumelte. Die sorgsam abgezählten Pfennigstücke purzelten ins Gras neben dem Eingang, und Harm lachte los und schlug sich auf die nackten Schenkel.
„Mensch, Berend, du Trottel!“
„Kann ich doch nichts für“, sagte Berend verlegen und lief rot an, während er sich schnell bückte. Gemeinsam hoben wir die Münzen auf. Ein Zehnpfennigstück war und blieb verschwunden, aber Harm hatte noch Ersatz.
„Hier!“ Er spuckte durch seine neueste Zahnlücke auf den Gehsteig. „Aber dafür musst du jetzt reingehen!“
„Wieso, du warst doch dran!“
„Jetzt nicht mehr“, sagte Harm und verschränkte die Arme vor seiner Brust. Nur noch die wirrhaarigen Köpfe der seltsamen Band, mit deren Konterfeis sein T-Shirt bedruckt war, lugten über seine Arme.
„Mist“, murmelte Berend geschlagen. Dann legte er die Hand auf die Klinke, holte tief Luft und zog die Tür auf, hinter der der Schnauzbart längst verschwunden war.
„Ich komm mit“, sagte ich und tauchte hinter ihm in das rauchgeschwängerte Dunkel von Pedders Kneipe ein.
Harm brummte missmutig vor sich hin und kam hinter uns her.
Niemand von uns ging gern in Pedders Kneipe. Weder Pedder selbst noch seine Angestellte konnten Kinder leiden, aber es war eben Sonntag, die Ferien waren vorüber und Pedders Kneipe die einzige Möglichkeit, ein Eis zu kaufen.
Trotz der frühen Nachmittagsstunde war im dunklen Gastraum fast jeder Platz besetzt. Stimmengewirr hing in der Luft und übertönte Christian Anders’ Schlagerstimme, die aus den Boxen säuselte. Tapfer bahnte Berend uns den Weg an Barhockern, torkelnden Männern und vereinzelten kichernden Frauen vorbei. Die meisten Gesichter kannte ich, unser Ort war nicht groß, und wenn die Touristen die Insel verlassen hatten, blieb den Einheimischen untereinander wenig verborgen.
Berend stieß zum Tresen vor, hinter dem die Eiskarte hing. Ich stellte mich dicht an seinen Rücken, und auch Harm schloss eng zu uns auf. Aber nicht eng genug.
„Was hast du denn da für komische Kerle vorne drauf? Wie sehen die denn aus?“, rief eine schrille Frauenstimme und hakelte mit einem Finger nach Harms Brust. Der rotlackierte Fingernagel sah aus, als wäre er blutig.
Der Begleiter der Frau beugte sich schwankend nach vorne. „Sex Pistols“, las er stockend von Harms Shirt ab. „Kenn ich nicht. Machen die Sex mit Pistolen oder was?“
Die Frau fiel fast vom Stuhl, so sehr lachte sie. Aber es gelang ihr dennoch, Harm unterm Kinn zu kraulen, bevor er den Kopf wegzog. „Du bist doch der Kleene vom Hotel Gerdes, oder?“, fragte sie und sog an ihrer Zigarette. „Da biste später mal ’ne richtig gute Partie, was?“
„Klar. Und die Sex Pistols sind eine Band“, sagte Harm ungerührt. „Und zwar eine richtig gute! Berend, Mann, jetzt bestell doch mal endlich!“
Berend sah unsicher zu Pedder, der jetzt hinter dem Tresen aufgetaucht war, ein Geschirrhandtuch in der einen Hand und ein Bierglas in der anderen. „Äh, wir möchten drei Eis“, sagte er leise.
„Was willst du? Mach mal den Mund auf, Junge.“ Pedder drehte das Tuch im Glas, dass es quietschte.
„Drei Eis“, sagte Berend ein wenig lauter. „Zwei Brauner Bär und ein Dolomiti, bitte.“ Er stellte sich in seinen Sandalen auf die Zehenspitzen und streckte Pedder das Geld hin.
Pedder sah ihn finster an und drehte sich um. In aller Seelenruhe platzierte er das Bierglas unter den Zapfhahn, füllte es und schlurfte dann zur Eistruhe, um darin herumzukramen. Berend warf mir einen Blick zu, dann entdeckte er jemanden hinter mir, und seine Lippen zuckten nervös.
„He, Reik, ist das nicht deine Jüngste?“, rief eine Stimme.
Ich drehte mich halb um. Mein Vater erhob sich gerade von seinem Hocker. Sein Blick war nicht auf mich, sondern auf Berend gerichtet. Berend, der stocksteif vor mir stand, mit struppigen Haaren, in seinem viel zu kurzen T-Shirt, verblichenen Shorts und ausgelatschten Sandalen. Mein Vater hatte Berend noch nie leiden können.
„Was macht ihr denn hier drin?“, fragte er jetzt finster. Das Stimmengewirr schien augenblicklich leiser zu werden, und sogar Christian Anders verstummte für einen Moment.
„Eis kaufen?“, sagte Berend vorsichtig. So, wie er es aussprach, klang es fast wie eine Frage, und das war für meinen Vater natürlich ein gefundenes Fressen.
„Eis kaufen?“, höhnte er. „Oder doch nicht? Was soll das heißen, weißt du nicht, was du willst, du Spargeltarzan?“
Berend sah mich hilflos an, und auch Harm, der sonst nie um eine freche Antwort verlegen war, klappte der Mund auf.
Mein Vater sah grimmig von Berend zu mir und wieder zurück. Er schwankte nicht, und ich konnte nicht feststellen, ob er betrunken war oder nicht, aber das schien keine Rolle zu spielen. „Los, du dünnes, mickriges Kerlchen, ich hab dich was gefragt!“
Die Frau mit den roten Fingernägeln lachte verdutzt auf. „Reik“, murmelte sie beschwichtigend, aber mein Vater machte eine abwehrende Handbewegung.
„Los, du Furzknoten, antworte!“
„Was … was denn?“, fragte Berend ängstlich.
„Was denn, was denn?“, äffte mein Vater ihn nach. „Was ist denn mit dir? Ständig hängst du Knilch mit meiner Tochter herum! Wenn du glaubst, du kriegst sie später mal, da irrst du dich aber gewaltig, Bürschchen!“
Berend warf mir einen verwirrten Blick zu, und ich stellte mich dichter neben ihn.
„Mensch, Papa“, murmelte ich, „wir wollen doch bloß …“
„Halt die Klappe!“, brüllte mein Vater und schubste mich gegen Harm. Berend zuckte zusammen und duckte sich, aber im gleichen Moment war einer der anderen Männer aufgestanden und schob sich dazwischen.
„He, Reik, nun mal halblang!“ Es war Klaas, ein kleiner, knurriger Eigenbrötler, der sich das ganze Jahr über um die Vögel draußen an der Odde, der Nordspitze der Insel, kümmerte. Im Sommer wohnte er in der Vogelwärterhütte, einem kleinen Holzhaus ein Stück hinter dem Schullandheim, von wo aus er auch Führungen durchs Watt leitete.
Mein Vater sah Klaas an, und seine Augen verengten sich. „Was willst du denn? Wer hat dich denn um deine Meinung gefragt?“
„Niemand“, sagte Klaas ruhig. Sein Blick wanderte von Berend zu mir und blieb auf meinem Gesicht hängen. In seinen Augen lag ein freundlicher, fast liebevoller Ausdruck, als er mir zunickte, und ich spürte, wie ich mich ein wenig entspannte. Er drehte sich zu Pedder. „Komm, Pedder, sei so gut und gib den Kindern das Eis. Und Reik noch ein Bier.“
„Ich will kein Bier von dir, Kerl“, zischte mein Vater trotzig. „Gerade von dir nicht!“
Einen Moment lang maßen die beiden sich mit Blicken. Dann zuckte Klaas mit den Schultern und wandte sich ab. „Dann nicht“, sagte er und ging zurück an seinen Tisch, wobei er wie üblich das rechte Bein nachzog.
Mein Vater sah ihm böse hinterher. „Von dir nicht, du … du …“, brummte er und sah wieder mich an. Aber die Wut aus seinen Augen war nicht mehr da. Plötzlich sah er einfach nur erschöpft aus. „Ach, haut doch ab, ihr Gören“, murmelte er und zog seine speckige Cordhose hoch, als er sich umdrehte.
„Hier!“ Pedder tippte Berend auf die Schulter, und Berend nahm hastig die drei Eis in Empfang und folgte Harm und mir hinaus ins gleißende Sonnenlicht.
„Hui“, sagte Harm und pfiff durch seine Zahnlücke, während er das Papier von seinem Braunen Bär riss. „Meine Scheiße, warum ist dein Vater eigentlich immer so sauer?“ Er steckte sich das Eis halb in den Mund verdrehte genießerisch die Augen.
„Keine Ahnung“, sagte ich. „Aber der war schon immer so.“ Ich sah zu Berend, der mit zitternden Fingern die Verpackung aufpulte. Er war bleich im Gesicht, aber irgendwie sah er trotzdem tapfer aus. „Ich glaub, wir können uns bei Klaas echt bedanken“, sagte er nachdenklich.
Harm zuckte mit den Schultern. „Tu das. Bedank dich beim ollen Humpelklaas“, sagte er und machte Klaas nach, indem er lachend ein paar Schritte vorwärts humpelte. „Und, was machen wir jetzt?“
Berlin, Mai 1994
„Danke erst mal.“ Rosch schwang die Beine aus dem Wagen. „Warten Sie dann bitte nach dem Konzert hier auf uns.“ Er schlug schwungvoll die Tür zu und öffnete die Tür des Fonds, um Elisabeth Herlitz beim Aussteigen behilflich zu sein.
Aber sie blieb noch sitzen und sah zu mir, eine Hand auf die Lehne des Vordersitzes gestützt. „Und Sie?“, fragte sie und beugte sich ein wenig nach vorn. „Was machen Sie jetzt? Kommen Sie nicht mit?“
Ich schüttelte den Kopf. „Ich vertreibe mir ein bisschen die Zeit und hole Sie dann wieder ab.“
Sie lächelte leicht und nickte. „In Ordnung.“ Dann stieg sie aus. Im selben Moment beugte sich Rosch zu mir, und ich drehte das Fenster herunter.
„Ach, Frau …?“
„Maan.“
„Frau Maan, ja“, sagte er, „ich hab’s mir anders überlegt. Stellen Sie doch den Wagen bitte hinten auf den Hof und geben Sie den Schlüssel am Empfang ab. Ich fahre dann später selber.“
Ich war selbst überrascht, wie enttäuscht ich war. „Geht klar.“
Rosch nickte kurz. Gekonnt schob er eine Hand unter Elisabeth Herlitz’ Ellenbogen und führte sie davon, durch die wogende Menge der gutgekleideten Konzertbesucher hindurch, die leise schwatzend auf den Haupteingang zustrebten. Elisabeth Herlitz war fast genauso groß wie Rosch, sie waren gleich alt, eigentlich gaben sie ein sehr gutaussehendes Paar ab. Missmutig gab ich Gas, bevor sie im Eingang verschwunden waren.
Der junge Mann am Empfang zuckte nur mit den Schultern, als ich ihm den Schlüssel überreichte, und rief eine der Garderobendamen zu sich, die mich wortlos zum Seiteneingang führte.
Im schwachen Licht der Notlampen schaffte ich es nur mit Mühe, das Konzertprogramm zu entziffern, aber schließlich gelang es mir doch, während die Luft um mich herum bereits erfüllt war von sanft schwingenden Klaviertönen. Der junge schwarzgelockte Pianist dort oben war Israeli und einer von sechs Absolventen der Stockholmer Musikhochschule, die einige neuere Kompositionen von Elisabeth Herlitz aufführen würden.
Ins Dunkel gelehnt stand ich da und lauschte den sanften, fast traurigen Klängen, während ich den Blick über die vollbesetzten Reihen des Saales gleiten ließ. Beifall brandete auf, als der junge Israeli seinen Vortrag beendet hatte und Platz machte für einen weiteren Klavierspieler, der von zwei Geigerinnen begleitet wurde.
Ich suchte weiter den Saal ab, während eine nervöse, fast traurige Klaviermelodie in meinen Ohren vibirierte. Die Geigen setzten grelle, fast schrille Kontrapunkte zu den tragenden Tönen, und als sich gegen Ende des Stückes alle drei Instrumente zu einem weichen Klangteppich verwoben, verspürte ich fast Erleichterung. Die drei jungen Musiker machten einem kräftigen, asiatisch aussehenden Cellisten und einer zierlichen Pianistin Platz, und als sie zu spielen begannen, hörte ich auf mit meiner Suche.
Etwas an der kraftvollen Vortragsweise des Cellisten, an der Art, wie er leicht vorgebeugt dasaß, mit fiebrigen Augen, wie auf dem Sprung, zog mich in den Bann. Das weiche Spiel der Pianistin war wie das Rauschen des Meeres, durchsetzt von Vogelgezwitscher und klagenden Rufen, vom Cellisten gezaubert. Plötzlich fröstelte mich, und ich schloss hastig die Augen. Die Rufe der Wasservögel wurden lauter und lauter, füllten mich aus, dann verebbten sie langsam.
Später, viel später, erst kurz vor der Pause, die beiden jungen Musiker hatten längst anderen Platz gemacht, da entdeckte ich sie in einer der Logen im ersten Stock. Rosch hockte vornübergebeugt da, das Kinn auf die Faust gestützt, und sein Blick flackerte immer wieder von der Bühne zu Elisabeth Herlitz hinüber, die sehr aufrecht neben ihm saß, einen konzentrierten, zugleich heiteren Ausdruck im Gesicht. Ihr Blick ruhte unverwandt auf den Musikern, manchmal nickte sie leicht, und einmal lächelte sie.
Ich lehnte mich tiefer ins Dunkel und war froh, als die Pause begann. Zwischen den herausströmenden Konzertbesuchern ließ ich mich ins Foyer treiben und stand dann eine Weile unschlüssig in einer Ecke herum, um die lächelnden, munter plaudernden Menschen zu betrachten, die sich um die Bar drängelten. Ich überlegte zu gehen, vielleicht war es genug. Die Megabar wartete auf mich, Hannes, Maja, die anderen.
Ich studierte noch einmal das Programm und drehte es um. Kein Foto von ihr, aber eine kurze Notiz zu ihrem Lebenslauf: Elisabeth Herlitz, las ich da, galt als eine der wichtigsten zeitgenössischen Komponistinnen Nordeuropas. Sie hatte Klavier in Stockholm studiert, anschließend Komponistik. Eine erfolgreiche Karriere als Konzertpianistin lag hinter ihr, seit 1987 arbeitete sie als Komponistin und Dozentin für Klavierspiel an der Musikhochschule Stockholm.
„So vertreiben Sie sich also die Zeit?“
Erschrocken sah ich auf. Elisabeth Herlitz stand direkt vor mir, mit verschränkten Armen und einem amüsierten Lächeln auf den Lippen. Verlegen faltete ich das Programm zusammen.
„Äh … ja.“
„Und?“ Sie legte den Kopf schräg. „Wie gefällt es Ihnen?“
„Ich …“ Ich nahm die Schultern nach vorne. „Ich … es hat mir gefallen. Sehr sogar.“
Sie nickte. „Das freut mich.“ Ihr Blick war aufmerksam. Sie wartete offenbar, dass noch mehr kam.
„Ich musste an Wasservögel denken“, fügte ich hinzu. „Irgendwie hat mich das an meine Kindheit erinnert. An den Ort, an dem ich aufgewachsen bin.“
„Ich hoffe, Sie haben schöne Erinnerungen daran?“
Ich zögerte. „Nein“, sagte ich dann. „Das heißt, nur wenige. Aber daran hat Ihre Musik mich erinnert. Ich meine, an die guten Erinnerungen. An das Schöne in meiner Kindheit.“
Sie nickte wieder und sah mich lange an. Sie hatte schöne Lippen, fand ich. Sehr schöne Lippen. „Das ist dann vielleicht gut“, sagte sie und zog eine Visitenkarte heraus. „Hier. Ich lebe an einem Ort, an dem es viele Wasservögel gibt. Wenn Sie einmal dorthin kommen, besuchen Sie mich.“
Überrascht nahm ich die Karte entgegen und hielt sie in der Hand. „Und wo liegt dieser Ort?“
„In der Ostsee.“ Elisabeth Herlitz lächelte, und dann sah ich Rosch hinter ihr auftauchen, mit zwei Sektgläsern in den Händen.