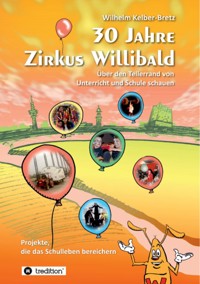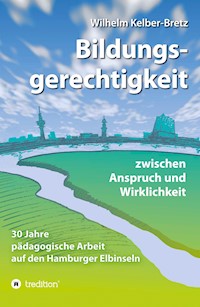
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Bildungsgerechtigkeit zwischen Anspruch und Wirklichkeit 30 Jahre pädagogische Arbeit auf den Hamburger Elbinseln Wilhelm Kelber-Bretz Deutschland schneidet weiterhin schlecht ab, wenn es um gute Bildungschancen für benachteiligte Kinder geht. Woran liegt das? Anhand des Beispiels der Hamburger Elbinseln Wilhelmsburg und Veddel geht der Pädagoge Wilhelm Kelber-Bretz der Frage auf verschiedenen Ebenen nach. Dabei geht er von der erlebten Praxis in Unterricht und Schule aus, beschreibt mit kritischem Blick die angewendeten pädagogischen und didaktischen Methoden der vergangenen drei Jahrzehnte - von der Kompetenzorientierung über das individualisierte Lernen bis zur Inklusion. Zugleich berichtet er von seinen Erfahrungen im außerschulischen Bereich, von Projekten und Kooperationen sowie der Bildungsnetzwerk-Arbeit im Stadtteil. Er fragt: Wie können wir bildungsbenachteiligte Kinder und Jugendliche besser fördern und ihre Bildungs- und Lebenschancen verbessern? Welche Konzepte wurden ausprobiert? Gab es Erfolge? Was müssen wir ändern? Welche Strategien könnten wirken? Am Ende jedes Kapitels formuliert er Anregungen zur Verbesserung. Wilhelm Kelber-Bretz war dreißig Jahre lang als Pädagoge und Bildungskoordinator auf den Hamburger Elbinseln, einem "sozialen Brennpunkt", tätig und erlebte die Entwicklungen und verschiedenen Phasen der gesellschafts- und bildungspolitischen Veränderungen hautnah.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 268
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Für Angelica
Wilhelm Kelber-Bretz
Bildungsgerechtigkeit zwischen Anspruch und Wirklichkeit
30 Jahre pädagogische Arbeit auf den Hamburger Elbinseln
© 2021 Wilhelm Kelber-Bretz
Umschlag, Illustration: Roswitha Stein
Lektorat, Korrektorat: Sigrun Clausen
Verlag & Druck: tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg
ISBN
Paperback
978-3-347-35142-4
Hardcover
978-3-347-35143-1
e-Book
978-3-347-35144-8
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Einleitung
Warum ich dieses Buch schreibe
Erstes Kapitel
Meine ersten zehn Jahre auf den Elbinseln
Mein Einstieg
Wilhelmsburg – ein abgeschriebener Stadtteil?
Vor-Erfahrungen
Als Lehrer in Simbabwe
Gute Voraussetzungen
Die ersten Jahre in der Schule
Erste Fragen
Besondere Ereignisse
Hereinspaziert! Zirkus Willibald – wie alles anfing
Wilhelmsburg „brennt”
Arbeit im Zeitraster
„Ich bringdich um!”
Die Zukunftskonferenz - neue Perspektiven für die Elbinseln
Fragen und Schulalltag
Schule - Auflistung von Problemen
Schwierige Klasse - schwieriger Schulalltag
Erkenntnis am Elternsprechtag
„So kann es nicht weitergehen!“
Erste Einordnungs- und Erklärungsversuche
Fazit
Zweites Kapitel
Pädagogische Veränderungen nach dem PISA-Schock
Lehrer am Limit?
Dynamik mit gesundem Menschenverstand?
Neuer Arbeitsalltag an den Schulen
Erste Kritik
Fragen
Mehr Fragen und erste Einordnungen
Neue Konzepte verändern die Schule
Kompetenzorientierung
Kompetenzraster
Macht Kompetenzorientierung unmündig?
Offene, individualisierte und selbstgesteuerte Formen des Lernens
Lernbüro
„PAUL“
Lernwerkstätten
„SEGELN“
Exkurs: Erkenntnisse aus der Hirnforschung
Innere und äußere Differenzierung
Zwischenfazit
Inklusion
Ein Konflikt entsteht
Wie ermöglichen wir eine inhaltliche Auseinandersetzung?
Inklusion - „Ende einer Dienstfahrt”?
Weitere schulische Aspekte und Einflussfaktoren
Digitalisierung und Medien - Fluch oder Chance?
Jungen und Gewalt
Ganztagsschule
Die Rhythmisierung des Ganztags
Keine Nebensächlichkeit: Gutes Essen für die Schüler
Übergang Schule/Beruf - Vorbildliche Berufsorientierung
Profilklasse ZEBRA
Fazit
Drittes Kapitel
Außerunterrichtliche und stadtteilweite Projekte beleben die Elbinseln
Club- und Sportaktivitäten in Simbabwe
Das Forum Bildung Wilhelmsburg (FBW) - ein lokales Netzwerk entsteht
Projekte des FBW beleben die Elbinseln
Die Wilhelmsburger Lesewochen
Die Forschungs- und Kochwochen
Zirkus Willibald - ein außergewöhnliches pädagogisches Projekt
Nicht denkbar ohne das FBW
Exkurs: Außerschulische Projekte und die Kommune als günstiger Erfahrungsraum
Fazit
Viertes Kapitel
Die Idee einer Bildungslandschaft
Die Elbinseln verändern sich
Das FBW beteiligt sich am Stadtentwicklungsprozess
„Die IBA braucht eine IBA”
Vom Beispielhaften zur langfristigen und systematischen Veränderung
Exkurs: Über den Tellerrand schauen
„Empowerment“ – Verantwortung statt Beteiligung
Bildungsoffensive mit allen und zum Nutzen aller?
Exkurs: Lebende Systeme
Netzwerkarbeit: Das FBW-Plenum wird zum Offenen Bildungsforum und ringt um eine gemeinsame Orientierung
Elbinselpädagogik - ein zukunftsweisender pädagogischer Rahmen?
Offenes Bildungsforum und Regionale Bildungskonferenzen - lokale bildungspolitische Entscheidungen durch Partizipation
Der Wilhelmsburger Bildungsfonds - Weiterführung der Projekte des FBW
„Hamburgs bester Stadtteil”?
„Bildungsoffensive Elbinseln: Hopp oder Top?“
Ungerechte Verteilung von Bildungschancen
Fazit
Brauchen wir eine neue Elbinsel-Pädagogik?
Anregungen für eine bessere Pädagogik
Nachwort
Danksagung
Literatur- und Quellenhinweise
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verwende ich in meinem Text sowohl die männliche Pluralendung, das Binnen-I als auch die männliche und weibliche Schreibweise. Damit möchte ich selbstverständlich niemanden ausschließen.
Land in Sicht, singt der Wind in mein Herz Die lange Reise ist vorbei …
Ton Steine Scherben
Vorwort
Und Jahre oder Jahrzehnte später zeigt sich ihr und uns, dass keine dieser kleinen Gesten klein war,sondern dass jede schwer war an Bedeutung …
Anne Weber, Anette, ein Heldinnenepos
Nach fast dreißig Jahren auf den Elbinseln sind mir heute viele freundliche Schülerinnen und Schüler, nette Klassen sowie eine Unmenge toller Projekte und herausragender Momente in sehr positiver Erinnerung. All das hat mich geprägt und angetrieben. Doch es war nicht immer leicht und nur eine Freude, in der Schule zu arbeiten. Ich brauchte an vielen Stellen Kraft, Ausdauer und Durchhaltevermögen, um meinen Weg zu finden. Über diese lange Zeit schließlich noch ein Buch zu schreiben, bedeutet für mich mehr, als nur die gemachten Erfahrungen geschickt in Worte zu kleiden. All das erscheint mir heute wie eine „lange Reise“.
Neben dem aktiven Vorantreiben in der Schule und bei den Projekten im Stadtteil gehörten für mich häufig auch ein Infragestellen und Widerspruch, ja, sogar Widerstand dazu. Dabei bin ich mit meiner kritischen Meinung zu bestimmten pädagogischen Fragen bei einer Reihe von Kolleginnen und Kollegen, besonders bei den Schulleitungen und der Bildungsbehörde, immer wieder angeeckt. Meine Kritik hätte aus meiner heutigen Sicht hier und da etwas weniger emotional, nicht so persönlich und manchmal im Ton nicht ganz so scharf formuliert sein müssen. Sachlich notwendig war sie in der Nachschau allemal!
Auf meinem Weg musste ich immer wieder neue Pfade suchen und finden. Das konnte ich nicht allein im stillen Kämmerlein. Ich benötigte Freunde, Kolleginnen und Unterstützer, die mir, mal mit großem Engagement, mal mit wertvollen kleinen Gesten, halfen und mitgingen.
Ich danke allen, die mich auf dieser langen Reise begleitet haben. Es sind so viele, dass ich sie in der gesonderten Danksagung am Ende des Buches nenne. Schon an dieser Stelle möchte ich besonders meine langjährigen Freunde und Kolleginnen des Forums Bildung Wilhelmsburg (FBW) sowie vom „roten Sofa“ in meiner Schule hervorheben.
Bei der Erstellung des Buches haben mir viele Freunde geholfen. Ich danke allen für die inhaltlichen und gestalterischen Anregungen! Es war mir bei diesem (letzten) großen Buch-Projekt noch einmal wichtig, mit den Kolleginnen auf den Elbinseln zusammenzuarbeiten, die mich seit vielen Jahren begleiten. Ich danke daher sehr herzlich Sigrun Clausen für das Endlektorat und Roswitha Stein für das Titelbild und die grafische Gestaltung.
Mit dem Verkauf des Buches sollen die Projekte des Wilhelmsburger Bildungsfonds (WBF) unterstützt werden.
Den weitaus größten Teil dieses Buches hatte ich vor dem März 2020 fertiggestellt. Dann kam Corona und veränderte das gesamte gesellschaftliche und somit auch das schulische Leben. Ich werde an bestimmten Stellen konkret auf die Auswirkungen der Pandemie Bezug nehmen, die neue Gesamtsituation kann ich hier allerdings nicht berücksichtigen.
Einleitung
Warum ich dieses Buch schreibe
Was ich möchte … ist, das wiederzugeben, was wert ist, gesehen zu werden: ein Stück Leben, das nicht jeder kennt.
Irving Stone, Vincent van Gogh – Ein Leben in Leidenschaft
Ich selbst komme aus bildungsfernen Verhältnissen. Das Engagement meines damaligen Lehrers war ein erster Impuls, selbst diesen Beruf ergreifen zu wollen und mich für bildungsbenachteiligte Kinder einzusetzen. Doch bevor ich Jahre später als Lehrer auf den Elbinseln arbeiten durfte, musste ich viele Umwege gehen: mit LKWs zu Baustellen fahren, auf Zauberbühnen Kunststücke präsentieren und als Entwicklungshelfer ein afrikanisches Land unterstützen.
Fast zehn Jahre nach meinem Examen war es dann so weit: Ich bekam doch noch eine Lehrerstelle im Hamburger Stadtteil Wilhelmsburg, auf der großen Elbinsel. Dort lernte ich Pädagoginnen und Pädagogen kennen, die ihren Beruf mit großem Engagement ausübten und versuchten, eigene und neue Wege einzuschlagen, um den Kindern bessere Chancen zu bieten. Die dabei gesammelten Erfahrungen dienen bis heute als Vorbilder für andere Stadtteile Hamburgs und darüber hinaus.
Ich hatte das Glück, fast dreißig Jahre lang in unterschiedlichen Bereichen der Bildung auf den Hamburger Elbinseln, vorwiegend in Wilhelmsburg, arbeiten zu dürfen. So konnte ich die verschiedenen Phasen der gesellschafts- und bildungspolitischen Entwicklungen aus nächster Nähe beobachten, begleiten und an einigen Stellen ein wenig mitgestalten.
In den ersten Jahren ab 1992 war ich vornehmlich als Fach- und Klassenlehrer an einer Gesamtschule in Wilhelmsburg tätig. Kurz danach startete ich parallel dazu mein erstes außerunterrichtliches Kinderprojekt, den Zirkus Willibald. Viele Jahren lang zeichnete ich darüber hinaus verantwortlich für unterschiedliche schulische Aufgabenfelder, anfänglich für den Freizeit- und Ganztagsbereich, später für die Berufsorientierung.
Um die Jahrtausendwende rückte Bildung allgemein durch den so genannten „PISA-Schock“ verstärkt in den Fokus der Öffentlichkeit und auch der Hamburger Politik. So wurde ich 2002 mit einer halben Lehrerstelle Geschäftsführer des lokalen Bildungsnetzwerkes Forum Bildung Wilhelmsburg (FBW). Das FBW war mit der Planung und Durchführung stadtteilweiter Bildungsprojekte, z. B. den Wilhelmsburger Lese- und Forschungswochen betraut.
2005 begannen die ersten Planungen der Internationalen Bauausstellung (IBA) mit der eingebundenen Bildungsoffensive Elbinseln (BOE). Damit erweiterte sich erneut mein Arbeitsfeld. In den folgenden Jahren wurde ich Verantwortlicher in unterschiedlichen neuen Bildungsgremien der IBA und der Bildungsbehörde. 2009 entwarfen wir in unserem Bildungsnetzwerk ein erstes gemeinsames pädagogisches Leitbild für den Stadtteil und nannten es „Elbinselpädagogik”.
2013 war das lang ersehnte große Präsentationsjahr der IBA und der BOE. Die Elbinseln sollten sich der Öffentlichkeit von ihrer besten Seite zeigen - und das taten sie auch. Doch schon 2014 setzte die Bildungsbehörde (BSB) erste entscheidende Zeichen: fast alle Koordinierungsstellen für die langjährige Netzwerkarbeit wurden nach und nach gestrichen (auch meine) und der größte Teil der Unterstützung für die stadtteilweiten Projekte lief aus. Wir mussten also schnell neue Wege finden, um zumindest die erfolgreichen Stadtteilprojekte weiterzuführen.
Über die vielen Jahre konnte ich die eben genannten Prozesse und Entwicklungen nicht nur beobachten, sondern als Lehrer in der schulischen Praxis sowie als Projektleiter und Bildungskoordinator auch an ihnen mitwirken.
Von Anfang an beschäftigte mich das Thema Bildungsgerechtigkeit, insbesondere die Fragen: Wie können bildungsbenachteiligte Kinder und Jugendliche besser gefördert werden? Wodurch verbessern sich tatsächlich ihre Bildungs- und damit ihre Aufstiegs- und Lebenschancen? Fast alle meine pädagogischen Aktivitäten im Unterricht, in der Schule und im Stadtteil waren letztlich an diesen Fragen ausgerichtet.
Über die vielen Jahre hinweg erkannte ich immer mehr Widersprüche. Im Laufe von dreißig Jahren hatten sich nicht nur eine Vielzahl von einzelnen pädagogischen Projekten in der Schule und im Stadtteil entwickelt, sondern es entstanden, trotz aller Probleme, verbindende Strukturen, ein einzigartiges „lebendes System”, das bildungsfernen Kindern bessere Möglichkeiten eröffnen konnte. Doch all das war immer nur begrenzt. Es funktionierte nicht widerspruchsfrei, und einiges behinderte aus meiner Sicht sogar die Förderung von Bildungsbenachteiligten und damit Bildungsgerechtigkeit.
Ich hielt zunächst sporadisch, dann systematischer einzelne Erlebnisse und Erfahrungen stichwortartig fest. Schon bei meinen ersten Versuchen des Zusammenschreibens spürte ich, wie besonders diese Zeitspanne war, wie viel sich über die Jahre verändert hatte - auch ich - und welche außergewöhnlichen Erfahrungen ich sammeln durfte. Wäre es nicht sinnvoll, all dies - geleitet von meinen zentralen Fragestellungen - anderen mitzuteilen? So entstand aus meinen Niederschriften dieses Buch.
Die Aufzeichnungen habe ich in vier Kapitel unterteilt. Zunächst stelle ich aus den ersten etwa zehn Jahren meiner Tätigkeit als Lehrer einige für mich prägende Aspekte dar. Im zweiten Kapitel geht es um den Zeitraum von der Jahrtausendwende bis heute. Die Elbinseln und auch die Pädagogik allgemein traten stärker in den Fokus. Vor dem Hintergrund einer rasanten gesellschaftlichen Entwicklung wurden pädagogische und schulische Veränderungen immer schneller eingeführt. Es zeigten sich neue Erkenntnisse in der Pädagogik, der Soziologie, der Psychologie und der Hirnforschung.
Schließlich stellt sich noch die Frage, ob Unterricht bzw. Schule überhaupt allein die umfassende Förderung der Kinder und Jugendlichen bewerkstelligen kann. So lege ich im dritten Kapitel meinen Fokus auf besondere Beispiele von außerunterrichtlichen und stadtteilweiten Projekten und beschreibe im letzten Kapitel die Netzwerkarbeit im Stadtteil.
Am Ende jedes Kapitels ziehe ich ein Fazit und versuche aus meiner heutigen Sicht Anregungen für eine zukunftsweisende Bildung für benachteiligte Kinder und Jugendliche zu geben. Meine unterbreiteten Vorschläge sollen jedoch keine „pädagogische Rezeptsammlung” sein.
Vielmehr möchte ich aus meinen langjährigen Erfahrungen Denk- und Diskussionsanstöße geben.
Ein Teil der folgenden Aufzeichnungen ist sehr persönlich. Alle im Buch beschriebenen Situationen habe ich selbst erlebt, nur an einigen Stellen leicht verändert, um die genannten Personen zu anonymisieren. Die Fallbeispiele wurden von mir deshalb ausgewählt, weil sie in ähnlicher Weise auch in vergleichbaren Schulen passiert sind oder an anderen Orten so hätten geschehen können.
Durch mein Buch sollen sich vor allem Pädagoginnen und Pädagogen angesprochen fühlen, die über den schulischen Tellerrand hinausschauen und sich für Bildungsgerechtigkeit einsetzen wollen. Ich möchte die Diskussion zu diesem Thema neu beleben. Diese Aufzeichnungen sind mein Beitrag dazu.
Darüber hinaus hoffe ich, mein Buch ist für alle Leserinnen und Leser eine interessante Lektüre - mit vielen Einblicken in ein besonderes „Stück Leben“ und in einen außergewöhnlichen Ort, mitten in einem großen deutschen Fluss. Das Buch soll Mut machen und Kraft geben, die Pädagogik auf den Elbinseln und in vergleichbaren Regionen weiter voranzutreiben.
Erstes Kapitel
Meine ersten zehn Jahre auf den Elbinseln
Mein Einstieg
Fast zehn Jahre lang hatte ich auf diesen Augenblick gewartet. Endlich stand ich im Sommer 1992 in einer Schule, einer Gesamtschule auf der zu Hamburg gehörenden Elbinsel Wilhelmsburg. Dort sollte ich als Lehrer, mit der Perspektive einer Festanstellung, arbeiten.
In den Jahren zuvor war es aussichtslos gewesen, in Deutschland eine Festanstellung als Lehrer zu bekommen. Nach meinem zweiten Staatsexamen als Gymnasiallehrer für Mathematik und Sport hatte ich daher seit Beginn der 1980er-Jahre meinen Lebensunterhalt als LKW-Fahrer, Nachhilfelehrer und als Entwicklungshelfer in Simbabwe sowie als Sozialbetreuer in einem Hamburger Sportverein verdient. Nebenher hatte ich auf Reisen in verschiedene Länder und Kontinente der Welt vielfältige Erfahrungen mit anderen Kulturen gesammelt. Meine Talente und meine Beschäftigung als Artist und Zauberkünstler versuchte ich zusätzlich zu profe ssionalisieren.
In Hamburg lebte ich nun seit einigen Jahren, hatte mich immer wieder für den Schuldienst beworben, aber, wie viele andere, die Hoffnung eigentlich schon aufgegeben. In irgendeiner Liste in der Bildungsbehörde schien meine Bewerbung abgelegt und vergessen worden zu sein.
Im Winter 1991/92 bekam ich zum ersten Mal für ein paar Wochen an einer Wilhelmsburger Schule eine Schwangerschaftsvertretung für eine Mathe-Lerngruppe. Hauptamtlich arbeitete ich in einem Sportverein und organisierte Kursangebote für den Seniorensport, Kooperationsprojekte mit Schulen und Zirkusprojekte mit Kindern und Jugendlichen. Abends und am Wochenende trat ich als Zauberkünstler auf und verdiente so noch ein bisschen Geld hinzu.
Kurz vor den Sommerferien 1992, es war ein Freitagnachmittag, ich bereitete mich gerade auf einen Zauberauftritt am frühen Abend vor, rief mich gegen 16 Uhr völlig überraschend der Personalreferent der Bildungsbehörde in Hamburg an. Er fragte mich, ob ich umgehend an einer Schule vorbeigehen könne, um mich dort vorzustellen. Es gehe um eine Festanstellung als Lehrer. Wäre ich nicht zuhause gewesen, hätte er wahrscheinlich den nächsten Kandidaten auf seiner Liste kontaktiert. So telefonierte ich sofort mit der Schule und vereinbarte für den selben Abend um 20 Uhr „in der Aula“ einen Termin beim Schulleiter.
Ich absolvierte noch meinen Auftritt und fuhr anschließend direkt dort hin. Mein Outfit, weißes Hemd, gebügelte Faltenhose und legeres, schwarzes Jackett, schienen mir durchaus angemessen für das bevorstehende Bewerbungsgespräch.
Vor der Aula sah ich zunächst nur zwei muskelbepackte, südländisch wirkende junge Männer, die als Türsteher fungierten. Hinter der verschlossenen Tür tobte das Leben. Laute türkische Musik war zu hören, verbunden mit einem ohrenbetäubenden Gejohle. Ich fragte die Burschen nach dem Schulleiter. Nach wenigen Augenblicken kam er heraus, ein großer, vollbärtiger Mann in Jeans und Wollpulli, der mich kurz von oben bis unten musterte, mich dann aber freundlich begrüßte, indem er mir mit seiner Pranke kräftig die Hand drückte. Er führte mich in sein Büro.
Das Vorstellungsgespräch, auf das ich fast zehn Jahre lang gewartet hatte, dauerte keine zehn Minuten. Die erste und eigentlich einzig wichtige Frage von ihm lautete: „Traust DU dir das hier wirklich zu?“ Ich antwortete nach kurzem Zögern einfach mit „Ja“ und versuchte noch mit ein paar Worten mein Overdressing sowie meine Erfahrungen und Qualifikationen für einen solchen Job zu erklären. Nach einem kurzen skeptischen Blick gab er mir sein Okay. Ich solle am Montag im Schulbüro vorbeikommen, um die Formalitäten zu erledigen. Er müsse jetzt zurück zum Schülerfest, sonst könne das schnell aus dem Ruder laufen.
Nach den Sommerferien fing ich als fest angestellter Lehrer an einer Gesamtschule in Wilhelmsburg an. Ich habe dort bis heute ohne Unterbrechung fast drei Jahrzehnte lang gearbeitet.
Wilhelmsburg – ein abgeschriebener Stadtteil?
Wilhelmsburg ist eine Insel. Man sieht das daran, dass man immer über eine Brücke fährt … Und Wilhelmsburg gehört auch zu Hamburg.
Selina, Grundschülerin aus Wilhelmsburg, in Willipedia - Ein Elbinselführer
Kaum einer meiner Freunde und Bekannten kannte damals die Elbinseln oder wusste etwas Genaueres über Wilhelmsburg. Der Stadtteil lag für die meisten Hamburger „weit weg, südlich der Elbe“. Man fuhr zwar häufig über die Elbbrücken zur A1 in Richtung Hannover, ließ von der Autobahn her die große Hochhaussiedlung Kirchdorf-Süd hinter der Raststätte Stillhorn an sich vorbeiziehen und sah weitläufige Wiesen, einige Felder und viele Bäume. Aber dort zu arbeiten oder sogar zu leben war für alteingesessene Hamburger kaum vorstellbar.
Wilhelmsburg kannte man eigentlich nur durch Negativschlagzeilen aus der Presse, als den vorgelagerten „Müllhaufen“ der Hansestadt. Hier verliefen nebeneinander die großen Verkehrs-Trassen, die nach Hamburg hinein- und herausführten. Hier lebten vorwiegend Migranten und Menschen vom Rande der deutschen Gesellschaft. Wenn es einen Raub, Mord oder Drogendeal in Hamburg gab, dann schien dies meist in Wilhelmsburg zu passieren.
Doch wie ich sehr schnell wahrnahm, gab es ein buntes, lebhaftes und interessantes Alltagsleben, in der Schule, auf den Straßen und Märkten, mit einer Vielfalt von Menschen, Kulturen und Religionen, die ich so überhaupt noch nicht kannte. Und die Elbinseln waren so unterschiedlich strukturiert, wie ich es bis dahin auch noch nicht gesehen hatte. Der Bogen spannte sich von Hafenkais und Industrieanlagen über ein dörfliches Milieu, traditionsreiche Wohnviertel aus der Gründerzeit und Hochhaussiedlungen aus den 70er-Jahren bis hin zu Schrebergärten und kleinen Kanälen, Elbstränden und Naturschutzgebieten sowie Feldern, naturbelassenen Wäldchen und Pferdeweiden - eine Vielfalt, die für Nicht-Wilhelmsburger im Verborgenen schlummerte und die es nach und nach für mich zu entdecken galt.
Neben dieser Vielfalt gab es etwas Besonderes, Eigenes, selten direkt Ausgesprochenes, aber doch Wahrnehmbares: ein Zusammengehörigkeitsgefühl, das wohl auf die Insellage und das zeitweise „Vergessen- Worden-Sein“ zurückzuführen war.
Bei Veranstaltungen oder auch zufällig begegneten mir oft engagierte Wilhelmsburger, Alteingesessene und neu Hinzugekommene, Aktive im Stadtteil, die sich schon seit vielen Jahren für Wilhelmsburg und die Veddel als qualitätsvollen Ort des Wohnens, des Zusammenlebens und des Arbeitens einsetzten.
Und das musste man auch sehr engagiert und couragiert tun. Denn die Elbinseln waren über Jahrzehnte von den Hamburgern ignoriert und vom Senat abgeschrieben worden. Nach der Flutkatastrophe von 1962 hatte sich Wilhelmsburg immer mehr zu einem „sozialen Brennpunkt“ entwickelt. So nahmen zwangsläufig auch die Konflikte und zum Teil heftigen Auseinandersetzungen auf den Elbinseln zu. Immer wieder standen die Themen Umwelt (Müllberg und Müllverbrennungsanlage), Verkehr (Autobahnen, Gütertrassen, die Wilhelmsburger Reichsstraße), Wohnen (fehlender Wohnraum und verwahrloste Mietblocks), Freizeit (zu wenige Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schließung des Freibades, fehlendes Kino) und natürlich auch die Bildung (unzureichende Versorgung mit Kitaplätzen, schlechte Ausstattung der Schulen, unterdurchschnittliche Bildungserfolge) auf der Agenda.
Die Situation an den Wilhelmsburger Schulen war damals verheerend. Mitte der 1990er-Jahre erreichten meist um die 25% eines Jahrgangs keinen Schulabschluss oder brachen die Schullaufbahn vorzeitig ab. Das waren mehr als doppelt so viele wie im Hamburger Durchschnitt. Knapp ein Drittel der Schulabgänger erreichten einen Hauptschulabschluss, gut 10% das Abitur. Nur wenige fanden direkt nach der Schule einen Ausbildungsplatz.
Vor-Erfahrungen
… dass ich zur Elite gehören sollte, verstand ich nicht … Ich ahnte, dass es etwas mit meiner Haltung zu tun hatte … dass meine … fussligen grauen Oberteile nicht geeignet waren … dass mein Wohnort nicht geeignet war.
Deniz Ohde, Streulicht
Ich stamme selbst aus einem bildungsfernen Elternhaus. Mein Vater war Bäcker, meine Mutter Hausfrau, beide hatten nur acht Jahre lang die Schule besucht. Ich habe noch fünf Geschwister und musste sehr viel im elterlichen Kleinbetrieb mitarbeiten. Als Sohn eines Handwerkers ging man in den 1960er-/70er-Jahren auf die Haupt- oder Mittelschule, um in die Fußstapfen des Vaters zu treten. Mein damaliger Klassenlehrer in der Realschule sah das jedoch anders. Er förderte mich, sah in mir Potenziale für weiterführende Bildungswege und setzt sich dafür ein. Nur durch seine aktive Unterstützung konnte ich nach der Mittleren Reife die Oberstufe eines Gymnasiums besuchen. Dieses besondere Engagement meines Lehrers war ein prägender Impuls für meine Berufswahl und auch für meinen eigenen, späteren Einsatz für bildungsbenachteiligte Kinder.
Ich kann mich noch sehr genau daran erinnern, wie ich zum ersten Mal zum ehrwürdigen städtischen Gymnasium ging und dort von den „höheren” Söhnen und Töchtern der Ärzte, Rechtsanwälte und Unternehmer meines Heimatortes von oben herab und mit der in ihren Blicken liegenden Arroganz betrachtet wurde. Passte schon mein Äußeres nicht, so vermutete ich zudem, dass meine begrenzte Sprachfähigkeit und meine einfache Lebensweise auffallen würden. Zum Glück begleitete mich ein Freund aus der Realschulzeit ins Gymnasium. Uns beiden wurde dort nichts geschenkt. Wir mussten regelmäßig und hart arbeiten, um gute Leistungen zu erzielen. So brauchte es ein bis zwei Jahre, bis wir eine gewisse Anerkennung erlangten.
Nach dem Abitur und dem zu dieser Zeit noch verpflichtenden Grundwehrdienst fing ich an, Mathematik und Sport für das Höhere Lehramt in Göttingen zu studieren. So schön das Sportstudium und so frei die Studentenzeit insgesamt auch ablief, das Mathematikstudium war extrem belastend und anspruchsvoll - und auch hier konnte ich nur gemeinsam mit Freunden, mit viel Fleiß und Disziplin, am Ende einen guten Abschluss erreichen. Nebenbei engagierte ich mich über viele Jahre im Fachschaftsrat Sport. Während dieser Zeit suchten wir bereits Alternativen zum Wettkampf- und Leistungssport. Ich sammelte erste Erfahrungen mit Akrobatik und Jonglage und schrieb meine Examensarbeit über den Beitrag des außerschulischen Sports zur gesellschaftlichen Emanzipation. Nach der erfolgreichen Lehrerausbildung, als es fast ein Jahrzehnt lang keine freien Lehrerstellen in ganz Deutschland gab, hatte ich, aus heutiger Sicht, das Glück, viele Tätigkeiten auszuüben, die mir später als Lehrer sehr halfen: Ich lernte in Fabriken, als LKW-Fahrer und auf Baustellen, also außerhalb eines akademischen und pädagogischen Milieus, mit sehr unterschiedlichen Menschen zusammenzuarbeiten.
Auch meine Erlebnisse auf den Reisen durch die halbe Welt, besonders in lateinamerikanische und arabische Länder, nach Iran und Afghanistan, prägten mich und halfen mir sehr, mit der kulturellen Vielfalt und meinen diversen Aufgabenfeldern an der Schule in Wilhelmsburg umzugehen. Als Zauberkünstler und Artist konnte ich nicht nur im Sportunterricht und bei Vertretungsstunden glänzen, sondern schon sehr bald eine Zirkusprojektwoche für die Grundschule organisieren und direkt anschließend mit meiner ersten eigenen Klasse den „Zirkus Willibald“ starten.
Als Lehrer in Simbabwe
Eine weitere entscheidende Prägung für meine spätere Arbeit in Wilhelmsburg erfuhr ich durch meine mehrjährige Tätigkeit als Entwicklungshelfer in Simbabwe im südlichen Afrika, die ich an dieser Stelle noch etwas ausführlicher beschreiben möchte.
„Ishe kumborera Afrika”. Dieses „Gott segne Afrika” war der Beginn der damaligen simbabwischen Nationalhymne, die jeden Morgen vor Unterrichtsbeginn bei der Schulversammlung von allen aus tiefstem Herzen gesungen wurde.
Ich hatte mich beim Deutschen Entwicklungsdienst (DED) beworben, der mich Mitte der 1980er-Jahre als Lehrer nach Simbabwe entsandte. Dort unterrichtete ich mehr als zwei Jahre lang Mathematik in den Abschlussklassen in einer ländlichen Sekundarschule mit etwa 600 Schülern. Die Schule lag rund 150 km von der Hauptstadt Harare entfernt, im Norden des Landes, kurz vor dem Sambesi-Tal.
Die ehemalige Missionsschule befand sich irgendwo im Nirgendwo in den so genannten Rural Areas, den von „Schwarzen” besiedelten, landwirtschaftlich schwer zu bewirtschaftenden Regionen des Landes. Von der Hauptstadt aus fuhr ich mit meinem kleinen Motorrad Richtung Norden zunächst auf breiten, gut geteerten Straßen. Irgendwann wurde die Straße einspurig, ging in eine „Gravelroad” über, auf der ich noch eine halbe Stunde lang fahren musste, um schließlich ohne jedes Hinweisschild nach links in eine „Dustroad” abzubiegen, die nach vielen weiteren Kilometern zur Magwenya Secundary School führte.
Simbabwe war damals noch ein aufstrebendes Land, mit einer Vorbildfunktion für das unter der Apartheid regierte Südafrika. Ich traf dort auf viele Menschen, die ihr Land vorwärts bringen wollten, die sich am Aufbau dieser jungen Demokratie beteiligten. Alle sahen in der Bildung den Schlüssel für die Entwicklung des ganzen Landes. Und ich wurde aufs Herzlichste eingeladen dabei mitzumachen.
Ich lebte unter sehr einfachen Bedingungen, in einem kleinen Häuschen mit Wellblechdach, Plumpsklo vor der Tür, ohne fließendes Wasser und Strom. Ich war im Umkreis von fünfzig Kilometern der einzige Weiße, der mit den Schwarzen eng zusammenlebte und als „normaler” Lehrer dort arbeitete.
Das Schulsystem, sehr autoritär und angegliedert an das britische Bildungs- und Prüfungswesen, war auf den strikt festgelegten und vorgegebenen Lernstoff der vorwiegend akademischen Fächer und die englischen/internationalen Cambridge-Prüfungen ausgerichtet. Neben der meist umgangssprachlich verwandten Landessprache Shona war Englisch die offizielle und auch die Unterrichts-Sprache. Die meisten Schüler lebten in den umliegenden Dörfern oder Compounds, meist kleinen Ansiedlungen aus Strohhütten. Die Eltern waren einfache Bauern. Täglich legten die Schüler morgens und am Spätnachmittag bis zu 10 km Fußmarsch - ob bei Tropenregen oder, meistens, bei trockener Hitze - zurück.
Nach der täglichen „Assembly”, der Schulversammlung mit Nationalhymne und den obligatorischen Ankündigungen des Schulleiters, ging es in die Klassen. Diese bestanden aus einfachen, weiß getünchten Räumen, manchmal sogar ohne Dach, ausgestattet mit zu wenigen, kleinen Sitzbänken und Pulten. Dort mussten die Kinder und Jugendlichen bis zu acht Unterrichtsstunden, den ganzen Tag lang, zu dritt oder viert sitzen, in den Prüfungszeiten sogar häufig auf dem blanken Boden, mit über vierzig anderen Schülern pro Klasse, bei einer Tagestemperatur von bis zu 40°C.
Neben den akademischen Fächern gab es am Anfang nur das Fach Landwirtschaft als so genanntes Praktisches Fach. Die einzige Abwechslung des sehr langen und streng geregelten Unterrichtsalltags waren die „Clubs“: Mittwochs ging der Unterricht nur bis zum Mittag, und am Nachmittag fanden diese Clubs in Verbindung mit dem Sport- und Kulturprogramm oder Wettkämpfen statt. Ich bekam zum ersten Mal die Möglichkeit, in diesem Bereich vielfältige Erfahrungen sammeln zu dürfen. Dabei wurde mir die Bedeutung dieser extracurricularen - und über die Schule hinausgehenden - Aktivitäten für die Entwicklung der Kinder und Jugendlichen bewusst.
Bis heute empfinde ich diese Zeit als die prägendste und spannendste Phase meines beruflichen Lebens. Was war das Besondere an meiner Arbeit als Lehrer in Afrika, an dieser Zeit insgesamt? Warum machte es mir große Freude und brachte mir Genugtuung, mit fast unendlicher Energie und immer mehr Leidenschaft diesen aus dörflichen Strukturen und ärmsten Verhältnissen kommenden Schülern zu helfen?
Trotz der äußerst harten Bedingungen traf ich fast durchgängig auf lernbegierige, offene und engagierte junge Menschen, die immer bemüht waren, ihr Bestes zu geben. Sie sahen in der Schule, im Unterricht und bei den Clubaktivitäten eine Chance, die sie nutzen wollten. Für sie waren Lernen und Erfahrungen sammeln, Bildung im weitesten Sinne, ein Privileg. Gute Abschlüsse waren für sie die einzige Möglichkeit, dem kargen Leben auf dem Lande und den ärmlichen Verhältnissen zu entrinnen. Heute noch erinnere ich mich mit großem Respekt an das Durchhaltevermögen der Schüler, ihren Fleiß und ihre Disziplin im Schulalltag. An das Erdulden von Widrigkeiten, wie die Hitze, das stundenlange Warten auf einen „Transport” und die täglichen kilometerlangen Fußmärsche. Und mit größter Freude denke ich an das offene Lachen, die Lebendigkeit, die Energie und auch den Respekt mir gegenüber sowie die Hilfsbereitschaft und die Freundlichkeit der Schüler zurück.
So gelang es trotz der harten Bedingungen vielen Schülern, einen guten Schulabschluss zu erreichen. Und ich durfte eine ganze Reihe von jungen Menschen in Simbabwe bei diesem schwierigen Weg unterstützen.
Nach meiner Rückkehr nach Deutschland zum Ende der 1980er-Jahre ging ich nach Hamburg und bekam eine befristete Stelle als „Sozialbetreuer“ in einem Sportverein. Mein Schwerpunkt sollte im Aufbau von Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche liegen. In diesem Rahmen startete ich meine ersten Jonglier- und Akrobatikkurse sowie regelmäßige Zirkusprojekte mit abschließenden großen Zirkusaufführungen und einer einwöchigen Zirkusfahrt mit Pferd und selbst bemalten Zirkuswagen durch den Landkreis. Diese Fahrt wurde für alle Beteiligten ein unvergessliches Erlebnis. Die meisten Kinder hatten so etwas noch nicht erlebt. Viele wirkten danach viel selbstbewusster - und das Erlebnis schweißte uns noch lange Zeit zusammen.
Diese Projekte sowie die damit verbundenen Organisations- und Kooperationserfahrungen halfen mir danach als Lehrer sehr dabei, aus der Schule herauszugehen und mit anderen Einrichtungen, wie Häusern der Jugend oder lokalen Turnvereinen zusammenzuarbeiten.
Gute Voraussetzungen
Im Grunde genommen gab es für mich zwei besonders gute persönliche Voraussetzungen für meine Arbeit als Lehrer in Wilhelmsburg: Die erste war meine Vergangenheit, mein eigener bildungsferner Hintergrund als Kind. Ich musste mich damals selbst gegen viele Widerstände „durchboxen“ und konnte so das soziale Umfeld und die damit verbundenen Schwierigkeiten der Schüler in Wilhelmsburg sehr gut nachvollziehen. Der zweite Vorteil war, dass ich eine Menge anderer Arbeitsbereiche kennengelernt und auf meinen langen Reisen und Auslandsaufenthalten viele Erfahrungen im realen Leben außerhalb der Schule gesammelt hatte. Sie konnte ich nun nutzen.
Als ich in Wilhelmsburg begann, war ich kein ganz junger Lehrer mehr. Trotzdem fühlte ich mich als der richtige Mann an der richtigen Stelle - und so machte ich mich auf den Weg. Ich startete neben dem Unterricht mit zunehmender Intensität fachübergreifende Projekte, Ausflüge und Fahrten, meist in Verbindung mit Zirkusaktivitäten - immer auch außerhalb der Schule und möglichst nah am realen Leben.
Die ersten Jahre in der Schule
Wie geht man vor, um sich das Fremde zum Freund zu machen? Man geht. Macht sich auf den Weg.
Ulla Hahn, Spiel der Zeit
Fast zehn Jahre nach dem Abschluss meiner Lehrerausbildung war ich nun an einer besonderen deutschen Schule angekommen. Die ersten Wochen als Lehrer waren spannend. Vieles war zunächst fremd, auch sehr belastend. Lange hatte ich in Deutschland nicht mehr in einer Schule unterrichtet, und noch nie in einem sozialen Brennpunkt einer Großstadt. An der Universität in Göttingen und im Referendariat im gutbürgerlichen Umfeld einer hessischen Kleinstadt war ich auf dieses spezielle Milieu nicht vorbereitet worden.
Anfangs fand ich keine angemessene Form, in den Unterrichtsstunden wirklich das geforderte Wissen zu vermitteln. Meist war ich froh, eine Stunde und einen Schultag halbwegs vernünftig hinter mich gebracht zu haben. An den Abenden und Wochenenden war ich so ausgelaugt, dass ich kaum noch anderen Aktivitäten nachgehen konnte. Auch fiel es mir sehr schwer, über den normalen Unterricht an die Schüler heranzukommen. Ich stellte aber schnell fest, dass mir dies relativ leicht beim Sport und in den eher informellen Bereichen, besonders bei den Freizeitaktivitäten und später verstärkt als Klassenlehrer, gelang.
Ich mochte die Kinder und Jugendlichen einzeln, zunächst aber nicht unbedingt als Lerngruppe. Mir gefiel ihre lebendige Art, das „Südländische“, das damals vorwiegend türkische Flair. Vor allem aber spürte ich etwas Unbekanntes auf mich zukommen. Ich merkte, dass ich mich an eine neue, interessante und auch sinnvolle Aufgabe herantasten durfte. Dabei rutschte ich in ein tolles Kollegium hinein. Die Schulleitung war offen und half, wo es nur ging. Sehr bald erkannte ich, dass ich auf meinen vielfältigen Vor-Erfahrungen aufbauen und diese immer mehr einbringen konnte.
In diesen ersten Jahren war ich neugierig, ging mit unendlicher Energie an die Arbeit heran, erkundete das schulische Umfeld, sammelte viele neue Erfahrungen und versuchte nach und nach, einen Überblick zu gewinnen. Ich sah dabei fast nur die positiven Seiten meiner Schule und meines Berufs: Zum einen das Glück, in einem offenen und engagierten Kollegium arbeiten zu dürfen. Man war sehr freundlich zueinander, sprach ohne Vorbehalte auch über die Probleme bei der Arbeit und unterstützte sich gegenseitig. Zum anderen das gute Gefühl, eng mit einer an Beteiligung interessierten Schulleitung kooperieren zu dürfen. Ich konnte von Anfang an an der Entwicklung eines neuen Schulprogramms mitarbeiten, meine Ideen einbringen und die gemeinsamen Vorstellungen in einer aufstrebenden Gesamtschule mit viel Unterstützung und wenigen Einschränkungen umsetzen.
Wir alle sahen uns eingebunden in die Tradition humanistischer und emanzipatorischer Erziehung, wollten die Schülerinnen und Schüler zur aktiven Teilnahme an der Gesellschaft befähigen und auch auf das Arbeitsleben vorbereiten. Ich sah den Lehrerberuf damals noch als einen „freien Beruf“ an, bei dem ich die methodischen, fachlichen und pädagogischen Entscheidungen im Wesentlichen aus meinen eigenen Erfahrungen heraus und aus meiner konkreten, persönlichen Sicht treffen konnte. Letztlich wurde nicht sehr vieles von oben verpflichtend vorgegeben, und die „neue Lernkultur” hielt zunächst nur in kleinen Portionen Einzug in den alltäglichen Unterricht. Es war uns immer wichtig, die Schüler und Eltern mit ins pädagogische Boot zu nehmen, die Schule in den Stadtteil zu öffnen und außerschulische Lernorte mit einzubeziehen.
Wir hatten in der Regel nicht sehr große Klassen mit maximal fünfundzwanzig Schülern, die wir immer im Doppeltutoriat leiteten, meist mit einer Frau und einem Mann. Auch die Stundenpläne wurden so weit wie möglich mit den KollegInnen und den Jahrgängen abgestimmt. Die Schule war überschaubar, mit vier parallelen Klassen in einem Jahrgang. Sie war nach den in Gesamtschulen damals gängigen Prinzipien mit einem offenen Ganztagskonzept einigermaßen klar strukturiert. Jeder Schüler konnte seinen Leistungsfähigkeiten und Möglichkeiten entsprechend ab Jahrgang 6 oder 7 auf Basis- oder erweitertem Niveaus in I-er oder II-er-Kursen lernen und jedes Halbjahr auf-, aber natürlich auch absteigen. Zudem konnte man, seinen Interessen folgend, verschiedene Wahlpflichtfächer aussuchen.
Die Schulleitung war kooperativ und in der Regel verständnisvoll. Auf den Jahrgangs- und Gesamtkonferenzen wurde zwar solidarisch, aber immer offen, wenn nötig konfrontativ argumentiert und für die besten inhaltlichen Lösungen gestritten. Dies alles war möglich, weil uns ein gemeinsames Ziel verband, nämlich uns für unsere vorwiegend bildungsfernen, sozial benachteiligten SchülerInnen einzusetzen. Wir wollten ihnen bessere Chancen bieten und das auf der Grundlage einer engen Verbundenheit. All das reflektierten wir über einige Jahre in einer festen Arbeitsgruppe zur Organisationsentwicklung der Schule und schrieben es in einem Schulprogramm zusammen, das für lange Zeit die Grundlage unserer erfolgreichen pädagogischen Arbeit war.