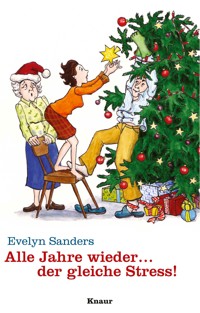6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Als sie sich als Reiseleiterin an der Riviera bewarb, hatte sich Tina eigentlich weniger Arbeit und mehr Ferien vorgestellt. Die deutschen Touristen aber entpuppen sich als verdrossene Meckerer, und Tinas wunderschöne Kollegin flirtet lieber, als ihr helfend zur Hand zu gehen. Da erbarmt sich der Schürzen-jäger Sergio und organisiert mit Tina eine Eselsafari. Doch die meisten Esel sprechen deutsch ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 447
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Evelyn Sanders
Bitte Einzelzimmer mit Bad
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Inhaltsübersicht
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 1
Das Telefon klingelte.
Ohne vom Kreuzworträtsel aufzusehen tastete Sabine nach dem Hörer und nahm ihn ab. »Redaktion Tageblatt, guten Tag.«
Barbara, die am gegenüberliegenden Schreibtisch in einer Illustrierten blätterte, schüttelte den Kopf und deutete auf das blinkende rote Lämpchen. »Ist doch die Hausleitung, du Schlafmütze! Lernst du das nie?«
Prompt tönte Sabine in den Hörer: »Bollmann.« Dann nickte sie, deckte mit der Hand die Sprechmuschel ab. »Der Alte will dich sehen. Bist du noch da?«
Barbara warf einen Blick auf ihre Armbanduhr. »Erst dreiviertel sechs, also muß ich wohl noch da sein.«
»Sie kommt gleich!« Sabine legte den Hörer auf und vertiefte sich wieder in ihr Rätsel.
»Warum muß der seinen schöpferischen Augenblick immer kurz vor Feierabend haben?« Barbara suchte ihren Stenogrammblock, durchwühlte Korrekturfahnen und Manuskripte, fand aber lediglich den Pik-Buben aus Peter Gerlachs Kartenspiel, den dieser seit seiner letzten Vorführung vermißte. Gelegentlich versuchte sich der Gerichtsreporter an Zauberkunststückchen, die ihm aber nur selten gelangen.
»Im Papierkorb ist er auch nicht. Ich müßte wirklich mal aufräumen! Gib mir schnell deinen!«
Wortlos schob ihr Sabine den Stenoblock zu. »Weißt du, wie der griechische Gott des Weines heißt?«
»Bacchus.«
»Quatsch, das ist der römische. Du solltest endlich mal was für deine Bildung tun! Und jetzt trab’ ab, sonst kreuzt der Sperling noch selber hier auf!«
Barbara griff nach dem Block, blätterte ihn kurz durch und meinte zweifelnd: »Nur noch acht leere Blätter. Hoffentlich reichen die. Das letzte Mal hat er mir vierzehn Seiten diktiert, und davon sind bestenfalls fünf gedruckt worden. Was is’n heute als Aufmacher dran? Ölkrise, Anarchisten oder Gewerkschaftsbund?«
»Wie kann man als Redaktionssekretärin an tagespolitischen Ereignissen nur so desinteressiert sein?« Mißbilligend betrat Willibald Dahms, der Ressortleiter für Sport, den Raum. »Heute abend findet das Qualifikationsspiel zur Europameisterschaft statt, und da nach der letzten Meinungsumfrage achtunddreißig Prozent unserer Leser die Zeitung lediglich wegen ihres ausgezeichneten Sportteils abonniert haben, wird sich der heutige Aufmacher natürlich mit Fußball befassen. Fräulein Pabst, ich möchte Ihnen schon vorab die Einleitung diktieren …«
»Kann nicht, muß zum Chef!« Barbara stöckelte zur Tür. »Das gibt sowieso wieder anderthalb Überstunden. Aber dafür gehe ich morgen früh gleich zum Friseur. Offiziell bin ich dann natürlich in der Landesbibliothek, vorbestellte Bücher für Dr. Laritz abholen.«
Sabine nickte. Die Bücherei diente seit jeher als Alibi, wenn eine von ihnen etwas Privates erledigen wollte.
Während Barbara im Zimmer des Chefredakteurs saß und mit gottergebener Miene dessen Meinung zu den desolaten Auswirkungen der neuen Bildungspolitik zu Papier brachte, stieg ein sommersprossiger Jüngling in den Fahrstuhl des Pressehauses, drückte den Knopf zum sechsten Stockwerk und memorierte noch einmal die Rede, die er sich auf dem Weg hierher zurechtgelegt hatte. »Liebes Schwesterchen«, würde er sagen, »auch du bist einmal Schülerin der elften Klasse gewesen, weißt also, daß man am Fünfundzwanzigsten kein Taschengeld mehr hat und …«
Der Fahrstuhl hielt. Karsten stieg aus und steuerte zielsicher die Glastür mit der Aufschrift »edaktion« an. (Das ›R‹ fehlte schon seit über einem Jahr.) Forsch drückte er auf die Klinke und trat ein. »Guten Abend, liebes …«
Verdutzt sah er Barbaras leeren Schreibtisch. »Ist Tinchen denn nicht mehr da?«
»Wer soll das sein?«
»Tinchen? Äh, ich meine natürlich Fräulein Pabst, ich bin nämlich ihr Bruder«, fügte er erklärend hinzu.
»Seit wann heißt Barbara denn Tinchen?« erkundigte sich Sabine mäßig interessiert.
»Seit ihrer Geburt. Barbara ist bloß ihr zweiter Name. Aber das soll keiner wissen.«
»Nun wissen es aber schon eine ganze Menge.« Sabine deutete in den Hintergrund, wo an mehreren Schreibmaschinen Reporter in den verschiedensten Stadien der Auflösung hockten, an Krawattenknoten zerrten, Bleistifte zerkauten und versuchten, ihre während des Tages gesammelten Eindrücke in den vorgeschriebenen zwanzig Zeilen zusammenzufassen. Eine dicke Wolke Zigarettenqualms hing über der Szenerie.
»Barbara hockt beim Chef. Wenn du willst, kannst du ja warten.«
Karsten beschloß, das diskriminierende ›Du‹ zu überhören, das ihm für seine gerade 18 Jahre denkbar unangemessen erschien, und setzte sich auf einen der Hocker.
»Nimm lieber einen anderen! Der da wackelt und ist nur für Leute gedacht, die sich beschweren wollen. Normale Besucher kriegen den grünen Stuhl da hinten. Bei dem wackelt bloß die Lehne.«
Suchend sah sich Karsten um. »Da ist aber kein Stuhl.«
»Dann hat ihn wieder jemand geklaut.« Sie zuckte mit den Schultern. »Setz dich auf den Schreibtisch. Weißt du übrigens, wie der griechische Gott des Weines heißt?«
»Dionysos.«
»Kluges Köpfchen!« Sie trug die Buchstaben ein. »Jetzt fehlt mir noch ein Fluß in Südostasien. Fängt mit M an.«
»Mekong oder Menam.« Interessiert beobachtete Karsten sein Gegenüber. »Gehört das auch zu Ihrer Arbeit?«
»Nicht unbedingt, ist mehr eine Art Beschäftigungstherapie. Bei einer Tageszeitung geht der Rummel erst abends los, trotzdem muß jemand Telefonwache schieben, Kaffee kochen, Rasierapparat und Aspirin für übernächtigte Reporter bereithalten, Manuskripte suchen und Blitzableiter spielen. Ein sehr vielseitiger Job, aber ein miserabel bezahlter!«
»Tinchen macht er Spaß.«
»Kunststück, die darf ja auch manchmal schöpferisch tätig sein, Filmkritiken schreiben und sogar selbständig die Post für unseren Kulturpapst erledigen. Dr. Laritz behauptet sogar, sie könne das besser als er selber. Der Mekong stimmt übrigens nicht. Gibt es noch einen anderen Fluß mit M?«
»Ja, den Mississippi!« Karsten vertiefte sich in eine der herumliegenden Zeitungen.
»Fließt denn der in Asien?«
Eine Zeitlang hörte man nur das Klappern der Schreibmaschinen, gelegentlich unterbrochen von einem unterdrückten Fluch oder dem Klirren einer Kaffeetasse. Dann tauchte Waldemar auf, der rothaarige Redaktionsbote, der eine Druckerlehre anstrebte und gemäß den Gepflogenheiten des Hauses zunächst einmal als Laufbursche tätig war. Zielsicher durchpflügte er die Rauchschwaden und steuerte den hintersten Schreibtisch an.
»Herr Müller-Menkert braucht den Bericht über die Karnevalsfeier bei den Monheimer Mostertköppen, Herr Flox, und warum der noch nicht in der Setzerei ist!«
»Herr Müller-Menkert kann mich mal!« Florian Bender drückte seine Zigarette in dem überdimensionalen Deckel aus, der einst einen Eimer mit Delikateßgurken verschlossen hatte und nunmehr seine Funktion als Aschenbecher erfüllte.
»Soll ich ihm das wörtlich bestellen?« feixte Waldemar.
»Du kriegst das glatt fertig! Sag’ deinem Herrn und Meister, daß meine aufopferungsvolle Tätigkeit im Dienste der Zeitung nicht nur das Ressort Lokales umfaßt, sondern daß ich darüber hinaus auch gelegentlich den Musen huldige und derzeit eine Eloge über die Neuinszenierung der ›Minna von Barnhelm‹ verfasse. Was kümmert mich profanes Narrentreiben, wenn hehre Dichtkunst mich bewegt?«
»Was?«
»Hau ab, du Kulturbanause! Der Artikel über die Helau-Brüder ist frühestens in einer Stunde fertig. Mehr als fünfzehn Zeilen springen sowieso nicht heraus. Die waren genauso besoffen wie im vergangenen Jahr und in den Jahren davor. Der einzige Unterschied besteht darin, daß sie jetzt arriviert sind und Sekt trinken statt Bier. Und dann merk’ dir endlich, Knabe, daß ich nicht Flox heiße, sondern Bender! Flox ist nur mein Künstlername.«
»Klingt eigentlich mehr nach Hundefutter«, bemerkte Waldemar respektlos.
»Quatsch! Ich heiße Florian und mit zweitem Namen Xylander. Mein alter Herr ist Archäologe und hat’s mit den ollen Griechen. Wenn es nach ihm gegangen wäre, hätte ich auch studieren und später irgendwelche Fossilien ausgraben müssen, aber in den geschichtsträchtigen Ländern ist es mir einfach zu heiß. Außerdem ist mein Bruder in seine Fußstapfen getreten! Der hat sich ja auch bereitwillig durchs humanistische Gymnasium prügeln lassen und später mit summa cum laude promoviert, während es bei mir nur zu einem Dreier-Abitur gelangt hat.«
»Und jetzt buddelt er Mumien aus?«
»Nee, er sortiert Scherben und klebt sie zusammen. Das schaffe ich auch ohne Studium. Der Deckel meiner Kaffeekanne hält schon seit zwei Jahren. – Und jetzt verschwinde endlich, ich muß arbeiten!« Florian hämmerte erneut in die Tasten.
»Eine Frage habe ich noch!« Waldemar ließ sich von dem vorgetäuschten Arbeitseifer nicht beeindrucken. »Hat Ihr Bruder auch so’n komischen Namen?«
»Der heißt so, wie er ist, nämlich FaDe – Fabian Demosthenes. Stell dir bloß mal vor, der müßte seine Artikel auch mit den Initialen abzeichnen. Kein Mensch würde die lesen!«
»Glauben Sie denn, Ihre liest jemand?« fragte Waldemar, bevor er im Eilschritt den Rückzug antrat. Vor der Tür stieß er mit Barbara zusammen, die maulend ihren Stenoblock durchblätterte. »Elf Seiten lang hat der Alte über Bildungsnotstand und Schulreform gefaselt, und zum Schluß wollte er von mir wissen, ob ich Ovid im Originaltext gelesen hätte. Als ob ich in der Schule Griechisch gelernt hätte …«
»Ovid war ein Römer und sprach Latein!« bemerkte Karsten vorwurfsvoll.
Barbaras Kopf flog herum. »Was machst du denn hier?«
»Och, ich war gerade in der Nähe, und da habe ich gedacht, ich könnte dich doch nach Hause bringen.«
»Kannst du deine Karre nicht alleine schieben?« Barbara setzte sich an ihren Schreibtisch, fischte Manuskriptpapier aus der Schublade und versuchte stirnrunzelnd, ihr Stenogramm zu entziffern.
»Seitdem ich eine neue Zündkerze drin habe, läuft der Roller wieder tadellos«, entrüstete sich Karsten. »Bloß der linke Blinker funktioniert noch nicht; aber wir müssen ja sowieso nur rechts abbiegen.«
»Vielen Dank, ich nehme lieber den Bus. Außerdem muß ich erst die geistigen Höhenflüge unseres Ayatollahs abtippen, und das dauert noch eine Weile. Fahr lieber nach Hause und pauke Latein! Das schiebst du schon seit drei Tagen vor dir her.«
»Die Arbeit schreiben wir erst übermorgen, und eigentlich wollte ich dich ja auch nur anpumpen. Mein Taschengeld liegt doch weit unter dem Durchschnittseinkommen meiner Kumpel, bloß Vati will das nicht einsehen. Nun gibt es im Roxy den tollen Science-fiction-Film, da wollen wir heute rein. Ich bin aber total pleite. Hab’ gestern sogar meine letzte Zigarette geraucht!«
»Deine vielleicht, aber an meinen hast du kräftig drangesessen.« Barbara schob ihrem Bruder eine halbvolle Packung über den Tisch. »Nimm sie und verschwinde! Ich habe zu tun!«
»Und das Kinogeld?«
Sie schüttelte den Kopf. »Gibt es nicht!«
»Nun sei nicht so geizig, Tinchen, schließlich warst du doch auch mal jung!«
»Wirst du wohl sofort den Mund halten!« zischte Barbara leise, »diesen albernen Namen kennt doch hier niemand.«
»Entweder du rückst jetzt zehn Mark raus, Tinchen, oder …«
»Oder was ist mit Tinchen?« Unbemerkt war Florian an den Schreibtisch getreten. Sichtlich erheitert musterte er den schlaksigen Jüngling. »Wenn ich dir jetzt die zehn Mark nicht nur pumpe, sondern sogar schenke, verrätst du mir dann, was es mit dem geheimnisvollen Tinchen auf sich hat?«
Entsetzt sah Barbara von ihrer Maschine hoch. »Wehe, wenn du den Mund aufmachst!«
Karsten schielte sehnsüchtig auf den Geldschein, mit dem Florian so verlockend vor seinem Gesicht wedelte. Schließlich griff er danach und meinte entschuldigend: »Jeder ist sich selbst der Nächste, und Egoismus ist ja auch bei dir eine sehr ausgeprägte Tugend! Also: Meine Schwester, die vor siebenundzwanzig Jahren als Tochter des Uhrmachermeisters Ernst Pabst geboren wurde, sollte ein Junge werden und die Dynastie der Päbste als Ernst der Vierte fortsetzen. Entgegen der Familientradition wurde sie bloß ein Mädchen, worauf ihr Vater seinen Kummer in Schwarzwälder Kirschwasser ersäufte. Als er wieder nüchtern war, beschloß er – wohl aus Rache! –, seine Tochter auf den wohlklingenden Namen Ernestine taufen zu lassen. Später nannte er sie dann Tinchen. Da mein Erscheinen damals weder voraussehbar noch geplant gewesen war, kam ich in den Genuß eines neuzeitlicheren Namens, wofür ich meiner Schwester zu lebenslangem Dank verpflichtet bin.«
»Du bist ein ekelhaftes Waschweib!« giftete Barbara, griff nach dem erstbesten Gegenstand, der ihr in die Hände kam, und schleuderte ihn in Karstens Richtung. Leider handelte es sich dabei um eine Kaffeetasse, und leider verfehlte sie ihr Ziel. Sie schoß vielmehr haarscharf an Florians Kopf vorbei und landete im redaktionseigenen Gummibaum, der an solche Behandlung nicht gewöhnt war und zwei Blätter abwarf. Nun waren es nur noch acht, was bei einer Stammlänge von 1,37 m nicht eben viel ist.
»Volltreffer!« rief Florian. »Morgen veranstaltet Frau Fischer wieder ein Staatsbegräbnis.«
Frau Fischer gehörte zum Ressort ›Reise und Erholung‹, das keine eigene Kaffeemaschine besaß und deshalb regelmäßig im Sekretariat nassauerte. Als Entgelt wurde der herrenlose Gummibaum zweimal wöchentlich von Frau Fischer bewässert und von vorschriftswidrigen Düngergaben wie Zigarettenkippen, Streichhölzern und zerknülltem Kohlepapier befreit. Dafür produzierte das Gewächs jeden Monat ein neues Blatt und verlor zwei alte.
Bevor seine Schwester zu noch massiveren Wurfgeschossen übergehen würde, von denen vielleicht doch mal eins treffen könnte, hatte sich Karsten verkrümelt. Verbissen hämmerte Barbara auf ihrer Maschine herum und bemühte sich vergeblich, alle Anzüglichkeiten zu überhören.
»Liebe Ernestine alias Barbara Pabst«, dozierte Florian, »einem bedauerlichen Irrtum zufolge reden wir dich seit zweieinhalb Jahren mit einem Namen an, der kraft deutscher Gesetzgebung lediglich für Standesbeamte und Sachbearbeiter behördlicher Fragebogen Gültigkeit hat. Mit sofortiger Wirkung wird der Name Barbara aus den Annalen der Redaktion gestrichen und durch den gesetzlich verbrieften Taufnamen Ernestine ersetzt!« Er winkte seinem gummikauenden Kollegen zu: »Gerlach, eine Taufe geht bekanntlich niemals trocken über die Bühne. Rück mal deine Wodkapulle raus, die du in der Ablage versteckt hast!«
Der so Angesprochene sah nicht einmal auf. »Erstens ist das Gin, und zweitens gehört mir die Flasche gar nicht.«
»Woher weißt du dann, was drin ist?«
»Die hat der Uhu dort versteckt!« Sabine zog einen Ordner aus dem Regal.
»L gleich Labsal, wie passend!« bemerkte Florian. »Wenn der Uhu heute noch aufkreuzen sollte, dann sagt ihm, ich hätte sein proletarisches Gesöff für eine rituelle Handlung gebraucht. Im übrigen schuldet er mir schon seit Pfingsten zwanzig Mark. Jetzt sind es bloß noch zehn.«
Edwin Kautz, genannt Uhu, war freier Mitarbeiter und erschien nur gelegentlich in den Redaktionsräumen. Nur im Sommer sah man ihn häufiger, weil er die Sparte ›Unser Kleingarten‹ betreute und berechtigte Zweifel hegte, daß man in der Setzerei seine handgeschriebenen Manuskripte auch richtig entziffern würde. Den empörten Leserbrief eines Gärtnermeisters im Ruhestand, der sich drei Seiten lang darüber aufgeregt hatte, daß die Pulchella Pallida den Herbstblühern zugeordnet worden war, wo es sieh doch einwandfrei um eine Tulpe und somit um eine Frühjahrspflanze handelte, hatte der Uhu wochenlang mit sich herumgetragen und jedem Interessierten oder auch nicht Interessierten als Beweis für die Unfähigkeit der Setzer vorgewiesen. »Jeder normale Mensch kann sich doch denken, daß man im Frühling nichts über Blumen schreibt, die im Herbst blühen«, hatte er sich beim Chefredakteur beschwert und für die Zukunft einen Korrektor gefordert, der Fachkenntnisse besäße oder zumindest Hobbygärtner sei. Leider gab es nur einen, und der züchtete Kakteen. Deshalb zog es Edwin Kautz vor, die Korrekturabzüge seiner Abhandlungen nunmehr eigenhändig zu redigieren.
»Wo sind Gläser?« fragte Florian, während er die Flasche aufschraubte.
»Die beiden letzten sind vorgestern kaputtgegangen, als Gerlach uns die Methoden des Bombenlegers vom Hindenburgplatz demonstrieren wollte«, sagte Sabine, »aber wir haben noch genügend Kaffeetassen!«
»Ich hab’ zwar schon mal Cointreau aus Biergläsern getrunken, aber Gin aus Kaffeetassen ist eine neue Variante.« Florian goß großzügig bemessene Portionen in die Keramiktöpfe, die ihm hilfsbereit entgegengehalten wurden. Dann stieg er auf einen Stuhl und tröpfelte direkt aus der Flasche etwas Gin auf Barbaras Kopf.
»Hiermit taufe ich dich auf den Namen Ernestine, genannt Tinchen, jetzt und immerdar!« Auffordernd blickte er in die Runde. »Erhebt eure Gefäße und stoßt mit mir ins Horn: Lange lebe unser Tinchen, der gute Geist der Redaktion! Hoch, hoch, hoch!«
»Du bist ein ganz widerwärtiges Individuum!« heulte Barbara, nunmehr endgültig als Tinchen enttarnt, und warf ihren Topf in Florians Richtung. Der duckte sich, und so segelte das Blümchengeschoß durch die sich öffnende Tür und zerschellte zu Füßen des Chefredakteurs. Entgeistert sah Tinchen ihn an. Dr. Viktor Vogel, hausintern Sperling genannt, ignorierte die Scherben.
»Haben Sie die Abschrift meines Artikels schon fertig, Fräulein Pabst?«
Tinchen schüttelte den Kopf. »Solange die Herren Reporter ihre Manuskripte hier im Sekretariat schreiben und ihre Meinungsverschiedenheiten ebenfalls hier austragen müssen, ist ein konzentriertes Arbeiten nahezu unmöglich. Könnte man für diese zwar notwendigen, aber äußerst lästigen Mitglieder des Redaktionsteams nicht irgendwo eine Besenkammer frei machen?«
Sichtlich bekümmert nickte Dr. Vogel. »Ich habe die beklagenswerte Raumknappheit schon mehrmals an höherer Stelle zur Sprache gebracht, nur im Augenblick läßt sich offenbar nichts daran ändern. Aber vielleicht könnten die Herren ihren Umtrunk in der Kantine fortsetzen. Übrigens, Herr Bender, ich würde gern einmal Ihren Bericht über die gestrige Theaterpremiere lesen.«
»Der ist schon in der Setzerei«, erwiderte Florian prompt. »Aber ich bringe Ihnen nachher gleich den Fahnenabzug.«
»Ich bitte darum!« Milde lächelnd verschwand Dr. Vogel.
»Das mit der Besenkammer war gemein von dir!« stellte Florian fest, bevor er sich seufzend wieder an seine Maschine setzte. »Was interessiert mich denn jetzt die Minna, wo ich doch ein Tinchen vor mir habe!«
Noch einmal schepperte es, aber diesmal hatte das Feuerzeug sein Ziel erreicht. Florian rieb sich die Stirn, auf der sich eine verdächtige Wölbung zu bilden begann, und Tinchen widmete sich befriedigt den bildungspolitischen Maßnahmen des derzeitigen Kultusministers beziehungsweise den sehr frei interpretierten Erläuterungen des Herrn Dr. Viktor Vogel.
Es war schon nach acht, als sie endlich die Tür zu dem kleinen Reihenhaus aufschloß, in dem sie zusammen mit ihren Eltern und ihrem Bruder wohnte. Oberkassel stand zwar in dem Ruf, zu den besten Wohngegenden Düsseldorfs zu gehören, aber weil man offenbar davon ausging, daß jeder Bewohner dieses Stadtteils über mindestens ein Auto verfügte, wurde das Nobelviertel von den öffentlichen Verkehrsmitteln etwas stiefmütterlich behandelt. Florian hatte sich zwar erboten, wieder einmal Taxi zu spielen und Tinchen nach Hause zu fahren, aber sie hatte ihn nur verachtungsvoll angesehen (zumindest hoffte sie, daß ihr herablassender Blick so gewirkt hatte) und war hinausgestöckelt.
»Tag, Paps!«
Herr Pabst hockte mitten im Wohnzimmer auf einem Standfahrrad, strampelte wie ein Sechstagefahrer beim Zwischenspurt und verfolgte im Fernseher die Tagesschau.
»Tag, Tinchen. Schade, daß du nicht ein bißchen früher gekommen bist. Weißt du, was die Kultusminister der Länder heute beschlossen haben? Sie wollen …«
»Hör auf, Papa! Man sollte sie alle auf den Mond schießen, die Schulpflicht aufheben und das Analphabetentum wieder einführen. Dann brauchte man auch keine Zeitungen mehr.«
»Ich sehe ohnehin die Zeit kommen, wo wir das Alphabet abschaffen und wieder so etwas wie die ägyptischen Hieroglyphen verwenden, damit wir der nächsten Generation entgegenkommen, die nur noch Bilder versteht.«
Tinchen lachte. »Wo ist Mutsch?«
Herr Pabst wischte sich die Schweißtropfen von der Stirn, kontrollierte den Tachostand und stellte befriedigt fest: »Schon sieben Kilometer! Bis zur Wetterkarte werden es mindestens zehn sein. Mutti ist nebenan bei Frau Freitag, einen neuen Diätplan holen!«
»O nein, nicht schon wieder! Jetzt kriegen wir garantiert wochenlang Variationen in Quark vorgesetzt. Ich habe noch von der Salatkur die Nase voll. Ein paarmal hatte ich sogar Alpträume und bin muhend aufgewacht.«
»Diesmal soll’s was mit Eiern sein!«
»Bin ich ein Huhn?« Tinchen schlüpfte aus ihren hochhakkigen Schuhen, klemmte sie unter den Arm und stieg die zwei Treppen zu ihrer Mansarde hinauf. Sie öffnete die Zimmertür, griff automatisch nach dem Lichtschalter, der seit zwei Wochen kaputt war, tastete sich zur Stehlampe durch, stieß – wie jeden Abend – gegen den Couchtisch, umrundete ihn vorsichtig und landete mit dem Kopf programmgemäß an der abgeschrägten Decke. Direkt daneben stand die Lampe. Das Licht flammte auf, und Tinchen betrachtete zufrieden die zurückgelegte Slalomstrecke. »War heute schon viel besser! Zum ersten Mal bin ich nicht mit dem Schreibtisch zusammengestoßen!«
Sie betrat das neben ihrem Zimmer liegende kleine Bad, wusch sich die Hände und entfernte den schwarzen Tupfer von der Nasenspitze. Der stammte sicherlich vom Farbband. Offenbar würde sie es nie lernen, ein Farbband zu wechseln, ohne hinterher auszusehen, als habe sie zentnerweise Kohlen geschleppt. Überhaupt würde sie niemals lernen, eine perfekte Sekretärin zu werden, die alles wußte, nichts vergaß und sogar ein Kursbuch lesen konnte. Dr. Laritz hatte ihr bis heute nicht verziehen, daß er einmal in Hamburg vier Stunden auf dem Bahnhof festgesessen hatte, weil der vermeintliche Zug nach Bremen das Fährschiff nach Helgoland gewesen war. Und Dr. Mahlmann, der in seiner Eigenschaft als politischer Redakteur einen Minister auf der Durchreise hatte interviewen wollen, hatte vergebens in der VIP-Lounge des Flughafens auf seinen Gesprächspartner gewartet. Der war erst am nächsten Tag gekommen! Und dann die Sache mit dem Nobelpreis-verdächtigen Schriftsteller, der im Breidenbacher Hof einen Whisky nach dem anderen gekippt hatte, während Dr. Laritz im Hilton literweise Eistee getrunken und erst mit Hilfe des Portiers herausgefunden hatte, daß Tinchen mal wieder irgend etwas verwechselt haben mußte.
»Tinchen, aus dir wird nie etwas!« hatte schon Onkel Anton gesagt, als sie in der sechsten Klasse sitzengeblieben war. Onkel Anton war der Bruder des Herrn Pabst und hatte es als Konrektor der Hauptschule Niederaulenheim zu angemessenem Wohlstand gebracht.
»Tinchen, was soll bloß aus dir werden?« hatte Oma Marlowitz geseufzt, als Ernestine ein Jahr nach dem Abitur noch immer nicht gewußt hatte, ob sie nun Innenarchitektin, Tierärztin oder Fotografin werden wollte. Vorsichtshalber hatte sie ein Studium der Kunstgeschichte begonnen.
»Tinchen, wann wird endlich etwas aus dir?« hatte Antonie Pabst geborene Marlowitz mißbilligend ihre Tochter gefragt, als diese nach drei Semestern das Studium hingeworfen und sich beim Tageblatt als Redaktionsvolontärin beworben hatte. Und das auch nur, weil just zu jener Zeit durch die Klatschspalten der Illustrierten diese rührselige Geschichte gegeistert war, in der eine junge amerikanische Reporterin einen Millionär interviewt und vier Wochen später geheiratet hatte.
Tinchen interviewte aber keine Millionäre, nicht einmal einen Filmstar auf Durchreise, sie wurde vielmehr ins Archiv verbannt, wo man weniger an ihrem Studium interessiert war und mehr Wert auf eine schöne Handschrift legte. Sie mußte nur leserlich und orthographisch korrekt die Worte ›Außenminister-Konferenz‹ oder ›Olympisches Komitee‹ auf ein Etikett schreiben, den Rest besorgte Adolar Amreimer. Der verwaltete nämlich das Archiv, und zwar so gründlich, daß er immer erst nach längerem planlosem Suchen das Gewünschte fand.
Vermutlich hätte man Tinchen in den Kellerräumen des Pressehauses genauso verstauben lassen wie die dort gesammelten Zeitungsausschnitte, wenn sie nicht eines Tages in der Kantine ein Buch über Barockbauten vergessen hätte. Es war Dr. Laritz in die Hände gefallen, der daraufhin höchstselbst in den Keller gestiegen und nach einer Unterhaltung mit Tinchen in der Gewißheit wieder ans Tageslicht gekommen war, daß die Personalabteilung mit lauter Idioten besetzt sein müsse. Aber das habe er ja schon immer gewußt!
Tinchen wurde also aus der Unterwelt geholt und gleich bis fast auf den Olymp gehievt; denn über den Redaktionsräumen im 6. Stock residierte nur noch der Herr Verleger persönlich, vorwiegend nachmittags von 15 bis 19 Uhr. Tagsüber vertrat ihn Herr Jerschke, seines Zeichens Verlagsleiter, der mangelnde Körpergröße durch forsches Auftreten zu kompensieren suchte und allgemein Rumpelstilz genannt wurde. Rumpelstilz ignorierte wohlweislich Dr. Laritz’ personalpolitische Eigenmächtigkeit, gegen die er doch nicht ankommen würde, hörte sich zähneknirschend Amreimers Klagerufe an, dessen Handschrift mehr Hieroglyphen als lateinischen Buchstaben glich, und der begreiflicherweise seiner Schreibkraft nachtrauerte, und versprach Abhilfe. Er fand sie in Gestalt einer Angehörigen der Leichtlohngruppe, die begeistert Scheuereimer und Bohnerbesen in die Ecke stellte und sich künftig ›Archivarin‹ nannte. Die Lücke im Putzfrauengeschwader konnte mangels geeigneter Bewerberinnen nicht wieder geschlossen werden, und seitdem begoß Frau Fischer von ›Reise und Erholung‹ nicht nur den Gummibaum, sondern auch die Kakteen in der Sportredaktion und den Philodendron im Flur.
Tinchen lernte Kaffee kochen, Korrekturfahnen sortieren, Kugelschreiberminen auswechseln und Briefe schreiben, die größtenteils mit dem Satz begannen: »Zu unserem Bedauern sehen wir uns leider nicht in der Lage …«
Sie war nicht gerade unglücklich, aber glücklich auch nicht. Und Antonie Pabsts Ermahnungen, doch auch mal an die Zukunft zu denken – worunter sie in erster Linie Mann und Kinder verstand –, waren keineswegs dazu angetan, Tinchens seelisches Gleichgewicht in der Balance zu halten.
Energisch drehte sie den Heißwasserhahn zu, der das kleine Bad inzwischen in eine Sauna verwandelt hatte, suchte ihre Handtasche, fand sie an der Stehlampe hängend und kippte ihren Inhalt kurzentschlossen auf dem Couchtisch aus. Zwischen Lippenstift, Geldbeutel, Monatskarte, abgerissenem Jackenknopf, Kopfschmerztabletten und einer Anleitung zur Aufzucht von Igeln fand sie endlich das Gesuchte: Einen schon reichlich zerknitterten Zeitungsausschnitt, der sich mit den Belangen der Berufsfeuerwehr befaßte. Tinchen interessierte sich allerdings mehr für die Rückseite, und die bestand aus einer Anzeige mit folgendem Text:
TOURISTIK-UNTERNEHMENsucht unabhängige Damen und Herren für interessante Reisetätigkeit. 25–35 Jahre, ansprechendes Äußeres, sicheres Auftreten, Organisationstalent. Gute Sprachkenntnisse in Italienisch bzw. Spanisch Bedingung. Zuschriften erbeten unter …
Seit zwei Tagen schon trug Tinchen dieses Inserat mit sich herum, und genausolange überlegte sie, ob sie die verlangten Voraussetzungen erfüllen würde. 25–35 Jahre stimmte, mit 27 lag sie genau richtig, auch wenn sie angeblich jünger aussah. Aber dem konnte man vielleicht mit ein paar hellgrauen Strähnen im dunklen Wuschelkopf abhelfen, die würden sie sicher seriöser machen. Dazu eventuell eine leicht getönte Brille mit Fensterglas? Eine ganz elegante natürlich, so eine, wie die Klinger aus der Moderedaktion sie trug.
Zweiter Punkt: ansprechendes Äußere. Tinchen öffnete die Schranktür und betrachtete sich kritisch im Innenspiegel. Die Figur war ganz ordentlich geraten, ein bißchen klein vielleicht, aber mit hohen Absätzen erreichte sie spielend 167 Zentimeter. Und daß sie schaumstoffgepolsterte Büstenhalter trug, konnte man schließlich nicht sehen. Dafür war sie fein heraus, wenn die Mode mal wieder Twiggy-Figuren vorschrieb.
Das Gesicht? Guter Durchschnitt, fand sie. Vielleicht ein wenig blaß, aber dadurch kamen die dunklen Augen besser zur Geltung. Und außerdem wurde sie regelmäßig schon im Frühling von den ersten Sonnenstrahlen braun. Nach dem Urlaub sah sie dann immer aus wie eines der Eingeborenenmädchen auf den Bildern von Gauguin. »Genau wie ’ne Knackwurst, bloß nicht so saftig«, pflegte ihr Bruder die mühelos erworbene Bräune zu kommentieren, aber daraus sprach natürlich nur der blanke Neid. Karsten wurde lediglich krebsrot und pellte sich nach drei Tagen wie eine Salatkartoffel.
Nein, also an ihrem Äußeren fand Tinchen nichts auszusetzen. Besonders stolz war sie auf ihre langen Beine, die erst in Shorts so richtig zur Geltung kamen. In südlichen Breiten sind diese Kleidungsstücke bei Touristen ja überaus beliebt. Auch Tinchen besaß fünf Stück in verschiedenen Farben.
Sicheres Auftreten? Sie stellte sich auf die Zehenspitzen und versuchte, energisch und zielbewußt auszusehen. Sie sah aber bloß aus wie Mary Poppins – nur der Regenschirm fehlte noch. Quatsch! Imponiergehabe kann man lernen!
Organisationstalent? Und ob sie das hatte! Wer in einer Zeitungsredaktion nicht über Organisationstalent verfügte, hatte bald keinen Stuhl mehr unter dem Hintern und keine Kaffeetasse mehr im Schreibtischfach.
Sprachkenntnisse! Das war der Angelpunkt, um den sich alles drehte. Tinchen bereute bitter, seinerzeit als Au-pair-Mädchen nach London gegangen zu sein und nicht nach Mailand oder Madrid. Was nützte es jetzt, daß sie nahezu fließend englisch sprach, auf spanisch aber nur den Satz »Dónde está el lavabo de señoras?« zusammenbrachte, was so viel bedeutete wie »Wo ist die Damentoilette?«
Mit dem Italienischen ging es ein bißchen besser, denn nicht umsonst hatte Tinchen schon seit Jahren regelmäßig ihren Urlaub in Italien verbracht und die ganze Adria-Küste von Rimini bis Bari abgeklappert. Sie war durchaus in der Lage, sich ein komplettes Mittagessen zu bestellen, aufdringliche Papagalli zu beschimpfen und auf Wochenmärkten wie ein orientalischer Teppichhändler zu feilschen. Ob diese Kenntnisse aber ausreichen würden, eine Herde Touristen durch das Landesinnere zu führen und vor Schaden zu bewahren, bezweifelte sie denn doch. Andererseits kann man Sprachen lernen, und am besten lernt man sie vor Ort. Und überhaupt kommt man mit Englisch überall durch! Weshalb sonst hätte man es als Verkehrssprache bei der UNO, der EG und bei den Fluglotsen eingeführt?
Bliebe nur noch die letzte Bedingung der Anzeige zu erfüllen, nämlich ›unabhängig‹. Paps würde Tinchens Reisepläne großartig finden, denn er war schon immer der Meinung gewesen, daß sich junge Menschen »mal ordentlich den Wind um die Nase wehen« lassen müssen. Mutsch würde entschieden dagegen sein und ein Verlassen des Elternhauses nur akzeptieren, wenn Tinchen ein paar Straßen weiter ein eigenes Heim nebst dazugehörigem Ehemann vorweisen könnte. Was Karsten sagen würde, war uninteressant. Vermutlich würde er sowieso nichts sagen, lediglich Anspruch auf Tinchens Mansarde erheben und bei dieser Gelegenheit endlich den Lichtschalter reparieren.
Sonst gab es niemanden, der etwas sagen würde. Seit jener Affäre mit dem Literaturstudenten Jochen, der in Tinchen abwechselnd das anbetungswürdige Gretchen oder die romantisch-verklärte Julia gesehen hatte und die von ihren Schöpfern nur schamhaft angedeuteten Verführungsszenen in freier Interpretation nachempfinden wollte, bis schließlich eine theaterbegeisterte Kellnerin den von Tinchen abgelehnten weiblichen Part übernommen hatte, war sie auf Studenten im allgemeinen und Literaturstudenten im besonderen nicht sonderlich gut zu sprechen. Eine Zeitlang hatte es noch den Flugzeugkonstrukteur gegeben, aber der wollte immer auf zugigen Bergkuppen das aerodynamische Verhalten zylindrischer Röhren studieren und benötigte Tinchen vorwiegend zum Festhalten verschiedener Drähte. Nach dem dritten Schnupfen innerhalb eines Vierteljahres hatte sie es vorgezogen, sonntags doch lieber mit ihrem Bruder ins Kino zu gehen. Da war es wenigstens warm.
Abgesehen von ihrem Dauerflirt mit Florian Bender gab es weit und breit nichts Männliches, an das Tinchen sich in irgendeiner Weise gebunden fühlte. Rein äußerlich glich Florian durchaus ihrem früheren Leinwandidol Rock Hudson, nur war er weder ähnlich begabt noch ähnlich begütert, und es bestand wenig Aussicht, daß sich dieser Zustand in absehbarer Zeit ändern würde. Mutsch hatte zwar des öfteren angedeutet, daß auch ein kleiner Lokalreporter nicht zu verachten sei und es bei entsprechender Zielstrebigkeit durchaus zu etwas bringen könne, ganz besonders dann, wenn die Frau in den ersten Jahren noch mitarbeiten würde, zumindest so lange, bis die Möbel und das erste Kind da wären. Und weshalb wohl würde der Herr Bender das Tinchen so oft ins Kino einladen und manchmal sogar ins Theater, wenn er nicht ernstere Absichten hätte? Nach Hause gebracht hatte er das Kind auch schon oft genug, sich jedoch leider immer geweigert, hereinzukommen und ein Gläschen zu trinken. Frau Pabst hatte ihn ja auch schon sonntags zum Essen bitten wollen, aber »der ernährt sich doch bloß an der Frittenbude!« hatte Tinchen abgewinkt. Außerdem hatte sie ihrer Mutter verschwiegen, daß Pressekarten immer für zwei Personen gelten und darüber hinaus mit einer entsprechenden Kritik im Tageblatt verbunden waren. Und gestern zur Minna von Barnhelm hatte Flox sie nicht einmal mitgenommen. Statt dessen hatte er die vertrocknete alte Schachtel aus der Buchhaltung eingeladen – lediglich aus Geschäftsgründen, wie er Tinchen versichert hatte. Na ja, wer ewig auf Vorschuß lebt, muß natürlich einen heißen Draht zu maßgeblichen Stellen haben.
Florian war ja ganz nett, hatte Charme (viel zuviel, wie sich auf dem letzten Betriebsfest herausgestellt hatte, als er dauernd um die kleine Blonde vom Vertrieb herumscharwenzelt war!), aber wer mit dreißig Jahren noch immer Lokalreporter ist, der würde wohl nie nach Höherem streben. Und außerdem würde er dafür sorgen, daß in spätestens drei Tagen die gesamte Redaktion wußte, weshalb aus Barbara ein Tinchen geworden war.
Sie schloß die Schranktür, klappte ihre Reiseschreibmaschine auf, spannte einen Bogen ein und begann zu tippen:
Sehr geehrte Herren,unter Bezugnahme auf Ihr Inserat …
Kapitel 2
Da ist Post für dich!« sagte Herr Pabst, als Tinchen ins Zimmer trat. »Irgend so ein Insektenforscher hat geschrieben. Wird vermutlich Reklame sein oder ein Spendenaufruf zur Rettung der vom Aussterben bedrohten Kakerlaken. Ich wollte den Kram schon in den Papierkorb werfen, aber Karsten ist scharf auf die Marke. Die hat er nämlich noch nicht.«
»Wo ist denn der Brief?«
Herr Pabst sah sich suchend um. »Vorhin hat er noch auf dem Tisch gelegen, aber inzwischen hat deine Mutter aufgeräumt. Sie bezeichnete das geordnete Nebeneinander von zwei Rechnungen, einer Bananenschale und einem Bierglas als Chaos und sorgte mit gewohnter Zielstrebigkeit wieder für den makellosen Zustand des Zimmers. Den Brief wird sie wohl mitgenommen haben.«
Tinchen begab sich in die Küche. Frau Pabst stand vor dem Kühlschrank und pellte Eier ab.
»Guten Abend, Mutsch. Hast du meinen Brief weggelegt?«
»Tag, mein Kind. Du bist heute aber wieder reichlich spät dran. Nun wasch dir schnell die Hände, das Essen ist gleich fertig. Es gibt Eier nach Art der Gärtnerin mit frischer Kresse und Diät-Mayonnaise. Ohne Fett natürlich, aber dafür hat sie auch kaum Kalorien.« Frau Pabst knüllte das Papier mit den Eierschalen zusammen und warf alles in den Mülleimer.
»Für mich bitte nicht, Mutsch, ich habe schon gegessen«, winkte Tinchen ab und dachte schaudernd an den undefinierbaren Kantinenfraß, von dem Sabine behauptet hatte, es müsse sich um etwas Ähnliches wie panierte Bisamratte gehandelt haben. Nach dieser Diagnose hatte Tinchen zwar keinen Bissen mehr heruntergebracht und war entsprechend hungrig, aber schon wieder Eier? Sie hatte ohnehin die Befürchtung, sich bald nur noch gackernd unterhalten zu können.
»Wo ist denn nun dieser Brief?«
»Welcher Brief?« Frau Pabst drapierte mit einigem Kunstverstand die Kresseblättchen auf die Eierscheiben und versah das Ganze mit einem Klacks rosaroter Paste, in der Tinchen mit Recht die erwähnte Diät-Mayonnaise vermutete. »Meinst du etwa das Reklameschreiben? Darauf habe ich eben die Eier abgeschält!«
»Also, Mutsch!« Tinchen öffnete den Mülleimer, fischte mit spitzen Fingern den Umschlag heraus, schüttelte die Eierschalen ab und glättete ihn. Den Absender zierte ein rostrotes Pfauenauge, darunter stand in Wellenlinien ›Schmetterlings-Reisen‹.
»Seit wann machen denn Schmetterlinge Urlaub?« Mit dem Zeigefinger schlitzte sie das Kuvert auf und entfaltete einen leicht angefetteten Briefbogen. In der rechten oberen Ecke tummelten sich gleich zwei Schmetterlinge, diesmal in Kornblumenblau.
›Sehr geehrtes Fräulein Pabst‹, las Tinchen, ›Ihre Bewerbung vom 25.1. d.J. interessiert uns, und wir würden uns freuen, wenn Sie im Laufe der nächsten Tage zu einer persönlichen Rücksprache nach Frankfurt kommen könnten. Für eine vorherige Terminabsprache wären wir Ihnen dankbar. Mit freundlichen Grüßen.‹ Die Unterschrift war, wie üblich, unleserlich und sehr markant.
»War wirklich bloß Reklame.« Tinchen zerriß nachdrücklich den Umschlag, bevor sie ihn wieder in den Mülleimer warf. Den Brief schob sie heimlich unter ihren Pullover.
»Wenn die das ganze Geld, was sie in die Briefmarken stekken, gleich zu den Spenden packen würden, brauchten die Leute vom Naturschutz erst gar keine Bettelbriefe zu schreiben«, bemerkte Frau Pabst mit bezwingender Logik und betrachtete zufrieden ihr Eier-Stilleben.
»Sieht hübsch aus, nicht wahr?«
»Sehr hübsch«, lobte Tinchen. »Genau wie die Nationalflagge von Ungarn. Ich habe aber trotzdem keinen Hunger.«
»Aber Kind, du mußt doch ein bißchen was essen!«
»Warum denn? Nulldiät hat noch weniger Kalorien als deine sogenannte Mayonnaise. Woraus besteht die eigentlich? Aus Fassadenfarbe?«
Die Antwort wartete sie nicht mehr ab. Sie stürmte die 22 Stufen zu ihrem Zimmer hinauf, eckte vor lauter Aufregung nicht nur wieder am Schreibtisch an, sondern auch am Kleiderschrank und fand erst nach längerem Herumtasten den Knopf der Stehlampe. Dann holte sie den Brief aus dem Pullover, breitete ihn auf dem Tisch aus und las noch einmal die inhaltsschweren Zeilen. Am liebsten hätte sie sich sofort ans Telefon gehängt und einen Besprechungstermin mit den Schmetterlingen vereinbart, aber auch der betriebsamste Nachtfalter würde wohl kaum um halb neun Uhr abends in seinem Büro sitzen.
Ob der Oberschmetterling wohl Flügel in Gestalt eines Umhangs hatte? Vielleicht trug er auch nur einen artgemäßen Schwalbenschwanz. Tinchen kicherte leise vor sich hin und studierte noch einmal die energische Unterschrift. Nein, also ›Pfauenauge‹ hieß das bestimmt nicht, eher schon Degenhard oder Degenbach.
In dieser Nacht träumte Tinchen, sie sei ein Schmetterling, der in einem kornblumenblauen Kleid mit rosaroten Mayonnaisetupfern über die Dächer von Marbella flog und verzweifelt rief: »Dónde está el lavabo de señoras?«
»Herr Dr. Vogel, kann ich wohl am Donnerstag einen Tag Urlaub bekommen? Ich muß wegen einer Erbschaftssache nach Frankfurt.« Tinchen schwindelte mit einer Geläufigkeit, die auf längere Übung schließen ließ.
»Erbschaft? So, so!« sagte denn auch der Sperling und strich bedächtig seinen gepflegten Schnauzbart, der ihm mehr das Aussehen eines Seehundes als eines Vogels verlieh. »Wen wollen Sie denn beerben?«
»Meine Großtante«, erwiderte Tinchen prompt. »Sie war schon zweiundachtzig und lebte seit Jahren im Altersheim. Ich glaube also nicht, daß es da viel zu erben gibt. Trotzdem muß ich hin, schon aus Gründen der Pietät.«
»Natürlich, natürlich!« Dr. Vogel zeigte sich durchaus verständnisvoll. »Aber muß es denn gerade am Donnerstag sein? Sie wissen doch, daß wir am Freitag die große Sonderbeilage über Kleintierhaltung bringen, und da fällt am Tag vorher immer noch ein Haufen Schreiberei an. Geht es nicht am Mittwoch?«
»Leider nein. Der Rechtsanwalt kann nur am Donnerstag ein bißchen Zeit erübrigen, an den anderen Tagen hat er dauernd Termine. Eigentlich ist er ja Strafverteidiger. Die Erbschaftssache hat er nur meiner Großtante zuliebe übernommen, weil er sie schon seit seiner Jugend kannte. Die beiden haben zusammen im Sandkasten gespielt.«
»Dann muß der gute Mann ja auch schon ein biblisches Alter erreicht haben«, wunderte sich Dr. Vogel. »Und er übernimmt immer noch Strafprozesse? Einfach unglaublich!«
»Na ja, nur, wenn es um etwas ganz Besonderes geht, Mord und Totschlag oder so was«, stotterte Tinchen und verwünschte ihre Vorliebe zum Detail. Es war doch völlig gleichgültig, mit wieviel Jahren die nicht existente Großtante angeblich gestorben war.
»Wenn Sie regelmäßig Zeitung lesen würden, dann wüßten Sie, daß Mord und Totschlag keineswegs etwas Besonderes ist«, sagte Dr. Vogel. »Erst unlängst ist mir eine Statistik des Bundeskriminalamtes in die Hände gefallen, wonach …«
»Kann ich nun am Donnerstag frei haben?« unterbrach ihn Tinchen.
»Wie bitte? Ach so, ja, wenn es also gar nicht anders geht, dann müssen wir eben ohne Sie auskommen. Hoffentlich ist Fräulein Bollmann wenigstens da.«
»Natürlich, die hat ja keine tote Tante«, versicherte Tinchen und zog sich aus dem Allerheiligsten zurück.
»Hat’s geklappt?« fragte Sabine, sah das zustimmende Nikken und wandte sich wieder ihrem Stenogramm zu. »Kannst du entziffern, was das hier heißen könnte?« Sie deutete mit dem Zeigefinger auf eine Anhäufung von Bleistiftkringeln. »Ich kriege das einfach nicht mehr zusammen.«
Tinchen beugte sich über den Block. »Sieht aus wie ›Polygamie‹.«
»Blödsinn, das ist doch ein Beitrag für den Wirtschaftsteil.«
»Ach so! Dann laß das Wort ruhig aus. Der Schmitz ist schon daran gewöhnt, daß außer ihm selbst kein Mensch sein Fachchinesisch versteht. Die Leser übrigens eingeschlossen.«
»Na schön, wenn du meinst, dann lasse ich hier einfach eine Lücke. Sehr viel sinnloser wird der Text dadurch auch nicht. Was ist denn ein Systemanalytiker?«
»Weiß ich nicht. Ist mir auch völlig Wurscht, ich habe gleich Feierabend. Liegt sonst noch etwas vor?« Tinchen kramte Puderdose und Lippenstift aus ihrer Handtasche und begann mit dem, was Karsten so prosaisch als Fassaden-Renovierung zu bezeichnen pflegte.
»Das Feuilleton braucht noch ein paar Füller. Du sollst mal nachsehen, was wir noch an Stehsatz haben. Laritz meint, Buchbesprechungen wären am besten. Hier in diesem Laden ist er bestimmt der einzige, der sogar die Bücher liest, bevor er sie rezensiert. Von den Neuerscheinungen, die im Herbst herausgekommen sind, müßte noch was da sein, behauptet er.«
»Jetzt haben wir Februar. Seit wann berichten wir denn über Antiquitäten?« Tinchen klappte die Puderdose zu, verstaute sie wieder zwischen Monatskarte und Schlüsselbund und machte sich auf den Weg in die Setzerei.
Als sie aus dem Fahrstuhl trat, dröhnte das dumpfe Röhren der großen Rotationsmaschine in ihren Ohren. Obwohl die Druckerei zwei Stockwerke tief unter der Erde lag, spürte Tinchen immer noch das leichte Vibrieren des Fußbodens.
In der Setzerei herrschte die übliche Betriebsamkeit. Niemand hatte Zeit, keiner hörte zu, als sie ihr Anliegen vorbrachte, und nur ein Jüngling mit Nickelbrille, der sechs Bierflaschen auszubalancieren suchte, murmelte etwas von »Da drüben am hintersten Tisch!«
Nachdem nun wenigstens die Richtung festgelegt war, in der sie suchen mußte, schöpfte sie neuen Mut. »Ich brauche fürs Feuilleton einen Abzug vom Stehsatz!« Energisch zupfte sie an einem blauen Overall.
»Und ich brauche eine Unterschrift«, sagte der Mann, der in dem blauen Overall steckte. »Bei mir sind Sie falsch, ich gehöre nicht zu dem Verein hier. Ich liefere bloß Seife aus.«
Tinchen versuchte es andersherum. Zielstrebig stellte sie sich einem Setzer in den Weg. »Herr Dr. Laritz braucht sofort einen Abzug vom Stehsatz!«
»Aber klar, Frollein, soll er kriegen. Wo is denn det Zeuch?«
»Keine Ahnung, ich denke, das wissen Sie?«
»Seh ick aus wie’n Archiv? Am besten jehn Se zu Herrn Sauerbier. Als Setzereileiter muß er ja wissen, wo in den Laden hier wat zu finden is.«
Tinchen warf einen Blick auf die große Uhr, die an der Stirnseite des Raumes hing. Schon wieder zwanzig nach sechs. Ob sie wohl jemals pünktlich Schluß machen könnte?
Herr Sauerbier, der im Gegensatz zu seinem Namen ausnehmend freundlich war, hörte sich geduldig Tinchens Gejammer an und versicherte ihr, die Sache selbst in die Hand nehmen zu wollen. Fünf Minuten später war er zurück und drückte ihr zwei Fahnenabzüge in die Hand. Die Überschrift auf dem ersten lautete: Beckenbauer bald Amerikaner?
Tinchen wandte sich zum Gehen. »Wer ist denn das?«
»Haben Sie wirklich noch nie etwas von Kaiser Franz gehört?« Herr Sauerbier konnte diese offensichtliche Unkenntnis nicht begreifen.
»Nee, aber wahrscheinlich ist Franz Kaiser bloß sein Pseudonym. Was für Bücher schreibt er denn?«
»Bücher??? Der spielt Fußball!!«
Tinchen überflog die ersten Zeilen des Fahnenabzugs und ließ die Türklinke wieder los. »Heiliger Himmel! Das hier ist doch Stehsatz vom Sport! Ich brauche den vom Feuilleton!«
»Warum sagen Sie das nicht gleich?«
»Habe ich ja! Dr. Laritz will …«
»Dr. Laritz fordert alle drei Tage Abzüge an. Inzwischen könnte er schon sein Zimmer damit tapezieren. Was macht er eigentlich mit dem ganzen Kram? Hat er kein eigenes Klopapier?«
Endlich bekam Tinchen das Gewünschte, lieferte es ab und sah mit Erbitterung, wie Dr. Laritz die so mühsam erkämpften Abzüge nach flüchtiger Prüfung in den Papierkorb warf. »Das ist doch alles Schnee von gestern«, murmelte er und wühlte auf seinem Schreibtisch herum. »Ich weiß gar nicht, weshalb man mir immer wieder diese alten Kamellen raufschickt. Wer will denn das jetzt noch lesen?«
Erleichtert fischte er aus dem Papierwust einen stark zerknitterten Zettel heraus. »Na also, auf einem gut geordneten Schreibtisch findet sich nach längerem Suchen alles wieder. Wir nehmen als Füller die Sache mit den Jupiter-Monden. Die Politik will’s nicht haben. Außerdem war Jupiter ein Gott, hat also im Feuilleton eine gewisse Existenzberechtigung.«
Dr. Laritz kritzelte ein paar Anweisungen an den Rand des Manuskripts und drückte es Tinchen in die Hand. »Würden Sie das auf dem Nachhauseweg noch in der Setzerei abgeben? Am besten gleich dem Sauerbier, es ist nämlich eilig. In einer halben Stunde habe ich Umbruch.«
»Gern«, sagte Tinchen folgsam und fest entschlossen, Herrn Sauerbier auf keinen Fall mehr unter die Augen zu treten. Zum Glück kreuzte Waldemar ihren Weg. Mit gewohntem Gleichmut nahm er das Manuskript in Empfang und betrachtete weit weniger gleichmütig das Markstück, das Tinchen ihm gab. »Die Kantine hat schon zu!«
»Dann wirf es in dein Sparschwein«, sagte Tinchen und zog so eilig ihren Mantel an, daß Waldemar nicht einmal mehr hilfreich zuspringen konnte. Sie griff nach ihrer Tasche und rannte förmlich zur Tür hinaus.
»Nicht mal auf Wiedersehen hat sie gesagt«, wunderte er sich und steckte das Geldstück in die Hosentasche. »Was hat sie bloß?«
»Vermutlich Schmetterlinge im Kopf«, sagte Sabine, worauf Waldemar erleichtert feststellte, daß seine Zeit als Redaktionsbote in Kürze beendet sein würde – gerade noch früh genug, um von dem in diesem Stockwerk grassierenden Irrsinn nicht mehr angesteckt zu werden.
»Am Donnerstag werde ich wahrscheinlich erst spät nach Hause kommen«, sagte Tinchen beim Abendessen. Es wurde montags immer in der Küche eingenommen, weil Herr Pabst an diesem Tag seinen Kegelabend und Karsten sein Judotraining hatte. Also lohnte es sich nach Frau Pabsts Ansicht gar nicht, im viel zu großen Eßzimmer zu decken.
»Gehst du wieder mit Herrn Bender ins Theater?« erkundigte sie sich, um sogleich mahnend fortzufahren: »Diesmal ziehst du aber das Weinrote an. Es steht dir wirklich gut, und du hast es noch nie getragen. Wenn das Oma wüßte!«
»Oma weiß es aber nicht. Leider! Sonst würde sie vielleicht endlich einsehen, daß ihr Geschmack nicht auch unbedingt meiner ist. Rüschen am Ausschnitt und auf der Schulter ein Paillettenpapagei. Das Kleid sieht aus wie ein Kaffeewärmer. Übrigens gehe ich nicht ins Theater, ich fahre nach Frankfurt.«
»Mußt du da ein Interview machen?« Frau Pabst hatte noch immer nicht die Hoffnung aufgegeben, eines Tages Tinchens Foto in der Zeitung zu finden und darunter die Überschrift: Unsere Chefreporterin berichtet. Auch Frau Freitag, ihre Busenfreundin aus dem Nebenhaus, hatte schon vor längerer Zeit prophezeit, daß das Tinchen noch einmal Karriere machen würde. Die Karten lügen bekanntlich nicht, und der dunkle Herr hatte direkt über der Herzdame gelegen, gleich neben der Geldkarte.
»Nein, Mutsch, ich bin bloß so eine Art Botenjunge. Ich soll in Frankfurt etwas abholen.« Stur blickte Tinchen auf ihren Teller.
Zu Hause schwindelte sie gar nicht gern, aber solange die Angelegenheit mit den Schmetterlingen noch in der Luft hing, wollte sie lieber nichts davon erzählen. Schon gar nicht ihrer Mutter. Dazu war später immer noch Zeit genug.
Frau Pabst sah sich unvermutet wieder in die profane Wirklichkeit versetzt und dachte sofort an das Nächstliegende. »Dann werde ich dir am besten ein paar Eier kochen und ein Schüsselchen Kartoffelsalat fertigmachen. Ein bißchen Obst solltest du auch mitnehmen, aber keine Bananen, die zerdrücken so leicht.«
»Also Mutsch, ich mache doch keine Pilgerreise durchs Sauerland. Ich fahre mit dem D-Zug nach Frankfurt!«
»Und wenn schon. In der Bahn kriegt man doch immer Hunger!«
»Dafür gibt es einen Speisewagen.«
»Warum willst du unnütz Geld ausgeben?« protestierte Frau Pabst, aber als sie das Gesicht ihrer Tochter sah, zog sie es doch vor, weitere Menüvorschläge für sich zu behalten. »Dann nimm wenigstens eine Thermoskanne Tee mit!« Aber auch diese Anregung wurde mit einem beredten Schweigen quittiert.
Antonie Pabst geborene Marlowitz verstand ihre Tochter nicht. Dankbar sollte das Mädel sein, weil sich jemand um den Reiseproviant kümmerte. Früher war man froh gewesen, wenn man überhaupt etwas Eßbares mitnehmen konnte. Speisewagen! Da konnte sie ja nur lachen!
Vielleicht sollte man erwähnen, daß Frau Antonies Erfahrungen mit der Deutschen Bundesbahn, die damals noch Reichsbahn geheißen hatte, aus der Kriegs- sowie der unmittelbaren Nachkriegszeit stammten und alles andere als erfreulich waren.
Ursprünglich in Posen beheimatet, war sie 1945 zusammen mit ihrer verwitweten Mutter ›ins Reich‹ geflohen. Als Beförderungsmittel hatten überwiegend Güterwagen gedient, und die Verpflegung hatte man sich auf irgendeine Art selbst beschaffen müssen. Rohe Karotten sind zwar gesund, als Hauptnahrung aber nicht eben befriedigend.
Was hätte Antonie damals nicht für ein saftiges Schnitzel gegeben … (Heute dagegen raspelte sie wieder Mohrrüben, weil sie in späteren Jahren entschieden zu viele Schnitzel gegessen hatte.)
Den nicht propagierten Endsieg der Alliierten hatte sie jedenfalls in Berlin erlebt, wo es eine entfernte Kusine zweiten Grades gegeben hatte, die in irgendwelche höheren Kreise eingeheiratet und standesgemäß am Wannsee gewohnt hatte. Den Wannsee hatte Frau Marlowitz gefunden, schließlich auch das Haus, oder besser das, was davon übriggeblieben war. Die Kusine hatte es noch rechtzeitig vorgezogen, das Familiensilber und sich selbst in Sicherheit zu bringen. Sie war ins Allgäu getürmt.
In Ermangelung eines geeigneteren Quartiers bezog Frau Marlowitz den noch halbwegs intakten Keller des ehemals herrschaftlichen Hauses und erlebte hier nun doch den Einmarsch der Russen, vor dem sie ja eigentlich geflohen war. Tochter Antonie, die außer Klavierspielen und französischer Konversation nichts von dem gelernt hatte, was in der gegenwärtigen Situation einigermaßen nützlich gewesen wäre, sah sich trotz ihrer zweiundzwanzig Jahre außerstande, sich und ihre Mutter irgendwie durchzubringen. Normalerweise wäre sie als Kanzleiratswitwentochter ja schon längst mit einem Beamten in gehobenerer Position verheiratet gewesen – nicht umsonst hatte es bereits zwei akzeptable Bewerber gegeben, aber man hatte deren berufliche Karriere rücksichtslos unterbrochen und sie in Uniformen gesteckt. Der Himmel mochte wissen, wo sie abgeblieben waren.
Bevor die letzten Karotten aufgegessen und die beiden noch verbliebenen Abkömmlinge derer von Marlowitz verhungert waren, entsann sich die verwitwete Frau Kanzleirat jener Pensionatsfreundin, die einen in Düsseldorf ansässigen Uhrmacher namens Gfreiner geheiratet hatte. Wieder ein Ziel vor Augen, erwachten in Frau Marlowitz verborgene Kräfte. Sie wagte sich mit den Resten ihres geretteten Schmucks (der größte Teil war während der Flucht auf rätselhafte Weise abhanden gekommen) in die Abgründe des schwarzen Marktes, wo sie zwar gründlich übers Ohr gehauen wurde, aber dennoch genügend Geld erzielte, um Reiseproviant – ebenfalls auf dem schwarzen Markt und ebenfalls mit Verlust – kaufen zu können. Das restliche Geld ging für Fahrkarten und eine Deutschlandkarte im Maßstab 1 : 300 000 drauf.
Solchermaßen gerüstet bestiegen – vielmehr enterten – Frau Marlowitz nebst Tochter einen der wenigen Züge, die in Richtung Westen fuhren. Daß sie den ersten Teil der Reise auf einer zugigen Plattform verbringen mußten, erschien Antonie noch erträglich.
Es war Sommer und darüber hinaus außergewöhnlich warm. Auch der damals obligatorische Fußmarsch über die Zonengrenze – illegal natürlich, der ortskundige Führer hatte sich mit Frau Marlowitz’ Armbanduhr als Lohn zufriedengeben müssen – war nicht sonderlich anstrengend gewesen.
Die nächsten zweihundert Kilometer Bahnfahrt, eingepfercht in der ohnedies nicht sehr geräumigen Toilette, hatten Antonie das Eisenbahnfahren nun endgültig verleidet. Zu allem Überfluß war man in der französischen Besatzungszone gelandet, obwohl man eigentlich in die britische gewollt hatte. Vermutlich war die bewußte Landkarte daran schuld gewesen, die den veränderten politischen Verhältnissen in keiner Weise Rechnung getragen hatte und immer noch in den Grenzen des Großdeutschen Reiches markiert gewesen war.
Aber nun hatte Antonie helfend einspringen können. Wenn ihr auch die einschlägigen Vokabeln für ›Besatzungszone‹ und ›grüne Grenze‹ nicht geläufig waren, so reichten ihre französischen Sprachkenntnisse immerhin aus, um bürokratische und militärpolizeiliche Hürden zu nehmen. Ausgerüstet mit den erforderlichen Papieren und einer Notverpflegung vom Roten Kreuz bestiegen die Damen Marlowitz erneut einen Zug. Er war nicht ganz so voll, dafür aber erheblich langsamer. Außerdem fuhr er nicht weit. Ein Armeelastwagen, beladen mit Wollsocken und Thunfischdosen, diente als nächstes Transportmittel. Thunfische sind nahrhaft und dank ihres konservierenden Behältnisses nicht so leicht verderblich. Frau Marlowitz ignorierte das siebente Gebot und forderte ihre Tochter auf, ein Gleiches zu tun. Trotz glühender Hitze wickelten sie sich in Mäntel, deren Taschen sich bald verdächtig nach außen wölbten. Auch der Koffer war viel schwerer geworden, was sich nachteilig bemerkbar machte, als die beiden Reisenden den Lastwagen verlassen hatten und zu Fuß zur nächsten Bahnstation pilgerten. Noch nachteiliger wirkte sich das Fehlen eines Büchsenöffners aus. Aber wenigstens hatte der Bahnhofsvorsteher einen an seinem Taschenmesser. Darüber hinaus war er bereit, ein paar Thunfischdosen anzunehmen und dafür zu sorgen, daß die Damen Marlowitz einen Platz im nächsten Zug bekommen würden. Sie bekamen ihn auch, diesmal auf dem Dach, was den Beförderungsvorschriften zwar widersprach, damals aber notgedrungen geduldet wurde.
Irgendwann war die Odyssee zu Ende. Der Bahnhof von Düsseldorf kam in Sicht, wenn auch kaum noch als solcher zu erkennen. Die Pensionatsfreundin gab es auch noch, ebenfalls kaum zu erkennen, weil ergraut und merklich gealtert. Aber sie nahm die Vertriebenen samt den Thunfischdosen auf und beschaffte dank einiger Beziehungen Unterkunft und Erwerbsmöglichkeit für Tochter Antonie. Letzteres übrigens in ihrer Werkstatt.
Der Uhrmachermeister Gfreiner hatte das Kriegsende nicht überlebt. Der Gerechtigkeit halber muß erwähnt werden, daß sein frühzeitiges Ableben nicht auf Bombenangriffe, Straßenkämpfe oder ähnliche Begleiterscheinungen eines Krieges zurückzuführen war, sondern einzig und allein auf seine Vorliebe für Moselweine. Um seinen reich gefüllten Weinkeller nicht in Feindeshand fallen zu lassen, hatte sich Herr Gfreiner gezwungen gesehen, die vorhandenen Bestände möglichst schnell und möglichst restlos zu verbrauchen. Um dieses Ziel zu erreichen, hatte er sich angewöhnt, schon sein Frühstück in flüssiger Form zu sich zu nehmen und auch im Laufe des Tages auf feste Nahrung weitgehend zu verzichten. Immerhin entging er einem langsamen Hungertod, indem er ziemlich schnell die Kellertreppe hinunterfiel und sich das Genick brach. Die noch übriggebliebenen Weinflaschen leerten später die zahlreichen Trauergäste und erfüllten somit den letzten Wunsch des nunmehr Verblichenen.
Frau Gfreiner, die von Uhren lediglich wußte, daß sie meistens falsch gingen, überließ die Fortführung des Geschäfts dem bisherigen Mitarbeiter ihres Mannes, einem gewissen Ernst Pabst, der bei Herrn Gfreiner selig als Lehrling angefangen hatte. Herr Pabst verstand entschieden mehr von Uhren als seine derzeitige Chefin; vor allen Dingen wußte er, daß man sie zweckmäßigerweise vor den kommenden Siegern in Sicherheit bringen sollte – wer immer das letzten Endes auch sein würde. Also beschaffte er stabile Behälter, darunter auch mehrere leere Munitionskisten, und stopfte sie voll mit Uhren jeglicher Größe, einschließlich einer auseinandergenommenen Standuhr mit Westminsterschlag. Dann versteckte er die Schatztruhen im Keller unter den Resten der letzten Kohlenzuteilung. Das nun leere Schaufenster dekorierte er mit Fieberthermometern sowie einem leicht verbogenen und daher unbrauchbaren Mikroskop.
Fortan reparierte er nur noch Uhren, und als die Ersatzteile alle waren, tat er gar nichts mehr, lebte die letzten paar Wochen vom Ersparten und wartete auf den Endsieg. In Reichweite lagen immer die beiden Krücken, die er zwar nicht brauchte, weil er trotz seines verkürzten Beines ausgezeichnet laufen konnte, die ihn aber davor bewahrten, in letzter Minute noch von den Rollkommandos zum Volkssturm geholt zu werden.
Etwa zwei Monate nach dem Zusammenbruch hielt Ernst Pabst es für angebracht, das Geschäft des Herrn Gfreiner selig wieder zu eröffnen, vorerst allerdings nur als Reparaturwerkstatt. Aber schon wenig später grub er einen Teil der versteckten Schätze aus und verkaufte sie gegen Naturalien. Seine Kunden waren überwiegend Besatzungssoldaten, die bereitwillig in der allgemein üblichen Zigarettenwährung zahlten und immer noch ein gutes Geschäft dabei machten.
Frau Gfreiner, die dank alliierter Hilfe bereits Bohnenkaffee trinken konnte, als die meisten anderen Deutschen nicht mal Muckefuck hatten, bot ihrem talentierten Geschäftsführer die Teilhaberschaft an und überließ es künftig ihm, für ihr leibliches Wohl zu sorgen. Zum Dank durfte er sich aus dem Kleiderschrank ihres verstorbenen Mannes bedienen. Wenn die Anzüge auch nicht unbedingt dem Geschmack eines Zweiunddreißigjährigen entsprachen, so waren sie doch noch sehr gut erhalten und überdies von erster Qualität. Ernst Pabst kannte einen Schneider, der am liebsten Virginiatabak rauchte, und so war auch die Garderobenfrage fürs erste gelöst.
In dieses sichtbar aufblühende Geschäft platzte nun die verwitwete Frau Kanzleirat Marlowitz nebst Tochter Antonie, letztere durchaus ansehnlich und – wie sich bald herausstellte – auch recht geschickt. Aus den anfänglichen Handlangerdiensten wurde schnell produktive Mitarbeit, und bald konnte Ernst Pabst auf seine ›Gesellin‹ gar nicht mehr verzichten. Außerdem sprach sie besser Englisch als er selber, was die manchmal komplizierten Verkaufsverhandlungen mit den Besatzern wesentlich abkürzte.
Antonie wiederum bewunderte ihren Brötchengeber, der alles das hatte, was ihr selbst fehlte: Unternehmungsgeist, Tatkraft, Humor und eine jungenhafte Unbekümmertheit. Auch die verwitwete Frau Kanzleirat betrachtete den jungen Mann wohlwollend, zumal er ihr nicht nur regelmäßig Bohnenkaffee brachte, sondern hin und wieder auch einen Blumenstrauß. Wer in dieser materialistischen Zeit an solche Artigkeiten dachte, verdiente ein gewisses Entgegenkommen. Und im übrigen war ja nun wirklich nichts dabei, wenn dieser nette Herr Pabst das Fräulein Antonie ins Kino einlud.
Natürlich blieb es nicht beim Kinobesuch. Antonie lernte Boogie-Woogie, bekam von Ernst Nylonstrümpfe und Hershey-Schokolade geschenkt und zum Geburtstag ein Paar Schuhe mit Kreppsohlen – made in USA. Kurz vor der Währungsreform machte Ernst Pabst dem Fräulein Antonie Marlowitz einen Heiratsantrag, und kurz nach der Währungsreform fand die zeitgemäß bescheidene Hochzeit statt. Eine Hochzeitsreise gab es nicht, oder vielmehr doch, nur endete sie schon in den Außenbezirken Düsseldorfs, wo das junge Paar eine nicht übermäßig komfortable, jedoch gründlich renovierte Zweizimmerwohnung mit Küche, Bad und Ofenheizung bezog. Hier wurde im Herbst 1949 auch Tochter Tinchen geboren.