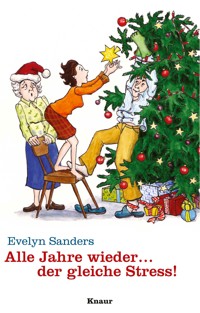6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Warum krümelt eigentlich der Sandkuchen schon wieder? Kann man eine zwei Meter lange Nordmanntanne mit lilafarbenen Glaskugeln schmücken? Und dann noch per Billigangebot in die Wüste – ob das wohl gut geht? Ganz zu schweigen von wüstentauglichen Klamotten. Tropenhelm? Oder reicht auch ein Taschentuch, an jedem Ende ein zipfeliger Knoten? Der ganz normale Wahnsinn, doch damit nicht genug: Das zweite Enkelkind befindet sich im Anmarsch, und was lange währt, wird endlich wahr: Die jüngste der Sanders-Töchter heiratet. Zwar soll die Hochzeit vor dem Polterabend stattfinden, aber was soll's: Ende gut, alles gut! Wie keine andere schafft es Evelyn Sanders, den Familienalltag voller Selbstironie und Herzenswärme auf den Punkt zu bringen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 488
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Evelyn Sanders
Geht das denn schon wieder los?
Roman
Knaur e-books
Inhaltsübersicht
Kapitel 1
Was weißt du über Wüsten?«
»Sie sind groß, bestehen überwiegend aus Sand und sind sogar zur Rushhour relativ unbelebt«, rekapitulierte ich meine Erinnerungen an die Durchquerung der Negev-Wüste, allerdings nicht hoch zu Kamel, was wenigstens stilvoll gewesen wäre, sondern bequem im klimatisierten Bus. Außerdem lag die Sache mindestens fünfzehn Jahre zurück, doch ich vermute, dass sich die Wüsten seitdem nicht sonderlich verändert haben. »Und weil wir gerade beim Thema sind: Bekomme ich noch eine Tasse Kaffee? Sonst kriege ich den Kuchen nicht runter, der ist ja so was von trocken …«
»Ist doch auch Sandkuchen«, kalauerte meine Tochter, »und ich habe ihn genau nach Rezept gemacht. Jedenfalls fast!«
Das glaubte ich ihr aufs Wort. Stefanie ist eine hervorragende Köchin, nur mit dem Backen hat sie nichts am Hut. Trotzdem versucht sie es immer wieder, obwohl Ehemann Hannes sie ständig damit tröstet, dass Konditoren letztendlich auch leben wollen und es am Ort sogar einen gebe, der über die Stadtgrenzen hinaus als Meister seines Fachs hoch gelobt werde. »Natürlich habe ich die fettreduzierte Variante genommen, man muss sich ja nicht schon vor den Feiertagen Pölsterchen anfressen!«
Das ist zwar richtig, erklärt aber auch, weshalb der Kuchen krümelt und wir schließlich die Kuchengabeln zur Seite legten und zu den Teelöffeln griffen. »Jedenfalls schmeckt er besser als er aussieht«, versicherte ich, »und er knirscht auch kein bisschen. Weshalb also deine Anspielung auf Wüstensand?«
»Na ja, langsam wird es Zeit, dass wir unseren Urlaub planen!«
Das allerdings stimmte. Bis zum kalendarischen Winteranfang war es nicht mehr lange hin, Steffi hatte vorhin die zweite Kerze auf dem Adventskranz angezündet, und zu diesem Zeitpunkt pflegen wir jedes Jahr Kataloge zu wälzen und uns exotische Reiseziele auszusuchen, die dann doch wieder nicht infrage kommen, weil sie entweder zu weit weg liegen oder zu gefährlich sind (wer plant schon vor dem Urlaub seine Entführung ein?), keine Tauchmöglichkeit bieten, gerade Regenzeit haben und vor allem viel zu viel kosten. Aber Wüste war noch nie dabei gewesen! »Wollt ihr etwa in einer Oase gründeln?«
»Es geht ja auch mal ein paar Tage ohne Korallenriffe«, sagte Stefanie, einen relativ dünnen Katalog durchblätternd, »ich habe da nämlich was gefunden. Hier …« Sie reichte mir das aufgeschlagene Heft herüber. »Das wäre doch mal was.«
Zumindest wäre es etwas absolut Neues, denn statt der sonst üblichen Strandkulisse mit Meer vorne, Palmen am Rand und im Hintergrund das grundsätzlich weiße Hotel mit Terrasse, Pool und bunten Sonnenschirmen gab es hier lediglich eine Zeichnung. Jemand mit nur mäßiger Begabung hatte eine Rotunde hingestrichelt, die auf den ersten Blick einem komfortablen, weil außergewöhnlich großen Klohäuschen ähnelte, wie man es gelegentlich auf Autobahnparkplätzen findet. Erst auf den zweiten Blick war eine Art Zeltdach zu erkennen. Weiteres Gestrichel deutete Grüngewächse an und der Rest bestand aus Text. Er war länger als sonst in Katalogen üblich und besagte, dass es sich bei dieser Zeichnung um ein neu errichtetes Hotel mitten in der Wüste handele, das bei Drucklegung des Katalogs noch nicht fertig gewesen war und deshalb auch nicht fotografiert werden konnte. Nach seiner Eröffnung im Februar würde es allerdings allen nur erdenklichen Luxus bieten, angefangen vom eigenen Pool vor jedem Zelt bis zu einer der Umgebung angepassten Freizeitgestaltung wie Falkenjagd, Wüstenrallye, Bogenschießen, Kamel-Safari und was man sonst so mit nichts als Sand drumherum offenbar zu treiben pflegt.
»Sag mal, tickst du nicht ganz richtig?«, war alles, was mir im ersten Moment einfiel. »Weder hast du jemals Karl May gelesen noch als Kind im Sandkasten gespielt. Stattdessen hast du in jeder Regenpfütze gesessen und bist sogar mal durch den Abwasserkanal gekrochen. Also woher kommt dein plötzliches Interesse für Sandwüsten?«
»Drüber geflogen sind wir ja schon öfter, und immer habe ich mir gewünscht, das Ganze auch mal hautnah zu erleben«, ergänzte sie im Hinblick auf die Strapazen, mit denen bei einem Fußmarsch wohl zu rechnen sein würde.
»Und an welche hattest du gedacht? Da wäre zunächst mal die Sahara, meines Wissens die größte Wüste, aber wenn es auch eine kleinere sein darf, dann empfehle ich die Namib in Südwestafrika oder gleich dahinter die Kalahari, schön abgelegen ist auch die Gobi …«
»Ach hör doch auf!«, unterbrach sie mich ärgerlich. »Warum musst du immer gleich so übertreiben? Hast du dir denn mal den ganzen Text durchgelesen?«
»Wozu? Wenn du glaubst, ich verbringe meinen nächsten Urlaub in einer überdimensionalen Buddelkiste, dann irrst du dich! Was soll ich in der Wüste? Sandflöhe dressieren?« Aber weil gerade das Telefon klingelte und Steffi mit einer ihrer zahlreichen Freundinnen die Frage erörtern musste, ob man einer anderen Freundin zum bevorstehenden Geburtstag den Handmixer oder besser einen Gutschein fürs Nagelstudio schenken soll, vertiefte ich mich doch ein bisschen intensiver in die Beschreibung des Wüstenhotels. Das alles klang ja wirklich sehr exotisch. Oder sollte ich sagen orientalisch? Diese Touristen-Herberge stand nämlich in Dubai. Nur – wo in aller Welt liegt Dubai?
Nach etwa einer Viertelstunde Palaver hatte man sich am Telefon endlich geeinigt – auf eine Einladung zum Sunday-Brunch in einem beliebten Szene-Café, da hätten die Spenderinnen auch was davon, denn sie würden natürlich mitkommen. »Ihren Lover muss sie aber zu Hause lassen«, verlangte Steffi noch, »das soll ein reiner Weiber-Treff werden. Und überhaupt wird es sonst auch zu teuer.« Sie schaltete den mobilen Hörer ab und legte ihn auf die Sofalehne, von wo er irgendwann abrutschte, zwischen den Kissen verschwand und später verzweifelt gesucht wurde. Früher wäre so was nie passiert, als es noch diese geschmackvollen bunten Kästen in Grün, Ocker oder Mitternachtsblau gab mit der Korkenzieherstrippe, die immer zu kurz war, und dem dranhängenden Hörer. Jetzt habe ich natürlich auch so einen transportablen Apparat, zum Glück aber nebenher noch ein Handy, und mit dem kann ich mich selber anrufen und akustisch orten, wo ich das andere Teil mal wieder liegen gelassen habe.
Während Steffi telefonierte, hatte ich nicht nur die ausführliche Beschreibung dieses seltsamen Hotels gelesen, sondern auch herausgefunden, wo Dubai liegt. Nämlich in den Emiraten am Persischen Golf, rechts von Saudi-Arabien, unter dem Iran – also dort, wo es auf einem Haufen viele kleine Länder mit vielen ergiebigen Ölquellen gibt. Das erklärt natürlich so manches! Sogar ein Hotel mitten in der Wüste mit privatem Pool und persönlicher Betreuung, was immer man darunter zu verstehen hatte.
Die Sache mit dem Zelt hatte ich schon mal gründlich missverstanden, wie mir Steffi später klar zu machen versuchte. Man würde zwar in offenbar weit auseinander liegenden »Rundhäusern« wohnen, doch die schienen nur optisch einem Zelt nachempfunden; laut Katalog bestanden sie aus Holz und Sandstein. Lediglich das Dach vermittelte den Eindruck eines Zirkuszeltes, denn hierbei handelte es sich um eine riesige Plane, die anscheinend von vier Pfosten innerhalb des Raumes gestützt wurde. Sie reichte weit über die Wände hinaus, so dass die umlaufende Veranda im Schatten lag. Einschließlich Pool. Wurde zumindest behauptet, denn auf der Zeichnung gab es keinen, und von dem »in orientalischem Stil errichteten Hauptgebäude mit klimatisierten offenen Terrassen, Speisesaal, Tea-Room, Bar und Bibliothek« war auch nichts zu sehen.
»Bist du sicher, dass wir unsere Unterkunft nicht selber aufbauen müssten, bevor wir zum ersten Mal drin schlafen könnten?« Ich deutete auf das hingestrichelte Zelt, das nun wirklich sehr provisorisch aussah und nur in einem Punkt mit der Beschreibung übereinstimmte: Es war tatsächlich rund! »Was soll diese vermeintliche Luxusherberge eigentlich kosten?«
»Das isses ja, die ist gar nicht so teuer. Jedenfalls nicht teurer als ein Mittelklassehotel in St. Tropez oder am Wörther See. Wahrscheinlich handelt es sich um das Eröffnungsangebot.«
»Da ich noch nie in St. Tropez übernachtet habe, weiß ich nicht, was dort als angemessen gilt.«
»Ich doch auch nicht«, winkte sie ab, »aber man kann sich’s ja ungefähr denken. Und überhaupt kommt dort noch der Sehen-und-gesehen-werden-Zuschlag hinzu.« Sie wandte sich wieder dem Katalog zu.
»Darauf können sie in der Wüste verzichten, da gibt’s nur Kamele. Und wenn ihr tatsächlich hinfahrt, sogar zweibeinige!«
Ärgerlich knallte sie den Prospekt auf den Tisch. »Du musst ja nicht mitkommen! Vielleicht hast du inzwischen doch das Alter erreicht, wo du deinen Urlaub in Bad Gastein verbringen, im Kurpark spazieren gehen und statt Campari Orange lieber Brunnenwasser trinken solltest!«
Das hatte gesessen! Dabei stimmte es überhaupt nicht! Auch heute noch antworte ich auf entsprechende Fragen, dass ich die dem Seniorenalter angemessenen Ferienziele erst dann ins Auge fassen würde, wenn die mitgeführte Reiseapotheke umfangreicher wäre als das übrige Gepäck. Zurzeit genügen aber noch Aspirin und Kohlekompretten. Empfindlich bin ich auch nicht. Immerhin habe ich schon einen Beinahe-Absturz mit einem kubanischen Hubschrauber hinter mir, habe einen Segeltörn auf dem Indischen Ozean bei ich weiß nicht welcher Windstärke überlebt, denn es war immer mehr Wasser ins Boot geschwappt, als ich hatte rausschöpfen können, und damals in Kenia hatte es ebenfalls eine heikle Situation gegeben. Gefährlicher konnte die Wüste auch nicht sein – sofern man sich überhaupt in eine solche begibt! Und genau das war der Knackpunkt! Was macht man denn da? Trotzdem lenkte ich ein.
»Wie viele Tage habt ihr für den Sandkasten eingeplant?«
»Fünf. Kostet genau einen Tausender – alles inklusive. Auch die ganzen Ausflüge. Für ein paar Tage kann man das doch mal machen, meinst du nicht? Und überhaupt sind wir da unten schon so dicht am Indischen Ozean dran, dass wir anschließend noch auf unsere Lieblingsinsel fliegen können. Da wollten wir doch sowieso hin, und die Malediven liegen quasi vor der Haustür. Irgendwo müssen wir den vielen Sand ja wieder abspülen.«
Letzteres klang natürlich sehr verlockend, nur – »dir scheint entgangen zu sein, dass die Bewohner der Emirate zwar mit dem Dirham zahlen, von Touristen jedoch Dollar erwarten, und zweihundert Dollar pro Wüstentag finde ich ein bisschen viel!«
Das fand sie auch, aber nur vier Minuten lang. Dann nämlich hatte sie sich überzeugt, dass im Katalog nicht von Dollar die Rede war, sondern von D-Mark (der Euro war zu diesem Zeitpunkt noch nicht im Umlauf gewesen, war nur Bankmenschen ein Begriff und vermutlich solchen Leuten, die ihre Geschäfte in sämtlichen Währungen der Welt tätigen und ihr Geld nicht mehr zählen, sondern wiegen). »Steht nicht überhaupt noch deine Belohnung aus? Warum gönnst du sie dir nicht mal in Form von …«
»… Sand? Wenn’s wenigstens goldhaltiger wäre!«
Vermutlich ist hier eine Erklärung fällig: Als vor vielen Jahren mein erstes Buch erschienen und ich der Meinung gewesen war, nun würde der Grundstock zu meiner ersten Million gelegt werden (nie wieder im Leben habe ich mich so sehr geirrt!), der fehlende Rest käme dann mit der Fortsetzung, hatte ich mir vor lauter Euphorie einen nicht ganz billigen Ring gekauft, obwohl meine fünf Nachkommen ganz andere Pläne gehabt hatten; angefangen beim eigenen Auto (Sohn Sven) über ein neues Fahrrad mit ich weiß nicht mehr welchem Sattel und mindestens 12-Gang-Schaltung (Tochter Stefanie) bis zu ganz bestimmten Schulmappen, die gerade en vogue gewesen waren und dem Preis nach aus Gazellenleder bestehen mussten (Zwillinge). Nur Sascha hatte keine Wünsche gehabt; er wohnte nicht mehr zu Hause, gratulierte mir aber zehn Minuten lang per R-Gespräch aus England. Schließlich hatte Ehemann Rolf ein Machtwort gesprochen und seinem maulenden Nachwuchs klar gemacht, dass ich ja wohl das Recht hätte, von meinem selbst verdienten Geld auch mal etwas für mich selbst zu kaufen. Quasi zur Belohnung.
»Ist denn Berühmtwerden nicht Belohnung genug?« Die Zwillinge schienen mir ab sofort den gleichen Prominentenstatus zuzubilligen wie Astrid Lindgren und Onkel Dittmeyer aus der Fernsehwerbung.
Millionärin bin ich noch immer nicht, dafür sorgt schon das Finanzamt, doch die Sache mit der Belohnung habe ich trotzdem beibehalten und nach jedem neuen Buch etwas gekauft, das ich mir normalerweise nicht gegönnt hätte – einen Dreitagetrip nach Malta, einen verrückten Hosenanzug, den ich nur einmal getragen habe und dann nie wieder, ein Wellness-Wochenende im Schwarzwald – alles kleine Wiedergutmachungen für unzählige zerrissene Manuskriptseiten, für Papierkörbe voll handschriftlicher Notizen, für die Anfälle von Verzweiflung, wenn im Computer mal wieder ein Dutzend Seiten verschwunden und erst dann wieder aufgetaucht waren, als ich sie nicht mehr brauchte, für schlaflose Nächte und verheulte Tage, weil überhaupt nichts mehr ging … kurz gesagt, für monatelange Einzelhaft mit PC, Laserdrucker und täglich drei Kannen Früchtetee Johannisbeer-Kirsche mit Honig statt Zucker.
Im Übrigen hatte Steffi Recht: Die Belohnung für mein letztes Opus hatte ich mir tatsächlich noch nicht gegönnt! Und der erwähnte Hosenanzug war seinerzeit noch teurer gewesen als fünf Tage Wüste und darüber hinaus rausgeschmissenes Geld, es sei denn, er fände noch mal Gnade vor den Augen eines weiblichen Familienmitglieds und käme wenigstens bei einer Faschingsveranstaltung zum Einsatz. Warum also nicht mal Sand statt Seide? Wohlwollend betrachtet wäre dieser Abstecher nach Dubai sowieso nur ein etwas längerer Zwischenstopp auf dem Flug zum vermutlichen Urlaubsziel. Sie waren dann ja wirklich nicht mehr so weit weg, die Malediven …
»Gleich morgen früh rufe ich Juli an«, versprach Stefanie beim Abschied und reichte mir eine oben zusammengedrehte Papiertüte ins Auto, »abends weiß ich schon mehr.«
Juli heißt eigentlich Juliane und ist auch eine von Steffis Freundinnen, nur hat sie im Gegensatz zu den meisten anderen einen sehr nützlichen Beruf: Sie ist Touristik-Kauffrau oder wie auch immer man diese im Umgang mit Kursbuch und Katalog-Preislisten versierten Damen nennt, leitet ein gar nicht mal kleines Reisebüro, weiß viel, und was sie wirklich nicht auf Anhieb weiß, kriegt sie raus. Wir verdanken ihr einen mehr als nur preiswerten Vier-Tage-Trip nach New York, und dass Steffi und Hannes ihren fünften Hochzeitstag in einem Traumhotel auf Ibiza feiern konnten, war auch Julis Verdienst gewesen; sie hatte ein Last-Minute-Angebot auf den Tisch gekriegt und sich sofort ans Telefon gehängt.
Während ich mich vorsichtig in den Adventsonntagnachmittagskaffeerückfahrtstau einfädelte und in flottem Sechzig-Kilometer-Tempo die Autobahn entlangzuckelte, stellte ich mir vor, ich säße mit einem Glas eisgekühltem Wodka-Lemon am Rande meines privaten Swimmingpools auf der mit Teakholz ausgelegten Terrasse (stand alles im Prospekt!), vor mir die unendliche Wüste, hinter deren Horizont eine rote Sonnenscheibe versinkt, in der Ferne das Gebrüll eines wilden Tieres (was läuft da eigentlich so herum außer Kamelen?), und eine Art Sarotti-Mohr in Turban und Pluderhosen steht hinter mir und fächelt mit einem Palmenwedel die Insekten weg (gibt es dort überhaupt welche? Muss mich gleich morgen genauer informieren!).
Plötzlich hupte es sehr aufdringlich hinter mir, rechts überholten mich drei Autos, deren Fahrer deutlich demonstrierten, was sie von mir hielten, und da erst merkte ich, dass sich das »hohe Verkehrsaufkommen« wieder normalisiert hatte und ich die linke Fahrspur blockierte. In der Wüste könnte so etwas nie passieren!
An die Papiertüte wurde ich erst drei Tage später erinnert, als ich im Wagen das heruntergefallene Fünfmarkstück suchte. »Für die Schlosspark-Enten« hatte Steffi draufgekritzelt, und drin befand sich – na was wohl? Richtig, der restliche Sandkuchen, nunmehr nur noch aus Krümeln bestehend. Die Enten wollten sie nicht mehr, aber im Teich leben ja auch Fische.
Kapitel 2
Wer schon einmal ein Buch von mir gelesen hat oder vielleicht sogar mehrere, der kennt natürlich die Sanders-Sippe, bestehend aus Haushaltsvorstand Rolf nebst Ehefrau Evelyn und fünf Nachkommen. Eigentlich hätten es nur vier sein sollen, nämlich zwei Jungs und zwei Mädchen – in genau dieser Reihenfolge. Hatte ja auch geklappt, allerdings nur sieben Minuten lang! Seitdem ist die weibliche Komponente in der Überzahl.
Dass unsere zweite Tochter Nicole heißen würde, hatte schon lange festgestanden, ein anderer Mädchenname war gar nicht in Betracht gekommen. Jetzt brauchten wir aber noch einen! Wäre es nach dem frisch gebackenen und einige Tage lang ziemlich verstörten Zwillingsvater gegangen, hieße Katja jetzt Carolin. Das allerdings hatte die große Schwester Stefanie verhindert. »Im Kindergarten haben wir auch eine Carolin, die ist ganz doof. Ich will aber keine doofe Schwester haben!«
Sven und Sascha, immerhin schon zehn bzw. acht Jahre älter als der jüngste Nachwuchs, betrachteten die Zwillinge mit einiger Skepsis und beschlossen erst einmal abzuwarten, was sich daraus entwickeln würde. Besonders Sascha schien nicht erbaut von der Aussicht, sich in Zukunft einer dreifachen Phalanx weiblicher Gegner stellen zu müssen, denn mit seiner vier Jahre jüngeren Schwester Steffi lag er schon jetzt dauernd im Clinch – ein Zustand, der noch weitere fünfzehn Jahre anhalten sollte. Dass Katja sich jedoch häufig auf seine Seite schlagen würde, konnte er seinerzeit noch nicht ahnen. Ich auch nicht. Mir fiel im Laufe der folgenden Jahre lediglich auf, dass die weibliche Übermacht bei scheinbar demokratischen Abstimmungen über Ausflugsziel, Fernsehprogramm oder auch nur den obligatorischen Sonntagskuchen (»immer den blöden langen, mach doch mal einen runden mit Rosinen drin!«) oft den Kürzeren zog, weil Katja grundsätzlich das wollte, was Sascha auch wollte, wenn’s sein musste, sogar Rosinen im Kuchen oder – noch schlimmer! – Wirsingeintopf.
Seit damals sind einige Jahrzehnte vergangen. Die Kinder sind längst aus dem Haus, zum Teil verheiratet, der Rest noch unschlüssig, ob die gegenwärtige Partnerschaft schon stabil genug ist fürs Standesamt, oder ob man doch noch abwarten soll nach der Devise: Drum prüfe, wer sich ewig bindet, ob sich nicht noch was Bess’res findet. Sascha gilt als Experte, hat er doch nicht nur als Erster von den Fünfen geheiratet, sondern bereits eine Scheidung hinter sich und eine zweite Hochzeit. Inzwischen gibt es einen vierjährigen Knaben namens Bastian Alexander (diesen Bandwurmnamen kriegt der später nie in die immer viel zu kleinen Kästchen amtlicher Formulare – im Land der Fragebogen muss man so was doch vorher berücksichtigen!). Ihm habe ich die etwas unübliche Bezeichnung Oma Evelyn zu verdanken. »Ich habe doch noch eine andere Oma, aber die heißt so komisch, da sage ich immer bloß Oma zu!« Na ja, dann …!
Steffi war Nummer zwei. Sie hatte ihren Hannes zwar im Schein der untergehenden Sonne an einem karibischen Strand heiraten wollen, aber dann war es doch beim heimischen Standesamt geblieben und einem Beamten, der offenbar nebenberuflich Trauerreden bei Begräbnissen hält. Er hatte da anscheinend etwas verwechselt und musste erst nachdrücklich an den erfreulicheren Zweck dieser Zusammenkunft erinnert werden.
Sven will nicht heiraten, und Katja will noch nicht, obwohl sie mit ihrem Tom schon seit etlichen Jahren Wohnung, Bett, Kühlschrank und gelegentlich auch das Auto teilt, wenn seins mal wieder in der Werkstatt steht. Bestimmte Anzeichen wie das ungewohnte Interesse für Schaufenster mit Festtagskleidung oder die harmlos klingende Frage nach dem Vorhandensein eines Familienstammbuchs lassen gewisse Rückschlüsse zu. Außerdem haben unlängst zwei gleichaltrige Freundinnen geheiratet, gar nicht zu reden von ihrer Zwillingsschwester Nicole, bei deren Hochzeit mit Jörg sie Trauzeugin gewesen ist und in Kürze Patentante werden will – präzise gesagt: Anfang des kommenden Jahres, also in knapp drei Wochen. Oma Evelyn zum Zweiten!
Enkel Nummer zwei soll übrigens Tim heißen. Dieser Name passt mit Sicherheit in jedes amtliche Formular.
»Kannst du das Ding nicht mal grade halten!«, schimpfte Steffi. »Der steht doch schon wieder schief!«
»Der steht überhaupt nicht schief! Du hast von da unten bloß die falsche Perspektive!«
Gemeint war der Weihnachtsbaum, den Steffi vergeblich in den Ständer zu praktizieren versuchte. Sie kniete auf der schneebedeckten Terrasse, neben sich ein handliches Beil und um sich herum diverse bunte Holzklötzchen aus Bastians Baukasten. »Die Dinger sind zu dick, hast du nicht was Dünneres?«
»Wenn du vom Stamm nicht zu viel abgehackt hättest, dann müssten wir jetzt nicht …«
»Und wenn du einen von diesen modernen Ständern gekauft hättest, in dem der Baum auf Anhieb gerade steht …«
»Die gibt’s hier noch nicht!«, unterbrach ich sie. »Du solltest doch aus langjähriger Erfahrung wissen, dass technische Neuheiten mindestens eine Saison brauchen, bis sie sich bei uns in der Provinz durchgesetzt haben. Novitäten sind meistens teuer und Schwaben sparsame Menschen.« Ich lehnte den Baum vorsichtig an die Hauswand, worauf er sich prompt zur Seite neigte und in den Schnee kippte.
»Na bravo!« Missmutig betrachtete Steffi die zwei Meter lange Nordmanntanne. »Jetzt können wir wieder von vorne anfangen! Wieso muss ich das eigentlich machen? Das Einpflanzen von Christbäumen gehört doch seit jeher zu den eindeutig männlichen Tätigkeiten! Wo ist Papi?«
»In die große Stadt gefahren! Ihm ist vorhin nämlich eingefallen, dass morgen Weihnachten ist! Und was den Christbaum betrifft – soweit ich mich erinnere, hat sich dein Vater zum letzten Mal darum gekümmert, als wir noch kurz vorm Schwarzwald gewohnt haben und den Baum mit försterlicher Genehmigung selber schlagen durften. Der war ungefähr so groß wie dieser hier gewesen, doch als er endlich im Ständer steckte, war er nur noch halb so lang, die Säge kaputt, die Cognacflasche fast leer und Rolf restlos betrunken.«
Steffi kicherte. »Wann ist das denn gewesen?«
Ich rechnete zurück. »Das müsste jetzt vierundzwanzig Jahre her sein …«
»Und seitdem hast du immer den Baum …?«
»Natürlich nicht! Dein Vater hat überall nette Nachbarn gefunden, die dem zwar künstlerisch begabten, jedoch in praktischen Dingen sichtbar hilflosen Familienvater geholfen haben. Man nennt das ›Arbeit delegieren‹.«
»In Ordnung!« Steffi war aufgestanden und klopfte den Schnee von ihren Jeans. »Dann delegiere ich das Eintopfen dieses Gewächses an meinen Bruder. Wenn mich nicht alles täuscht, ist er gerade vorgefahren. Oder gibt es noch jemanden in der Gegend, der einen rosa Panda fährt?«
Nein, den gab es mit Sicherheit nicht! Wer kommt schon auf die Idee, ein technisch zwar noch einwandfreies, vom Lack her jedoch unansehnliches Auto ausgerechnet pinkfarben umspritzen zu lassen? Als Mann! Das Argument, seitdem würde er seinen Wagen überall auf Anhieb finden, lässt sich allerdings kaum widerlegen. Obwohl sich Sven normalerweise durch nichts aus der Ruhe bringen lässt und Hänseleien mit stoischem Gleichmut begegnet, wurden ihm die Anspielungen auf sein »Barbiemobil« wohl doch zu nervig, jedenfalls prangte eines Tages ein deutlich lesbarer Aufkleber an der Heckklappe: Ich bin nicht schwul, sondern farbenblind!
Sven lud seinen Koffer aus und gleich noch ein bisschen Bügelwäsche, muss man ja ausnutzen, wenn man ein paar Tage lang zu Hause bleibt, nein, Hunger hätte er nicht, Durst eigentlich auch nicht, schon gar nicht auf Tee, aber vielleicht ein Weizenbier …
Potenzielle Helfer muss man bei Laune halten, also bekam er sein Bier und wurde anschließend zum Tatort geführt.
»Schön gewachsener Baum!«, stellte er nach der ersten Besichtigung fest. »Nur hättet ihr ihn besser aufrecht hingestellt, jetzt klebt doch der ganze Schnee dran!«
»Na und? Der fällt auch wieder runter!« Steffi verlor allmählich die Geduld. »Fang endlich an! Heilig Abend ist nämlich schon morgen!«
»Wozu braucht ihr eigentlich die ganzen Bauklötze?« Er schob das Sammelsurium von unterschiedlich starken Hölzchen zur Seite. »Zum Fixieren des Stamms?«
»Nein!«, blaffte Steffi zurück. »Zum Anzünden der Grillkohlen natürlich. Die Gans passt nämlich nicht in den Ofen!«
Auch Sven stellte sehr schnell fest, dass der von Stefanie auf schlanke Linie getrimmte Baumstamm definitiv zu dünn war, ein Bauklotz zu dick, Zeitungspapier zu weich und Vogelfutter zu instabil. »Hast du noch die Hausärztin?« Fragend sah er mich an.
»Ob ich was habe?«
»Na, diesen dicken Wälzer, der fast ein Jahrzehnt lang das abgebrochene Bein von meinem Bett ersetzt hatte. Irgendwann hast du ihn mal gebraucht, ich glaube, das war damals, als Katja den Bänderriss hatte und du nachgucken wolltest, ob’s nicht vielleicht doch bloß eine Verstauchung ist – oder so ähnlich«, setzte er erklärend hinzu. »Jedenfalls haben wir das Buch kaum noch unterm Bett vorgekriegt, und als wir’s schließlich hatten, waren ausgerechnet die Seiten über Beine gar nicht mehr drin.« Er schüttelte den Kopf. »Weißt du das wirklich nicht mehr?«
Natürlich konnte ich mich an das Buch erinnern, auch an den Bänderriss (einen Tag vor Katjas Tanzstunden-Abschlussball!), nur nicht an die Kombination von beidem. Die Frau als Hausärztin hatte das umfangreiche Werk geheißen und war im neunzehnten Jahrhundert erschienen, als man Zahnschmerzen noch mit aufgelegten Kamillesäckchen bekämpfte (bei dem damaligen Stand der Zahnheilkunde vermutlich das kleinere Übel) und Babys in den Zuständigkeitsbereich von Klapperstörchen fielen.
Jenes Buch also hatte ich nach dem Tod meiner Großmutter als vermeintliche Antiquität an mich genommen, es war dann – von niemandem vermisst – in irgendeinem Schrank verschwunden, durch Zufall wieder aufgetaucht, von einem Antiquar als »hübsch, aber kaum etwas wert« eingestuft und daraufhin nur noch zweckentfremdet worden. Eine Zeit lang hatte es als Sockel für Rolfs Schreibtischlampe gedient, bis er sich eine neue kaufte mit einem längeren Arm; es eignete sich zum Beschweren von Herbstlaub, das für den Bio-Unterricht gepresst werden musste, ich hab’s mal einem aufmüpfigen Knaben hinterher geworfen, wahrscheinlich war’s Sascha gewesen, er beschuldigt mich nämlich noch heute des versuchten Totschlags, und Katja hatte es gelegentlich als Trittbrett benutzt, denn wenn sie sich draufstellte, kam sie an den Einschaltknopf vom Fernseher.
Irgendwann hatte es jedoch wieder seinen endgültigen Platz als vierter Pfosten von Svens Bett gefunden. Und stand das nicht immer noch oben in der Mansarde …?
»Wozu um alles in der Welt brauchst du jetzt dieses Buch? Ich bin mir sicher, dass es nichts enthält, was dir beim Eintopfen des Weihnachtsbaumes helfen könnte. Es sei denn, du möchtest seinen Stamm fachmännisch mit einer Mullbinde umwickeln, aber das würdest du bestimmt auch ohne Bildvorlage hinkriegen.«
Sven fing an zu lachen. »Ich kann mich noch dunkel erinnern, dass dieses voluminöse Werk einen sehr stabilen Einband hatte, dunkelrot war der, richtig dick und nicht kaputtzukriegen. Ich glaube, der hätte genau die richtige Stärke für – was hast du eben gesagt? Mullbinde? Das isses doch! Wir verpassen dem Stamm einfach einen Verband! Den können wir so dick wickeln, wie wir ihn brauchen!« Er schüttelte den Kopf. »Darauf hätte ich wirklich schon eher kommen können!«
Zum ersten Mal wurde der Deckel des genormten und in jedem Kraftfahrzeug mitzuführenden Verbandkastens DIN A 13 164 geöffnet und ihm nach längerer Suche eine gedehnte Kompressionsbinde von acht Zentimeter Breite entnommen, um damit den Stamm des Weihnachtsbaums so lange zu umwickeln, bis er kerzengrade und bombenfest in der wirklich schon sehr antiquierten Halterung stand.
Ich hatte gerade die letzte auberginefarbene Kugel an den Baum gehängt (dank meiner inzwischen den meisten Lesern bekannten Beziehungen zu einem Dekorations-Großhandel bin ich natürlich immer über die jeweiligen weihnachtlichen Trends nicht nur informiert, sondern auch mit den entsprechenden Utensilien ausgestattet), als es klingelte. »Das wird Nicki sein, die will ihre Geschenke schon heute abladen, weil sie doch morgen Abend zuerst bei Jörgs Eltern antreten müssen. Vor zehn sind die nicht hier.«
Stefanie trabte zur Haustür, während ich ein paar Schritte zurücktrat und den Weihnachtsbaum in seiner violett-silbernen Pracht beäugte. »Lila – der letzte Versuch!«, murmelte ich vor mich hin eingedenk des Protests meiner Großmutter, als ihr seinerzeit die Verkäuferin in der Stoffabteilung des KaDeWe einen preiswerten Restposten pflaumenfarbener Seide hatte aufschwatzen wollen, während Omi genau wusste, dass Tante Else sich weigern würde, aus dieser »unmöglichen Farbe« ein Theaterkleid für ihre Kusine zu schneidern.
Bei mir war Tante Else nie so wählerisch gewesen. Abgesehen von dem verhassten Bleylekleid, das jedes Jahr einmal zum Anstricken in die Fabrik geschickt worden war (heute unvorstellbar, damals durchaus üblich), hatte ich nur Selbstgenähtes besessen, und dafür war eben jene Tante Else zuständig gewesen, ihres Zeichens Hausschneiderin und mehr auf solide Verarbeitung programmiert als auf modische Finessen. Das weiß ich deshalb so genau, weil mein dunkelgrün kariertes Taftkleid (ich habe es nie ausstehen können!) erst dann ausrangiert worden war, als es trotz des schon zweimal herausgelassenen Saumes nur noch knapp über den Po reichte. Zu diesem Zeitpunkt hatte es allerdings bereits zwei Weihnachtsfeste, eine Hochzeit und mindestens ein Dutzend Kindergeburtstage schadlos überstanden – es war nämlich mein Sonntagskleid gewesen! So was haben Kinder heutzutage gar nicht mehr, für die jetzt üblichen Geburtstagspartys bei McDonald’s wären wasserfeste Overalls sowieso am vorteilhaftesten, aber dunkle Jeans tun’s auch.
»Meine Güte, ist der hässlich!«, war alles, was Nicole beim Anblick des Weihnachtsbaums herausbrachte. »Warum denn lila?«
»Weil das in diesem Jahr ›in‹ ist, frag Steffi, die muss das schließlich wissen, und weil ihr euch oft genug darüber mokiert, dass ich in manchen Dingen angeblich in den frühen Achtzigern stehen geblieben bin. Damals hatte ein deutscher Christbaum aber rote und goldene Kugeln zu haben«, trumpfte ich auf, »und die hatten wir nie!«
»Stimmt!«, bestätigte Sven, einen Korb mit eingewickelten Päckchen hereintragend. »Du wolltest immer blaue haben. Und weil jedes Jahr welche kaputtgingen und die nachgekauften nie den gleichen Farbton hatten, sah unser Baum schließlich aus wie die Farbtafel im Malergeschäft. – Wo soll ich denn jetzt hin mit den Liebesgaben?« Er setzte den Korb ab und musterte Nicki kritisch. »Wird das nicht langsam gefährlich oder kann das gar nicht platzen?«
»Wenn du nicht sofort verschwindest, dann platzt gleich dein Kopf!« Drohend griff sie nach dem metallenen Kerzenständer. »Bring den Korb in den Keller und bleib am besten auch gleich unten!«
Sven trabte ab, während Nicki sich in den nächsten Sessel plumpsen ließ. »Er hat ja Recht«, seufzte sie, jenen Körperbereich betrachtend, der noch vor einem halben Jahr in Leggins der Größe 38 gesteckt hatte und nun von einem sackförmigen Pullover der Gattung »prénatal« verhüllt wurde, »ich komme mir ja selber vor wie ein Fesselballon!«
»Weiß ich, aber in zwei Wochen hast du’s überstanden, und ich garantiere dir, dass du dich noch so manches Mal zurücksehnen wirst nach den letzten Wochen, als du nachmittags gemütlich die Beine hochlegen und ein Buch lesen konntest, nachts durchschlafen durftest und alle Welt auf dich Rücksicht genommen hat. Die Schonfrist nach der Geburt ist nämlich wesentlich kürzer als die vorher – glaub’s mir, ich habe da meine Erfahrungen!«
Natürlich glaubte sie es nicht. »Jörg hat aber gesagt, er wird …«
Ganz egal, was der künftige Vater zugesichert hatte, halten wird er es sowieso nicht, weil Männer schon aus physischen Gründen manches gar nicht können, selbst wenn sie es wollten, und für das, was sie später auch nicht wollen, haben sie im Laufe der Jahrhunderte einen kaum zu widerlegenden Grund gefunden: Sie müssen jetzt nämlich noch mehr arbeiten als vorher, um den erhöhten finanziellen Anforderungen gerecht zu werden. Was allein schon die Windeln kosten …
Dass Väter ihre Babys nicht stillen können, ist ein gravierender Fehler der Natur, der leider auch im Laufe der Evolution nicht behoben wurde; genauso wenig wie die Notwendigkeit, allen Müttern ein zweites Paar Hände wachsen zu lassen, die mit der Volljährigkeit ihrer Nachkommen wieder verschwinden oder vielleicht auch nur zu jeweils einem sechsten Finger mutieren könnten als Beweis dafür, dass sie zumindest einen künftigen Rentenzahler in die Welt gesetzt und damit ihren eigenen Versorgungsanspruch gesichert haben (sollten).
Männer reichen ihrem Nachwuchs zwar gern das Teefläschchen, stecken ihm den ausgespuckten Schnuller in den Mund zurück und schieben stolz den Kinderwagen, aber die Windeln ihres Babys wechseln sie nur höchst ungern, was sich außerhalb ihrer vier Wände jedoch ganz anders anhört. Da machen sie das nämlich täglich und mit links und lassen sich sogar mit anderen Vätern auf längere Diskussionen ein, ob die kostengünstigeren Windeln von Aldi genauso gut sind wie die aus der TV-Werbung. Die junge Mutter hat aber schon alle einschlägigen Marken durchprobiert und sich auf eine festgelegt. Ihre Mahnung »… und vergiss nicht, heute Abend zwei Großpackungen Babysoft mitzubringen, die kriege ich nämlich nicht in die Ablage vom Kinderwagen!«, wird der stolze Papi jetzt regelmäßig hören. Nur ist er weit weniger stolz, wenn er sie wieder umtauschen muss, weil er die falsche Größe gebracht hat. »Peer Magnus ist nämlich erst zwei Monate alt.«
Die Nachtruhe ist den meisten Männern allerdings heilig. Vielleicht sind sie ja wirklich in den ersten Nächten noch mit aufgestanden, aber da sie die natürlichen Bedürfnisse ihres Kindes nicht befriedigen können (siehe oben), kriechen sie gern wieder ins Bett, nicht ohne der gähnenden Mutter noch schnell das Stillkissen gereicht zu haben. »Ich muss doch gleich morgen früh in diese Sitzung, muss also spätestens um sieben aus dem Haus, aber du bleibst natürlich noch liegen!« Dass der kleine Schreihals schon um halb sechs sein Frühstück haben will, bekommt Papi gar nicht mit, er freut sich später nur über den bereitstehenden Kaffee und das weich gekochte Ei.
Genau genommen sind Babys für die meisten Väter eigentlich erst dann so richtig vollwertig, wenn sie gar keine Babys mehr sind, sondern schon Papa sagen und allein aufs Klo gehen können.
Es gibt natürlich auch Ausnahmen, doch inwieweit Jörg eine sein würde, blieb abzuwarten.
»Steht jetzt eigentlich fest, wo wir essen gehen werden?«, wollte Nicki wissen, nachdem sie ihren derzeit herausragendsten Körperteil in eine bequemere Lage gebracht hatte, »Erika hat mich nämlich danach gefragt.«
Richtig, das Familiendiner! Lange Jahre Hauptbestandteil des Weihnachtsfestes, zu dem sich regelmäßig auch die bereits in der Ferne angesiedelten Sippenmitglieder eingefunden hatten, bis ich eines Tages genug hatte von dem Stapel fettglänzender Teller, von Gänsebratengerippe und kalten Klößen, von den Rotweinflecken auf (Leinen-, was sonst?) Servietten, von überall verteiltem Kerzenwachs und dreimal Kaffeemaschine munitionieren, bis alle versorgt waren. Gar nicht zu reden von den kleineren Pannen wie dem steif gefrorenen Dessert (bei neun Grad minus sollte man die Terrasse besser nicht als Ersatzkühlschrank benutzen) oder dem Salz in der Zuckerdose, wobei ich mir bis heute nicht sicher bin, ob es sich tatsächlich um ein Versehen gehandelt hatte.
»Das nächste Mal gehen wir essen!«, hatte ich der noch mit dem Verdauen beschäftigten Familie angekündigt, nachdem ich die Spülmaschine mit der ersten Ladung Geschirr bestückt und eingeschaltet hatte.
»Zu teuer!«, hatte mein Ehemann sofort gekontert. Offenbar hatte er sich schon des Privilegs beraubt gesehen, eine halbe Stunde vor Beginn der Abfütterung die Weinflaschen zu öffnen und ihren Inhalt zu verkosten – er könnte ja nach Kork schmecken oder gar überlagert sein (speziell das war mir immer höchst unwahrscheinlich vorgekommen!).
»In diesem Fall würde natürlich ich die Rechnung übernehmen«, hatte ich zugesichert in der Hoffnung, bis dahin das zu jener Zeit noch sehr dünne Manuskript für das neue Buch fertig gestellt und somit Anspruch auf einen Teil meines Honorars zu haben.
»Na ja, wenn das sooo ist …«
Damit war das Thema erledigt gewesen – aber nicht vergessen! Bereits im Oktober hatte ich von verschiedenen Seiten dezente Hinweise bekommen, dass ein First-Class-Hotel ganz in unserer Nähe gerade den zweiten Michelin-Stern bekommen habe, oder dass es sich lohnen würde, ruhig mal ein bisschen durch die winterliche Natur zu fahren, und so sehr weit weg sei der Schwarzwald ja gar nicht. »Weißt du, Määm, die Traube in Tonbach …«
»Habt ihr denn Schneeketten für eure Wagen?«
Haben wir natürlich nicht, im Flachland mit rundherum Bundesautobahnen braucht man so was nicht, da genügen Winterreifen.
Wir hatten uns dann aber doch auf ein Restaurant hier in der Gegend geeinigt, das zwar keinen Stern vorweisen konnte, dafür jedoch diverse Kochmützen und ein halbes Dutzend Referenzen in Form von Blechschildern rechts und links vom Eingang. Der Serviettenknödel war auch wirklich ausgezeichnet gewesen.
Im Laufe der folgenden Jahre hatten wir eine ganze Reihe Lokalitäten durchprobiert, und diesmal hatte ich eins in Heidelberg ausgeguckt, von dem Hannes behauptete, es biete am ersten Weihnachtsfeiertag ein ausgezeichnetes kalt-warmes Buffet, und das sei doch besser als immer bloß die verschiedenen Variationen von Gans. Völlig richtig! Gänsebraten enthält viel Fett, Fett macht dick, und seit unserer gemeinsamen Nikotin-Abstinenz üben Stefanie und ich auch in diesem Punkt Enthaltsamkeit. Also hatte ich in jenem Fresstempel einen Tisch bestellt.
Nicht gerechnet hatte ich allerdings mit Nickis Protest. »Dann müsst ihr auf uns verzichten! Ich fahre doch jetzt nicht mehr in ein Restaurant, das mindestens eine Autostunde vom Krankenhaus entfernt ist! Das Baby kann praktisch jede Minute kommen, damit muss man immer rechnen, wir haben nämlich Vollmond, und Frau Jansen hat gesagt …«
Frau Jansen war Nickis Hebamme, das wusste ich bereits, und was sie gesagt hatte, konnte ich mir denken. Nach Ansicht fast aller vor dem 20. Juli 1969 ausgebildeten Hebammen übt der Vollmond auch heute noch eine große Anziehungskraft auf ungeborene Babys aus, doch seit Neil Armstrongs Besuch auf demselben hat unser Mond zumindest bei den jüngeren Geburtshelferinnen seine mystische Aura weitgehend verloren. Ich habe die Sache mit der Beeinflussung sowieso nie geglaubt, denn Steffi hatte seinerzeit den in leuchtendem Gelb am Himmel stehenden Vollmond glatt ignoriert und sich noch weitere sechs Tage Zeit gelassen. War auch vernünftig gewesen, sie ist nämlich nicht nur ein Sonntagskind geworden, sondern hat darüber hinaus immer an einem Feiertag Geburtstag – jedenfalls solange sie in Bayern oder Baden-Württemberg lebt.
»Du willst dir das Essen im trauten Familienkreis entgehen lassen bloß auf die vage Möglichkeit hin, dein Sohn könnte es besonders eilig haben?«, zweifelte Stefanie. »Soviel ich gehört habe, dauert es vom Beginn des Countdown bis zu Zero etliche Stunden, also halte ich es für ziemlich unwahrscheinlich, dass Tims Geburtsort mal Bundesautobahn Nummer sechs, Kilometerstein 209 oder so ähnlich lauten könnte.«
»Abgesehen davon besteht halb Heidelberg aus Krankenhäusern und Uni-Kliniken«, warf ich ein, »im Falle eines Falles wärst du dort sogar besser aufgehoben.«
Nicki schüttelte den Kopf. »Während der Feiertage haben die doch überall bloß einen Notdienst sitzen, und wer garantiert mir, dass das nicht ein Medizinstudent im letzten Semester ist?«
Da gab ich es auf. Werdende Mütter sind ähnlich sensibel wie Bräute kurz vor der Hochzeit, man sollte ihnen in allem zustimmen und dann das tun, was man selbst für richtig hält!
Nicki bekam also ihr Kännchen Roibusch-Tee (keine Ahnung, welche schwangerschaftsverträglichen Inhaltsstoffe der hat, bis dato hatte ich nicht mal gewusst, dass es ihn gibt, jetzt steht der Rest immer noch irgendwo hinten im Vorratsschrank) und die Zusicherung, ich würde mich noch im Laufe des Abends um ein näher gelegenes Restaurant kümmern: »Wenn ich das richtig verstanden habe, sollte es möglichst in Rufweite vom Krankenhaus gelegen sein, keinesfalls jedoch weiter entfernt als fünf Kilometer und mit Parkplatz direkt vor der Tür.«
»Ich weiß gar nicht, weshalb du eine Frühgeburt überhaupt für möglich hältst«, bemerkte Steffi grinsend, »schließlich ist das auch Jörgs Kind, und der ist doch noch nie pünktlich gewesen …«
Kapitel 3
Nun ist es nicht ganz einfach, vierzig Stunden vor Beginn der weihnachtlichen Schlemmerorgie ein Restaurant zu finden, dessen Ambiente nicht nur aus rustikalen Holztischen mit karierter Tischdecke und in Plastik eingeschweißten doppelseitigen Speisekarten besteht; nicht zu vergessen die Papierservietten und den großen Porzellan-Aschenbecher mit Reklameaufdruck. Ein bisschen Stil sollte es schon haben.
Doch nach dem sechsten Anruf und dem höflichen Bedauern, man sei schon seit Wochen restlos ausgebucht, war ich drauf und dran, das ganze Unternehmen abzublasen und die Familie einfach mit Hähnchenbrust in Sahnesoße abzufüttern; das wäre zwar kein Drei-Gänge-Menü und schon gar nicht festlich, aber zumindest die Zutaten dafür hatte ich im Haus. Vier Packungen Hähnchenbrust für Notfälle froren schon seit längerer Zeit in der Kühltruhe vor sich hin, und die zwei dauerkonservierten Sahneschachteln mussten auch langsam weg. Ich hatte sie irgendwann im Herbst mal mitgenommen, weil sie bis Silvester halten sollten und man hundertfünfzig Milliliter Sahne immer gerade dann braucht, wenn man sie nicht hat.
»Wenn ich die beiden Tütensuppen aus dem Vorratsschrank mit einer Dose Spargelspitzen verlängere und die Tassen nicht ganz voll mache, könnten sie sogar als Vorspeise reichen. Was meinst du?«
Rolf meinte erst gar nichts, doch dann fiel ihm ein, dass am Heiligen Abend die Geschäfte vormittags alle noch geöffnet und die Tiefkühlgänse bestimmt nicht ausverkauft seien. »Die letzten davon kriegt man doch immer zu Ostern als Sonderangebot.«
»Das stimmt nicht! Die Ostergänse sind welche aus der Frühmast!«
»Aus der – was?«
»Na ja, Frühmastgänse – die sind auch nie so fett!«
Er sah mich an mit einem Blick, in dem Mitleid gepaart war mit männlicher Überheblichkeit. »Wann hast du als Großstadtkind denn jemals eine lebendige Gans gesehen? Außer im Zoo vielleicht.«
»Immerhin bin ich anderthalb Jahre lang mindestens einmal täglich vor diesen Viechern getürmt, wenn sie mit gereckten Hälsen hinter mir her waren!«
»Wo denn? Auf dem Kurfürstendamm?«
»In Ostpreußen, Kinderlandverschickung nach Harteck, Kreis Goldap! Da sind diese Vögel nämlich frei auf der Dorfstraße rumgelaufen!«
Das hatte er vergessen, räumte jedoch ein, dass er von ostpreußischen Gänsen keine Ahnung habe, er sei schließlich gebürtiger Braunschweiger, folglich habe seine Mutter nur Gänse aus der herzoglichen Geflügelzucht auf den Tisch gebracht, und die seien mit Hafer gemästet worden, und zwar im Herbst und nicht im Frühjahr. Jawohl! »Frühmast! So ein Blödsinn! Seit wann isst man Gänse im Sommer?«
»Seitdem es Tiefkühltruhen gibt!« Bevor sich Rolf wieder dem Studium des Fernsehprogramms widmen konnte, drückte ich ihm den Hörer und den Zettel mit den Nummern der noch nicht abtelefonierten Restaurants in die Hand. »Versuch du mal dein Glück! Bisher habe ich nur Frauen an der Strippe gehabt, und die hätten bei einer männlichen Stimme bestimmt weniger abweisend reagiert. Wenn du vielleicht deinen früheren Charme ein bisschen reaktivieren könntest …? Nur kurzfristig natürlich!«, beteuerte ich sofort. »Hier zu Hause brauchst du ihn ja nicht.«
Die Tür flog auf, und hindurch schob sich Steffi mit einem Tablett, auf dem ein Teller mit Weihnachtsgebäck und drei Tassen Cappuccino standen. Ein Tritt mit dem Fuß, dann war die Tür wieder zu. »Kann es sein, dass ich eben was von Charme gehört habe?« Sie stellte das Tablett ab und verteilte die Tassen. »Und zwar in Verbindung mit Papi? War doch ’n Irrtum, oder?« Fragend sah sie mich an.
»In gewisser Weise ja. Es begab sich nämlich schon vor langer langer Zeit, als im siebenten Stock des Düsseldorfer Pressehauses ein charmanter Mann …«
»Au ja, ein Weihnachtsmärchen!«, unterbrach sie mich sofort, setzte sich und sah mich auffordernd an.
Nun hatte Rolf endgültig genug und das konnte ich ihm nicht mal verübeln. Zähneknirschend stand er auf, griff aber doch noch zu Telefon und Zettel und stürmte aus dem Zimmer durch die Essdiele in die Küche. Wieder donnerte die Tür ins Schloss, und diesmal flog sogar der Schlüssel heraus, im Regal kippten ein paar Bücher zur Seite, und meine blaue Majolika-Vase, ein Mitbringsel von unserer abenteuerlichen Wohnmobiltour durch Südfrankreich, begann heftig zu wackeln. Ich konnte sie gerade noch festhalten, bevor sie kippte.
»Könnte es sein, dass wir Papi etwas verärgert haben?« Stefanie schälte sich aus dem Sessel. »Ich trage ihm besser den Kaffee wieder raus, so schnell kommt er bestimmt nicht zurück.«
»Nimm ein paar Kekse mit!«
»Nicht nötig, auf dem Küchentisch steht doch die halb volle Dose.«
»Jetzt ist sie garantiert nicht mehr halb voll! Bring wenigstens den Rest noch mit rein, Weihnachten ist erst morgen!«
Ihre in wechselnder Lautstärke geführte Unterhaltung dauerte genau fünf Minuten, dann kamen Vater und Tochter vereint wieder ins Zimmer und wollten die Versöhnung begießen. Mit einem Glas Sekt. Während Steffi in den Keller stieg und im dort aufs Altenteil gesetzten Getränkekühlschrank (Baujahr 1981) nach einer geeigneten Flasche suchte, meinte Rolf nachdenklich: »Manchmal vergesse ich einfach, dass sie inzwischen vierunddreißig Jahre alt und verheiratet ist. Ich sehe sie immer noch in ihren Lederhosen vor mir, wie sie mit den Jungs Fußball spielt oder in der Spitze vom Apfelbaum sitzt und nicht mehr runter kann!«
»Und du kämst heute nicht mehr rauf, um sie zu runterzuholen!«
»Das hat er doch schon damals nicht gekonnt!« Steffi stellte die Flasche ab und suchte im Schrank nach passenden Gläsern. »Runtergeholt hatte mich Sven, aber Papi hat die Leiter gehalten! Und mir hinterher eine Mark in die Hand gedrückt, damit ich nichts sage. Sven hat sogar drei gekriegt.«
Es ist doch merkwürdig, wie sehr Ereignisse, die seinerzeit einen regelrechten Familienkrach heraufbeschworen hatten, an Bedeutung verlieren, wenn sie Jahrzehnte zurückliegen. Sascha hatte eins hinter die Ohren gekriegt, weil er seine Schwester zu dieser Klettertour herausgefordert hatte, und ich hatte mir von meinem Mann eine halbe Stunde lang anhören müssen, wie sehr ich meine Aufsichtspflicht vernachlässigt hatte, und was dem Kind nicht alles hätte passieren können.
»Dieses Kind wird in dreizehn Jahren und zwei Monaten volljährig«, hatte ich zurückgeblafft, »also sollte es langsam anfangen, Verantwortung für sich selber zu übernehmen!« (Seine schwereren Blessuren hat es sich auch erst geholt, als es bereits über achtzehn war!).
Als wir beim Rückblick auf ihre jugendlichen Heldentaten, von denen die meisten in einer Arztpraxis geendet hatten, bei Stefanies neuntem Geburtstag angekommen waren, einschließlich des unbeabsichtigten Freudenfeuers im Garten, dem drei frisch gepflanzte Bambusbüsche zum Opfer gefallen waren, erinnerte ich an das noch immer nicht gelöste Problem, wo wir denn nun übermorgen das Familien-Weihnachtsessen zu uns nehmen könnten.
»Versuch’s doch mal im Burg-Hotel!«
»Lieber nicht!«, warnte Stefanie. »Da war ich mal mit Hannes, und hinterher sind wir bei McDonald’s gelandet, weil wir noch Hunger hatten. Das Ambiente in dem Restaurant ist spartanisch-edel und das Essen ebenfalls. Nouvelle Cuisine mit riesigen Tellern und dreiteiligem Besteck: Messer, Gabel, Lupe!«
Also doch Hähnchenbrust in Sahnesoße? Geht aber nicht, denn mir war inzwischen siedend heiß eingefallen, dass ich ja Nickis Schwiegereltern ebenfalls eingeladen hatte, nur nicht an den heimischen Herd, da kann ich mit den Kochkünsten von Frau B. nicht konkurrieren, sie hat’s einfach besser drauf! Das hatte ich im Frühjahr wieder feststellen können, als wir den ersten Spargel der Saison bei ihnen auf der Dachterrasse gegessen hatten – mit einer Vinaigrette, die garantiert nicht aus einer Fertigpackung zusammengerührt worden war. Bei dieser Gelegenheit hatte ich auch mit einem kleinen bisschen Neid die neue Einbauküche bewundert – da verschwindet sogar der elektrische Allesschneider auf Knopfdruck irgendwo in der Tiefe eines Unterschranks, und vor allem die gläserne Dunstabzugshaube hatte mich restlos begeistert – sieht richtig futuristisch aus, soll aber sehr pflegeintensiv sein, also werde ich wohl doch besser bei meiner alten bleiben.
Nun erfordert es die Etikette, eine derartige Einladung zu erwidern, und deshalb hatte ich einen gemütlichen sommerlichen Grillabend im Garten geplant, mit Windlichtern rundherum inklusive Mücken, mit verschiedenen Salaten (wir haben einen sehr guten Metzger!), frischem Baguette und diversen Flaschen leichtem Wein, doch irgendwie hatte es den ganzen Sommer über mit den Terminen nicht geklappt. Mal waren die Schwiegereltern verreist, dann wieder hatte Rolf keine Zeit oder Nicki und Jörg hatten nicht gekonnt, und geregnet hatte es auch oft genug. Doch nun stand Weihnachten vor der Tür und damit die letzte Gelegenheit, meinen Gastgeberpflichten nachzukommen – aber nicht unbedingt mit Selbstgekochtem!
Gestärkt mit inzwischen kalt gewordenem Cappuccino, ungefähr einem halben Pfund Plätzchen und zwei Gläsern Sekt fühlte sich Rolf stark genug, die noch übrig gebliebenen Nummern der Reihe nach abzutelefonieren. Wenn er sachlich blieb, war zweifellos ein Mann am Apparat, begann er jedoch Süßholz zu raspeln, dann musste es ein weibliches Wesen sein, und in diesem Fall räumte ich uns größere Chancen ein. Ich sollte Recht behalten!
»Also dann übermorgen um dreizehn Uhr«, beendete er das Gespräch, »und nochmals vielen Dank, gnä’ Frau, Sie haben uns aus einer ganz großen Verlegenheit geholfen.«
»Na, sooo groß war die Verlegenheit nun auch wieder nicht«, behauptete ich, nachdem Rolf den Hörer aufgelegt hatte, »schlimmstenfalls hätte ich immer noch die Tütensuppen und die Hähnchenbrüste gehabt!«
Wann Sven am späten Abend oder sogar erst in der Nacht nach Hause gekommen war, weiß ich nicht, jedenfalls war er noch nicht aus seiner Mansarde aufgetaucht, als der Weihnachtsbaum umkippte. Die nur angelehnte Terrassentür war nämlich aufgeflogen – weil der Postbote geklingelt hatte, musste ich die Haustür öffnen, und da die Zimmertüren offen standen und es draußen ziemlich windig war, gab’s Durchzug. Ich quittierte gerade den Empfang des Päckchens, da knallten gleichzeitig mehrere Türen zu, irgendetwas klirrte und im selben Moment hörte ich Steffi schreien: »Neeeiiiin!«
»Frohes Fest!«, wünschte der Postmensch und machte, dass er wegkam. Nicht mal auf das Trinkgeld hatte er gewartet. Ich drückte die Haustür zu, warf das Päckchen auf den Schuhschrank und lief ins Wohnzimmer. Und dort sah ich eine sperrangelweit geöffnete Terrassentür, durch die munter der Schnee ins Zimmer wehte, und zwei Meter davor eine entsetzte Stefanie, mit einer Hand die sich immer weiter zu Boden neigende Spitze des Weihnachtsbaumes hochstemmend, während sie mit der anderen die flatternde Gardine von den Zweigen fern zu halten versuchte. »Hilf mir doch mal! Ich kann das Ding nicht mehr halten!«
»Lass es doch einfach fallen, da ist eh nichts mehr zu retten!«
Ein weiteres Mal klirrte es, dann schlängelte ich mich an dem Tannen-Torso vorbei und schloss erst einmal die Terrassentür.
»Wie kann man den Baum aber auch genau vor die Tür stellen!« Mit spitzen Fingern sammelte Steffi hängen gebliebene Tannennadeln von ihrem Pullover. »Dort stand er doch noch nie!«
»Richtig! Aber da hatten wir auch noch nicht den großen Fernseher, und weil der nicht in das Regalfach passte, in dem der alte gestanden hatte, mussten wir das ganze Ding ein bisschen umbauen – allerdings konnte ich den früheren Standort des Weihnachtsbaums dabei nicht berücksichtigen. Entweder ungehinderter Zugang zur Terrasse und Zweige vor dem Bildschirm, oder freier Blick zur Glotze, dafür Betreten des Gartens vorübergehend nur außen herum. Und wann muss ich um diese Jahreszeit überhaupt da rein? Gar nicht! Die Petersilie wächst nämlich zurzeit im Blumentopf unten im Keller.« Dann fiel mir etwas ein. »Wieso war die Terrassentür überhaupt offen?«
»Woher soll ich das wissen? Ich war’s jedenfalls nicht!«, kam es zurück, und damit wurde auch diese Frage vorerst zu jenen vielen anderen und bis heute unbeantworteten Fragen gelegt, wie zum Beispiel die, wohin der Duden mit den neuen Rechtschreibregeln verschwunden ist, wem ich diesen scheußlichen Kratzer auf der Tischplatte zu verdanken habe, wieso nach einer angeblich nur dreißig Kilometer weiten Fahrt der Sprit in meinem vorher voll getankten Auto am nächsten Tag gerade noch bis zur Tankstelle um die Ecke gereicht hat und – last, not least – wer im Sommer das knallrote Polohemd zu den ganzen Badetüchern in die Maschine gesteckt hat. Seitdem besitze ich ein halbes Dutzend rosa Frottiertücher und ein Poloshirt, das niemandem gehört.
»Wo fangen wir denn jetzt hier an?«, wollte Steffi wissen, mit spitzen Fingern die lila Überreste einer Kugel vom Boden klaubend. »So kann’s ja wohl nicht bleiben.«
Damit hatte sie zweifellos Recht, zumal der Christbaumständer mit umgekippt war und sich das darin enthaltene Wasser überall verteilte. »Erst mal müssen wir Platz schaffen und den Teppich trockenlegen!«
»Wenigstens ist der Baum ganz geblieben!«, bemerkte Steffi, nachdem sie ihn auf der Terrasse abgestellt hatte. »Von den Kugeln dürfte knapp die Hälfte überlebt haben, und dass die Beleuchtung noch funktioniert, bezweifle ich.«
»Ich auch! Deshalb solltest du jetzt schleunigst deinen Mann anrufen, damit er nachher noch zwei Lichterketten mitbringt!« Wozu hat man schließlich einen Schwiegersohn, der mit so was handelt? »Und ein paar Kartons mit Kugeln, aber bitte keine violetten mehr.«
»Die sind schon lange ausverkauft.«
Richtig, diese Farbe war ja heuer en vogue.
Während Stefanie am Telefon hing und ihrem Hannes wortreich die vorweihnachtliche Katastrophe nebst ihren Folgen schilderte, sammelte ich die Scherben zusammen, wischte den Boden auf, tupfte den Teppich einigermaßen trocken, saugte Glassplitter und Tannennadeln weg und dachte darüber nach, dass Weihnachten irgendwo an einem karibischen Strand auch seine Reize haben musste, zumal man dort gar keine Weihnachtsbäume kennt, sondern – falls überhaupt – bunte Lichtlein an die in diesen Breitengraden üblichen Grüngewächse hängt. Und die bleiben draußen und dürfen im Gegensatz zu unseren Tannen sogar weiter wachsen und groß werden.
»Schönen Gruß von Hannes, und ob er nicht vorsichtshalber noch einen von unseren künstlichen Bäumen mitbringen soll? Der ist standfest, braucht kein Wasser, nadelt nicht, und man kann ihn jedes Jahr wieder verwenden.«
»Aber vorher steht er elf Monate lang in einer Kellerecke als mietfreies Domizil für diese fetten schwarzen Spinnen! Nein danke!«
Als Sven schließlich leicht verpliert auf der Bildfläche erschien, wirkte das Zimmer beinahe so wie vor dem Desaster, nur mit dem einen kleinen Unterschied, dass der am Vorabend noch in lila Pracht erstrahlte Tannenbaum plötzlich aussah, als habe man vergessen, ihn rechtzeitig für die alljährliche Christbaum-Sammelaktion der Jugendfeuerwehr vor die Tür zu stellen.
»Was ist denn mit dem passiert?«, stammelte Sven verblüfft. »Ich gebe ja zu, dass ich mit Wolle, Chris und Manni ein bisschen sehr intensiv unser Wiedersehen begossen habe, aber ihr wollt mir doch nicht erzählen, dass ich zwei Tage lang geschlafen und Weihnachten verpennt habe …«
»Doch«, sagte Steffi, »und wir haben dich überhaupt nicht vermisst!«
Diese Liebe unter den Geschwistern erfreut doch immer wieder das Mutterherz!
Wenig später kam auch Rolf zurück, der noch irgendwo einen Entwurf zur Begutachtung hatte vorbeibringen müssen, und dann war schon wieder Zeit zum Mittagessen, von dem ich noch nicht mal wusste, wie es aussehen würde. Warum muss man überhaupt zu bestimmten Zeiten immer etwas essen? Nur deshalb, weil man das als Kind tun musste, obwohl man oft genug gar keinen Hunger hatte? Ich hatte auch jetzt keinen. Also versammelte ich meine Lieben in der Küche.
»Es ist jetzt genau dreizehn Uhr und somit jener Zeitpunkt, zu dem eine vorbildliche Hausfrau und Mutter ihrer Familie das Mittagessen vorsetzt. Eine vorbildliche Hausfrau bin ich noch nie gewesen, Mutter bin ich nur noch bedingt, heute Abend gibt es traditionsgemäß Kartoffelsalat und Würstchen, der ist fertig, aber wehe, jemand vergreift sich schon jetzt daran, und wer nun unbedingt was essen will, der muss sich selbst was machen. Er kann’s aber auch bleiben lassen und mir helfen, die ganzen Kalorienbomben auf die bunten Teller zu verteilen.«
Stefanie erklärte sich mit mir solidarisch, angeblich war sie auch nicht hungrig, während die beiden Männer von der Aussicht, selber aktiv werden zu müssen, offensichtlich wenig begeistert waren. »Komm, Sohn, ich lade dich ein! Hier hat unlängst ein neuer Döner-Snack aufgemacht, der soll richtig gut sein!«
»Hat er denn heute nicht geschlossen?«, erinnerte Steffi.
»Der ist Moslem, bei denen gibt’s kein Weihnachten«, behauptete Rolf, stand kurze Zeit später zusammen mit Sven vor der verschlossenen Tür und entschied sich für den Chinesen, der aber auch gerade schließen wollte, doch den beiden wenigstens noch zwei in Styropor-Schachteln verpackte Take-away-Portionen über den Tresen reichte. Eine davon enthielt gebackene Calamares, die Rolf verabscheut, Steffi aber liebt (wenigstens eine, die schließlich satt wurde), während der Inhalt des anderen Kartons wie Hühnerfutter aussah und wohl auch so ähnlich geschmeckt haben muss, jedenfalls ist eine Menge davon übrig geblieben.
Nach und nach trudelten die Besucher ein. Als Erster fuhr Jörg vor und lieferte zwei Blechdosen mit Plätzchen ab. »Die hatte Nicole gestern mitzubringen vergessen.«
Abgesehen davon, dass er als Einziger in der Familie seine Frau korrekt mit Nicole anredet, während sie für uns nach wie vor Nicki heißt, möchte ich nur ein einziges Mal erleben, dass er in seiner Freizeit in dem bei Männern doch allgemein so beliebten Gammel-Look herumläuft. Gibt’s einfach nicht! Er ist immer so angezogen, dass er jederzeit seinem Chef, unserem Stadtoberhaupt oder sogar dem Bundespräsidenten die Tür öffnen könnte. Bei ihm gibt es keinen zerfransten Bademantel, keine ausgeleierte Jogginghose und auch kein Sweatshirt, das vor vier Jahren mal gepasst hat, inzwischen jedoch so lang wie breit geworden und zum beliebtesten Kleidungsstück des Besitzers aufgestiegen ist. So etwas hat doch fast jeder Mann im Schrank hängen oder – noch schlimmer! – als ewiges Streitobjekt im Bad liegen, damit es immer gleich zur Hand ist.
Nicht so Jörg. Er trug auch jetzt wieder zwar bequeme und trotzdem wie maßgeschneidert sitzende Freizeithosen, ein Polohemd und darüber einen farblich abgestimmten Pullover. An den Füßen Sportschuhe und nicht solche ausgelatschten Treter, in denen Rolf speziell zu Hause gern herumläuft. Soweit ich mich erinnere, hat er sie mal irgendwann in den achtziger Jahren des letzten Jahrhunderts aus Irland mitgebracht. Angeblich mussten sie aus einem nicht nachvollziehbaren Grund vor dem ersten Tragen mit Guinness ausgegossen werden, und genauso sehen sie auch aus. Die Frage, ob das Bier hinterher vom Besitzer der Schuhe getrunken werden musste, habe ich mir allerdings verkniffen.
Jörg warf einen Blick ins Wohnzimmer, wo Sven bäuchlings auf dem Boden herumrobbte und die verhedderte Lichterkette auseinander fieselte – eine hatte wunderbarerweise überlebt –, äußerte sein Erstaunen, da doch sonst immer schon am Vorabend ein gemeinsames Baumschmücken angesagt war, an dem er sich allerdings noch nie beteiligt hatte, und zog schließlich mit dem Hinweis ab, man käme dann am späteren Abend vorbei.
Pünktlich zum Kaffeetrinken trafen Tom und Katja ein – irgendwann mussten wir ja doch mal etwas essen, weshalb also nicht ein paar Plätzchen, selbst gebackene hatte ich nun wirklich genug vorrätig, voraussichtlich würden sie wieder bis Ostern reichen – und nur wenig später fuhr Hannes vor und begann auszuladen: Drei Lichterketten à hundert Birnchen (welche Vorstellung hatte er eigentlich von der Größe unseres Baumes?), ungefähr ein Dutzend Packungen Kugeln in unterschiedlichen Farben, allerdings keine silbernen, dafür welche in Dunkelgrün-Hochglanz und als Kontrast dazu kakaofarbene, ferner zwei Schachteln voll kristallener Glitzersternchen, die ich ganz vorsichtig behandelte, bis ich dahinter kam, dass sie aus Plastik waren, und als Krönung schließlich eine große braune Tüte, die er eigenhändig in die Küche trug. »Ich habe seit dem Frühstück noch nichts gegessen!«
»Warum hast du nicht vorher angerufen und gefragt, ob du uns was mitbringen kannst?«, moserte Stefanie. »Der brave Mann denkt bis zuletzt an sich selbst, nicht wahr? Muss schon zu Schillers Zeiten so gewesen sein!« Dabei schob sie sich ein Kartoffelstäbchen nach dem anderen in den Mund.
Irgendwie knurrte mir ja auch der Magen, doch ich hatte mir vor den kulinarischen Verlockungen der kommenden Tage etwas Zurückhaltung verordnet, und die fetten Fleischklopse zusammen mit den aus Papptüten ragenden Pommes frites fielen bestimmt nicht unter diesen Begriff. Dabei wird man entgegen der allgemeinen Auffassung gar nicht mal zwischen Weihnachten und Neujahr dick, sondern überwiegend zwischen Neujahr und Weihnachten!
Dank vorbildlicher Zusammenarbeit und mithilfe geistiger Getränke war es uns dann doch noch gelungen, die malträtierte Tanne wieder in einen Weihnachtsbaum zu verwandeln und sogar noch rechtzeitig vor der Bescherung damit fertig zu werden. Reichlich bunt hatte er ausgesehen, und ein bisschen sehr gewöhnungsbedürftig war er auch gewesen, doch sogar Nicki hatte zu später Stunde festgestellt: »Sonst war er eigentlich immer etwas langweilig, also irgendwie zu symmetrisch dekoriert, aber das kann man diesmal wirklich nicht sagen!«
Genau deshalb haben wir ihn ja auch fotografiert!
»Ist Wintereinbruch eigentlich strafbar?«, grummelte Sven vor sich hin, als er durchs Küchenfenster in das Schneegestöber starrte. »Gestern habe ich noch nachgeguckt, ob die Schneeglöckchen schon rauskommen, und jetzt sieht es draußen aus, als ob man bald gar nichts mehr sieht. Wo kommt denn so plötzlich das schlechte Wetter her?«
»Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur unterschiedliche Arten von gutem!«, erinnerte ich ihn an seine früheren Erkenntnisse, wenn er zusammen mit seinem Bruder auch dann noch auf die Rodelbahn gezogen war, wenn die Schneeflächen sich zusehends in grauen Matsch verwandelten und die weißen Flocken in kalten Sprühregen übergingen.
»Ich befürchte ja auch nur, dass wir bei null Sicht dieses komische Restaurant nicht finden werden. Oder weißt du genau, wo das ist? Zum Schwarzen Schimmel – das klingt doch, als hätte uns jemand ganz gewaltig auf den Arm genommen!«
Stimmt! Dieser Widerspruch war mir noch gar nicht aufgefallen, aber Sven hatte Recht: Schwarze Schimmel gibt es nicht, die haben weiß zu sein, sonst sind es keine. Und schwarze Pferde heißen Rappen. Das war schon immer so. Eine logische Begründung für den seltsamen Namen dieses Restaurants fiel mir nicht ein, aber mir hat ja auch noch niemand erklären können, weshalb man »auf Schusters Rappen« unterwegs ist, wenn man mal zu Fuß geht.
Kurz nach zwölf fuhr der Konvoi dunkler Wagen vor, angeführt von Tom und Katja, die aus Platzgründen bei Nicki übernachtet hatten; wir beherbergten ja schon Stefanie nebst Ehemann, gar nicht zu reden von Sven, der die Mansarde hatte räumen müssen und nun in Rolfs Arbeitszimmer kampierte.
Im zweiten Auto saßen Nicki und Jörg, im dritten die Schwiegereltern.
»Reden die nicht mehr miteinander?«, wunderte sich Hannes. »Wohnen nur ein paar hundert Meter auseinander, haben dasselbe Ziel und brauchen trotzdem zwei Autos?«