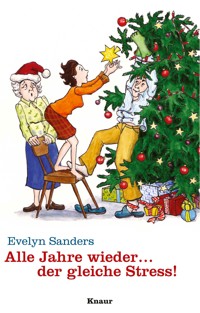6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wenn Evelyn Sanders auf Reisen geht, sind haarsträubende Erlebnisse und jede Menge komischer Situationen vorprogrammiert: Obwohl die »Frau Reisemuffel« am liebsten zu Hause geblieben wäre, lässt sie sich von Freundin Irene zu einer Gruppenreise durch Israel überreden. Kaum wieder daheim, muss Evelyn erneut die Koffer packen, da Tochter Stefanie unbedingt ihre Beziehungsprobleme mit ihr besprechen muss - und zwar während eines Urlaubs auf den Malediven... Heiter, charmant und erfrischend normal - die Chefin der Großfamilie einmal fern von Zuhause!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 452
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Evelyn Sanders
Muss ich denn schon wieder verreisen?
Roman
Knaur e-books
Inhaltsübersicht
Kapitel 1
Angefangen hatte alles mit den Blumenzwiebeln oder, um es korrekt botanisch auszudrücken, mit den Rhizomen. Aus denen waren nämlich immer schwarzgraue Blüten gekommen, obwohl Irene doch ausdrücklich rosafarbene geordert hatte. »Entweder kann er meine Schrift nicht entziffern, oder sein Deutsch ist ähnlich umfassend wie mein Hebräisch«, hatte sie vermutet und ihre nächste Bestellung der Oncocyclus Susiana mit pinkfarbenen Filzstiftstrichen umrahmt. »Ich kann bloß Shalom und Masel tow.«
»Für eine Geschäftskorrespondenz nicht gerade viel«, bestätigte ich. »Was heißt das überhaupt?«
»Guten Tag.«
»Das weiß ich auch. Ich meine doch das andere.«
»Masel tow? Ich glaube, das läßt sich überall verwenden. Damit kannst du jemandem zum Geburtstag gratulieren, gute Reise wünschen oder ihn trösten, wenn er von der Leiter gefallen ist und sich das Bein gebrochen hat. Es hätte ja auch sein Hals sein können.«
»Also ein Wort mit vielfältiger Bedeutung. Na dann: Masel tow!« Ich zeigte auf den inzwischen zugeklebten und frankierten Luftpostbrief. »Mögen die künftigen Susianas endlich in rosa Schönheit erblühen!«
»Das tun sie vermutlich erst dann, wenn ich dem Kerl persönlich auf die Bude rücke und mir die Knollen selber abhole. Dabei weiß ich bloß, daß er seine Gärtnerei in einem Kibbuz irgendwo beim See Genezareth hat.«
Wenigstens davon hatte ich schon mal etwas gehört. »Bißchen weit für einen Wochenendausflug.«
»Eben! Und deshalb werde ich meinen Kunden klarzumachen versuchen, daß die Farbangabe im Prospekt ein Irrtum meinerseits war und dieses exotische Gewächs nur dunkelgrau blüht. Frau Meyer-Sinderfeld wird das allerdings nicht gefallen. Sie hat nämlich rosafarbene Polster.«
»Sie hat was?«
Irene ließ sich in ihren Schreibtischsessel sinken und griff nach einer Zigarette. »Meine zum Teil sehr elitäre und häufig auch leicht überkandidelte Kundschaft legt manchmal Wert auf Pflanzen, die mit dem Ambiente von Wintergarten und Terrasse harmonieren. Frau Meyer-Sinderfeld lebt in einer Pralinenpackung – weißlackierte Rattanmöbel mit roséfarbenen Auflagen; Betonung auf der zweiten Silbe!«
Langsam begriff ich. »Und dazu braucht sie das passende Gemüse? Warum nimmt sie keine Petunien?«
»Die sind ihr zu ordinär.«
Ich dachte an den Wildwuchs in unserem Garten, in dem sich ein paar mutige Dahlien gegen Klee und Löwenzahn zu behaupten versuchen, und an die von Weinlaub umrankte Terrasse, auf der ein paar Kübel mit den Produkten irgendwelcher Samentüten stehen. Nicht mal Sohn Sven mit seinem Gärtnerdiplom kann alle Gewächse identifizieren. Sollte es tatsächlich Leute geben, die ihre Blumen auf die Farbe ihrer Sonnenliege abstimmen? »Was machst du, wenn jemand braune Möbel hat?«
»Den Fall hatte ich schon«, sagte Irene lachend. »Herr Dr. Dr. Gutermund bevorzugt tabakfarbenes Mobiliar, angefangen von den Bodenfliesen bis zur Markise. Jetzt hat er neben seiner Terrasse ein großes Spalier mit Kiwipflanzen. Und ab mittags keine Sonne mehr!« Sie griff nach dem Stapel Geschäftspost und stand auf. »Ich muß den Kram noch zum Briefkasten bringen. Kommst du mit?«
»In drei Stunden geht mein Flieger«, antwortete ich, »und ich habe noch nicht mal gepackt.«
Während Irene den in Ehren – nein, nicht ergrauten, das war er von Natur aus – angerosteten Kombi aus der Parklükke zwischen den beiden Eichen bugsierte, stieg ich die Treppe ins obere Stockwerk hinauf, vergaß auch nicht, die auf der untersten Stufe abgelegten und auf den Weitertransport wartenden Sachen aufzusammeln (diesmal waren es nur zwei Bücher, eine Glühbirne und eine leere Blumenvase), lud oben alles auf dem Korbtisch ab und betrat das Gästezimmer.
Wer häufig mehr oder weniger freiwillig bei Verwandten oder Bekannten übernachten muß, weiß, wie die sogenannten Gästezimmer meistens aussehen. In der Regel wird das ehemalige Kinderzimmer, also der kleinste Raum, dazu ernannt, aus dem Sohn oder Tochter schon seit Jahren ausgezogen sind und das vollgestopfte Regal mit Plüschtieren, Comic-Heften, Federballschlägern und den Erzeugnissen des Werk- beziehungsweise Handarbeitsunterrichts bei Gelegenheit mal abholen wollen. Sie sind bloß noch nicht dazu gekommen. Sein Bett allerdings hat der Nestflüchter beim Auszug mitgenommen, weshalb an seine Stelle das eichene Monstrum von Oma getreten ist, das man damals bei der Wohnungsauflösung nicht loswerden konnte. Und für den Sperrmüll war das gute Stück natürlich viel zu schade gewesen, immerhin sechzig Jahre alt und noch echte deutsche Wertarbeit. Auf dem Bett steht der Korb mit Bügelwäsche, daneben liegen zwei Handtücher für den Gast.
Im Kleiderschrank, häufig auch ein Erbstück längst verblichener Verwandter und deshalb mit einer fantasievollen Konstruktion aus mehreren Einweckgummis zusammengehalten, weil der Schlüssel fehlt und sonst die Türen immer aufgehen würden, hängt wahlweise die Sommer- oder Wintergarderobe der gesamten Familie. Zwei oder drei leere Kleiderbügel ermöglichen es dem Gast, wenigstens die beiden Blusen und eine der Hosen aus dem Koffer zu holen. Der Rest bleibt drin. Vor dem Fenster steht die Nähmaschine, zugedeckt mit einem alten Tischtuch, hinter der Tür lehnt das Bügelbrett und, wenn man Pech hat, auch noch der Staubsauger, den die Gastgeberin morgens um sieben braucht, weil sie schnell noch die Salzstangenkrümel vom Vorabend beseitigen will, bevor der Gast aufsteht.
Der ist aber längst wach, denn die ebenfalls sechzig Jahre alte Matratze hat ihm eine sehr unruhige Nacht beschert. Außerdem liegt sein Zimmer zur Straße hinaus, und die führt direkt zur Autobahn.
Dann gibt es noch das provisorische Gästezimmer, aus dem das vierjährige Kind des Hauses ins elterliche Schlafgemach umquartiert worden ist, dafür aber im Morgengrauen vor der Campingliege des Gastes steht, ihm ein dickes Buch auf den Magen knallt und ihm unmißverständlich klarmacht, daß er jetzt die Geschichte von den drei kleinen Schweinchen vorlesen soll.
Ich habe schon im Hobbykeller geschlafen und im neben dem Haus abgestellten Wohnwagen, habe auf einem zu kurzen Sofa genächtigt oder auch mal auf einer Luftmatratze, und deshalb bin ich jedesmal aufs neue begeistert, wenn ich zu Irene komme.
Sie wohnt in Berlin, genauer gesagt in Zehlendorf, in einem schon etwas altersschwachen Haus, das der Stadt gehört und bei Renovierungsarbeiten immer zu kurz gekommen ist. Den letzten Anstrich hat es vermutlich gleich nach der Währungsreform gekriegt, doch die schwärzliche Fassade wird größtenteils von wildem Wein verdeckt. Außerdem liegt es etwas abseits der Straße, wo der alte Baumbestand gnädig den direkten Blick auf das marode Gemäuer versperrt. Drum herum befindet sich ein großer Garten, der vorne verwildert ist, sich hinter dem Haus jedoch zu einer gepflegten Rasenfläche erweitert mit Blumenrabatten und herrlichen alten Bäumen. Überall am Zaun stehen dichte Büsche, die jedem Unbefugten den Einblick in den hinteren Teil des Gartens verwehren. Dachten wir! Als wir aber an einem heißen Sommertag in der Sonne brutzelten und uns zwecks nahtloser Bräunung auch noch der Bikinihöschen entledigt hatten, erklang plötzlich hinter uns eine männliche Stimme: »’tschuldigung, die Damen, aba det Klingeln hat wohl keener jehört, und ick hab’ hier ’nen Einschreibebrief!«
Betritt man das Innere dieses Hexenhäuschens, dann ist man überrascht. Große hohe Räume bringen die recht eigenwillige Mischung von Ikea und früheren Jahrhunderten voll zur Geltung. Neben der handbemalten Bauerntruhe steht etwas Hochbeiniges mit viel Glas außen und handgeschliffenen Gläsern drinnen; der runde Eßtisch mit den Lehnstühlen stammt aus der Mitte des vorigen Jahrhunderts. Der Bauernschrank fürs Geschirr trägt die Jahreszahl 1711, die schwarze Ledergarnitur in der Sitzecke ist knapp zwei Jahre alt. Der wunderschöne Tisch davor hat bereits drei Kriege überdauert, und den kleinen Sekretär im Nebenzimmer mit den Goldbeschlägen hat Irenes Vater schon von seinem Opa geerbt.
Doch das Mobiliar allein macht nicht das Flair dieses Hauses aus. Die Kleinigkeiten sind es, die jeden Besucher faszinieren. Ein alter Backtrog zum Beispiel, angefüllt mit bunten Steinen, die auf vielen Reisen in vielen Ländern gesammelt worden waren. Oder der wacklige Klavierschemel aus Kaiser Wilhelms Zeiten mit der Suppenterrine aus Meißner Porzellan obendrauf; die Kupferschale mit farbigen Samenkapseln, in einem Fenster leuchtend blaue Glaskugeln, an den Wänden alte Stiche, moderne Drucke und dazwischen auch mal eine spanische Marionettenpuppe.
Überall stehen Kerzenhalter mit farbigen Kerzen. Im großen aus Sterlingsilber stecken rosa Kerzen, in den gläsernen dunkelblaue, auf einem dreieckigen Beistelltischchen flakkert eine dicke honigfarbene Wachskerze, und auf dem Couchtisch haben die Kristalleuchter ihren Stammplatz. Und was das erstaunlichste ist, sie erfüllen nicht nur einen dekorativen Zweck, nein, die Kerzen werden alle angezündet, sobald es draußen zu dämmern beginnt.
»Früher haben wir die Dinger immer angesteckt, um die kalte Bude wenigstens optisch zu erwärmen«, hatte Irene erläutert, als ich mich einmal über diese Illumination wunderte, »doch irgendwann war ich die ewigen Reklamationen leid, habe der Stadt per Einschreiben meinen demnächst zu erwartenden Tod durch Erfrieren angekündigt, und dann endlich haben sie die antiquierte Zentralheizung erneuert. Da waren die Kerzen aber schon fester Bestandteil meines Haushaltsbudgets.«
Ähnlich liebevoll wie die anderen Räume ist auch das Gästezimmer ausgestattet. Neben dem äußerst bequemen, weil neuzeitlichen Bett gibt es eine Sitzecke, unter dem Fenster steht eine uralte Puppenstube, mit der man richtig spielen kann, der Kleiderschrank ist leer, und auf der ebenfalls leeren Kommode liegt eine verzweigte, auf Hochglanz polierte Wurzel, an der lauter Modeschmuck hängt (bei Bedarf zu benutzen!). Leseratten können sich am Bücherregal bedienen, Fantasielose den kleinen Fernseher einschalten. Programmheft vorhanden.
Während ich meine Sachen zusammensuchte und in den Koffer stopfte, rechnete ich nach, wie lange Irene und ich uns schon kannten. Fünf Jahrzehnte und noch ein bißchen darüber. Wir sind nämlich zusammen eingeschult worden.
An diesen Tag kann ich mich noch recht gut erinnern. Zum erstenmal durfte ich den neuen dunkelblauen Rock mit passendem Bolerojäckchen und die ebenfalls neue weiße Bluse anziehen, und dann schlappte ich an der Seite meiner Großmutter mit reichlich gemischten Gefühlen in meinen künftigen Weisheitstempel. In einem Arm hielt ich die viel zu große Schultüte, die andere Hand hatte Omi umklammert, weil meine Schritte immer langsamer wurden, je mehr wir uns der Schule näherten.
Normalerweise pflegen die Mütter ihre Sprößlinge auf ihrem ersten schweren Gang zu begleiten, doch wir hatten Krieg. Mein Vater marschierte siegend durch Frankreich, während meine Mutter im Besetzungsbüro der TOBIS in Babelsberg versuchte, bereits kriegsdienstverpflichtete Schauspieler für den nächsten Film freizustellen – was ihr auch meistens gelang, denn Kintopp war wichtig. Brot und Spiele hatten schon die alten Römer dem Volk versprochen, damit es von den Eroberungskriegen ein bißchen abgelenkt wurde. Na ja, und Brot kriegten wir damals auch noch genug, allerdings auf Marken.
Schon auf dem Schulhof, wo wir uns allmählich sammelten, hielt Omi Ausschau nach potentiellen Freundinnen für mich. Ich war ja ein Einzelkind und als solches ziemlich schüchtern.
»Guck mal, die Kleine da drüben mit den blonden Zöpfen sieht doch recht ansprechend aus«, sagte sie und pirschte sich näher an die Auserwählte heran. »Ihre Mutter macht auch einen sehr soliden Eindruck.«
Den soliden Eindruck vermittelten zweifellos der Hut und die weißen Glacéhandschuhe, und bei der ansprechenden Kleinen dominierte die steif gestärkte Haarschleife, für Omi ein untrügliches Zeichen für häusliche Ordnung. Immerhin trug ich auch so einen Propeller auf dem Kopf und wußte, daß Omi die breiten Bänder nach dem Waschen immer erst durch Zuckerwasser zog und dann unter Seidenpapier bügelte, weil sie sonst am Eisen festgeklebt wären.
Eine erste Kontaktaufnahme mit der soliden Mutter ergab allerdings, daß sie am entgegengesetzten Ende der Riemeisterstraße wohnte, also viel zu weit entfernt, um eine intensivere Beziehung aufzubauen. Ich wurde sowieso nicht gefragt.
Das nächste von ihr angepeilte Objekt war ein schon recht großes Mädchen mit Kurzhaarfrisur, einer ebenfalls sorgfältig gebundenen Haarschleife und einer schmalbrüstigen Begleitperson, die einen gouvernantenhaften Eindruck machte. Es war auch eine! Nein, sie sei nicht die Mutter, teilte sie Omi kurz angebunden mit, die Eltern des Kindes, Herr und Frau von Rothenfelde (oder so ähnlich), seien in diplomatischer Mission unterwegs, und überhaupt werde Irmgard demnächst im Ausland leben.
Omi schluckte die Abfuhr mit einem liebenswürdigen Lächeln, flüsterte mir so was wie »paßt sowieso nicht zu uns« ins Ohr und gab weitere Annäherungsversuche auf, weil wir alle in die Aula gebeten wurden.
Anschließend im Klassenzimmer wurden wir in alphabetischer Reihenfolge aufgerufen und mußten uns nacheinander in die Bänke setzen. »Nur für heute, später könnt ihr natürlich die Plätze tauschen«, versprach die Lehrerin, denn die ersten Tränen waren schon geflossen, weil Freundinnen getrennt worden waren.
Neben mir schob sich ein dunkelhaariges Mädchen in die Bank. Es war mir schon in der Aula aufgefallen, weil es irgendwie aus dem Rahmen fiel. Es hatte nämlich leicht schräg stehende Augen, hohe Wangenknochen und sah überhaupt etwas fremdländisch aus. »Hier bleibe ich nicht sitzen«, wisperte es mir sofort zu, »morgen setze ich mich zu Anita, aber die fängt mit einem anderen Buchstaben an, deshalb muß sie erst mal nach hinten.«
»Bist du von hier? Du siehst so anders aus.« Kinder pflegen selten besonders taktvoll zu sein.
»Natürlich bin ich von hier!« kam es empört zurück. »Und wieso sehe ich anders aus?«
»Weiß ich auch nicht. Eben anders.«
»Du hast ja ’nen herrlichen Knall!«
So begann meine Bekanntschaft mit Irene. Jahre später, als wir schon die Schulzeit hinter uns hatten, erwähnte sie einmal beiläufig, daß sie bereits im Säuglingsalter von ihren Eltern adoptiert worden sei und niemand etwas über ihre eigentliche Herkunft wisse. »Ich vermute einen mongolischen Ururgroßvater, der sich in seinem Zelt eine indische Sklavin gehalten hat. Oder umgekehrt, der Maharani hat ihr mongolischer Leibwächter gefallen. Bliebe nur die Frage zu klären, weshalb der illegitime Nachkomme nicht ersäuft worden, sondern auf rätselhafte Weise in Europa gelandet ist.«
Jedenfalls hat Irene den unbekannten Vorfahren ihr apartes Aussehen zu verdanken.
Zu meinem heimlichen Bedauern wurde sie damals noch nicht meine Freundin. Dabei bewunderte ich sie rückhaltlos. Im Gegensatz zu mir war sie überhaupt nicht schüchtern, gehörte schon bald zu den Beliebtesten in der Klasse – auch bei der Lehrerin –, war eine gute Schülerin und unschlagbar im Sportunterricht. Leider hing sie ständig mit Anita zusammen, die im Haus gegenüber wohnte und mit der sie schon im Sandkasten gespielt hatte.
Das änderte sich erst, als wir ›kinderlandverschickt‹ wurden. Anita kam nach Bayern, weil sie dort Verwandte hatte, die nicht so Glücklichen wurden nach Ostpreußen verfrachtet und Pflegeeltern anvertraut. Ich landete auf einem kleinen Bauernhof, Irene bei einer alleinstehenden älteren Dame, die zwar lieb und nett, aber auch ziemlich langweilig war. Weit weg von zu Hause und zumindest anfangs noch mit einer gehörigen Portion Heimweh behaftet, schlossen wir Berliner uns natürlich enger zusammen, zumal uns die Dorfkinder zunächst mit scheelen Blicken ansahen und uns auslachten, wenn wir schreiend vor den frei herumlaufenden Gänsen mit ihren drohend gereckten Hälsen türmten. Den ostpreußischen Dialekt verstanden wir auch nicht. Lediglich in der Schule sammelten wir ein paar Pluspunkte, denn wir waren mit dem Unterrichtsstoff viel weiter und freuten uns immer auf die regelmäßigen Diktate, bei denen wir mit zwei oder drei Fehlern abschnitten, während die ›Dorfdeppen‹ bei einem Dutzend erst anfingen.
Bevor die große Evakuierung in Ostpreußen begann, holte mich meine Mutter auf abenteuerliche Weise aus dem Hexenkessel heraus. Das Kriegsende erlebten wir einigermaßen unbeschadet in Berlin, und als sich die Verhältnisse wieder zu normalisieren begannen und die Amerikaner unseren Sektor übernommen hatten, traf ich eines Tages Irene in der Ladenstraße.
Von da an sahen wir uns beinahe täglich; morgens in der Schule, denn die hatte wieder ihre Pforten geöffnet, nachmittags, wenn wir Schlange standen, sei es vor dem Bäcker, dem Metzger oder auch mal mit zwei Briketts unterm Arm beim Friseur zur ersten Dauerwelle. Anita kam aus ihrem bayrischen Asyl, Gerda, die vom Kriegsende in Thüringen überrascht worden war, stieß zu uns, und kurze Zeit später war auch Regina wieder da. Unsere ehemalige Clique war komplett. Von den anderen Mitschülerinnen wußten wir kaum etwas, zum Teil waren sie gar nicht nach Berlin zurückgekommen, zum Teil besuchten sie andere Schulen, und einige werden wohl den Krieg nicht überlebt haben.
Da die meisten Schulgebäude in Berlin durch Bomben zerstört waren, mußten die erhaltenen von mehreren Schulen benutzt werden, was nicht nur weniger Stunden, sondern auch Schichtunterricht bedeutete – eine Woche vormittags, die nächste nachmittags. Bei uns hatte sich das Arndt-Gymnasium einquartiert, erstaunlicherweise eine Jungenschule, während wir eine Mädchenschule waren. Von Koedukation hielt man damals noch nicht so viel. Anhand der öfter mal an der Tafel hinterlassenen Matheaufgaben gelangten wir zu dem Schluß, daß wir unseren Klassenraum mit einem etwas älteren Jahrgang teilten; Wurzelziehen hatten wir noch nicht gehabt.
Wer auf die Idee gekommen ist, weiß ich nicht mehr, aber geboren wurde sie während einer der tödlich langweiligen Biologiestunden, wenn wir unter der Bank Karl May lasen, Schiffe versenken spielten oder uns auf ähnliche Weise beschäftigten.
»Ich möchte zu gern mal wissen, wer noch auf meinem Platz hockt«, flüsterte die hinter mir sitzende Anita. »Das muß ein ausgemachtes Ferkel sein. Zwei Tintenflecke sind ja von mir, aber die anderen siebzehn gehen nicht auf mein Konto.« Sorgfältig umrahmte sie die Corpora delicti auf ihrem Tisch mit Rotstift. »Dem Kerl sollte man mal die Leviten lesen.«
»Tu’s doch!« flüsterte ich zurück. »Hinterlaß einfach einen Zettel unter der Bank.«
In der großen Pause brüteten wir gemeinsam über einem Schreiben, das zwar einerseits tadelnd, andererseits aber auch versöhnlich klingend Anitas Empörung zum Ausdruck bringen sollte. Da wir uns über die Anrede nicht einigen konnten – sie variierte zwischen »Lieber Mitbenutzer« bis zu »Altes Dreckschwein« –, verzichteten wir ganz darauf, und was schließlich auf der herausgerissenen Heftseite zu lesen war, klang ungefähr so: »Wenn Du Deinen Füller unbedingt in der Schule saubermachen mußt, dann bring das nächste Mal wenigstens ein paar Löschblätter mit! Mein Tisch sieht inzwischen aus wie ein Blatt vom Polypodium (auch Gemeiner Tüpfelfarn genannt)!«
Am darauffolgenden Tag fanden wir prompt eine Antwort. »Welchen Tüpfelfarn meinst Du genau? Es gibt über 7000 Arten davon. Gruß, Bertram.« Und als PS stand drunter: »Die Flecken stammen übrigens nicht von mir, ich benutze nämlich grüne Tinte.«
Zu meiner Überraschung entdeckte ich unter meiner Bank ebenfalls einen Zettel. »Kannst Du Dein Butterbrotpapier nicht in den Papierkorb werfen, wo es hingehört?«
Eine hektische Suche unter allen Bänken setzte ein, und zum Teil war sie auch erfolgreich. Es hatten noch ein paar andere Knaben Kommunikationsversuche gestartet.
Von nun an herrschte ein reger Briefverkehr zwischen unserer Klasse und der Einquartierung. Persönliches wurde erzählt – mein Partner hieß Wilfried, war fünfzehn Jahre alt und wollte Förster im Grunewald werden –, die Lehrer wurden durchgehechelt, und gelegentlich gab es auch die nicht zu unterschätzende Hilfestellung speziell bei unlösbaren Matheaufgaben. »Ich kriege die Gleichung nicht raus, Du vielleicht?« Am nächsten Tag lag sie da und mußte nur noch ins Heft geschrieben werden.
Natürlich hätten wir ganz gern gewußt, wie unsere Briefpartner aussahen, aber so viel Courage, die vorgeschlagenen Treffen auch einzuhalten, hatten wir denn doch nicht. »Da geht bestimmt die ganze Illusion flöten«, meinte Gerda. »Ich stelle mir den Harald als gutaussehenden schwarzhaarigen Jüngling vor, so ähnlich wie Cary Grant, und in Wirklichkeit hat er vielleicht blonde Strähnen, Pickel und ’ne Nickelbrille. Nee, das lassen wir lieber.«
Irene korrespondierte mit einem Hans. Hatte sie uns anfangs noch die witzigen Briefchen gezeigt, so wurde sie im Laufe der Zeit immer zurückhaltender, behauptete, den Zettel schon weggeworfen oder verlegt zu haben, und wenn wir mal wieder gemeinsam etwas unternehmen wollten, hatte sie immer häufiger keine Zeit. Niemand ahnte, daß sie sich heimlich mit Hans getroffen und über beide Ohren verliebt hatte. Umgekehrt mußte es wohl so ähnlich gewesen sein. Einzelheiten erfuhr ich erst viel später, denn ich übersiedelte mit meiner Mutter nach Düsseldorf, und der Kontakt zu meiner Clique beschränkte sich bald nur noch auf gelegentliche Briefe, die mit den Jahren immer seltener und immer kürzer wurden.
Ich hatte gerade bei einer Kinderzeitung mit dem Erwerb meiner ersten eigenen Brötchen begonnen, als ich abends eine Vermählungsanzeige aus dem Briefkasten fischte. Irene hatte ihren Hans geheiratet. Auf der Rückseite stand: »Pickel hat er nicht mehr, aber er trägt eine Brille und sieht trotzdem gut aus.«
Als ich nach etlichen Jahren zum erstenmal wieder nach Berlin kam, hatte Irene bereits zwei Kinder und wohnte schon in dem Haus, das noch heute mein heimliches Entzükken ist. Hans hatte die väterliche Gärtnerei übernommen und nebenher den Versand von Blumenzwiebeln aufgebaut, indem er aus aller Herren Länder Knollen importierte und an einen immer größer werdenden Kundenkreis verschickte. Ein paar Jahre später verkaufte er die Gärtnerei und widmete sich nur noch seiner Zwiebelkollektion, was weniger arbeitsintensiv, dafür um so lukrativer war. Eigene Kreuzungsversuche mit irgendwelchen exotischen Pflanzen sind zwar danebengegangen, doch für seine neue Tulpenzüchtung hat er sogar einen Preis bekommen; die Urkunde hängt im Gästezimmer.
Inzwischen hatte ich ebenfalls geheiratet, war mit recht aufwendiger Brutpflege beschäftigt, aber wenn ich mal wieder von allem restlos die Nase voll hatte, hängte ich mich ans Telefon und ließ mich moralisch aufrüsten. Nach einer halben Stunde Plauderei über die gesündeste Beschaffenheit von Schulbroten und die zweckmäßigste Behandlung aufmüpfiger Teenager war ich zwar aus meinem Tief nicht herausgekommen, doch ich hatte wenigstens bestätigt gekriegt: Irene ging es auch nicht besser!
Und dann klingelte eines Morgens das Telefon. »Hans ist tot.«
»Was?«
»Vor zwei Stunden. Herzinfarkt.«
Was sagt man in solch einem Fall? Tröstende Worte? Mir fielen keine ein, die nicht banal geklungen hätten. »Soll ich kommen?«
»Ja, aber nicht jetzt. Ich habe gleich die ganze Verwandtschaft auf dem Hals, dabei möchte ich überhaupt keinen sehen. Komm in ein paar Wochen, wenn ich wieder klar denken kann.«
Aus den Wochen wurden dann doch einige Monate, weil ich mir das Bein gebrochen hatte und mich selbst sehr trostbedürftig fühlte. Erst im Sommer wurde ich vom Familienverband für reisefähig erklärt.
Statt einer gramgebeugten Witwe traf ich eine zwar blasse und um etliche Kilo leichtere, aber erstaunlich resolute Irene an. »Natürlich trauere ich immer noch um Hans«, sagte sie, die bei unseren Wiedersehen übliche Sektflasche entkorkend. »Wochenlang habe ich niemanden an mich herangelassen, doch schließlich war es vorbei. Die Trauer ist stiller geworden, und das Leben geht weiter.« Sie füllte die Gläser. »Prosit! Trinken wir auf uns!«
Dann sprudelte es aus ihr heraus: »Als der ganze Auftrieb vorüber und die lieben Verwandten mit dem üblichen Quatsch ›Wenn du Hilfe brauchst, wir sind immer für dich da‹ endlich abgezogen waren, habe ich notgedrungen den Schreibtisch durchforstet. Da fielen mir Bankauszüge in die Hände, Rechnungen, bezahlte und unbezahlte, Einkommensteuerbescheide und, und, und. Zu allem Überfluß hielt auch noch jeden Tag das Postauto vor der Tür und lieferte stapelweise Pakete mit Blumenzwiebeln ab, alles Bestellungen, die Hans noch in Auftrag gegeben hatte. Ich bin beinahe ausgerastet.«
»Kann ich mir denken«, murmelte ich, um überhaupt etwas zu sagen, denn vorstellen konnte ich mir diese Situation nicht.
»Dabei hatte ich doch von nichts eine Ahnung«, fuhr sie fort. »Hans war total patriarchalisch. Er hat noch nach der antiquierten Vorstellung gelebt, daß eine Frau ins Kinderzimmer und an den Kochtopf gehört, für geschäftliche Dinge aber zu dämlich ist. Wenn Not am Mann war, durfte ich zwar das Bügeleisen stehenlassen und Blumenzwiebeln verpacken, aber ich habe nie eine Rechnung geschrieben oder einen Scheck eingelöst.«
»Warum hast du dich denn gegen diese Bevormundung nie gewehrt?«
Sie zuckte nur mit den Schultern. »Wahrscheinlich hat es mir gefallen, daß ich mit dem ganzen Kram nichts zu tun hatte. Geld war immer da, keine Reichtümer, aber genug zum Leben, und für zwei oder auch mal drei Reisen pro Jahr hat es ebenfalls gereicht. Vor geistiger Verblödung schützt einen ja die Berliner Kulturszene. Wir sind oft ins Theater gegangen, hatten einen netten Freundeskreis … Ich hab’ doch nie daran gedacht, daß das von heute auf morgen vorbei sein könnte. Gib mal dein Glas rüber, die Flasche ist ja noch halb voll!«
Während sie die Gläser füllte, erzählte sie weiter: »Nachdem ich die Eckpfeiler unserer Existenz gesichtet hatte, rief ich den Steuerberater an. Der kam auch gleich, und dann haben wir stundenlang über den Papieren gesessen. Es gab nur zwei Möglichkeiten: die Firma verkaufen oder weitermachen. Ich habe mich für letzteres entschieden. Der Schnellkurs in Buchhaltung auf der Volkshochschule war auch ganz hilfreich. Jedenfalls wurstele ich mich schon recht gut durch. Zusammen mit den beiden Roten Socken klappt der Laden sogar fast reibungslos.«
»Rote Socken?«
Sie grinste. »Das sind meine beiden Mitarbeiter, junge Kerle noch, aber schwer in Ordnung. Ihrem Alter entsprechend, sind sie total links. Keine Demo, bei der sie nicht mitmischen, gelegentliche Übernachtung im Knast inbegriffen, aber sonst absolut kompetent und zuverlässig.«
Ich ließ meinen Blick durch das Wohnzimmer schweifen. »Bleibt denn unterm Strich genug Geld übrig, um das Haus zu halten und dir die Margarine auf der Stulle zu garantieren?«
»Es reicht sogar noch für eine Einladung zum Abendessen«, sagte sie lachend. »Ich habe nämlich nur am Wochenende Zeit zum Kochen.«
Seit jenem Tag ist eine Menge Wasser die Spree runtergeflossen, und unsere Freundschaft hat sich gefestigt. Wir sehen uns nicht oft, höchstens einmal im Jahr, und meist bin ich es, die sich in Marsch setzt. Irene hat nur im Winter Zeit zum Verreisen, weil da kein Mensch Blumenzwiebeln in den Boden steckt. Zu dieser Jahreszeit aber bietet mein schwäbisches Domizil wenig Anreize für Besucher. In den geschichtsträchtigen Burgruinen ringsherum, zur Sommerzeit von Touristen überrannt, zieht’s im Winter ganz erbärmlich, und Heidelberg bei Schneetreiben ist auch nicht das Wahre. Umgekehrt ist Berlin im Winter äußerst attraktiv. Sämtliche Theater spielen, eine Ausstellung löst die andere ab, und ein Bummel über den abendlichen Kurfürstendamm ist unterhaltsamer als ein Spaziergang durch die Bad Randersauer Fußgängerzone.
»Bist du fertig?« tönte es von unten.
Himmel, nein! Ich hatte total vergessen, daß Irene mich zum Flugplatz bringen wollte. Ich hatte überhaupt vergessen, daß wieder einmal ein Abschied bevorstand. Mußte wohl ein bißchen zu tief in der Erinnerungskiste gegraben haben.
»Komme gleich!« Ich klappte den Koffer zu, machte ihn wieder auf, weil ich den Kulturbeutel im Bad vergessen hatte, suchte meine Schuhe, mein Ticket, das ich bei meiner Ankunft vorsichtshalber aus der Handtasche genommen hatte, fand es – wie war es da bloß hingekommen? – in der Puppenstube, stopfte es in die Hosentasche, griff nach dem Koffer und polterte die Treppe hinunter. Unten drückte mir Irene ein verschnürtes Paket von Schuhkartongröße in die Hand. »Hier, kannst du mitnehmen.«
»Danke schön, aber ich kriege im Flieger was zu essen. Oder ist etwas anderes drin?«
»Na, Blumenzwiebeln, was denn sonst?«
Kapitel 2
Das war Ende August gewesen. Anfang Oktober rief mich Frau Marquardt an. Hauptberuflich hat sie auch mit Büchern zu tun. Nebenberuflich ›reiseleitet‹ sie – nicht ganz uneigennützig, denn sie liebt ferne Länder, nur stehen die Kosten für einen Trip in exotische Gegenden in einem nicht immer vertretbaren Verhältnis zu ihrem Einkommen. Reiseleiter dagegen müssen nichts bezahlen, sie kriegen noch was dafür. Sie brauchen lediglich Organisationstalent, müssen reden können, diplomatisch sein, und die jeweilige Landessprache zu beherrschen ist vorteilhaft, aber nicht Bedingung.
Mit Frau Marquardt und einer sehr gemischten Gruppe bildungsbeflissener Touristen war ich schon mal fünf Tage lang durch Rom gezogen, hatte unzählige Kirchen und noch mehr Altertümer besichtigt, mir zwei Blasen gelaufen und nach einem abenteuerlichen Rückflug geschworen, nie wieder an einer Gruppenreise teilzunehmen.
Zu einer solchen wollte sie mich jedoch erneut überreden. Diesmal nach Israel. Elf Tage quer durchs Land.
»Ich bin doch nicht lebensmüde«, war das erste, was mir einfiel. »Die schießen sich da unten ja dauernd gegenseitig tot!«
»Zur Zeit ist es absolut ruhig«, blockte sie ab. »Ich bin gerade erst zurückgekommen, nachdem ich die Reiseroute abgefahren war.«
»Etwa allein?«
»Natürlich allein, was dachten Sie denn?«
Das behielt ich lieber für mich. Man kann einer Verrückten schließlich nicht sagen, daß sie verrückt ist. »Ihnen sind wirklich keine zerschossenen Autos, keine Militärkolonnen und keine randalierenden Araber aufgefallen?«
Sie lachte lauthals los. »Mit Arabern habe ich in einem arabischen Dorf Tee getrunken, Soldaten sind mir nur als Anhalter begegnet, die übers Wochenende nach Hause wollten, und die liegengebliebenen Autos am Straßenrand rosten da schon seit dem Jom-Kippur-Krieg. Sonst noch Fragen?«
Aber natürlich, eine ganze Menge sogar. Nach ungefähr siebenunddreißig Telefoneinheiten hatte sie mir klargemacht, daß Israel ein interessantes, äußerst friedliches Land ist, das zu bereisen in jedem Fall lohnenswert sei, besonders im November, wenn dort die Sonne scheint, während hier bei uns die Nebelschwaden wallen.
Zumindest das war ein einleuchtendes Argument. Und auch der frischgepreßte Orangensaft, der angeblich nirgendwo so gut schmeckt wie im Land der Apfelsinenplantagen. Ich habe wirklich schon sämtliche Säfte durchprobiert, die in der Fernsehwerbung immer so beredt als ›von Frischgepreßten kaum zu unterscheiden‹ angepriesen werden, aber leider bin ich noch nie dem netten Mann begegnet, der einem immer die Augen verbindet, bevor man trinken darf. Dem hätte ich nämlich einiges zu sagen gehabt!
Nach der fünfundvierzigsten Gesprächseinheit hatte mich Frau Marquardt so mürbe gemacht, daß sie mir die Reiseunterlagen schicken durfte. Ja, ich würde sie mir genau ansehen und mich wieder melden. Bis dahin erst mal tschüs und schönen Abend noch.
Israel! Wer fährt da schon hin, wenn er nicht muß? Irene vielleicht wegen ihrer Blumenzwiebeln, aber doch nicht ein normaler Mensch mit normalen … Moment mal, wenn ich sie zum Mitkommen überreden könnte, sähe die Sache möglicherweise anders aus. Zu zweit macht eine Reise viel mehr Spaß, man hat jemanden, mit dem man reden (und lästern!) kann, braucht nicht ständig mit der ganzen Gruppe herumzupilgern, kann mal auf eigene Faust losziehen und ist trotzdem nicht ganz allein. Und überhaupt ist Irene ein sehr brauchbarer Partner, weil sie nie den Kopf verliert. Das hatte sie schon als Teenager auf einem Schulausflug bewiesen, als ein Mädchen von einer Kreuzotter gebissen worden war und niemand gewußt hatte, was wir tun sollten. Sogar unsere Lehrerin war wie ein aufgescheuchtes Huhn herumgeflattert und hatte nach einem Arzt geschrien, der auf der unbewohnten Havelinsel natürlich nicht aufzutreiben gewesen war. Irene hatte mit einem Taschenmesser die winzige Wunde vergrößert, das Blut ausgesaugt und danach mit einem Gürtel den Arm abgebunden. Die Rettungsmedaille hatte sie zwar nicht bekommen, jedoch ein dickes Lob vom Arzt und später eine Privataudienz bei unserem Direx, der ihr zur Belohnung zwei nagelneue Schreibhefte in die Hand gedrückt hatte. Die waren vor der Währungsreform mehr wert gewesen als jeder Orden.
Frau Marquardt hielt Wort. Zwei Tage nach ihrem Anruf blätterte ich die Unterlagen durch, verfolgte auf der dazugelegten Karte die Reiseroute und mußte zu meinem Bedauern feststellen, daß ein Abstecher zum Roten Meer nicht vorgesehen war. Das wäre doch wenigstens was gewesen! Strand, Sonne und Schwimmen im warmen Wasser. Allerdings soll es im Roten Meer Haie geben, und die Wahl zwischen erschossen zu werden oder als Fischfutter herhalten zu müssen hätte den gleichen Endeffekt gehabt. Das Tote Meer dagegen war ungefährlich; dort kann man ja nicht mal ertrinken. Das zumindest würden wir ausprobieren können. Mal hören, was Irene dazu sagt.
Ich hatte sie ohnehin anrufen und mich über die miserable Qualität ihrer Zwiebeln beschweren wollen. Gleich nach meiner Rückkehr aus Berlin hatte ich die Knollen vorschriftsmäßig im Boden versenkt, sogar frische Blumenerde daraufgehäufelt und jeden Tag gewartet, daß irgendwas Grünes zum Vorschein kommt. Jetzt, nach sechs Wochen, war noch immer nichts zu sehen.
Irene nahm meine Reklamation mit bewundernswertem Gleichmut entgegen. »Eigentlich hatte ich vorausgesetzt, daß du des Lesens kundig bist und darüber hinaus sogar weißt, daß Krokusse zu den Frühjahrsblühern gehören. Im März wirst du einen buntgesprenkelten Rasen haben.«
Na bravo! Und ich hatte die Zwiebeln in einer Reihe neben der Terrasse in den Boden gesteckt, wo sie im März bestimmt nicht zur Geltung kommen würden, weil um diese Zeit kein Mensch draußen sitzt.
»Und woher, bitte schön, hätte ich wissen sollen, daß aus diesem Trockengemüse Krokusse werden? Ich bin kein Botaniker, der die lateinischen Abkürzungen in verständliche Begriffe übersetzen kann. Fibl. ssp. Alex klingt so ähnlich wie das, was Ärzte auf ihre Rezepte schreiben.«
Ein paar Minuten blödelten wir herum, dann kam ich zum eigentlichen Grund meines Anrufs. »Hast du Lust, mit nach Israel zu kommen?«
Sie hatte keine. Eine andere Antwort hatte ich auch gar nicht erwartet. Immerhin brauchte ich erheblich weniger Gesprächseinheiten als Frau Marquardt, um Irene zur Lektüre der Prospekte zu überreden. »Ich schicke sie heute noch ab«, versprach ich. »Und denk daran: Wenn du deine Zwiebeln beim Erzeuger selbst abholst, kannst du die Fahrt als Geschäftsreise steuerlich absetzen.«
»Du doch auch.«
»Wie denn? Ich handle nicht mit Grünkram.«
»Dann schreibst du eben ein Buch über die Fahrt!«
Sollte einigen von Ihnen schon ein früheres Werk von mir in die Hände gefallen sein und sollten Sie es sogar gelesen haben, dann wissen Sie, daß ich nicht nur einen Ehemann habe, sondern darüber hinaus fünf Kinder beiderlei Geschlechts, von denen die letzten zwei gleich zusammen gekommen waren. Bis auf die Zwillinge hatte der Nachwuchs schon das Elternhaus verlassen, war aber in erreichbarer Nähe geblieben, so daß sich im Bedarfsfall – und vor allem bei hohen Feiertagen – die ganze Sippe relativ schnell zusammenfinden kann. Der Bedarfsfall tritt immer dann ein, wenn ein Familienmitglied etwas nicht Alltägliches beabsichtigt, also umziehen, auswandern, heiraten oder das Studium schmeißen will. Verreisen gehört auch dazu. Je nach Lage der Dinge wird dem Betreffenden zu- oder abgeraten. Die Diskussionen können nach einer Stunde beendet sein oder auch erst nach mehreren, doch meistens ist es uns gelungen, das aufmüpfige Sippenmitglied wieder zur Vernunft zu bringen. Sohn Sven pflegt weiterhin als Landschaftsgärtner deutsche Parkanlagen, statt in kanadischen Wäldern nach Waschbären zu jagen; Tochter Stefanie hat eingesehen, daß eine Zweizimmerwohnung leichter sauberzuhalten ist als eine Vierzimmermaisonettewohnung, die sie sowieso nicht hätte bezahlen können, und die Zwillinge haben inzwischen ihr Staatsexamen und finden es im nachhinein doch befriedigender, Sechsjährigen in der Schule Lesen und Schreiben beizubringen statt Dreijährigen im Kindergarten die Nasen zu putzen.
Nur bei Sascha haben wir uns vergeblich den Mund fußlig geredet. Er hat trotzdem seine englische Vicky geheiratet und ist entgegen aller Prognosen noch immer nicht geschieden.
Der Familienrat wurde einberufen, und man befand, daß ich mir einige Ferientage verdient habe. Die hinter mir liegende Lesereise quer durch Nordrhein-Westfalen war ziemlich anstrengend gewesen – jeden Tag eine andere Buchhandlung, jede Nacht ein anderes Bett –, und überhaupt hatte ich in diesem Jahr noch gar keinen richtigen Urlaub gehabt. Ich unterscheide nämlich zwischen Muß- und Will-Reisen.
Muß-Reisen sind zum Beispiel Fahrten nach Unterbopfelheim zu Onkel Henry, wenn er mal wieder auf dem Sterbebett liegt, bei meiner Ankunft jedoch aus der Dorfkneipe geholt wird. Zwei Nächte auf dem Ledersofa und vier üppige Mahlzeiten später darf ich wieder nach Hause fahren.
Eine Muß-Reise ist auch der achtzigste Geburtstag von Tante Lotti, sehr feierlich im Roten Salon eines Viersternehotels mit morgendlichem Sektempfang und abendlichem Diner, zu dem die Geladenen in Abendgarderobe zu erscheinen haben. Tante Lotti in Silberlamé präsidiert den Mumienkonvent, denn selbstverständlich sind die Gäste überwiegend recht betagt, nur nicht ähnlich begütert wie die Gastgeberin, weshalb die vorgeschriebenen Abendkleider zwischen Taftmoiré (fünfziger Jahre) und Seide mit Filetstickerei am Ausschnitt (noch früher!) variieren. Die Smokingjacken der Herren sind auch längst aus der Mode und gehen vorne nicht mehr zu. Der stellvertretende Bürgermeister erscheint mit einem Präsentkorb, hat nur einen dunklen Anzug an, darf aber trotzdem ganz unten an der Tafel mitessen.
Mein Tischherr ist einundneunzig und schon etwas senil, die Unterhaltung wenig ergiebig. Immerhin erfahre ich, daß der Herr Professor Chefarzt eines Krankenhauses und Spezialist im Veröden von Krampfadern gewesen ist. Ob ich auch welche habe? Da ich passen muß, verliert der Herr Professor das Interesse an mir und wendet sich an die Dame zu seiner Linken, die genau wie er ein künstliches Gebiß und ebenfalls Schwierigkeiten mit ihrem Entrecôte hat. Es war in der Tat etwas zäh geraten.
Nachdem das Streichquartett seine bezahlten zwei Stunden abgegeigt hatte, durfte ich mich auch verabschieden. Mit dem stellvertretenden Bürgermeister kippte ich noch etwas Handfestes an der Bar – der Champagner kam uns allmählich aus den Ohren heraus –, dann stieg er in sein Auto und ich die Treppe zu meinem Zimmer hinauf. Am nächsten Morgen noch Frühstück mit Tante Lotti nebst detailliertem Bericht über den restlichen Verlauf des Abends (»Stell dir vor, mein Liebes, wir haben in der Hotelbar sogar noch getanzt!«), dann war ich in Gnaden entlassen.
Der fünfundachtzigste Geburtstag ist mir erspart geblieben; Tante Lotti ist drei Monate vorher friedlich entschlafen.
Zu den Muß-Reisen gehören auch die gelegentlichen Fahrten zum Verlag, wo man bei den meiner Ansicht nach völlig überflüssigen Besprechungen (wozu gibt es Telefon?) erst literweise mit Kaffee abgefüllt und dann ins Restaurant geschleppt wird, weil alle Verleger offenbar der Ansicht sind, sie müßten ihren Autoren mal ein kostenloses Mittagessen spendieren. Wenn man sich seine Honorarabrechnungen ansieht, ist diese Überlegung gar nicht so abwegig!
Eine Muß-Reise ist auch die alljährlich stattfindende Buchmesse. Bisher gab’s nur die in Frankfurt, jetzt veranstaltet Leipzig ebenfalls eine, und wenn man nicht gerade einen Blinddarmdurchbruch oder zwei Gipsbeine vorzuweisen hat – eins ist zuwenig, damit kann man ja noch laufen –, muß man hin. Und das nur, um mehr oder weniger dekorativ am Stand herumzusitzen und gelegentlich mit freundlichem Lächeln seinen Namen in ein Buch zu schreiben. Hin und wieder fegt ein Außendienst-Mitarbeiter vorbei, stutzt, dreht sich um, kommt zurück, um einem die Hand zu schütteln und gleichzeitig zu bedauern, daß er einen Termin habe.
»Schade, ich hätte mich gern mal mit Ihnen unterhalten. Sind Sie nachher noch da?«
Natürlich ist man noch da, nur hat der Außendienst-Mitarbeiter inzwischen zwei neue Termine.
Meine letzte Muß-Reise führte mich zu einem Verlag, der in einer seiner Illustrierten einen Roman von mir als Fortsetzung bringen und die Autorin entsprechend vorstellen wollte. Ob man eine Reporterin sowie einen Fotografen schicken dürfe?
Bloß das nicht! Zu gut erinnerte ich mich noch an die ›Heimreportage‹ einer Rundfunkzeitung, zu der man vor Jahren aus dem gleichen Grund zwei Interviewer zu uns in Marsch gesetzt hatte. Damals ist mein Nachwuchs von der Aussicht, sich in Wort und Bild abgedruckt zu sehen, noch begeistert gewesen, doch jetzt hätte man ihn weder mit Geld noch mit tausend Bitten vor eine Kamera gekriegt. Also erklärte ich mich bereit, hinzufahren und mich für die Rubrik ›Zu Gast in unserer Redaktion‹ befragen und ablichten zu lassen. Auf diese Weise blieb mir wenigstens das sonst übliche mehrmalige Umziehen erspart, denn vor dem blühenden Fliederbusch kann man keine blaue Bluse tragen, die hebt sich farblich nicht so richtig ab, und wenn man vor der Bücherwand posieren muß, darf man nur etwas Einfarbiges anziehen, weil der Hintergrund schon bunt genug ist. Der weiße Hosenanzug wiederum paßt nicht in die Küche, die ist nämlich auch weiß.
Diese Art Modenschau bleibt einem erspart, wenn man, neutral gekleidet, dem betreffenden Verlag selbst auf die Bude rückt und es dem Fotografen überläßt, den ihm genehmen Hintergrund zu suchen. Allerdings kann es dann passieren, daß er einen bei zwei Grad minus in den nahe gelegenen Park zu dem so zauberhaft verschneiten Tulpenbaum schleppt. Ohne Mantel!
Den nachhaltigsten Eindruck hat zweifellos jene Muß-Reise nach Luxemburg bei mir hinterlassen, als die privaten Fernsehsender noch in den Kinderschuhen steckten und die bekanntesten Gesichter auf dem Bildschirm die der Nachrichtensprecher waren. Die Prominenz hielt sich mit Auftritten bei den neuen Sendern noch zurück, und man war bereits dankbar, wenn überhaupt jemand kam, dessen Namen eventuell schon mal jemand gehört hatte.
Ich habe (vermutlich aus gutem Grund) nie herausbekommen, wer vom Verlag mich für befähigt gehalten hat, mein neues Buch via Bildschirm vorzustellen, und es ist mir heute noch rätselhaft, weshalb ich mich überhaupt darauf eingelassen habe. Vermutlich war es Saschas Schuld gewesen, der aus nicht mehr rekonstruierbaren Gründen zu Hause herumsaß und sich langweilte. »Na klar machste das«, bestimmte er sofort. »Ich fahr dich auch hin. Ein Fernsehstudio wollte ich schon immer mal von innen sehen.«
Diesen Wunsch hatte ich zwar noch nie verspürt, doch legte der Verlag großen Wert auf meinen Auftritt. Immerhin sei ich rhetorisch nicht ganz ungewandt, und überhaupt laufe der Verkauf des neuen Buches noch gar nicht so besonders gut. Das ändere sich bestimmt, sobald ich vor einem Millionenpublikum etwas darüber erzählt habe.
»Von wegen Millionenpublikum«, räsonierte ich. »Wer setzt sich denn an einem Feiertag vormittags vor die Glotze?« Daß ich an einem Montag im ›Frühstücksfernsehen‹ auftreten sollte, war mir bekannt, nicht jedoch, daß es sich um den Pfingstmontag handelte. Das wurde mir erst nach einem Blick in den Kalender klar.
»Ein Feiertag ist doch gerade gut«, widersprach mein Sohn. »Da hängen die meisten zu Hause rum und wissen nichts mit sich anzufangen. Was tun sie also? Fernsehen!«
»Aber nicht morgens um halb neun. Um die Zeit löffelt die gesamte Familie ihr Sonntagsei, sofern sie überhaupt schon aufgestanden ist, und Papa verbietet das Fernsehen, denn er will ja in aller Ruhe mit seiner Sippe frühstücken.«
Sascha gab nicht auf. »Du mußt mal an die Kinder denken! Die drücken doch noch im Halbschlaf auf den Einschaltknopf.«
»Nur dürften die sich mehr für Tom und Jerry interessieren als für Buchbesprechungen. Leider heiße ich nicht Mark Twain.«
»Der ist sowieso out!«
Es half alles nichts, ich hatte zugesagt und konnte nicht mehr zurück. So quälten wir uns am Pfingstsonntag von einem Autobahnstau zum nächsten und schafften es tatsächlich, abends um sechs beim Sender zu sein. Dreimal waren wir daran vorbeigefahren, weil wir in diesem unauffälligen Haus mit dem mickrigen Seiteneingang niemals ein Fernsehstudio vermutet hätten. Es war aber doch eins, auch wenn es mehr auf Improvisation als auf Können angewiesen war. Inzwischen dürfte sich wohl einiges geändert haben.
Ein Besprechungsraum im ersten Stock wurde uns als Wartezimmer zugewiesen, und als ich die verschiedenen Muster der überall herumstehenden benutzten Kaffeetassen hätte auswendig nachzeichnen können, erschien endlich ein langhaariger Twen. Entschuldigung, aber Herr XY, der morgen das Interview mit mir mache, sei im Moment nicht da, ich müsse also mit ihm vorliebnehmen. Mueller sei sein Name, mit ue. Leider habe er überhaupt keine Ahnung von Ikebana, und ob ich die zur Demonstration erforderlichen Blumen selber mitbringen würde. »Brauchen Sie eine Vase, oder haben Sie die dabei?«
Offensichtlich lag hier ein Irrtum vor. »Ich schreibe Bücher«, bemerkte ich schüchtern.
»Ach so.« Der Jüngling blätterte in den mitgebrachten Zetteln. Endlich hatte er den richtigen gefunden. »Dann sind Sie Frau Sauter?«
»Sanders!« verbesserte Sascha zähneknirschend.
»So? Tut mir leid, aber die Klaue hier kann kein Mensch lesen.« Mit einem Rotstift korrigierte er meinen Namen. »Sie sind um acht Uhr siebenunddreißig dran, gleich nach dem Wetterbericht. Vorgesehen sind maximal sechs Minuten. Bitte nichts Kleinkariertes anziehen, das flimmert auf dem Bildschirm, am besten etwas Einfarbiges, aber möglichst nichts in Weiß.« Er raffte seine Papiere zusammen und stand auf. »Haben Sie noch Fragen?«
»Ja, zwei!« sagte Sascha. »Frage eins: In welchem Hotel übernachten wir? Und Frage zwei: Wann muß meine Mutter morgen auf der Matte stehen?«
»Im Parkhotel, zweimal um die Ecke rum und dann auf der linken Seite, und was die zweite Frage betrifft: Um sechs Uhr.«
»Wie bitte?« Da mußte ich mich wohl verhört haben. »Ich denke, das ist eine Vormittagssendung.«
Herr Mueller mit ue sah mich mitleidig an. »Zuerst findet ein Vorgespräch mit Herrn XY statt (an seinen Namen kann ich mich beim besten Willen nicht mehr erinnern), dann müssen Sie in die Maske, und etwas essen sollten Sie vorher auch noch.«
»Gibt’s denn im Hotel nichts?«
»Doch, aber erst ab sieben. Wir improvisieren hier immer ein Frühstück.« Er reichte uns beiden die Hand. »Dann also bis morgen früh. Und fallen Sie nicht die Treppe runter, die ist frisch gebohnert.«
»Hm«, meinte Sascha, als wir wieder draußen standen, »irgendwie hatte ich mir das anders vorgestellt. Und bilde dir bloß nicht ein, daß ich morgen um halb sechs aufstehe. Die paar Schritte kannst du ja wohl allein gehen.«
Sicher hätte ich das gekonnt, doch letztendlich hatte er mich zu diesem Abenteuer überredet, und nun sollte er auch die Konsequenzen mittragen. »Entweder kommst du mit, oder du kannst dein Abendessen nachher selbst bezahlen.«
Woraufhin er sich zum Mitkommen entschloß!
Um halb elf, als ich gerade mein Buch zur Seite gelegt und das Licht ausgeknipst hatte, trabte Sascha in mein Zimmer. Das Abschließen hatte ich mal wieder vergessen. »Bei mir ist der Fernseher kaputt. Geht deiner?«
»Keine Ahnung, ich habe ihn nicht ausprobiert.«
Er fummelte an der Fernbedienung herum. »Mußt du denn jetzt unbedingt noch in die Röhre gucken? Geh lieber ins Bett.«
»Will ich ja, aber ohne Fernseher ist das so langweilig.«
»Du schläfst ja doch davor ein.«
»Eben!« Und dann, etwas zögernd: »Würde es dir viel ausmachen, das Zimmer mit mir zu tauschen? Der Kasten hier ist nämlich in Ordnung.«
Das allerdings war nicht zu überhören. Schüsse peitschten, Autoreifen quietschten auf einer Sanddüne, ohnehin ein akustisches Phänomen, ein Hubschrauber ratterte, und weil der Krach noch nicht laut genug war, wurde das ganze Spektakel musikalisch untermalt. »Stell den Ton leiser!«
»Mach ich ja schon.« Er mußte jedoch den falschen Knopf erwischt haben, denn der Radau steigerte sich zu einer das Gehör schädigenden Phonzahl. »Du sollst die Kiste abstellen!« brüllte ich.
»Will ich ja!« brüllte er zurück, drückte den nächsten Knopf, und dann war da wenigstens nur noch lautes Stöhnen. Im anderen Kanal wälzte sich ein Pärchen auf schwarzen Seidenlaken. »Das ist übrigens der Sender, bei dem du morgen auftrittst«, informierte er mich grinsend.
»Ja, aber nicht in Unterwäsche.«
Bevor ich mein Bett räumte, weil Sascha sonst doch keine Ruhe geben würde, konnte ich mir die Bemerkung nicht verkneifen, daß Fernsehen keine Garantie für Weitblick sei.
»Das vielleicht nicht«, konterte mein Sohn, »aber du mußt doch zugeben, daß ein Fernsehapparat das intelligenteste aller Haushaltsgeräte ist. Statt Hemden wäscht es Gehirne.«
»Dann müßte deins inzwischen porentief rein sein!«
Um fünf klingelte der Wecker. Draußen dämmerte es erst, doch was ich durchs Fenster sah, hob nicht gerade die Stimmung. Nieselregen sprühte an die Scheiben, und die Birkenwipfel im Park gegenüber kamen sich gegenseitig ins Gehege. Windig war es also obendrein. Na ja, Pfingsten! Was kann man da schon anderes erwarten? Ostern war ja auch verregnet gewesen.
Mit einem Prominenten-Coiffeur, der meine Haare in eine telegene Form bringen würde, konnte ich kaum rechnen, also do it yourself. Das Shampoo hatte ich zu Hause vergessen, also mußte es wohl am Duschgel gelegen haben, daß meine Frisur ein bißchen anders ausfiel als normalerweise. Besser jedenfalls nicht.
Das fand auch Sascha, den ich nach vier vergeblichen Versuchen endlich aus dem Bett gescheucht hatte. »Meine Güte, Määm, Afrolook trägt doch heute kein Mensch mehr!«
Es war ja gar keiner. Eigentlich sollte die ganze Sache nur ein bißchen leger aussehen, jetzt war ein Mop daraus geworden. Auch egal. Rollkragenpullover an, Hundehalsband drüber (verkauft worden war mir die dicke Kette als Modeschmuck) – fertig!
»Du siehst aus, als würdest du zum Kegeln gehen«, mekkerte Sascha. »Hast du nicht was Eleganteres mit?«
»Wozu denn? Ich kriege ja nicht den Büchner-Preis überreicht. Und meine Zuschauer, so es denn überhaupt welche geben sollte, werden größtenteils im Bademantel vor dem Fernseher sitzen.«
Im Gegensatz zu mir hatte sich Sascha regelrecht gestylt. Messerscharfe Bügelfalten, Hemd, Krawatte, Blazer …
»Vielleicht sollte man lieber dich vor die Kamera setzen. Optisch gibst du wesentlich mehr her als ich, und über das Buch wirst du wohl auch ein paar Sätze sagen können.«
»Dazu müßte ich es ja gelesen haben«, erwiderte mein Sohn.
Der Prophet gilt eben nichts im eigenen Land! Hatte mein Nachwuchs sich auf meine ersten beiden Bücher noch regelrecht gestürzt, so ließ das Interesse nun allmählich nach. Jetzt kann es durchaus vorkommen, daß ein Nachbar sich bei Nicole erkundigt, ob sie tatsächlich mal in einer Milchfabrik Joghurtbecher zugedeckelt habe. Er habe das in meinem letzten Opus gelesen.
»Tatsächlich? Dann muß sie das ja auch schon wieder verwurstet haben.«
Im Funkhaus herrschte bereits reger Betrieb. Offenbar war ein Job bei der Institution Fernsehen doch nicht so erstrebenswert, denn vor dem Aufstehen schon aufstehen zu müssen, ist nicht jedermanns Sache. Meine jedenfalls nicht!
Diesmal wurden wir sofort empfangen. Man schob uns in ein total überfülltes Zimmer, in dem auf einem Kühlschrank drei Kaffeemaschinen blubberten. Frische Brötchen wurden aufgeschnitten (der Fleiß französischer Bäcker muß wohl auf ihre luxemburgischen Kollegen abgefärbt haben), jemand schrie nach Leberwurst, ein anderer nach Marmelade. Dazwischen klingelte das Telefon, und fortwährend kam oder verschwand jemand durch die Tür.
Ich fühlte mich gleich zu Hause. Genauso war es früher bei uns so zwischen halb sieben und sieben zugegangen, bevor alle fünf Gören in die Schule mußten.
»Im Kühlschrank liegt noch ein Rest Lachs von gestern. Wenn den heute keiner ißt, können wir ihn wegschmeißen.« Ich bekam einen Teller und ein Messer in die Hand gedrückt, ein Mann mit Bart räumte bereitwillig seinen Stuhl – »ich bin sowieso fertig« –, ein anderer stellte eine Tasse Kaffee vor mich hin, ein junges Mädchen reichte die Butter herüber. »Ist ja alles ein bißchen chaotisch hier, aber wir ziehen in Kürze um. Dann bekommen wir sogar eine richtige Küche. Wollen Sie Käse?«
Langsam fing die Sache an, mir Spaß zu machen. Die Stimmung war ausgesprochen locker. Außer Sascha schien es keinen einzigen Morgenmuffel zu geben. Kein Mensch nahm Notiz von mir, Besucher waren die Regel, nicht die Ausnahme, und so fühlte sich auch niemand bemüßigt, dauernd um uns herumzutänzeln. Für die nächsten zwei Stunden gehörte ich ganz einfach zum Team.
Irgendwann ließ der Zustrom hungriger Mitarbeiter nach, und das Zimmer leerte sich. Übrig blieben außer Sascha und mir zwei Dutzend Kaffeetassen, ein Stapel benutzte Teller, eine Untertasse mit Käserinden, diverse halbvolle Aschenbecher sowie ein jüngerer Herr in grauem Anzug mit Krawatte und passendem Einstecktuch. Dank dieses Outfits zwischen all den Jeans und Schlabberpullis war er mir schon vorher aufgefallen. Mit Recht, wie sich jetzt herausstellte, denn er war mein künftiger Gesprächspartner.
Jetzt wurde es ernst! »Ja, Frau Sanders«, begann er, »ein Interview sollte man zwar vorher nicht absprechen, doch ein paar Stichworte müßten wir schon festlegen. Gibt es irgend etwas Bestimmtes, worüber Sie nicht gern reden würden?«
»Nein, Tabuthemen kann ich mir gar nicht mehr leisten. Nach vier Büchern über meine Familie sitzen wir sowieso schon alle im Glashaus. Ich wäre nur dankbar, wenn Sie mir nicht auch wieder die gleichen Fragen stellen würden, die ich mindestens schon hundertsiebenundzwanzigmal beantwortet habe.«
»Und das wären welche?«
Ich zählte sie der Reihe nach auf. »Die meisten davon habe ich im vorliegenden Buch sowieso behandelt, schon deshalb würden sie sich erübrigen.«
Herr XY schrieb etwas auf einen Zettel. »Dann werde ich Sie nachher ganz einfach vorstellen und Sie fragen, ob Sie schon immer Schriftstellerin werden wollten, und falls nicht, wie Sie zum Schreiben gekommen sind.«
Ich hatte es doch geahnt! »Also gut, dann werde ich diese Frage eben zum hundertachtundzwanzigstenmal beantworten.«
Er guckte etwas unsicher. »Irgendeinen Einstieg müssen wir haben.«
»Das ist mir klar, und ich werde auch ganz brav darauf eingehen, aber die übrigen Standardfragen ersparen Sie mir, ja?« Das sicherte er zu, und damit war die Vorbesprechung auch schon zu Ende. Nun kam Sascha an die Reihe. »Sind Sie der ältere oder der jüngere Sohn?«
»Der Zweitgeborene.«
»Werden Sie auch mal in die Fußstapfen Ihrer Mutter treten?«
»Ganz bestimmt nicht«, fuhr ich dazwischen, »der schreibt ja nicht mal Briefe.«
»Wozu auch«, meinte Herr XY, »es gibt doch Telefon.«
»Das schon«, Sascha grinste über das ganze Gesicht, »nur sind Satellitengespräche ziemlich teuer.«
Jetzt wurde Herr XY hellhörig. »Wieso Satellit? Wo leben Sie denn?«
»Jeden Tag woanders.«
»Nanu? Sind Sie Pilot?«
»Nee, Steward auf ’nem Kreuzfahrtschiff.«
»Das ist ja interessant.« Herr XY wechselte seinen Platz und setzte sich zu Sascha. »Welche Route fahren Sie denn? Mittelmeer? Malta, Madeira, Abstecher auf die Kanaren und so weiter?«
Saschas Grinsen wurde immer unverschämter. »Eigentlich mehr Pazifik, Indischer Ozean und so weiter, also Neuseeland, Bali, Hongkong mit Abstecher auf die Malediven.«
Herr XY staunte. »Das muß dann aber ein ziemlich großer Pott sein. Kenne ich ihn?«
»Möglich«, sagte Sascha gleichmütig. »Er heißt Queen Elizabeth II.«
Herr XY holte frischen Kaffee. »Wollen Sie auch noch welchen? Nein? Ist auch besser. Diese Höllenbrühe garantiert baldigen Herzinfarkt.« Er jonglierte die Tasse zum Tisch zurück und setzte sich wieder. »Geht es auf so einem Dampfer wirklich zu wie in der Traumschiff-Serie? Die hätten wir übrigens auch gern gehabt, hat tolle Einschaltquoten. Erzählen Sie doch mal ein bißchen.«
Sofort winkte Sascha ab. »Lieber nicht, sonst kriege ich Krach mit der Reederei. Fernsehfilme haben nur selten etwas mit der Realität zu tun.« Dann plauderte er aber doch aus dem Nähkästchen, und je mehr er erzählte, desto interessierter wurde Herr XY. Schließlich meinte er: »Würden Sie sich zutrauen, ähnlich locker vor der Kamera zu reden?«
»Na klar, warum nicht?« Erst dann schien Sascha aufzugehen, was diese Frage bedeutete. »Sie denken doch nicht etwa an einen Auftritt im Fernsehen?«
Genau das schwebte Herrn XY vor. »Wir sollten das möglichst bald durchziehen, solange die MS Astor beim ZDF noch über den Bildschirm schwimmt. Traumschiff und Wirklichkeit, das wäre ein tolles Thema.«
»Für Sie vielleicht, aber ich wäre meinen Job los. Welcher Betrieb mag es schon, wenn man ihm hinter die Kulissen schaut? Nee, das lassen wir schön bleiben. Und außerdem ginge es auch gar nicht. Am Freitag muß ich wieder in Southampton sein. Dann ist mein Urlaub zu Ende.«
Das stimmte zwar nicht, sein Kahn würde erst in zwei Wochen wieder seinen Heimathafen anlaufen; doch das brauchte Herr XY ja nicht zu wissen.
»Frau Sanders bitte in die Maske!« tönte es aus einem unsichtbaren Lautsprecher. Ein dienstbarer Geist brachte mich in ein kleines Kabuff, in dem außer einem Stuhl mit einem Spiegel davor und einem Wägelchen voller Schminkutensilien gerade noch Platz für die Maskenbildnerin blieb.
Zehn Minuten später sah ich wie ein rosa Schweinchen aus. Das müsse so sein wegen der Scheinwerfer, wurde ich belehrt, bekam noch einen Rougetupfer auf die Wangen und durfte gehen. Niemandem außer Sascha fiel mein Babygesicht auf. »In welchen Farbkübel haben sie dich denn gesteckt?«
»Ich bezweifle ja auch, daß mir der pinkfarbene Lippenstift steht, aber vielleicht sehe ich nachher auf dem Bildschirm fünfzehn Jahre jünger aus.«
»Lieber nicht, dann müßtest du nämlich mit dreizehn zum erstenmal gemuttert haben!«
Herr XY kreuzte meinen Weg. »Sind Sie fertig? Wir sind gleich dran.«
Jetzt wurde mir doch ein bißchen mulmig. Im Bauch fing es an zu kribbeln, ein Kloß setzte sich in der Kehle fest, meine Stimme hatte sich in ein Krächzen verwandelt. Wenn doch bloß schon die nächste Viertelstunde vorbei wäre.
»Und sag nicht dauernd ›äh‹«, flüsterte mir Sascha noch zu, bevor ich Herrn XY ins Aufnahmestudio folgte. Was ich erwartet hatte, kann ich heute nicht mehr sagen, auf keinen Fall jedoch ein simples Wohnzimmer mit Bücherschrank und Sitzecke, dessen Ausmaße ungefähr dem sozialen Wohnungsbau entsprachen. Lediglich die an der Decke befestigten Scheinwerfer paßten nicht so ganz zum Ambiente. Dem Sofa gegenüber war die Kamera postiert, und damit hatte sich’s auch schon. Keine Kabelträger, keine Dame mit Puderquaste, kein Aufnahmeleiter, nur ein Monitor in der Ecke mit einem Männergesicht, das den Wetterbericht verlas: Überwiegend bewölkt und für die Jahreszeit zu kühl.
Ich mußte auf dem Sofa Platz nehmen, Herr XY ließ sich im daneben stehenden Sessel nieder, rückte die Vase mit den Pfingstrosen etwas zur Seite, wandte sein Gesicht zur Kamera und setzte, sobald das rote Licht aufflammte, ein sehr gekonntes professionelles Lächeln auf. »Einen schönen guten Morgen und herzlich willkommen zum Frühstücksfernsehen. Wir haben heute …«