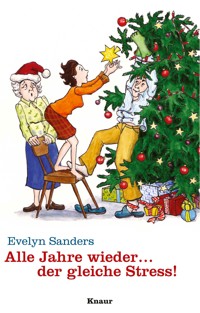6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Küken sind zwar schon ausgeflogen, aber der elterlichen Nestwärme noch lange nicht entwachsen. Ob Liebeskummer, Wohnungssuche oder Examensvorbereitung, Mutter Sanders bleibt Dreh- und Angelpunkt der Familie. Und wenn sie sich einen solchen Luxus wie eine Lesereise erlaubt, geht alles drunter und drüber. Selbst die Gegenstände in der Wohnung scheinen sich verschoben zu haben. Herzerfrischend Heiteres von der Bestsellerautorin!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 562
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Evelyn Sanders
Schuld war nur die Badewanne
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Die Küken sind zwar schon ausgeflogen, aber der elterlichen Nestwärme noch lange nicht entwachsen. Ob Liebeskummer, Wohnungssuche oder Examensvorbereitung, Mutter Sanders bleibt Dreh- und Angelpunkt der Familie. Und wenn sie sich einen solchen Luxus wie eine Lesereise erlaubt, geht alles drunter und drüber. Selbst die Gegenstände in der Wohnung scheinen sich verschoben zu haben …
Inhaltsübersicht
Familiengeplauder
Alle Jahre wieder
Westöstlicher Briefwechsel und seine Folgen
Aller Anfang ist schwer
Frühstücksbons und Seniorenkaffee
Geburtstagsparty im »Löwen«-Haus
Eselspfade und andere Umwege
Fahrerwechsel
Frau Schmitt mit Doppel-T
Zwischen Frankfurt/Oder und Berlin
Victors Villa contra Friedrichs Schloss
Die große Frage: Leerer- oder Lehrerstuhl
Kühlschrank gegen Waschmaschine?
Doppelter Umzug
Das Straßenfest
Betriebsbesichtigung
»Nie wieder auf so ’ne Karre!«
Schuld war nur die Badewanne
O mia bella Venezia!
Es wird ernst
Polterabend
Die große Stunde naht
»Kraft des mir verliehenen Amtes …«
Familiengeplauder
Düdellüdellüt … düdellüdellüt … düdellüdellüt …«
Warum, um alles in der Welt, muss dieses verflixte Telefon immer gerade dann bimmeln, wenn ich im Keller die Waschmaschine füttere, oder, wie jetzt, oben in der Mansarde die Fenster inspiziere, ob jemand die längst überfällige Reinigung nicht doch noch eine Woche hinausschieben kann? In der Beliebtheitsskala unerlässlicher Hausarbeiten kommt Fensterputzen bei mir gleich hinterm Wäschebügeln!
Das Telefon steht 24 Stufen tiefer im Erdgeschoss. Bis ich die zwei Treppen hinuntergespurtet bin, hat der Anrufer entweder aufgegeben, oder die Konserve hat sich eingeschaltet. Sofern ich nicht wieder vergessen habe, auf den entsprechenden Knopf zu drücken. Seit meinem letzten Geburtstag besitze ich sogar ein transportables Telefon, familienintern »Knochen« genannt, aber der hat auch seine Tücken. Entweder habe ich versäumt, den Akku auszuwechseln, dann geht überhaupt nichts, oder – was meistens der Fall ist – ich finde den Hörer erst gar nicht. Mal ist er unter der aufgeschlagenen Zeitung vergraben, mal liegt er im Wohnzimmer zwischen den Sofakissen, doch meistens buddle ich ihn in Rolfs Zimmer aus. Aber auch nur dann, wenn es gerade läutet und ich das Teil akustisch orten kann. Früher konnte man sich in chaotischen Haushalten wenigstens mit Hilfe der Zuleitungsschnur zum Apparat vorarbeiten, bei den strippenlosen Dingern geht das auch nicht mehr. Wen also wundert es, wenn ich von den technischen Fortschritten nicht immer gleich begeistert bin?
Nach Ansicht meiner Nachkommen, denen ich das nützliche Geschenk zu verdanken habe, soll ich den Knochen ständig mit mir herumtragen. Nun bin ich jedoch ein entschiedener Gegner von Kittelschürzen mit ihren unbestritten praktischen Taschen (ihre Aufnahmekapazität erstaunt mich immer wieder; unsere Putzfrau stopft sogar den Inhalt eines halben Papierkorbes hinein), doch ich trage meistens Jeans. Und bei denen wiederum sind die Taschen lediglich Dekoration. Deshalb räume ich sie auch nie aus, und deshalb habe ich unlängst Svens Mini-Geldbeutel samt Führerschein und Scheckkarte versehentlich mit in die Maschine gesteckt. Das Waschpulver hat auch prompt gehalten, was die Werbung versprochen hatte: Die Papiere sind hinterher so weiß gewesen, dass wir sie nicht mehr lesen konnten.
Das Telefon bimmelt immer noch. Ich beschließe also, dass die Fenster noch nicht geputzt werden müssen – man kann noch deutlich erkennen, dass draußen ein bisschen die Sonne scheint –, und jage die Treppen hinunter. Zu spät. Meine leiernde Stimme teilt dem Anrufer gerade mit, dass ich nicht zu Hause bin. Inzwischen dürfte er das ohnehin gemerkt haben.
Den Text sollte ich auch mal ändern. Diesen dämlichen Spruch, ich sei gerade unterwegs, um das Geld aufzusammeln, das bekanntlich auf der Straße liegt, kennen mittlerweile alle Freunde. Zwischendrin quäkt Katja: »Nun geh doch endlich ran, ich weiß ja, dass du da bist!«
Kann sie überhaupt nicht! Sie hat jetzt im Hörsaal zu sein und sich mit den Werken von Pestalozzi und Frau Montessori herumzuschlagen. Angehende Lehrer müssen auch das lernen, was dank unzähliger Schulreformen und neuer psychologischer Erkenntnisse längst überholt ist.
Endlich habe ich den Hörer in der Hand. »Wieso bist du nicht in der Uni?«
»Weil die letzte Vorlesung mal wieder ausgefallen ist. Sitzt du?«
Nein, ich sitze nicht. Den einzigen erreichbaren Stuhl hat Hund Otto belegt, der meine Aufforderung, den Platz zu räumen, stoisch ignoriert. Nicht umsonst ist er ein gebürtiger Bayer. Wahrscheinlich hat er es uns nie verziehen, dass er in einen preußischen Haushalt geraten ist. Notgedrungen lehne ich mich also gegen den Esstisch. »Ich bin darauf trainiert, Katastrophenmeldungen auch stehend entgegenzunehmen. Raus mit der Sprache, was ist passiert?«
»Sei nicht immer so destruktiv«, kichert Katja, »freu dich lieber! Du wirst nämlich Oma!«
»Bei wem? Etwa bei dir?«
Katja ist Studentin im siebten Semester und sollte eigentlich hinreichend aufgeklärt sein. Außerdem nimmt sie die Pille. Sie wiegelt auch sofort ab. »Im Augenblick reichen mir die Kids, mit denen ich mich im Praktikum herumärgern muss. Nein, Vicky ist schwanger.«
»Woher weißt du das?«
»Sie hat es Steffi erzählt, und die hat mich gerade angerufen.«
Die Kommunikation innerhalb unserer Familie klappt immer noch hervorragend.
»Konnte sie sich das nicht früher überlegen?«, jammert Katja. »Ich habe doch meine Weihnachtsgeschenke schon alle zusammen. Was meinst du, ob ich ihr einen Gutschein für fünf Packungen Pampers schenke? Den brauche ich erst im Herbst einzulösen. Momentan bin ich nämlich total pleite.«
Das ist sie meistens und nicht nur zwei Wochen vor Weihnachten. »Wann soll denn das Baby kommen?«
»Na ja, September oder so. Ich nehme doch an, dass auch Engländerinnen die gleiche Tragezeit haben wie normale Frauen. Oder glaubst du, dass die später werfen?«
»Vicky ist kein Elefant!«
»Noch nicht«, gluckst Katja. »Ach ja, noch etwas: Du weißt natürlich nichts von dem Familienzuwachs. Vicky hat es Stefanie unter dem Siegel der Verschwiegenheit erzählt.«
»Und deshalb hat sie dich auch gleich angerufen?«
»Na klar. Aber ich soll’s nicht weitersagen. Wahrscheinlich wollen sie dir die Neuigkeit als Weihnachtsgeschenk präsentieren. – Du, ich muss Schluss machen, es klingelt. Das wird Nicki sein. Die hat mal wieder ihren Schlüssel verbummelt. Bin neugierig, was sie sagt, wenn sie hört, dass sie Tante wird.«
Vielen Lesern dieses Buches wird meine Familie schon bekannt sein, und manche von ihnen haben den Werdegang meiner Nachkommen quasi vom Windelalter an verfolgt, doch es soll immer noch einige Menschen geben, die den Sanders’ schen Familienclan nicht kennen. Und bevor sie das Buch entnervt zur Seite legen, weil ihnen der Durchblick fehlt, sei mir eine kurze Rückschau gestattet:
Die Silberhochzeit habe ich seit etlichen Jahren hinter mir, was den Schluss nahelegt, dass ich noch immer mit demselben Mann verheiratet bin. Rolf ist Werbeberater (heute heißt das public relations manager oder wenigstens art director, seinerzeit reichte die deutsche Bezeichnung) mit zunehmender Tendenz zum Ruhestand – eine Entwicklung, die ich mit Besorgnis verfolge. Doppelt so viel Ehemann mit halb so viel Geld! Er hat zwar viele Hobbys, aber die machen ja nur Spaß, solange man keine Zeit dafür hat. Wie hatte sich das früher immer angehört? »Ich würde ja wirklich gern mal wieder im Garten wursteln, ich kriege es bloß zeitlich nicht auf die Reihe. Der Prospekt für Meier und Schulze muss wieder geändert werden, die Kaffeetassen sollen doch lieber weiß bleiben, zur Druckerei soll ich kommen, und der Steuerberater hat auch schon zweimal angerufen.«
Jetzt hätte Rolf Zeit für die Hobbys, nur hat er keine Lust mehr. »Rasen mähen? Der ist doch noch ganz nass!«
Dieser mitunter etwas turbulenten Ehe sind im Laufe von zehn Jahren fünf Kinder entsprossen. Sohn Nr. 1 ist Sven. Aus dem naturbegeisterten Knaben, der meinen Kühlschrank mit Gläsern voll toten Spinnen, Regenwürmern und ähnlich Eingemachtem zu füllen pflegte, ist ein Landschaftsgärtner geworden, der sich ganz in unserer Nähe etabliert hat und sein Leben als Junggeselle zu beenden gedenkt. Bis jetzt wenigstens!
Sohn Sascha, zwei Jahre jünger, hatte Ähnliches im Sinn gehabt, reduzierte die Zeitspanne später auf »vor meinem dreißigsten Geburtstag heirate ich auf keinen Fall!«, und wurde dann doch mit siebenundzwanzig Ehemann besagter Vicky, die eigentlich Victoria heißt und noch immer englische Staatsbürgerin ist. Kennengelernt hatte er sie auf der QUEEN ELIZABETH II, jenem Kreuzfahrtschiff, auf dem er als Steward zwei Jahre lang um die Welt gefahren war. Vicky ist ausgebildete Tänzerin und gehörte zur Showtruppe des Riesenkahns. Seine Verlobung hatte uns Sascha telefonisch irgendwo aus dem Indischen Ozean mitgeteilt, und kennengelernt habe ich meine Schwiegertochter erst bei der Hochzeit in England.
Wenige Tage später importierte Sascha seine Gattin nebst einem Lieferwagen voll Möbel und Hochzeitsgeschenken nach Deutschland, quartierte vorübergehend alles bei uns ein, weil die angemietete Wohnung noch nicht fertig war, und überließ es mir, der jungen Ehefrau sowohl die deutsche Sprache als auch die Grundbegriffe von Haushaltsführung beizubringen. Deutsch kann sie inzwischen!
Eine Zeitlang hatte er noch in seinem erlernten Beruf als Restaurantfachmann gearbeitet, dann jedoch das Silbertablett an den Nagel gehängt mit der Begründung, dass dieser Job ausgesprochen familienfeindlich sei. Unregelmäßige Arbeitszeiten, Dienst auch an Feiertagen und so weiter. Bis dahin war ihm das nie aufgefallen, seine jeweiligen Freundinnen waren alle aus der Hotelbranche gekommen. Jedenfalls eröffnete er uns eines Tages, er habe einen ihm genehmen Posten in der Industrie gefunden, womit allerdings ein Umzug nach Mainz verbunden sei, aber eine Wohnung gebe es bereits. Er informierte eine Umzugsfirma und zog mitsamt Ehefrau, Hund Mäx sowie inzwischen vergrößertem Hausrat nach Norden. Seitdem steigt er die Karriereleiter stetig aufwärts, aber da Vicky sich beharrlich weigert, den Führerschein zu machen und auf diese Weise selber mobil zu werden, sehen wir uns relativ selten. Die Telekom verdient jedoch ganz gut. Vicky ruft grundsätzlich tagsüber an.
Als Sascha das Kindergartenalter erreicht hatte und nur noch nachmittags mit dreckbeschmierten Gummistiefeln durchs Haus marschierte, entschlossen wir uns zu einem dritten Kind, das hoffentlich ein Mädchen werden und mit Puppen statt mit verbeulten Blechbüchsen spielen und keine halbtoten Mäuse in den Taschen herumschleppen würde. Es wurde tatsächlich ein Mädchen – zumindest optisch. Kinderbilder zeigen ein niedliches Gör mit großen dunklen Augen und einem fast schwarzen Lockenkopf. Nur bei der Erziehung müssen wir etwas falsch gemacht haben. Stefanie entwickelte sich zum dritten Jungen, schmiss die Puppen aus dem Puppenwagen und setzte Nachbars einäugige Katze rein, klaute ihren Brüdern die Matchbox-Autos und wünschte sich zum Geburtstag Fußballschuhe. Ihre Freunde waren überwiegend männlichen Geschlechts, mit denen sie sich herumprügelte und dabei meistens die Oberhand behielt. Die letzte Keilerei erlebten wir, als sie elf war und sich mit Busenfreund Manuel in den Haaren lag. Diesmal siegte männliche Kraft über weibliche Finessen, und soviel ich weiß, haben die beiden Kontrahenten seitdem nie wieder ein Wort miteinander gewechselt.
Meine Vorstellung von einem Mädchen hatte aber ganz anders ausgesehen! Statt pastellfarbener Kleidchen kaufte ich robuste Lederhosen für Steffi, statt Lackschühchen feste Treter mit Lkw-Bereifung, und das kleine silberne Armband, Geschenk von Oma zum vierten Geburtstag, hing schon am nächsten Tag zerrissen an einem Ast vom Mostapfelbaum.
Also ein letzter Versuch, die männliche Vorherrschaft in unserer Familie zu brechen. Nicole sollte unsere Tochter heißen, einen Jungennamen hatten wir erst gar nicht parat. Einen zweiten Mädchennamen aber auch nicht! Wer rechnet schon mit Zwillingen??? Bei der ersten Begutachtung seines doppelten Nachwuchses meinte Rolf denn auch: »Welche von den beiden ist denn nun der Mengenrabatt?«
Seit jenem Tag sind 23 Jahre vergangen. Die Zwillinge studieren in Heidelberg, haben eine kleine Dachgeschosswohnung, sind fest mit jeweils einem Thomas verbandelt, was sie aber nicht hindert, an den Wochenenden häufig und grundsätzlich ohne Vorwarnung im Elternhaus aufzutauchen, oft genug mit Kommilitonen im Schlepptau, die genauso abgebrannt sind wie sie selber, den Kühlschrank halb leer fressen und mit den verbliebenen Resten im Kofferraum zwei Tage später wieder abziehen.
Dackel Otto wurde bereits erwähnt. Laut Stammbaum heißt er »Zorro von der Frankenhöhe«, doch trotz der adeligen Herkunft lassen seine Manieren sehr zu wünschen übrig. Hundedamen gegenüber verhält er sich ausgesprochen chauvinistisch, und von Heldenmut kann auch keine Rede sein. Seine Vorfahren haben Pokale eingeheimst und sogar Prüfungen abgelegt als Stöberhund und KaninchenschleppeHerauszieher, was immer das auch bedeuten mag, doch Otto türmt schon winselnd unter den nächsten Stuhl, sobald er nur Katjas Goldhamster wittert.
Womit die Familie vorgestellt wäre und das Buch endlich anfangen kann.
Alle Jahre wieder
Wenn die in den nächsten zehn Minuten nicht einreiten, fangen wir an«, moserte Sven, »mein Magen hängt schon in den Kniekehlen!«
»Da wäre er eine Zeitlang ganz gut aufgehoben.« Katja warf einen vielsagenden Blick auf Svens Taille. »Als ich dir den Gürtel zum Geburtstag geschenkt habe, hat er noch im dritten Loch gepasst.«
»Alle Säugetiere der nördlichen Hemisphäre legen sich Winterspeck zu, das hat die Natur so vorgesehen«, behauptete er grinsend, »aber ich fange ja schon an, ihn wieder abzubauen.«
»Wie denn?«
»Mit einer Joghurtdiät.«
Jetzt wurde Steffi aufmerksam. »Davon habe ich noch nie was gehört. Was darfst du denn da essen?«
»So ziemlich alles. Außer Joghurt.«
»Idiot!!!«
Heiligabend. Fest des Friedens und der Familie. Die Familie war fast vollzählig versammelt, doch die friedliche Stimmung geriet bereits ins Wanken. Die ersten zwei Würstchen waren auch schon geplatzt. Ich schaltete den Herd ab und sah auf die Uhr. Halb acht. Zwei Stunden maximal braucht man von Mainz bis zu uns, wo also blieben Sascha und Vicky?
»Otto kratzt an der Tür«, meldete Nicole, »muss der etwa jetzt noch raus? Ich gehe jedenfalls nicht schon wieder. Vorhin habe ich ihn bloß hinter mir her gezerrt.«
Stimmt. Otto ist ausgesprochen lauffaul und dürfte der einzige Hund sein, dem die Leine grundsätzlich längs über der Schnauze hängt. Normale Dackel rennen vorneweg, Otto schleicht im Zeitlupentempo hinterher. Rolf öffnete die Terrassentür. Der Hund steckte den Kopf ins Freie, befand den Schneeregen als für ihn unzumutbar, drehte um und verkroch sich unterm Schaukelstuhl, nicht ohne vorher einen anklagenden Blick in meine Richtung geworfen zu haben. Die vielen Leute gingen ihm ganz offensichtlich auf die Nerven. Außerdem war kein Sessel mehr frei, und sein Lieblingsplatz auf dem Sofa war ebenfalls belegt.
Wer hat eigentlich behauptet, wenn man in die mittleren Jahre käme und die Kinder so nach und nach aus dem Haus gingen, würde bei den gestressten Eltern allmählich Ruhe einkehren? Aus dem Haus gehen sie ja wirklich, doch nach kurzer Zeit kommen sie wieder und sind zu zweit. Früher hatten sich außer uns allenfalls noch eine und einmal sogar alle beiden Omas zum Ansingen der Edeltanne eingefunden, doch jetzt ähnelte unser Wohnzimmer immer häufiger einem Theaterfoyer kurz vor Beginn der Vorstellung. Gesungen wird auch nicht mehr.
»Wenn das so weitergeht, müssen wir anbauen«, hatte Rolf erst unlängst überlegt. »Stell dir bloß mal vor, hier tummeln sich noch zwei bis sieben Enkelkinder und wollen Ostereier suchen.«
Im Augenblick hatten sich allerdings erst die eventuellen Erzeuger dieser Enkelkinder eingefunden, nämlich Steffis Dauerfreund Horst Hermann sowie die beiden Thomasse. Katja legt übrigens großen Wert darauf, dass ihr Thomas Tom genannt wird, um jede Verwechslung mit Nickis Thomas auszuschließen. Die Gefahr ist allerdings sehr gering, denn die beiden ähneln sich überhaupt nicht, und dass Thomas im internen Kreis bei uns nur noch »der Schwabe« hieß, hat Nicki erst erfahren, als ich mich in ihrer Gegenwart mal verquasselt hatte. Darauf hatte sie mich drei Wochen lang nicht angeguckt, obwohl ich ihr begreiflich machen wollte, dass diese Bezeichnung nichts mit seinem Charakter zu tun hätte, sondern lediglich mit seiner Herkunft. Sehr überzeugend kann ich nicht gewesen sein!
Lediglich Sven hockte unbeweibt auf dem Boden und ärgerte Otto. Die Eltern seiner Freundin pflegten die Feiertage immer in ihrem Ferienhaus bei Marbella zu verbringen, hatten ihn auch zum Mitkommen aufgefordert, doch das hatte er abgelehnt. »Im Kofferraum ’ne Plastiktanne und im Hinterkopf ein ellenlanges Vergnügungsprogramm einschließlich Silvesterball in so einem Schickimicki-Laden. Nee, danke. Ohne mich!«
Bremsen quietschten, ein Hund bellte, drinnen antwortete Otto – die Nachzügler waren endlich da. Ich öffnete die Tür. »Wo bleibt ihr denn so lange … Mäx, olles Ferkel!!!« Nichts ist so anschmiegsam wie ein nasser Hund! Da hatte dieses Wollknäuel erst einen kurzen Inspektionsgang durch den Vorgarten unternommen, das frisch angehäufelte Mandelbäumchen bepinkelt, und jetzt hing das Vieh an meiner hellen Hose. »Die habe ich erst gestern aus der Reinigung geholt! Könnt ihr diesen verrückten Handfeger nicht festhalten?«
»Der freut sich doch bloß«, informierte mich Sascha. Als ob ich das nicht wüsste! Otto freut sich ja auch dauernd, wobei es völlig gleichgültig ist, ob ich aus dem Keller komme oder auf der Gästetoilette eine neue Rolle Klopapier eingesetzt habe. Sobald ich länger als zwei Minuten aus Ottos Blickfeld verschwunden bin, führt er bei meinem Wiederauftauchen einen Freudentanz auf.
Jetzt begrüßte er quiekend und jaulend seinen Halbbruder, wälzte sich mit ihm auf dem Teppich herum, entdeckte die noch offenstehende Haustür, ein kurzer Blickkontakt genügte, und prompt verschwanden beide Hunde ins Dunkle. Wir hörten es bloß noch rascheln und fauchen. Die Katze von gegenüber, seit Jahren Erzfeind unseres Vierbeiners, war noch unterwegs und nunmehr auf der Flucht. Die Hunde hechelnd hinterher.
»Seht zu, wie ihr die wieder einfangt. Ich ziehe mich erst mal um.«
Es war fast neun Uhr, als ich das letzte Würstchen – jetzt waren sie alle geplatzt! – aus dem Topf fischte und die Platte auf den Tisch stellte. Dazu gibt (und gab es seit jeher) Kartoffelsalat. Das ist Tradition. Nur weiß kein Mensch mehr, woher die eigentlich stammt. Rolf meint, ihr Ursprung sei wohl in jenen Jahren zu suchen, als unser Nachwuchs mehr an dem Inhalt der bunten Teller interessiert gewesen war als an einem Drei-Gänge-Menü und beides hintereinander selbst die Aufnahmekapazität von Teenagermägen überfordert hätte. Ich kann mich auch noch gut an etliche Weihnachtsmorgen erinnern, die speziell bei den Jungs mit Zwieback und Kamillentee begonnen hatten.
Während wir auf den reichlich verwässerten Würstchen herumkauten – die frisch geduschten und trockengefönten Hunde lagen schmollend in einer Ecke –, erklärte Sascha ausführlich, weshalb sie so spät gekommen waren. Demnach hatte er erst den größten Verkehrstrubel abwarten wollen, dann habe jedoch Schneegestöber eingesetzt, außerdem dürfe er mit Vicky als Beifahrerin nie schneller als hundert fahren, und auf den letzten Kilometern Landstraße habe es noch einen Unfall gegeben.
»So’n Heizöl-Ferrari hat mich überholt, aber zwei Kilometer weiter hing er an ’ner Fichte. Der Fahrer hat bloß ein paar Schrammen abgekriegt, nur die Karre ist einen halben Meter kürzer geworden. Autos sollten sich eben nie auf einen Zweikampf mit Bäumen einlassen, die haben die bessere Bodenhaftung«, schloss er mit einem ironischen Seitenblick zu seinem Vater, der auch schon mal versucht hatte, an einer Rotbuche zu bremsen. Allerdings hatte ihn das nur einen neuen Kotflügel gekostet und mich den Wäschetrockner, den ich endlich hätte kriegen sollen und dann doch wieder nicht bekam. Ein ramponiertes Auto fällt eben mehr auf als ungebügelte Hosen, wenn sie nicht rechtzeitig trocken geworden sind!
»Na, du wirst dir wohl auch bald einen Kombi zulegen müssen«, sagte Steffi beiläufig, »in deinen Wagen kriegst du doch keinen Kind … äh, ich meine, der hat doch inzwischen weit über hunderttausend Kilometer drauf, und du hast immer gesagt … äh, wolltest du nicht schon damals einen Kombi haben?«
»Nein, nie!«
Steffi lief dunkelrot an, wir anderen sagten gar nichts, weil wir offiziell nicht wissen durften, was wir inzwischen doch alle wussten, aber schließlich war es Vicky selber, die das ungemütliche Schweigen brach. »Eigentlich wollten wir es euch erst nachher sagen, doch nun ist es egal. Ich bin nämlich schwanger.«
Einem unbeteiligten Zuschauer wäre so viel gekünstelte Überraschung wahrscheinlich aufgefallen, die künftige Mutter sonnte sich jedoch in der allgemeinen Aufmerksamkeit, nahm Glückwünsche entgegen und beantwortete bereitwillig alle Fragen von »Wann ist es denn so weit?« bis zu »Habt ihr schon einen Namen für das Baby?«
»Yannik oder Tabea«, sagte Vicky.
»O Gott«, murmelte Sascha bloß. Mit seiner Rolle als werdender Vater schien er ohnehin noch erhebliche Schwierigkeiten zu haben, denn als Tom ihn ein bisschen auf die Schippe nahm, winkte er sofort ab. »Hör auf mit dem Quatsch, ihr geht mir alle auf den Geist! Und du ganz besonders!«
»Wenn wenigstens was da wäre, wo ich drauf gehen könnte …«
Auch über das Geschenk konnte Sascha nicht lachen, das Steffi als vermeintlich einzige »Eingeweihte« noch in letzter Minute besorgt hatte und nun stolz präsentierte: einen Marienkäfer auf Rädern. Sobald man die Flügel entfernte, kam ein Töpfchen zum Vorschein. »Etwas noch Dussligeres hast du wohl nicht gefunden?«
Steffi war beleidigt, Tom hatte sich achselzuckend abgewandt, Sascha sagte auch nichts mehr – der Abend drohte ein Desaster zu werden. Aber es gab ja noch Mäx und Otto. Nach ihrem »Festtagsmenü für kleine verwöhnte Hunde« – ich war so lange von der Werbung berieselt worden, bis ich tatsächlich zwei Packungen gekauft hatte – hatten sie uns das verhasste Duschen verziehen, eine Runde geschlafen, und nun waren sie im Gegensatz zu uns putzmunter.
»Wer kommt mit auf die Pipi-Runde?« Eine Frage, die normalerweise von jedem Familienmitglied mit dem Hinweis unaufschiebbarer Tätigkeiten mit »Ich nicht! Außerdem ist es ja dein Hund!« beantwortet wird. Diesmal fanden sich aber so viele Freiwillige, dass ich zu Hause bleiben konnte.
»Also gut, die Männer ziehen los, wir anderen räumen mal ein bisschen auf«, schlug ich vor, doch das musste wohl keine so gute Idee gewesen sein. Das Geschirr stand schon wieder im Schrank, die letzten Überreste der Goldfolienschlacht waren beseitigt (ja, ich weiß, inzwischen benutze ich auch recycelbares Geschenkpapier, doch vor ein paar Jahren waren glitzernde Verpackungen noch nicht mit einem Tabu behaftet gewesen), sogar die Geschenke hatten wir schon zusammengestellt – nur die Gassigehkolonne war noch nicht wieder aufgetaucht.
»Sind die eingeschneit?« Katja öffnete die Haustür und streckte die Hand hinaus. »Höchstens abgesoffen – es gießt in Strömen. Bei dem Wetter bleibt doch keiner länger draußen, als er muss.«
»Schon gar nicht Otto«, ergänzte Nicki. »Der traut sich ja nicht mal bei dreißig Grad im Schatten in die Nähe vom Rasensprenger.«
»Vielleicht sind sie in einer Kneipe gelandet?«
»Heute? Da hat doch alles zu!«
Eben das war unser Irrtum! Ein Kneipier, erst unlängst von seiner Frau geschieden, hatte seine Wirtschaft offengehalten, vermutlich in der nicht unberechtigten Hoffnung, dass Leidensgenossen und Ehemänner auf der Flucht vor Schwiegermüttern oder sonstigen Verwandten bei ihm Zuflucht suchen würden. Jedenfalls waren unsere Männer, angelockt von der erleuchteten Bierreklame, zwecks äußerlicher Trocknung und innerlicher Erwärmung dort eingekehrt und hängengeblieben. Die Hunde hatten Frikadellen bekommen und waren selig eingeschlafen, den Herren der Schöpfung war es nach dem vierten Grog so ähnlich ergangen. Schließlich hatten sie sich doch noch für den Rückweg entschieden und standen nun tropfnass vor der Tür.
Eine Übernachtung sämtlicher Gäste war eigentlich nicht vorgesehen gewesen. Genaugenommen sollten nur Sascha und Vicky bei uns schlafen, alle anderen hatten nach Hause fahren wollen, doch beim Anblick der Jammergestalten war das kein Thema mehr. Und wozu gibt es Luftmatratzen, Schlafsäcke und diese platzsparenden, weil zusammenklappbaren Gästebetten, die man allerdings nur solchen Gästen zumuten sollte, die man nie wiedersehen möchte? Egal, Improvisation ist alles. Die klatschnassen Mäntel kamen in den Heizungskeller, alle verfügbaren Kissen und Decken wurden zusammengetragen, das Wohnzimmer zum Feldlager für die männlichen Schläfer ernannt, die weiblichen verteilten sich in den oberen Stockwerken – nur die Hunde waren etwas frustriert. Ihren angestammten Platz auf dem Sofa hatte Tom belegt, und bei seinen 1,97 Meter Gesamtlänge hatten sie keine Chance mehr.
»Ich kann mir nicht helfen«, sagte Steffi später, den Mund schon voll Zahnpasta, »aber früher ist Weihnachten irgendwie gemütlicher gewesen.«
Zwei Wochen danach rief mich Sascha an. Wir plauderten über dies und das und hatten uns schon verabschiedet, als ihm noch etwas einfiel: »Ach ja, ehe ich es vergesse: Den versprochenen Kinderwagen brauchst du vorläufig nicht zu kaufen. Vicky ist gestern beim Arzt gewesen. Die Schwangerschaft war bloß eine Hormonstörung.«
Westöstlicher Briefwechsel und seine Folgen
Seitdem der antifaschistische Schutzwall, wie diese Mauer quer durch Deutschland von ihren Erbauern bezeichnet wurde, demontiert worden ist, bekomme ich auch Leserbriefe aus der ehemaligen DDR. Der allererste kam von einer Dame aus Wandlitz.
»Wo is’n das überhaupt?«, wollte Steffi wissen, deren Geografiekenntnisse der östlich gelegenen Länder sich seinerzeit noch auf Städte wie Moskau, Warschau oder allenfalls Leipzig beschränkt hatten.
So ganz genau wusste ich das aber auch nicht. Also Atlas her! Der stammte noch aus der Mauerzeit und wies eine offenbar recht dünn besiedelte DDR aus. Wandlitz war nicht drauf.
»Jetzt erst recht!« Steffi klappte den Atlas zu und empfahl mir den baldigen Ankauf eines neuen. Bei den ständig wechselnden politischen Gegebenheiten könne man zwar nicht immer auf dem Laufenden sein, doch dass es jenseits der Elbe auch noch Städte mit deutschen Namen gebe, habe sich ja inzwischen herumgesprochen. Nur von Wandlitz hatte sie noch nichts gehört. »Im Wagen habe ich einen nagelneuen Autoatlas, erst vorige Woche gekauft.« Sie trabte ab, und wenig später saßen wir, ich mit Brille, sie mit Lupe bewaffnet, am Tisch und suchten Wandlitz. Wir fanden es in der Nähe von Berlin.
»Na ja, wenn man so dicht dran wohnt, kommt man sicher auch mal in eine Westberliner Buchhandlung, oder woher sonst soll dein neuer Ossi-Fan deine Bücher kennen?«
»Vielleicht deshalb, weil man sie jetzt auch in den Neubuläs kaufen kann.«
»In – was???«
»In den NEUen BUndesLÄndern!«
Steffi kicherte. »Stammt diese Wortschöpfung von dir?«
»Was soll man denn sonst sagen? Ehemalige DDR ist viel zu lang, und Ossiland finde ich auch nicht so doll.«
»Dein – wie war das noch? – Neubulä hört sich aber auch ziemlich bescheuert an. Was will dein neuer Fan denn überhaupt von dir?«
»Lies doch selber!« Ich schob ihr den Brief hinüber und formulierte in Gedanken schon eine Antwort.
»Du sollst da ’ne Lesung abhalten?« Kopfschüttelnd gab mir Steffi das Schreiben zurück. »Manche Leute haben wirklich merkwürdige Einfälle. Für nur einmal lesen ist der Weg doch viel zu weit.«
Frau S. hatte mir mitgeteilt, dass man ihr schon früher einige Bücher von mir hinübergeschmuggelt habe, und momentan würde jenes Opus vor ihr liegen, in dem ich die Erlebnisse auf einer Lese-Tournee geschildert hatte. Jetzt wollte sie fragen, ob ich solch eine Reise nicht mal in den neuen Bundesländern unternehmen und natürlich auch in Wandlitz Station machen könnte. Für Unterkunft, zumindest bei ihr, sei gesorgt.
Nun ist das mit Lesungen ja nicht so ganz einfach. Da erkundigt sich zum Beispiel ein Buchhändler beim Verlag, ob dieser oder jener Autor sich bereitfinden würde, nach Kassel, Würzburg, Castrop-Rauxel oder in einen Ort, den manchmal nur seine Einwohner kennen, zu einem Leseabend zu kommen. Der Verlag erkundigt sich beim Autor, und der sagt erst mal NEIN. Weil er keine Lust hat, weil die betreffende Stadt fünf Autostunden weit entfernt ist, weil Frau, Kinder, Hund, Katze krank sind oder das Pferd in Kürze fohlen wird. Außerdem arbeitet er gerade an einem neuen Werk, hat also gar keine Zeit, und in Urlaub will er auch noch fahren. Der Verlag sieht das ein und vertröstet den Buchhändler auf einen späteren Termin. Irgendwann wird sich schon eine Möglichkeit ergeben.
Dann kommt die Buchmesse, auf der der Autor sein neues Werk präsentiert hat, und nun ist er auch zu anderen Taten bereit – besonders zu solchen, die dem Verkauf seines Werkes förderlich sind. Der Verlag hat inzwischen die Anfragen weiterer Buchhändler gesammelt und ist bemüht, eine Route zusammenzustellen, die sowohl die potenziellen Gastgeber als auch die Wünsche des Autors berücksichtigt. Der will nämlich nicht nach Bayern, weil er da mal schlechte Erfahrungen gemacht hat, nach Flensburg aber auch nicht, das ist zu weit weg. Schließlich einigt man sich. Zwei Abende in Hessen, dann Ruhrgebiet, da liegen die Orte so schön dicht beieinander, und den Abschluss in Hamburg. Dort gibt es sogar drei Interessenten. Außerdem wohnt der Bruder des Autors ganz in der Nähe. Ein Besuch bei ihm geht also auf Spesen.
In gemilderter und ausführlicherer Form teilte ich Frau S. die Präliminarien einer Lesereise mit, bestätigte jedoch, dass ich sehr gern in die ehemalige DDR kommen würde, steckte den Brief in den Kasten und vergaß die ganze Sache.
Nicht so Frau S. Kurz nach Neujahr fand ich unter meiner Post ein Schreiben der »Staatlichen Fachstelle für öffentliche Bibliotheken« in Frankfurt an der Oder. Eine Frau Wagner teilte mir mit, sie habe auf Veranlassung von Frau S. ein rundes Dutzend Büchereien ausfindig gemacht, die an einer Lesung mit mir interessiert seien – und ob ich denn nun auch wirklich kommen würde? PS.: Welche Kosten würden wohl entstehen? Man habe leider nur einen sehr geringen Etat.
Mein erster Gedanke war: Was haste dir da bloß eingebrockt? Das biegst du aber ganz schnell irgendwie ab. Und gleich danach der zweite: Warum eigentlich nicht? Zumindest solltest du mal darüber nachdenken.
Nun habe ich keine Ahnung, inwieweit es in der früheren DDR Autorenlesungen gegeben hat und wie die ausgesehen haben. Wurden die Autoren zwangsverpflichtet, abkommandiert, bekamen sie Honorar, oder liefen derartige Veranstaltungen unter dem Oberbegriff Freiwilliger Arbeitseinsatz? Autoren konnte man ja kaum zum Kartoffelbuddeln schicken, aber zum Gemeinwohl haben sie bestimmt auch beitragen müssen, warum also nicht in Form von Lesungen? Wo mögen die überhaupt stattgefunden haben? Gab’s da drüben nicht solche hübschen Betonklötze, die man Kulturhaus nannte und die meistens den Charme eines Wartesaals ausstrahlten?
Mein Ehemann, Meister im Erfinden glaubhafter Ausreden, wenn er irgendwohin muss und keine Lust hat, schüttelte nur den Kopf, als ich ihn um Rat fragte. »Wer A sagt, muss auch B sagen!« Eine dämliche Redensart und völlig unlogisch. Wie viele Wörter gibt es denn, bei denen auf das A ein B folgt? Doch nur solche, die mit Ab … anfangen, also Abstand, Absolution, Absage …
Der Familienrat wurde einberufen. Er war einstimmig dagegen. Von Sibirien war die Rede und von »die Ossis gucken doch jetzt abends lieber RTL und SAT, statt sich was vorlesen zu lassen. Bücher haben die auch früher schon gehabt!« Die zum Teil absurden Argumente, weshalb ich mich auf diese Reise nicht einlassen sollte, gipfelten schließlich in Svens Meinung, wonach sowieso kein Mensch zu einem Leseabend kommen würde. »Die sorgen sich um Betriebsschließungen, um Arbeitslosigkeit, um Mieterhöhungen – da hat doch keiner Sinn für deine Familienstorys. Hätte ich auch nicht, wenn ich nicht wüsste, wovon ich im nächsten Monat meine Kinder ernähren soll.« Dabei hat er gar keine!
Irgendwann hatte Rolf die Nase voll. »Jetzt lass dir erst mal genaue Informationen schicken, wie die in Frankfurt sich die Sache vorstellen, und dann kannst du immer noch einen Rückzieher machen.«
Doch das hatte ich schon nicht mehr vor.
Frau Wagner antwortete postwendend. Dass ich für die Lesungen kein Honorar nehmen würde, überraschte sie gar nicht (also doch Arbeitseinsatz??!), die Fahrtkosten würde man selbstverständlich erstatten, um Unterkünfte würde man sich kümmern, auch wenn das manchmal etwas schwierig wäre, und anliegend eine Liste jener Büchereien, die auf meinen Besuch warteten. PS.: Ob ich gegebenenfalls auch mit einem Privatquartier einverstanden sei?
Karte her! In weiser Voraussicht hatte ich mir inzwischen selbst eine besorgt. Die erste Station meiner Reise sollte Templin sein, nördlich von Berlin gelegen und mitten in der Uckermark. Die kannte ich noch nicht. Dann würde es weitergehen nach Prenzlau, von dort nach Gramzow (nie gehört!), anschließend nach Eberswalde und zum Schluss nach Wandlitz. Dass es sich bei diesen Angaben nur um die jeweiligen Übernachtungen handelte und ich später in Dörfern landete, die ich nur mit Hilfe von Ortskundigen fand, ahnte ich damals noch nicht. Frau Wagner fand übrigens, dass der Mai doch ein herrlicher Monat für solch eine Reise sei, die Mark Brandenburg präsentiere sich gerade dann in ihrer ganzen Schönheit, und ob ich mich mit diesem Termin anfreunden könne?
Was Fauna und Flora anbelangt, so mag ich den Mai auch am liebsten, doch erfahrungsgemäß wird um diese Jahreszeit auch in Wald und Flur geackert, von den heimischen Gemüsegärten ganz zu schweigen. Wer aber acht Stunden und länger Rüben gehackt oder Unkraut gezupft hat, der dürfte für eine abendliche Dichterlesung, zu der man sich notgedrungen auch noch umziehen muss, wenig Begeisterung zeigen. Aber vielleicht war das in den Neubuläs ja ganz anders! Ausgehungert nach westlicher Literatur – schließlich hatte man den armen DDRlern jahrzehntelang nur politischen oder linientreuen Lesestoff verordnet –, würden die Zuhörer in Scharen kommen, dankbar, dass sich sogar jemand in die tiefste Provinz vorwagt. Hatte ich gedacht.
Ungefähr vier Wochen vor Beginn der Reise eröffnete mir Steffi, dass der unter Ausschluss eines Stimmberechtigten tagende Familienrat beschlossen habe, mich nicht allein fahren zu lassen. »Erstens wirst du den halben Tag auf Landstraßen verbringen, weil du selten auf Anhieb dort landest, wohin du willst, und zweitens kriegst du ja Depressionen, wenn du vierzehn Tage lang mutterseelenallein durch die Pampa driftest.«
Davor hatte ich auch schon einen Bammel gehabt, aber das sagte ich natürlich nicht. Im Gegenteil, ich protestierte sofort. »Ich brauche keinen Babysitter! Und überhaupt – wer von euch würde denn freiwillig mitkommen wollen?«
»Na ja, das ist ein bisschen schwierig«, gab Steffi zu, »ich habe nämlich nur eine Woche Urlaub gekriegt, und die Zwillinge stecken mitten im Prüfungsstress.«
Das war nun wieder maßlos übertrieben. Es stimmte zwar, dass im Oktober das erste Staatsexamen beginnen würde, doch von Stress war den beiden nichts anzumerken. Hin und wieder erwähnten sie zwar mal die Zulassungsarbeiten, deren Fertigstellung in erster Linie im Nachschlagen pädagogischer Werke und dem Zitieren ihrer Verfasser bestand (Kommentar Katja: »Das Wichtigste sind die Quellenangaben. Je länger später der Abspann ist, desto größer die Überzeugung der Prüfungskommission, dass du diese ganzen Wälzer auch tatsächlich gelesen hast!«) – aber von rauchenden Köpfen und durchgeistigter Stubenhockerblässe hatte ich bei den Mädchen noch nichts bemerkt.
»Ja, also wir hatten uns das so gedacht«, nahm Steffi den Faden wieder auf, »in der ersten Woche fahre ich mit und in der zweiten Nicki. Die kommt dann rauf.«
»Seid ihr verrückt? Wie stellt ihr euch das denn vor? Bis Berlin sind es ja bloß schlappe 700 Kilometer!« Ich hatte vorgehabt, am Sonntag vor der ersten Lesung nach Berlin zu fahren, dort bei Freundin Irene zu übernachten, und am nächsten Morgen gemütlich nach Templin zu tuckern. Bis zum Abend würde ich die hundert Kilometer wohl geschafft haben. Am Freitag wollte ich wieder nach Berlin zurückkommen, das freie Wochenende bei Irene verbringen und von dort zur letzten Etappe nach Eberswalde und Wandlitz starten. Wie es schien, wollten meine Töchter den Austausch in Berlin vornehmen. »Das ist doch heller Wahnsinn«, erklärte ich dann auch, »kommt überhaupt nicht in Frage. Ich schaffe das schon allein.«
»Wir haben aber alles schon abgemacht. Thomas bringt Nicki rauf und nimmt mich mit zurück.« Sie seufzte. »Die Vorstellung, mit diesem Langweiler stundenlang im Auto sitzen zu müssen, hätte mich beinahe von meinem edlen Vorsatz abgebracht, aber was tut man nicht alles aus töchterlichem Pflichtgefühl?«
Von wegen! »Gib doch zu, dass dich die pure Neugier treibt! Du hast noch nie einen Fuß in die DDR gesetzt, kennst lediglich die Transitautobahn und hast bis vor kurzem geglaubt, dass man jenseits der Mauer nur russisch spricht.«
»Jetzt übertreibst du aber!«, empörte sie sich.
»Findest du?«
Eine Rückfrage bei Frau Wagner, ob man die gebuchten Einzelzimmer in Doppelzimmer umwandeln könnte – selbstverständlich würde ich die zusätzlichen Kosten selber tra-gen –, erregte nur gelindes Erstaunen. Es ständen sowieso immer zwei Betten drin, Einzelzimmer gäbe es gar nicht. Ach so?!
Als Nächstes der längst überfällige Anruf bei Irene. Nach dem üblichen Geplauder über das Wohlergehen der Enkelkinder und der Blumenzwiebeln (sie handelt damit) kam ich zum Kernpunkt. »Hast du am elften Mai mal wieder ein Nachtquartier für Steffi und mich?«
»Immer«, lautete die Antwort, »bloß bin ich dann nicht da.«
Damit hatte ich nun überhaupt nicht gerechnet. »Warum nicht?«
»Weil ich mit Katharina in die Toskana fahre. Die muss mal raus und ich auch.«
Durchaus begreiflich. Katharina ist Irenes Tochter und arbeitet als Kinderpsychologin.
»Aber du kannst ja trotzdem kommen, du kennst dich doch aus, und wo du den Hausschlüssel findest, weißt du ebenfalls. Also wo liegt das Problem? Ich muss nur Janka Bescheid sagen, sonst alarmiert sie das Überfallkom-mando.«
Janka ist Irenes Putzfrau und während ihrer Abwesenheit zuständig fürs Blümchengießen und die Fütterung der Raubtiere in Gestalt dreier schon etwas betagter Katzen.
»Warum hast du denn nicht früher gesagt, dass du kommen willst? Dann hätten wir die Reise um ein paar Tage verschoben.«
»Der Termin hat sich erst jetzt ergeben.« Fünf Minuten lang Erläuterung meiner geplanten Exkursion.
»Du bist ganz schön mutig«, meinte Irene nur.
»Weshalb denn? Die Kriminalitätsrate ist in Ossiland wesentlich geringer als bei uns.«
»Das habe ich auch nicht gemeint, aber wir Wessis sind bei unseren Brüdern und Schwestern zurzeit wenig beliebt. Soll ja innerhalb der Verwandtschaft gelegentlich vorkommen.«
Mit der Zusage, mich noch mal zu melden, legte ich den Hörer auf. Was nun? Irenes Angebot, trotz ihrer Abwesenheit in ihrem Haus einzufallen, annehmen oder nach einem Ausweichquartier suchen? Wer oder was käme denn da in Frage? Kunzes Laube? Freunde von uns bezeichnen ihr gar nicht mal so kleines und einschließlich Küche gemütlich möbliertes Wochenendhaus mit beharrlicher Untertreibung als »Laube«, obwohl es mit den unter diesem Begriff bekannten Schrebergarten-Bretterbuden nicht die geringste Ähnlichkeit hat. Allerdings liegt besagte Laube jott-we-de. Außerdem gibt’s da keinen Boiler, und wenn ich etwas hasse, dann ist es die morgendliche Kaltwasserdusche.
Tante Annelies? Nein, lieber nicht. Sie würde zwar mit Freuden Möbel rücken und in ihrer ohnehin blitzsauberen Miniwohnung einen Großputz veranstalten, um uns entsprechend beherbergen zu können, doch die Jüngste ist sie nun wirklich nicht mehr. Außerdem hat sie Rheuma.
Wer bleibt denn noch? Richtig, Dagi! Warum bin ich nicht gleich darauf gekommen?
Dagi habe ich quasi geerbt. Unsere Eltern waren Jugendfreunde gewesen. Wir Kinder nicht. Ich konnte Dagi nicht ausstehen, und diese »Zuneigung« beruhte auf Gegenseitigkeit. Beide wurden wir von Omas aufgezogen. Unsere Väter standen an der Front, die Mütter waren »kriegsdienstverpflichtet«, und es war damals völlig normal, dass die Aufzucht des Nachwuchses häufig Großeltern oder anderen, meist älteren Verwandten überlassen blieb.
Im Gegensatz zu meiner eigenen, die mich streng preußisch erzog, war Dagis Großmutter eine richtige Bilderbuch-Oma: klein und rund mit Knoten im Nacken und geblümter Schürze vorm Bauch, gutmütig, nachgiebig und ihrer temperamentvollen Enkelin hoffnungslos unterlegen. Außerdem gab es da noch Tante Idchen. Die war noch ein bisschen kleiner als Oma Emma und noch ein bisschen toleranter.
Platzte Emma tatsächlich mal der Kragen und sie verhängte über Dagi eine drakonische Strafe, die in der Regel aus ein paar Stunden Stubenarrest bestand, dann versüßte Tante Idchen dem bedauernswerten Kind die Haft mit Bonbons und sicherte ihm für den nächsten Tag einen Kinobesuch zu.
Dabei war Dagi wirklich ein ausgemachtes Ekel! Statt sich wie ein normales Kind fair zu prügeln, kratzte, biss und spuckte sie, brüllte wie am Spieß, wenn sie nicht das bekam, was sie gerade wollte, und stand mal wieder ihr Besuch in Aussicht, dann räumte Omi vorsichtshalber alles Zerbrechliche weg. Seitdem Dagi ihre große Kristallschale zertrümmert hatte, weil sie unbedingt die darin aufbewahrten Rosenblätter essen wollte, hasste Omi dieses »unerzogene Scheusal« beinahe so sehr wie ich.
Als wir von Berlin nach Düsseldorf übersiedelten, verlor ich Dagi aus den Augen. Ich erfuhr zwar, dass sie sehr früh geheiratet und nach anderthalb Jahren Sohn Harry in die Welt gesetzt hatte, nur war der Mann ihrer Träume wohl doch nicht das gewesen, was sie erwartet hatte. Also Scheidung und einige Jahre danach ein neuer Versuch. Diesmal war es ein Arzt, in den sie sich Hals über Kopf verliebt hatte. Nach der Hochzeit entpuppte er sich als Säufer, worauf Dagi erneut ihren Anwalt bemühte und seitdem kaum noch Alkohol trinkt.
Über den Weg gelaufen sind wir uns erst wieder, als ich während einer Berlinreise ihre Mutter besuchte und Dagi unverhofft in der Tür stand. Aus dem widerlichen Kind war eine selbstbewusste, blendend aussehende Frau geworden, die ihr Leben fest im Griff hatte. Wir verstanden uns auf Anhieb und sehen uns jetzt, sooft sich eine Möglichkeit ergibt. Unsere regelmäßigen und nicht eben kurzen Telefonate sind Rolf seit Jahren ein Dorn im Auge. »Meinst du nicht, es wird billiger, wenn Dagmar mal wieder herkommt?«
Geheiratet hat sie nicht mehr, doch es gibt Victor. Victor ist ein Workaholic mit viel Geld und wenig Zeit. Als er Dagi damals einen Antrag machte, hatte sie ihm einen Korb gegeben; Jahre später hätte sie ihn ganz gern genommen, aber nun wollte er nicht mehr – jedenfalls nicht amtlich mit Brief und Siegel. Trotzdem kommt einer ohne den anderen nicht klar, und so leben die beiden seit ewigen Zeiten miteinander oder auch nebeneinander, je nachdem, ob es mal wieder Krach gegeben hat oder das Barometer auf Sonnenschein steht.
Victor hat mit Immobilien zu tun, und dank dieser Tatsache besitzt Dagi eine kleine Wohnung in einer ruhigen Ecke von Schöneberg mit viel Grün drum herum und recht honorigen Nachbarn. Ich war allerdings noch nie dort gewesen, doch das ließe sich ja ändern. Schließlich brauchte ich ein Nachtquartier.
Dagi war sofort einverstanden.
»Na klar könnt ihr kommen! Gemeinsam werden wir es schon schaffen, diese verdammte Ausziehcouch zum letzten Mal in ein Doppelbett zu verwandeln. Die klemmt nämlich und fliegt bei der nächsten Sperrmüll-Abfuhr raus. Bloß wenn ich jetzt eine neue kaufe, weiß ich nicht, wohin mit der anderen. Der Keller ist voll.«
»Ist das etwa immer noch das alte Ding von Oma Emmchen?«
»Aber sicher! Ist ja schließlich Vorkriegsware und noch gute deutsche Wertarbeit. Deshalb habe ich auch schon mal versucht, das Möbel einem Bekannten als Antiquität unterzujubeln und vorher ein paar Holzwurmlöcher reingebohrt. Sah auch richtig echt aus, hat aber leider nur beinahe geklappt.«
Berlin ist bekanntlich eine Reise wert – man muss bloß erst mal hinkommen! Wohnt man im südwestlichen Zipfel der Bundesrepublik, dann muss man halbschräg durch dreiviertel Deutschland. Eine passende Autobahn quer durch gibt es jedoch nicht, also fährt man ca. zweihundert Kilometer Umwege. Steffi hatte sich für die südliche Route entschieden, da sei weniger Verkehr. Das war der erste Irrtum!
Der zweite stellte sich heraus, als wir die frühere Grenze passiert hatten und einsehen mussten, dass wir unseren Zeitplan nie würden einhalten können. Wo damals überwiegend Lastwagen und Autos mit westdeutschen Kennzeichen im Hundertkilometertempo langgeschlichen waren, herrschte jetzt ein Verkehr wie am Frankfurter Kreuz zur Rush-hour. Vom verbeulten Opel Baujahr 79 bis zum nagelneuen Renommierschlitten schoben sich endlose Kolonnen über den ramponierten Asphalt, und fast jedes Auto gehörte nach Ossiland. Die vereinzelten Trabis mittendrin fielen schon richtig aus dem Rahmen.
Es ist ja kein Geheimnis mehr, dass viele ehemalige Trabifahrer mit den vermehrten Pferdestärken gewisse Schwierigkeiten hatten und immer noch haben. Nach der dritten Vollbremsung, weil es vor uns mal wieder gekracht hatte, und einem leichten Bumsen gegen die rückwärtige Stoßstange meinte Steffi nur: »Hier drüben könnte man dringend eine Bremse brauchen, mit der man den Wagen des Hintermannes zum Stehen bringen kann.«
Endlich Dreilinden. Wie oft hatte ich hier in der Autoschlange gewartet, bis mein Pass von den Vopos kontrolliert, fotografiert und mit irgendwelchen Listen verglichen worden war! Und einmal hatte ich sogar in die taghell erleuchtete Halle fahren müssen, wo man den Wagen buchstäblich auseinandergenommen hatte. Außer einem alten Exemplar des Playboy, der von einem männlichen Familienmitglied wohl mal liegengelassen und nun sofort konfisziert worden war, hatte man allerdings nichts gefunden.
Es war schon ein merkwürdiges Gefühl, an diesem Kontrollpunkt so einfach vorbeifahren zu können, doch Steffi kurvte trotzdem auf einen Parkplatz. »Du musst hier nicht mehr halten!«, erinnerte ich sie.
»Ich habe keine sentimentalen Gefühle, ich brauche den Stadtplan!«
Ach so.
»Jetzt setz mal deine Brille auf, sonst erkennst du wieder die blauen Striche nicht, und dann sag mir genau, wie ich fahren muss!«
Kein Problem, den Weg zur Rosenheimer Straße hatten wir schon zu Hause sorgfältig markiert. Das Problem entstand erst dadurch, dass ich zwar zum Lesen eine Brille brauche, zum normalen Sehen jedoch nicht. Und bis jetzt habe ich mich einfach noch nicht dazu durchringen können, mir eine dieser ausnehmend kleidsamen Lesebrillen zuzulegen, die so elegant auf der Nasenspitze thronen und immer aussehen wie gewollt und nicht gekonnt. Bis ich – Brille ab! – das Straßenschild entziffert und – Brille auf! – auf der Karte gefunden hatte, waren wir schon wieder zwei Straßen weiter.
»Da vorne kommt so ’ne Art Platz«, warnte Steffi rechtzeitig.
»Wie heißt der denn?«
»Woher soll ich das wissen? Du bist doch in Berlin aufgewachsen.«
»Aber nicht in dieser Gegend.« Ich beugte mich wieder über die Karte. »Hier scheint es eine Menge Plätze zu geben.«
»In der Mitte steht ein Denkmal.«
»Jeder Platz, der was auf sich hält, hat ein Denkmal. Kannst du erkennen, was es ist?«
»Ein Mann auf einem Pferd«, sagte Steffi lakonisch.
»Dann ist es wahrscheinlich Bismarck, also stehen wir logischerweise vor dem Bismarckplatz, und wenn ich mich nicht irre, liegt der in Schmargendorf.«
»Wollen wir dahin?«
»Nein!!!«
»Was soll ich denn jetzt machen?« Die Ampel sprang gerade auf Grün.
»Fahr erst mal geradeaus weiter!«
»Geht nicht. Einbahnstraße.«
Nach ungefähr zwei Stunden hatten wir endlich unser Ziel gefunden, weitere zwanzig Minuten vergingen mit der Suche nach einem Parkplatz. »Die müssen hier alle Drittwagen haben«, seufzte Steffi, als wir zum x-ten Mal an Dagis Haustür vorbeifuhren. »Wieso gibt es nirgends eine Lücke?«
»Als diese Häuser in den fünfziger Jahren gebaut wurden, brauchte man Wohnungen und keine Garagen. Wer hatte damals denn schon ein Auto?«
»Siehste, und nu isses umgekehrt! Jetzt baut man zehnstöckige Garagen und bezeichnet sie als Wohnungen. – Guck mal, da drüben fährt einer raus. Ich kann hier aber nicht wenden. Steig schnell aus, nimm meine Reisetasche mit und stell dich genau in die Mitte. Und wehe, du rührst dich von der Stelle, bis ich wieder da bin! Ich fahre nur schnell einmal um den Pudding.«
Wie ein zerrupftes Mauerblümchen kam ich mir vor, als ich Dagi in der geöffneten Wohnungstür stehen sah, gut frisiert und in einem schicken apricotfarbenen Fummel. Würde ich so etwas anziehen, hätte ich allenfalls auf einem Kostümfest Erfolg, etwa als Gespenst von Canterville oder so ähnlich. Abgesehen davon, dass mir Apricot überhaupt nicht steht, könnte ich auch keine Schlabberkleider tragen. »Wie machst du das eigentlich, dass du immer noch aussiehst wie höchstens fünfundvierzig?«
»Wandleuchten mit 25-Watt-Birnen«, lautete die lapidare Erklärung. »Aber jetzt kommt erst mal rein, und macht es euch gemütlich. Ich habe schon gedacht, ihr seid unterwegs verlorengegangen. Wollt ihr ’n Kaffee haben, Tee oder lieber etwas Gehaltvolleres?«
»Tee klingt gut«, meinte Steffi, »aber kann ich mir erst mal die Hände waschen?«
»Erste Tür links.«
Ich hörte sie nur noch »Wow!« sagen, bevor sie verschwand.
Später wusste ich auch, weshalb. Das Bad war nicht sehr groß, aber ein Traum in Pink. Marmorboden, Marmorwanne, eingebautes Waschbecken, indirekte Beleuchtung und viel Grünzeug. »Nach sozialem Wohnungsbau sieht das nicht gerade aus.«
»Ist es aber«, sagte Dagi, »allerdings hat Victor ein bisschen die Finger dazwischen gehabt. Wenn ich bei ihm in der Villa schon unbezahlte Putzfrau spiele, kann er ja auch mal was für mich tun.«
Richtig, die Villa! In Nikolassee steht sie, also in Berlins Nobelviertel, ein bisschen sehr heruntergekommen und für eine Person viel zu groß, doch der arme Mann hat ja keine Zeit zum Renovieren. Gerade mal drei Zimmer bewohnt er, edel eingerichtet, und zu einer neuen Einbauküche hatte Dagi ihn auch noch überreden können, doch wenn er duschen will, muss er ganz nach unten, wo der Swimmingpool ist. Da gibt es eine.
Nach Besichtigung der übrigen Wohnung einschließlich der großmütterlichen Antiquität, die statt des mir noch bekannten Großblumendessins nun einen altrosa Bezug hatte und ganz passabel aussah, sowie insgesamt fünf Tassen Tee wollte Dagi wissen: »Habt ihr eigentlich keinen Hunger?«
Doch, und wie! Seitdem auf den Speisekarten der Autobahnraststätten genau aufgelistet ist, welche Chemikalien in welchen Gerichten enthalten sind, vergeht mir meistens schon vorher der Appetit. Es wäre doch wesentlich einfacher, nur die paar Speisen zu kennzeichnen, die nicht gesundheitsschädlich sind. Ein Omelett jedenfalls braucht weder Ameisensäure noch Emulgatoren, dafür war es zäh gewesen, und die frischen Waldpilze hatten größtenteils aus getrockneten Lamellen bestanden.
»Ich hab mir gedacht, wir essen einen Happen in meiner Stammkneipe. Ist nur zwei Ecken weiter. Einverstanden?«
Natürlich waren wir einverstanden. »In Ordnung, dann rufe ich schnell an, damit sie einen Tisch freihalten.« Sie holte ihr Telefonverzeichnis, blätterte darin und sah sich suchend um. »Habt ihr irgendwo eine Brille liegen sehen?«
Ich stutzte. Dagmar und Brille? Sie hatte doch immer abgelehnt, solch ein »entstellendes Monstrum« auch nur in Erwägung zu ziehen. »Seit wann hast du denn eine?«
»Seitdem ich neulich beim Kuchenbacken zwei Rosinen mit der Fliegenklatsche erschlagen habe. – Wenn ich bloß wüsste, wo ich das Ding wieder liegengelassen habe.«
Eine hektische Suche begann, die schließlich im Bad endete. »Richtig«, erinnerte sie sich, »ich wollte vorhin mal ausprobieren, ob mir falsche Wimpern stehen. Geht aber nicht, die schleifen an den Brillengläsern.«
Die Kneipe war klein, voll, verräuchert, aber urgemütlich – und die Küche hervorragend. Außer bei meiner Großmutter habe ich nie wieder solch einen köstlichen Wirsingeintopf gegessen. Gesättigt und auch hinreichend mit »Berliner Kindl« abgefüllt, zogen wir zwei Stunden später von dannen.
»So, und jetzt kommt Mütterchens Heimwerkerstunde«, meinte Dagi, nachdem wir gemeinsam die Betten bezogen hatten. »Das letzte Mal habe ich die halbe Nacht gebraucht, bis ich dieses verdammte Ding auseinander hatte.«
»Wo fängt man denn da an?«, wollte Steffi wissen, misstrauisch das rosa Möbel begutachtend.
»Erst mal gar nicht. Wir brauchen noch einen Hammer, eventuell ein Stemmeisen und mit Sicherheit Heftpflaster.«
Soweit ich mich erinnere, musste unten etwas herausgezogen und oben etwas drübergeklappt werden, nur waren im Laufe der Jahrzehnte die Metallteile angerostet und verbogen. Es knirschte und quietschte, als wir mit vereinten Kräften an dem sperrigen Unterteil zerrten. Auf der einen Seite schlug Steffi mit dem Hammer auf die Eisenstrebe, auf der anderen bearbeitete Dagi das verklemmte Pendant mit dem Stemmeisen, und nach zehn Minuten Geziehe und Geschiebe sah das Sofa tatsächlich wie ein Bett aus.
»Da vorne fehlt was!« Steffi wies auf die linke Ecke, die sich bedenklich nach unten neigte.
»Ach ja, der Fuß«, meinte Dagi gleichmütig, »der ist schon lange ab. Er wird jetzt irgendwo drunterliegen. Wenn man bloß drauf sitzt, hält er, aber zum Schlafen nehme ich immer etwas anderes.« Aus dem Regal zog sie einen dicken Wälzer heraus, dessen Ledereinband schon tiefe Dellen aufwies. »Das ist ein altes Kochbuch von Emmchen. Benutzen kann ich es sowieso nicht, weil so ziemlich jedes Gericht anfängt mit: ›Man nehme acht Eier und ein Pfund gute Butter‹, aber es hat genau die richtige Höhe.«
Geschlafen habe ich übrigens prima, nur nicht lange genug. Als der erste Dieselmotor zu hämmern anfing und immer mehr Autotüren zuklappten, wachte ich auf.
Da war es kurz nach sechs. Großstadtlärm bin ich eben nicht mehr gewöhnt. In meiner ländlichen Kurort-Idylle, wo Ruhe die erste Bürgerpflicht bedeutet, werde ich ja schon nervös, wenn in unserer Nachbarschaft mal ein fremder Hund bellt.
Aller Anfang ist schwer
Meteorologie ist die Wissenschaft, die uns aufgrund komplizierter Hoch- und Tiefdruckberechnungen genauestens darüber informiert, wie das Wetter hätte sein sollen. Gestern Abend hatte der Herr vom Berliner Wetteramt Regen prophezeit, und dieser Meinung war er um acht Uhr morgens immer noch. Draußen schien die Sonne.
»Ziehe ich nun was Langärmeliges an oder bloß ein T-Shirt?«, überlegte Steffi vor der geöffneten Tasche.
»Das kommt darauf an, ob du dich auf den Wetterbericht verlässt oder auf dein Knie.«
Seitdem Stefanie im Teenageralter ihre sportliche Phase gehabt und vom Voltigieren bis zum Kugelstoßen alles ausprobiert hatte, womit man seine Knochen ruinieren kann, hat sie zwei Operationen hinter sich, und ihr linkes Knie sieht jetzt aus wie die tektonische Landkarte von Spanien. Aber es ist ein zuverlässiger Wetterprophet. Andere müssen sich auf ihr Rheuma verlassen, Steffi befragt ihr Knie. »Da merke ich nichts«, erklärte sie denn auch, »also gibt es keinen Wetterumschwung.«
Die Sonne begleitete uns, bis wir uns aus Berlin herausgewurstelt hatten, und sie war auch noch da, als wir auf der Landstraße nach Norden tuckerten – ganz gemütlich, wir hatten ja genug Zeit.
»Wenn wir wieder zu Hause sind, brauchst du neue Stoßdämpfer«, konstatierte Steffi, nachdem sie ein Schlagloch umrundet, das nächste jedoch übersehen hatte. »Bis zu den Straßen scheint der Aufbau Ost noch nicht vorgedrungen zu sein.«
»Erst mal sind die Autobahnen dran. Sonst hätten die Bewohner der Neubuläs keine Möglichkeit, ihre neuen Wagen mal richtig auszufahren, also würden sie erst gar keine mehr kaufen, wodurch wiederum die westdeutsche Autoindustrie …«
»… stagnierte und die Zulieferfirmen Pleite machten. So kann man die soziale Marktwirtschaft auch definieren.«
Je weiter wir uns von Berlin entfernten, desto unberührter wurde die Landschaft.
Rechts und links Wiesen, die noch wie richtige Wiesen aussahen, durchsetzt von Wildblumen, über denen Schmetterlinge tanzten. Dann wieder ein schilfbewachsener See oder ein Bach, der sich durch die Felder schlängelte und bestimmt noch keine Abwässer gesehen hatte. Doch am meisten beeindruckten mich die herrlichen alten Bäume am Straßenrand, deren Kronen ein fast geschlossenes Dach bildeten, so dass die Sonnenstrahlen nur vereinzelte Kringel auf den schattigen Asphalt malen konnten – ein kilometerlanger lichtdurchfluteter Dom.
»Wetten, dass diese Buchen in spätestens zwei Jahren …«
»Die Buchen sind Linden«, verbesserte ich.
»Also schön, dass diese Linden dann abgehackt, die Straßen begradigt und doppelt so breit sind und alle hundert Meter ein Verkehrsschild steht? Wo gibt es denn bei uns noch solche Alleen? Nach westdeutschen Kriterien sind sie in höchstem Grade verkehrsgefährdend; die vielen Bäume, nicht mal ’ne Parkbucht, und fluoreszierende Kilometersteine habe ich auch noch nicht gesehen.«
Dafür sahen wir an einer Wegkreuzung eine alte Frau unter einem Sonnenschirm sitzen, vor sich einen Klapptisch und darauf mehrere Blecheimer mit selbstgebundenen Feldblumensträußen.
»Halt mal an!«
Steffi trat auf die Bremse. »Du willst doch nicht etwa was von dem Suppengrün kaufen? Bis wir im Hotel sind, ist es welk.«
»Die Hälfte der Strecke haben wir doch schon hinter uns. Außerdem zeichnen sich die meisten Hotelzimmer durch gleichbleibende Tristesse aus, da kann ein bisschen Frühling in der Vase bestimmt nicht schaden.« Weil sie so hübsch aussahen, kaufte ich gleich zwei Sträuße.
»Müssen Sie noch weit fahren?«, fragte die Frau, während sie die Blumen erst in eine feuchte Zeitung und dann in braunes Packpapier wickelte.
»Nur nach Templin.«
»Bis dahin werden sie sich halten, doch dann sollten sie gleich ins Wasser. Feldblumen sind empfindlich.«
»Was hast du denn jetzt dafür bezahlt?«, wollte Steffi wissen, als ich meinen Einkauf auf dem Rücksitz deponiert hatte.
»Vier Mark zusammen.«
»Dafür hätt’ste bei uns nicht mal die Margeriten gekriegt. – Hoppla, das wäre beinahe schiefgegangen!« In letzter Sekunde hatte sie noch das Steuer herumgerissen, sonst hätte sie die Ente plattgefahren. »Wo kam die denn plötzlich her?«
»Frag sie doch!«
Grimmig sah sie mich an. »Du bist auch schon mal komischer gewesen! – Apropos Ente: Langsam kriege ich Hunger.«
»Ich auch, aber wir müssen ja bald da sein. Sollten wir nicht überhaupt mal links abbiegen?«
»Erst in Mümmeldorf oder wie das Kaff heißt. Bisher ist es noch nicht aufgetaucht.«
Das Kaff hieß Milmersdorf und wurde renoviert. Zumindest hörte plötzlich die Straße auf. Rotweiße Schranken signalisierten Bautätigkeit, von der allerdings nichts zu sehen war. Der Ort schien menschenleer.
»Mittagspause«, vermutete Steffi. »Bis die zu Ende ist, möchte ich eigentlich nicht warten.«
»Weshalb solltest du?«
»Weil ich partout keine Ahnung habe, wie ich jetzt weiterfahren muss. Siehst du vielleicht irgendwo ein Schild? Na also! Und bevor wir eventuell an der Ostsee landen, würde ich doch lieber einen Eingeborenen fragen.«
»Wie stellst du dir das vor? Willst du an der nächsten Haustür klingeln?«
»Ich nicht!«, kam es prompt zurück.
Ich sah in ihr erwartungsvolles Gesicht und schüttelte den Kopf. »Denk erst gar nicht daran!« Andererseits hatte ich auch keine Lust, bis zum Erscheinen des ersten menschlichen Wesens auszuharren. Die Länge der Mittagspausen hängt bekanntlich vom Arbeitseifer der jeweiligen Vorgesetzten ab, speziell bei Bauarbeitern, und von denen will der Polier auch erst mal in Ruhe seine Bildzeitung lesen. »Fahr doch einfach weiter! Am besten nach links, da müssen wir sowieso hin.«
»Auf diesen Trampelpfad? Na, wenn du meinst …«
Es musste wohl der richtige gewesen sein. Plötzlich waren wir wieder auf einer Straße und wenig später am Ortseingang von Templin. Genau in diesem Augenblick fing es an zu regnen.
»Scheint ja ein reizendes Städtchen zu sein.« Steffi deutete auf die trostlosen Wohnblocks mit ihren abblätternden Fassaden, die den ersten und letzten Anstrich während der Ulbricht-Ära bekommen hatten. Dazwischen eine Jugendstilvilla, heruntergekommen, beinahe schon baufällig. Neu waren lediglich die Satellitenschüsseln, mal neben dem Fenster montiert, mal auf dem Balkongitter befestigt, selten auf dem Dach – ein Meer von runden Scheiben.
Bevor wir uns auf die Suche nach der Kreisbibliothek machten, steuerte Steffi ein am See gelegenes Restaurant an. »Die hier scheinen von unserem Solidaritätszuschlag schon was abgekriegt zu haben.«
Vielleicht war das hübsche Holzhaus früher mal eine HO-Gaststätte gewesen – direkt am See gegenüber von einem Angelsteg gelegen –, ein bisschen sah es noch danach aus, doch hatte man es offensichtlich renoviert und ein kleines Restaurant daraus gemacht. Der verlockende Duft nach Gebratenem trieb uns hinein.
»Ich nehme die Kohlrouladen«, entschied Steffi nach einem flüchtigen Blick auf die Speisekarte, »du machst ja nie welche!«
Stimmt. Seit meiner letzten Blamage, die allerdings schon etliche Jahre zurücklag, hatte ich mich an diese sperrigen Dinger nicht mehr herangewagt.
»Kohlrouladen haben aus Kohl zu bestehen und nicht aus Hackfleisch!«, hatte mein Ehemann gemeckert, als ich ihm das erste Produkt meiner damals noch sehr unzulänglichen Kochbuch-Kenntnisse vorgesetzt hatte. Seitdem musste ich immer mindestens fünf Kohlblätter um die Füllung wickeln, aber dann hält die Klammer nicht, und mit Zahnstochern braucht man gar nicht erst anzufangen. Die Methode unserer Altvordern ist in diesem Fall die beste. Omi hatte früher immer eine Rolle Nähgarn in der Küchenschublade gehabt, ich nehme lieber Zwirn, der reißt nicht so schnell.
An jenem bewussten Tag – Rolf war nicht da, stattdessen hatte Sascha mal wieder zwei Freunde an den kostenlosen Mittagstisch geschleppt – klingelte das Telefon, als ich gerade das Essen aufgetragen hatte. Während ich noch an der Strippe hing, hörte ich plötzlich aus dem Nebenzimmer die Kommandostimme meines Sohnes: »Eins, zwei, drei! Und ziehen … rollen … ziehen … rollen …« Ich warf den Hörer hin und stürzte ins Nebenzimmer. Da stand doch die ganze Meute auf den Stühlen und spulte zwei Meter Zwirnsfaden auf die Gabeln. Ich hatte ganz einfach vergessen, ihn vor dem Servieren zu entfernen. – Seitdem habe ich etwas gegen Kohlrouladen!
Ganz genau hatte uns die Kellnerin den Weg zur Friedrich-Engels-Straße beschrieben. Die hatten wir auch gleich gefunden, nur die Bücherei suchten wir vergebens. Es gab kein Haus mit der Nummer sieben.
»Eigentlich kann es nur der Schuppen da hinten sein«, meinte Steffi, nachdem wir ein zweites Mal die Straße rauf- und wieder runtergefahren waren, »etwas anderes steht doch hier gar nicht.«
Ich sah zu dem zurückliegenden, wellblechgedeckten Flachbau hinüber, betrachtete den aufgeweichten, von Pfützen übersäten Weg und befand, dass er keinesfalls zu einer kulturellen Stätte führen könne.
»Wetten, dass …?«, fragte Steffi grinsend.
»Wetten, dass nicht …?«
Den Wagen ließen wir vorsichtshalber auf der Straße stehen, es genügte, wenn unsere Schuhe im Matsch versanken. »Hat’s denn im Arbeiter- und Bauernstaat nicht mal ein paar Eimer Schotter gegeben?«, schimpfte Steffi, mit einem Papiertaschentuch den Lehm von ihren Tretern wischend. »Und sieh dir mal meine Hosen an! Wenn ich die nachher ausziehe, stehen sie untenrum von alleine.«
Wenigstens waren wir auf dem richtigen Weg gewesen. Steffis Gemecker hatte die Bibliothekarin vor die Tür gelockt. Offenbar fiel ihr ein Stein vom Herzen, als sie uns sah. »Sie sind doch Frau Sanders, nicht wahr? Wir hatten schon Angst, dass Sie gar nicht kommen. Das wäre für unsere Leser eine große Enttäuschung geworden.«
Na, so furchtbar viele würden das bestimmt nicht werden. Die beiden Räume waren nicht groß und würden selbst nach einigen Umbauten Platz für maximal zwei Dutzend Stühle haben. Mich wunderte allerdings, dass man damit noch gar nicht angefangen hatte. Ich hatte nämlich festgestellt, dass die einzelnen Regale keine Rollen hatten, und wenn man die erst würde ausräumen müssen, um sie zur Seite schieben zu können …
Frau Bort musste Gedankenleserin sein. »Die Veranstaltung findet natürlich nicht hier statt, sondern im Gemeindesaal. Der ist aber ganz einfach zu finden. Gleich das zweite Haus rechts am Marktplatz, und da im ersten Stock. Unten ist die Kindertagesstätte drin.«
Das hörte sich schon besser an. »Vorher würden wir noch gern ins Hotel fahren.«
»Ja, natürlich«, sagte Frau Bort, »das ist nicht weit weg. Bis zur Unterführung, da biegen Sie links zum Wald ab, und dann sehen Sie es schon.« Bevor wir uns verabschiedeten, drückte sie mir ein Kuvert in die Hand. Den Absender kannte ich schon: Staatl. Fachstelle für öffentliche Bibliotheken. »Frau Wagner war sich nicht sicher, ob der Brief Sie vor Ihrer Abreise noch erreichen würde, deshalb hat sie ihn hierher geschickt. Ich glaube, da hat es ein paar Änderungen gegeben.«
Die hatten Zeit bis später. Ich wollte endlich raus hier und im Hotel unter die heiße Dusche.
»Es fängt an zu regnen«, bemerkte Steffi ganz richtig, während wir bei noch geöffneten Türen im Wagen saßen und den klebrigen Lehm von den Schuhen kratzten. »Wären wir später angekommen, hätten wir wahrscheinlich schwimmen müssen.« Sie deutete auf die Pfützen, die sich zusehends zu einem See vereinten. »Im Winter wird man Schlittschuhe brauchen.«
Selbst bei Sonnenschein würde diese Stadt nicht gerade einladend aussehen, bei Regen wirkte sie einfach trostlos. Grauer Himmel, graue Häuser, Farbtupfer höchstens durch ein beleuchtetes Schaufenster oder frischgestrichene Fensterrahmen. Dazwischen immer mal wieder die verblichenen Buchstaben eines ehemaligen HO-Geschäfts.