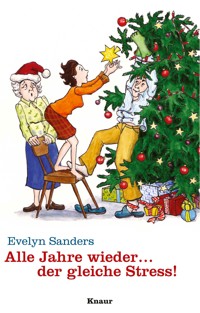6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Das hat der gestressten Mutter Evelyn Sanders gerade noch gefehlt: Da dichtet sie ihrem Sohn zum Geburtstag eine witzige Familiengeschichte, und was geschieht? Der Ehemann bringt das Buch an den Verlag – und es wird prompt zum absoluten Bestseller! Und das Leben als Spitzenautorin ist wirklich nicht ohne! Angefangen bei Flutwellen voller Fanpost und hochgefährlichen Spirituosen auf der Buchmesse bis hin zum vollendeten Chaos im ohnehin schon komplizierten Leben der Großfamilie ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 462
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Evelyn Sanders
Das hätt’ ich vorher wissen müssen
Roman
Knaur e-books
Inhaltsübersicht
Das hätt’ ich vorher wissen müssen
Kennen Sie Rom?«
»Natürlich kenne ich Rom! Ich hab ›Ben Hur‹ gesehen, ›Cäsar und Kleopatra‹ und nicht zu vergessen Fellinis ›Dolce Vita‹!«
Das mokante Grinsen von Frau Marquardt konnte ich durch den Telefonhörer förmlich sehen. »Ich meine doch nicht den Striptease von Anita Ekberg, sondern das richtige, echte Rom.«
Auf der Heimreise von einer dieser maritimen Grillstätten hatte ich wenigstens einen Blick auf den Mailänder Dom werfen können, aber nur von außen. Das Benzin war alle gewesen, und Rolf hatte wohl Angst gehabt, die letzten paar Tropfen würden bei einem längeren Aufenthalt in der Mittagshitze verdunsten und nicht mehr bis zur nächsten Tankstelle reichen. So hatte ich bloß ein paar Fotos geknipst, auf denen man später viel Vorplatz mit Tauben sehen konnte und wenig Dom.
Meine Kenntnisse italienischer Kulturdenkmäler bewegten sich also auf einem äußerst niedrigen Niveau und konnten sich durchaus mit dem nicht viel umfangreicheren Wissen meiner beiden jüngsten Töchter messen. Sie sollen in einem Jahr Abitur machen, halten aber noch heute den Tiber für einen römischen Kaiser und das Kapitol für den Sitz der amerikanischen Regierung. Irgendwie muß das mit der Schulreform zusammenhängen. Im Erdkundeunterricht lernen sie, wie man Eskimos in das Gemeinschaftsleben ceylonesischer Teepflücker integrieren könnte, aber Lappland suchen sie dann irgendwo in der Gegend von Kanada.
Ich erinnere mich noch an den Rückflug von Teneriffa, wo wir zwei Wochen Urlaub verbracht hatten. Der Pilot verkündete über Bordlautsprecher, daß wir rechts unten die Straße von Gibraltar sehen könnten. Meine damals dreizehnjährige Tochter Katja hängte sich auch sofort ans Fenster, starrte minutenlang auf die spanische Küste, um dann befriedigt festzustellen: »Jetzt habe ich sie gefunden! Aber unsere Autobahnen sind viel breiter.«
Doch wen wundert es, wenn die heutige Generation Nagasaki mit Nairobi verwechselt? Man braucht doch nur einmal einen Schulatlas aufzuschlagen. Da findet man seitenweise Diagramme der exogenen und der endogenen Kräfte, was immer das auch sein mag, dann Bildtafeln, die die Tektonik veranschaulichen sollen, unter der ich mir im übrigen auch nichts vorstellen kann, gefolgt von meteorologischen Karten – fällt unter die Rubrik Klimatologie –, danach kommen Tiergeographie, ein paar Seiten Staatenbündnisse und Beistandspakte, nicht zu vergessen die internationalen Luftverkehrswege … und hintendran hängen tatsächlich noch einige Landkarten, auf denen wenigstens die größeren Städte eingezeichnet sind.
Zu meiner Schulzeit haben wir noch die genaue Kilometerlänge von Nil und Amazonas wissen müssen, und wer die Hauptstädte Südamerikas nicht in einem Atemzug herunterbeten konnte, bekam von vornherein eine Vier. Solchermaßen geschult, wußte ich also, daß Rom sowohl geographisch als auch geschichtlich interessant ist. Nur gesehen hatte ich es noch nicht.
»Dann kommen Sie doch mit!« sagte Frau Marquardt. »Fünf Tage einschließlich Flug und Halbpension zu einem äußerst günstigen Preis.«
Frau Marquardt ist zehn Jahre jünger als ich, zehnmal so couragiert und mindestens doppelt so unternehmungslustig. Wohl deshalb hatte sie auch ihren eigentlichen Beruf an den Nagel gehängt und sich aufs Reiseleiten verlegt. Nur war sie bisher meist mit einem Troß mittelalterlicher Damen und Herren nach Wien gefahren und hatte dort das übliche Programm abgespult: Donaudampfer und Heurigenseligkeit, morgens Fiakerrundfahrt und abends im Theater »Land des Lächelns« – also keineswegs das, was mich auch nur im entferntesten hätte reizen können.
»Statt Wien also diesmal Via Veneto und Papstmesse? Betrifft mich nicht, ich bin evangelisch.«
Sie lachte. »Sogar Mohammedaner besichtigen den Petersdom.«
»Auch wieder wahr. Trotzdem glaube ich nicht, daß ich mich für so einen Herdentrip begeistern kann. Ewig im Kielwasser des Leithammels von Kirche zu Kirche schlappen, Städteführer in der Hand und Fotoapparat vorm Bauch ist nicht mein Fall. Dazu kriegt man pausenlos Namen und Daten um die Ohren geschlagen, die sich kein Mensch merken kann, und am Schluß der Besichtigungstour fragt jemand: Fräulein, ich hab nicht alles verstanden, können Sie mir noch mal sagen, wer die Figur auf dem Marc-Aurel-Denkmal war? – Nein, vielen Dank, ohne mich!«
»Man merkt, daß Sie noch nie eine Gruppenreise mitgemacht haben. Kein Mensch zwingt Sie, an jeder Führung teilzunehmen, aber das Programm ist wirklich interessant und nicht überladen. Es bleibt Ihnen genügend freie Zeit für Eigeninitiative. Soll ich Ihnen nicht doch mal die Unterlagen schicken?«
»Na schön, ansehen kostet ja nichts. Und überhaupt muß ich erst einmal abtasten, wie sich die Familie dazu stellt.«
Sie reagierte unterschiedlich. Ehemann Rolf, noch immer nicht an meine gelegentlichen Alleingänge gewöhnt, sagte gar nichts, holte den Rasenmäher und köpfte die ohnehin erst streichholzlangen Grashalme um ein weiteres Drittel. Auch eine Methode, seinen Unmut loszuwerden.
Sohn Sven, siebenundzwanzig Jahre alt, Junggeselle mit gelegentlichem Hang zur Zweisamkeit und deshalb hundert Kilometer vom Heimathafen entfernt wohnend, wunderte sich über meinen Anruf und empfahl mir lediglich Brustbeutel und Reiseschecks, »weil doch in Italien so viel geklaut wird«.
Sein zwei Jahre jüngerer Bruder Sascha, ebenfalls schon lange zum Nestflüchter geworden, wunderte sich noch viel mehr. »Es ist mir doch völlig Wurscht, wann du wie lange wohin fährst«, bellte er durchs Telefon, erbat sich die obligatorische Ansichtskarte aber diesmal im Hochformat, weil sie sonst auf seiner Pinnwand keinen Platz mehr hätte.
Stefanie dagegen war begeistert von meinen Reiseplänen und dachte sofort praktisch. »Kannst du nicht mal sehen, ob du da unten einen schicken mintgrünen Pulli für mich auftreibst? Bennetton oder so was in der Richtung. Die kommen doch alle aus Italien und sind dort bestimmt viel billiger als bei uns.«
Blieben also noch die Zwillinge. Sie würden in erster Linie die Leidtragenden sein, fühlten sich aber gar nicht als solche. »Natürlich fährst du«, erklärten sie unisono, »die paar Tage kommen wir schon alleine klar. Wir sind doch keine kleinen Kinder mehr!«
Das war nur bedingt richtig. Laut Geburtsurkunde sind sie siebzehn, haben die Mentalität von Fünfzehnjährigen und sind noch immer nicht in der Lage, eine Bluse zu bügeln, ohne daß sie hinterher aussieht, als habe jemand zwei Nächte darin geschlafen.
»Na ja, wenn ihr meint …« Noch immer zögerte ich, meine auf drei Personen geschrumpfte Familie ihrem Schicksal zu überlassen, ihr fünf Tage lang Pizza und Bratkartoffeln zuzumuten – zu mehr würde es ja doch nicht reichen – und mich selber an Scampi, Spaghetti alla Carbonara und ähnlichen italienischen Spezialitäten gütlich zu tun.
»Du mußt endlich mal deinen Gluckenkomplex ablegen«, zerstreute Nicole meine unausgesprochenen Bedenken, »und überhaupt wärst du schön blöd, wenn du diese Reise nicht mitmachen würdest. Schließlich kannst du sie dir doch jetzt leisten.«
Wie oft hatte ich diesen Satz in den vergangenen Jahren gehört! Genaugenommen seit dem Tag, an dem ich den Vertrag für mein erstes Buch unterschrieben und nicht geahnt hatte, was er für Folgen haben würde. Warum hatte mir das bloß niemand vorher gesagt?
Kapitel 1
Angefangen hatte alles irgendwann in den Sommerferien. Zum erstenmal war es uns gelungen, den auf fünf Köpfe angewachsenen Nachwuchs über die Verwandtschaft zu verteilen, und wir beiden Daheimgebliebenen freuten uns auf eine ruhige Zeit ohne Überfälle von Jugendlichen, die den Kühlschrank leer fraßen und das Haus als Schlachtfeld hinterließen. Nach einer Woche ging Rolf jedoch die ungewohnte Stille dermaßen auf die Nerven, daß er kurzerhand einen Freund anrief und mit ihm einen Angelurlaub an einem österreichischen See verabredete. Der Form halber wurde ich zum Mitkommen aufgefordert, aber nach meiner Ansicht gibt es nur eine Tätigkeit, die noch langweiliger ist als Angeln: Zugucken.
»Mußt du ja gar nicht«, sagte mein Ehemann, »du kannst dich durchaus nützlich machen. Köder suchen, Fische schuppen …«
Ich lehnte dankend ab und war froh, als er samt geliehener Angelrute, Gummistiefeln und zusammenklappbarem Campinghocker ins Auto stieg. Mich erschütterte nicht einmal die Aussicht, in nächster Zeit nur auf meine Beine angewiesen zu sein. Spazierengehen ist gesund, außerdem wollte ich meine Taillenweite um mindestens zwei Zentimeter reduzieren und mich vorwiegend von Obst und Joghurt ernähren, das wiegt nicht viel, das kann man im Einkaufsnetz nach Hause tragen. Ansonsten wollte ich ganz einfach mal so richtig faulenzen, in der Sonne liegen, endlich die Bücher lesen, die ich vor anderthalb Jahren zu Weihnachten bekommen hatte, und es genießen, eine Zeitlang keine wie auch immer gearteten Verpflichtungen zu haben.
Nur hatte ich nicht voraussehen können, daß jenes Jahr in die Annalen der meteorologischen Geschichte als ein Sommer eingehen würde, der sich auf drei Tage im Mai und sieben Tage im Juli beschränkte. Es regnete pausenlos. Und wenn es wirklich mal aufhörte, war es kalt. Frierend stand ich am Fenster und starrte auf die tropfenden Terrassenmöbel. In Österreich schiene die Sonne, hatte Rolf am Telefon gesagt, und ob ich nicht doch noch nachkommen wollte? Nein, nun gerade nicht!
»Du hast mich mit deinem Anruf aus dem Liegestuhl gescheucht, und ich denke nicht daran, ihn in die Ecke zu stellen, um Regenwürmer auf Angelhaken zu spießen. Petri Heil!« Der Hörer flog auf die Gabel zurück, und ich schloß das Fenster, weil es reinregnete. Innerlich knirschte ich mit den Zähnen.
Die beinahe täglich eintrudelnden Urlaubsgrüße aus exotischen Gegenden trugen auch nicht zur Stimmungsförderung bei. Woran liegt es bloß, daß einem Bekannte, die man das ganze Jahr über kaum sieht, plötzlich vom anderen Ende der Welt schreiben, wie sehr sie es bedauern, daß man nicht mit ihnen dort sein kann? Wahre Freunde schicken einem keine Karte von den sonnigen Seychellen!
Um es genau zu sagen: Ich langweilte mich erbärmlich! Die Schränke hatte ich schon aufgeräumt, alle Fensterbrettblumen umgetopft, Kontoauszüge abgeheftet und sogar die letzten Ostergrüße der Verwandtschaft beantwortet. Es gab wirklich nichts mehr zu tun. Allenfalls konnte ich noch die Fotos sortieren und einkleben, die mir beim Herumstöbern in die Hände gefallen waren – Erinnerungen, konserviert in Schuhkartons. Manche Bilder waren schon ein bißchen vergilbt, andere hatten Wasserflecken, waren zerknickt … Wahllos zog ich eins heraus. Sascha grinste mich spitzbübisch an, in einer Hand einen Spaten, in der anderen eine tote Wühlmaus. Diese Aufnahme stammte aus Heidenberg, jenem 211-Seelen-Dorf im Schwäbischen, wohin es uns Großstadtpflanzen seinerzeit verschlagen hatte. Oder hier das Foto mit dem Bierfaß, in das wir den Weihnachtsbaum einzementiert hatten. Vier Meter hoch war er gewesen und hatte in keinen normalen Ständer gepaßt. Später haben wir ihn nicht mehr rausgekriegt.
Eine verrückte Zeit hatten wir erlebt, damals, als die Kinder noch klein und das gemietete Haus am Dorfrand so riesengroß gewesen waren. Eigentlich schade, daß man Fotos immer nur in Alben vergräbt, mit Daten umrandet und die kleinen Begebenheiten, die mit solchen Aufnahmen meistens zusammenhängen, allmählich vergißt. Sascha konnte sich bestimmt nicht mehr an seinen sechsten Geburtstag erinnern, zu dem er ohne mein Wissen die gesamte Dorfjugend unter zehn Jahren eingeladen hatte. Die Katastrophe war ja dann auch nicht ausgeblieben.
Man sollte diese Geschichten ganz einfach mal aufschreiben, Fotos dazukleben und den Kindern zum achtzehnten Geburtstag schenken. Dazu hätte ich auch entschieden mehr Talent als für den dunkelgrünen Pullover mit Rautenmuster, den sich Sven gewünscht hatte. Handgestrickt natürlich, das war gerade wieder mal »in«.
Kurz entschlossen setzte ich mich an die Maschine und fing an. Die ganze Sache machte mir so viel Spaß, daß ich den ursprünglichen Zweck dieser Schreiberei vergaß und einfach drauflosfabulierte. Immer mehr fiel mir ein zum Thema Heidenberg: Die Faschingsfeier in der ehemaligen Gemeindekelterei, dann Hannibal, mein sogenanntes Zweitauto, das vor jeder Anhöhe streikte und nie von selbst ansprang, und natürlich Wenzel-Berta, unser Faktotum mit dem unschlagbaren Mundwerk.
Als Rolf zurückkam, braungebrannt und blendend erholt, fand er mich mit durchgeistigter Stubenhockerblässe an seinem Schreibtisch sitzend, um mich herum Notizzettel, Fotos und vierundsechzig vollgeschriebene Manuskriptseiten.
»Bist du wahnsinnig geworden? Ich hab dir doch schon hundertmal gesagt, daß du meinen Schreibtisch nicht aufräumen sollst!«
»Hab ich ja gar nicht! Ich habe ihn lediglich seiner eigentlichen Bestimmung zugeführt und daran geschrieben. Du benutzt ihn ja doch bloß als Müllcontainer!«
Inzwischen hatte er das Manuskript entdeckt und zu lesen angefangen. »Was soll denn das werden? So eine Art Lebensbeichte?«
»Quatsch! Biographien sind Dichtungen, geschrieben von Leuten, die die Wahrheit kennen. Ich hab bloß mal ein bißchen zusammengefaßt, was wir damals alles in Heidenberg erlebt haben, quasi eine Gedächtnisprothese für die Kinder.«
»Wieso nur für die Kinder? Da hätten andere Leute bestimmt auch ihren Spaß dran.« Er hatte sich in einen Sessel gesetzt und in das Manuskript vertieft. Plötzlich lachte er laut auf. »Du, das ist ja direkt druckreif!«
Ich fühlte mich geschmeichelt. Immerhin war er ein paar Jahre lang Chefredakteur einer Jugendzeitung gewesen und hatte ein bißchen Ahnung von der Materie.
»Natürlich muß man hier und da noch etwas ändern, an manchen Stellen raffen – wenn ich Zeit habe, werde ich mich mal damit beschäftigen.«
Erstens hatte er nie Zeit, und zweitens … »Du wirst überhaupt nichts daran tun! Das wird mein Geburtstagsgeschenk für Sven, und das mache ich allein fertig. Von dir kriegt er ja den Führerschein. Da ist übrigens eine Mahnung von der Fahrschule gekommen, du hast die zweite Rate noch nicht bezahlt.«
»Wieso bin ich eigentlich verpflichtet, meinem Sohn die Fahrstunden zu bezahlen? Meine eigenen hat mir auch niemand finanziert.«
»Soweit ich mich erinnern kann, war das deine Idee!«
»Da muß ich besoffen gewesen sein!«
Ehemännern soll man nur im äußersten Notfall widersprechen. »Du meinst also, ich soll die Geschichte fertigschreiben?«
Offenbar interessierte ihn das aber schon nicht mehr. »Warum nicht?« sagte er im Hinausgehen. »Wenn’s dir Spaß macht. Wann gibt es übrigens Abendbrot?«
Schriftsteller sind über so profane Dinge wie Essen und Trinken erhaben. Fast zwei Wochen lang hatte ich mich von Spiegeleiern, Toast und schwarzem Kaffee ernährt, dabei anderthalb Kilo abgenommen, und nun sah ich keine Veranlassung, diese Lebensweise wieder zu ändern. »Koch dir doch selber was, ich muß arbeiten.«
Dann kamen nach und nach die Kinder zurück und mit ihnen Berge von schmutziger Wäsche. Das Bügeleisen hatte Hochkonjunktur, die Schreibmaschine Pause. Der Herbst ging vorüber mit Elternabenden, Svens Tanzstundenball, mit gesellschaftlichen Verpflichtungen, vor denen man sich nicht drücken kann, wo man vorher zum Friseur und hinterher zum Arzt muß, weil der Geflügelsalat verdorben gewesen war; dann nahte Weihnachten mit Nikolausfeiern, Plätzchenbacken und Verwandtenbesuch, und dann kam Svens achtzehnter Geburtstag. Auf dem Gabentisch lagen neben dem Führerschein ein gekaufter dunkelgrüner Pullover sowie der Gutschein für eine »Überraschung ideeller Art«, auf dessen Einlösungstermin ich mich nicht näher festlegen wollte. Sven war auch nicht sonderlich interessiert. Von Überraschungen hielt er ohnehin nicht viel, sie waren meist unerfreulicher Natur, und von ideellen hielt er schon gar nichts, die waren ihm zu abstrakt. Bald hatte er die ganze Sache vergessen.
Rolf übrigens auch. Er kam nie wieder auf das Manuskript zu sprechen, und wenn er mich gelegentlich in Stefanies Zimmer auf der Maschine klappern hörte, dann verlor er kein Wort darüber. Zu meinen selbstverständlichen Pflichten gehörte auch die Familienkorrespondenz.
Heute weiß ich nicht mehr, wie ich dieses Manuskript jemals zu Ende bringen konnte. Mal eine Stunde zwischen Staubsaugen und Kartoffelschälen, mal am Abend, wenn die Kinder im Bett waren und Rolf in seiner Stammkneipe mit anderen streßgeplagten Ehemännern über die Ungerechtigkeit der Welt klagte, in der den Vätern die Arbeit und ihren Frauen das Geldausgeben zugeteilt ist. »Meine Familie braucht keine Konsumentenberatung«, hatte er mal geäußert, »das sind lauter geborene Konsumenten.«
Im Spätsommer, also fast vierzehn Monate nach Beginn meiner Schreiberei, war die Geschichte fertig. Ein recht umfangreiches Gedächtnisprotokoll, wie ich beim Durchblättern der fast zweihundert Seiten feststellte. Natürlich würde ich den ganzen Kram noch mal abtippen und Platz aussparen müssen für die Fotos, aber alles in allem war ich recht zufrieden. Zunächst verschwand der Schnellhefter in einer Schublade.
Da lag er, bis Rolf einmal einen Schal suchte und in meinem Schrank damit anfing. Den Schal fand er nicht, statt dessen entdeckte er den Pappendeckel, und da alles, was irgendwie mit Akten zusammenhängt, in sein Ressort fiel, nahm er ihn mit. Am nächsten Morgen bekam ich ihn zurück.
»Warum hast du mir nicht längst erzählt, daß du diese Heidenberger Geschichten fertig hast? Die halbe Nacht habe ich mir um die Ohren geschlagen, weil ich sie zu Ende lesen wollte.«
»Und, hast du?«
»Natürlich habe ich, und ich finde sie großartig. Ein Jammer, daß so etwas im Schrank verstaubt.«
»Also das ist nicht wahr! Zweimal im Jahr mach ich die Schubkästen auch innen sauber!«
»Du solltest das Manuskript einem Verlag anbieten.«
»Blödsinn, wer interessiert sich schon für Familieninterna? Und überhaupt – kennst du denn einen?«
»Wen?«
»Einen Verlag.«
»Nein.«
Rolf ist Werbeberater, zu dessen Kunden Bonbonhersteller und Möbelfabrikanten gehören, aber leider keine Verleger. Also war sein Vorschlag von vornherein utopisch. Trotzdem ließ mir die Sache keine Ruhe. Er hatte mir einen Floh ins Ohr gesetzt, und der rumorte.
»Versuch’s doch mal«, flüsterte er immer wieder, »jeder Autor hat irgendwann als Unbekannter angefangen …«
»… und die meisten sind dabei auf die Schnauze gefallen!« antwortete mein realistisch geschulter Verstand, während die kleine Gehirnecke, die für Träume und Illusionen zuständig ist, bereits Schlagzeilen begeisterter Kritiker produzierte: Neue Bestseller-Autorin entdeckt! Vielversprechendes Talent verkümmerte am Kochtopf! Und so weiter.
Beim nächsten Ausflug ins Großstadtleben graste ich sämtliche Heilbronner Buchhandlungen ab und sammelte alles ein, was an Verlagsprospekten und Leserinformationen herumlag. Es war eine ganze Menge, doch als ich zu Hause meine Ausbeute sortierte, mußte ich den größten Teil davon wieder in den Papierkorb werfen. Wer Böll und Grass verlegte, kam für mich natürlich nicht in Frage, mein Größenwahn hielt sich wenigstens noch in Grenzen. Die Kochbuchspezialisten konnte ich wohl ebenso abhaken wie die Herausgeber von Reiseführern, und wer sogar den letztjährigen Nobelpreisträger in seinem Programm hatte, dürfte über simple Unterhaltungsliteratur ohnehin erhaben sein. Da blieben wirklich nicht mehr sehr viele übrig, bei denen ich einen Vorstoß wagen konnte. Ich schrieb ein paar Namen auf verschiedene Zettel, breitete sie auf dem Fußboden aus und warf eine Münze über die Schulter. Sie drehte sich ein paarmal und kullerte zu einem größeren Verlag in Süddeutschland. Also würde dessen Lektor als erster die Chance bekommen, das neue Literaturgenie zu entdecken.
Er entdeckte es nicht! Das Manuskript kam zurück, und an den vier Seiten, die ich an einer Ecke zusammengeklebt hatte und die immer noch pappten, konnte ich erkennen, daß man mein bedeutendes Werk nicht einmal gelesen hatte. So was frustriert!
»Du fängst das auch falsch an!« sagte mein lieber Ehemann etwas herablassend. »Du mußt Leseproben verschikken! Zwanzig Seiten überfliegt man schneller als zweihundert. Wenn dein Stil ankommt, wird man das komplette Manuskript schon anfordern.«
Das leuchtete ein, nur »Wie muß denn so eine Leseprobe aussehen?«
Rolf wußte das auch nicht so genau. »Nimm irgendein Kapitel heraus, setz ein bißchen was davor und hintendran den Schluß vom Buch, damit die Sache ein Gesicht kriegt, und dann versuch’s noch mal. Hast du überhaupt schon einen Titel?«
»Wieso? Braucht man den? Ich dachte immer, den sucht der Verlag.«
Über soviel Naivität konnte Rolf nur wissend lächeln. »Das Kind muß einen Namen haben.«
Mußte es wirklich? Außerdem war hier ja von fünf Kindern die Rede, die konnte ich doch unmöglich im Titel alle einzeln aufzählen. Wir hatten selbst schon bei jedem Neuankömmling Mühe gehabt, einen nicht allzu abgedroschenen Namen zu finden, bei den Zwillingen waren wir uns tagelang nicht einig geworden, Kinderreichtum hat auch seine negativen Seiten, – Moment mal, das klang doch gar nicht so schlecht: Mit Fünfen ist man kinderreich!
»Hoffentlich vermutet niemand eine soziologische Abhandlung dahinter«, dämpfte Rolf meine Begeisterung, aber etwas Besseres hatte er auch nicht zu bieten.
»Und so was schimpft sich nun Werbeberater! Hätte ich eine neue Sorte Leberwurst erfunden, wäre dir sofort der passende Slogan eingefallen!«
»Das ist auch wesentlich leichter, da braucht man sich nicht an Fakten zu halten.« Er grinste. »Die Seele einer Frau, der Magen einer Sau, das Inn’re einer Leberworscht, die sind noch gänzlich unerforscht! Übrigens könnte ich jetzt ganz gut ein zweites Frühstück vertragen. Aber mit Schinken.«
Er bekam seinen Schinken und ich ein Vorsatzblatt für meine Leseprobe, handgemalt und dann in sechsfacher Ausfertigung fotokopiert. »Du mußt mindestens ein halbes Dutzend Eisen im Feuer haben! Je mehr Manuskripte unterwegs sind …«
»… desto mehr kommen auch wieder zurück!« prophezeite ich.
»Das hast du gesagt!«
Der Rest war ganz einfach und wurde später zur Routine: Großen Briefumschlag beschriften, Schnellhefter samt Anschreiben hinein, zukleben, frankieren, wegschicken. Sobald die Manuskripte zurückkamen – und sie kamen mit schöner Regelmäßigkeit zurück, der Postbote beschwerte sich bereits –, Umschlag öffnen, Absagebrief vernichten, neues Anschreiben, neues Kuvert, und wieder ab in den Briefkasten. Vorher mußte ich allerdings auf meiner immer länger werdenden Liste diejenigen Verlage abhaken, denen mein Opus bedauerlicherweise nicht ins Programm gepaßt hatte, oder – das war die andere Version – die in den nächsten drei Jahren leider keine Möglichkeit gesehen hatten, mein Werk zu publizieren.
Na schön, dann eben nicht! Mußte ja auch nicht sein! Hatte ich die kleinen Stories nicht ursprünglich für meine Kinder geschrieben? Sven wartete immer noch auf sein ganz spezielles Exemplar, zu dessen Fertigstellung ich vor lauter Eifer, mich nun auch in der Elite der schreibenden Zunft einzureihen, nicht gekommen war. Meine Höhenflüge sollte ich mir endlich abschminken und an den mir zustehenden Platz vor Kochtopf und Bügelbrett zurückkehren! Amen.
Doch dann geschah etwas, womit ich nicht mehr gerechnet hatte: Ein Schweizer Verlag erbat sich das komplette Manuskript. Unter den beifälligen Blicken der gesamten Familie wurde es sorgfältig verpackt, von allen dreimal bespuckt und per Einschreiben auf den Weg geschickt.
Nun begann das Warten. Jeden Vormittag lief ich dem Briefträger schon auf der Straße entgegen, aber meistens schüttelte er bereits von weitem den Kopf. Er war richtig glücklich, wenn er mir wenigstens eine zurückgesandte Leseprobe aushändigen konnte und ich ihm nicht völlig umsonst in die Arme gestürzt war. Nur der Brief, auf den ich so sehnsüchtig wartete, kam nicht.
Dafür kam ein anderer. Ein Bayreuther Verlag, den ich erst angeschrieben hatte, nachdem mein Vorrat an Adressen langsam zur Neige gegangen war, wollte ebenfalls das ganze Manuskript haben. Ich hatte aber gar keins mehr! Von meinem Opus hatte ich nur einen einzigen Durchschlag gemacht, das Original ruhte noch immer auf irgendeinem Schweizer Schreibtisch, und die Kopie war bei Tante Käte in Düsseldorf. Am Telefon hatte ich ihr beiläufig etwas von meinen literarischen Ambitionen erzählt, und sie hatte sofort gefragt, ob ich ihr das Manuskript nicht mal schicken könnte. Dankbar, daß sich wenigstens einer dafür interessierte, hatte ich ihr den Gefallen getan. Jetzt lag es vierhundert Kilometer weit weg auf dem Klavier oder sonstwo, und ich kam nicht ran! Tante Käte weilte zu Besuch bei ihrer Tochter, wie mir die gerade Blumen gießende Nachbarin nach sieben vergeblichen Anrufen mitteilte.
Ob sie irgendwo in der Wohnung einen dunkelblauen Schnellhefter sehen könnte, fragte ich verzweifelt. Nein, ihr sei nichts aufgefallen. Würde sie vielleicht so liebenswürdig sein und einmal etwas gründlicher nachschauen? Nein, und wie ich überhaupt dazu käme, sie schnüffle doch nicht in anderer Leute Wohnungen herum.
Geduldig versuchte ich der guten Frau zu erklären, daß es um etwas Lebensnotwendiges ginge und Frau Zillich ganz bestimmt nichts dagegen hätte. Während ich nervös auf der Telefonstrippe herumkaute, suchte ich nach einem Ausweg, falls das Manuskript unauffindbar sein würde. Notgedrungen müßte ich die ganze Zweihundert-Seiten-Kladde noch einmal abschreiben.
»Auf’m Nachttisch han isch so en blaue Aktendeckel jefunde«, sagte die Stimme am Telefon, »isset dat, wat Sie meinen?«
»Ja, das ist es!« jubelte ich. »Nun seien Sie bitte so nett, stecken den Schnellhefter in einen Umschlag und schicken ihn per Eilboten an mich zurück.« Ich buchstabierte Namen und Adresse durch. »Gleich morgen früh geht ein Scheck an Sie ab, der alle Kosten decken wird.«
»Dat is nich nötich, weil ich nämlich die Akten nich aus dä Hand jeben tu«, sagte diese Gemütsperson. »Die Frau Zillich würd mich sonstwat verzähle, wenn isch ihre Sachen an fremde Leut so einfach durchs Telefon wechjeben tät.«
Alles Zureden half nichts. Frau Schmitz, wie sie sich inzwischen vorgestellt hatte, war nicht bereit, mir mein Eigentum zurückzugeben, »weil man jetzt immer so vill liest von Betrüjer und so«. Welche Betrugsmasche ich nach ihrer Meinung abzuziehen versuchte, blieb ungeklärt, aber wenigstens rückte sie die Telefonnummer von Tante Kätes Tochter heraus.
Also rief ich dort an, und Tante Käte wiederum rief Frau Schmitz an und erteilte ihr die Erlaubnis, diesen heißumkämpften Schnellhefter an mich abzuschicken. Und ob sie ihn noch mal haben könne, wenn er wieder zurückkäme, sie sei noch nicht ganz fertig geworden. Ich versprach ihr ein Freiexemplar mit Widmung, sobald das Buch auf dem Markt sei. Immerhin interessierten sich jetzt schon zwei Verleger dafür, einer würde doch wohl anbeißen.
Ich hatte mich geirrt! Ein paar Tage später war das Manuskript aus der Schweiz wieder da, zusammen mit einem Brief, in dem mir auf anderthalb Seiten mitgeteilt wurde, weshalb man mein Buch nun doch nicht einer Veröffentlichung für würdig befunden hatte. Der »rote Faden« fehle, und ich solle die ganze Geschichte noch einmal umschreiben und einen großangelegten Familienroman daraus machen. Das Talent dazu hätte ich auf jeden Fall.
Das klang zwar tröstlich, aber »Ich denke gar nicht daran!« entschied ich. Inzwischen konnte ich den Text schon rückwärts und hatte nicht die geringste Lust, alles noch mal in epischer Breite wiederzukäuen.
»Großangelegte Familienromane zeichnen sich doch wohl in erster Linie durch ihre Länge aus. Soll ich jetzt jede durchgewetzte Hose von Sascha im einzelnen beschreiben und mich drei Seiten lang über das muntere Glucksen des Wassers auslassen, als damals die ganzen Rosen ersoffen sind? Entweder nimmt mir jemand das Manuskript so ab, wie es ist, oder sämtliche Verleger Deutschlands und auch der Schweiz können mir im Mondschein begegnen!«
»Versuch’s doch mal woanders im Ausland«, schlug Sven vor, und Stefanie fügte tröstend hinzu: »Soll ich meine Englischlehrerin fragen, ob sie dir das übersetzt?«
»Nein!!!« Ich knallte die Tür hinter mir zu, lief ins Schlafzimmer, warf mich aufs Bett und heulte erst mal ein bißchen, weil mir gerade danach zumute war. Das haste nu davon, kicherte mein besseres Ich schadenfroh, hätt’ste dich bloß nicht auf das ganze Unternehmen eingelassen! Dir wäre so manche Enttäuschung erspart geblieben! Bloß, weil dein Mann sagt, er findet dein Geschreibsel ganz nett, fühlst du dich zur Schriftstellerin berufen. Langsam solltest du doch wissen, daß Ehemänner nie objektiv sind.
Das andere Ich, dem ich meine Selbstüberschätzung verdankte, frohlockte auch ein bißchen. Wenigstens hatte Rolf das Titelblatt umsonst gezeichnet, und an Portokosten hatte er ein ganz hübsches Sümmchen herausrücken müssen, selbst wenn er es später wieder von der Steuer absetzen konnte.
Schließlich gab ich mir einen Ruck: Nach Ansicht des Familienministers hast du als Frau von Natur aus selbstlos zu sein. Tätigkeiten, für die Geld gezahlt wird – und für Bücher kriegt man welches! –, widerstreben also deiner eigentlichen Natur. Am besten begräbst du deinen kurzen Traum von Ruhm, Geld und Anerkennung und stopfst weiter Strümpfe, das kannst du besser. Tröste dich mit der Tatsache, daß der Hausaufsatz, den du für Sascha entworfen hast, immerhin eine glatte Zwei eingebracht hat. Lessing liegt dir eben mehr als leichte Literatur!
An den kahlen Weinranken hingen Papierschlangen, die morgens noch nicht dort gehangen hatten. Was sollte der Blödsinn? Zu Fasching hatten die Zwillinge in Ermangelung geeigneter Dekorationen das Haus mit Klopapier beflaggt, und jetzt wedelten mindestens ein Dutzend Papierschlangen trübselig im Märzwind. Wahrscheinlich hatten die Gören irgendwo noch eine Rolle gefunden und damit die Giebelwand geschmückt. Es sah ziemlich albern aus.
Ich stellte meine Einkaufstüten ab und drückte auf die Klingel. Nichts tat sich. Normalerweise stürzte mir immer die halbe Familie entgegen, aber diesmal knallten weder Türen noch wankte das Treppenhaus unter dem Getrappel herunterstürmender Clogs. War denn überhaupt keiner da? Ich kramte die Schlüssel heraus und öffnete selber. Totenstille. Offenbar war seit Stunden niemand mehr im Haus gewesen, denn die Post lag noch vor dem Briefschlitz auf dem Boden. Flüchtig blätterte ich sie durch. Telefonrechnung, Wasserrechnung, die Rechnung vom Glaser für das demolierte Kellerfenster (Sascha würde nie einen Elfmeter ins Tor kriegen, der traf immer meilenweit daneben), ein Brief von Tante Elfi, unwichtig, denn seitdem sie in Amerika lebte, zählte sie doch bloß immer die monatliche Verbrechensquote von Los Angeles auf, Reklame von einem Buchclub … hoppla, was sollte denn das? Quer über das Kuvert hatte jemand mit rotem Filzstift geschmiert: Brauchen wir nicht, wir schreiben selber!
Taktloses Volk! Müssen sie mir das immer wieder unter die Nase reiben?
Ich schleppte meine Tüten in die Küche und fing an auszupacken. Plötzlich öffnete sich die Wohnzimmertür, und ein sechsstimmiger Chor intonierte in voller Lautstärke »Hoch soll sie leben«. Heiliger Himmel, was hatte ich denn jetzt wieder für ein Familienfest vergessen? Hochzeitstag? War schon vorbei. Tag der ersten Begegnung? Nee, kommt erst. Tag der ersten … nein, das war ein Geheimdatum, von dem die Kinder nichts wußten. Was also in drei Teufels Namen wurde hier gefeiert, und weshalb ließ man mich hochleben? »Euer Kalender geht falsch!«
»Nun komm doch endlich rein!« drängte Stefanie, nachdem das unmelodische Gebrüll mit einer dreifachen Kadenz geendet hatte.
Auf dem Tisch stand ein Rosenstrauß, daneben der Sektkühler, aus dem der Hals einer echten Champagnerflasche ragte, davor fünf Kelch- und zwei Weingläser.
»Wer hat denn jetzt schon wieder eins von den Sektgläsern runtergeschmissen? Silvester waren es noch sechs.«
»Du kannst dir ja neue kaufen, wenn du willst, sogar handgeschliffene«, sagte Rolf beziehungsvoll.
»Das Stück zu dreißig Mark? Hast du im Lotto gewonnen?«
»Ich nicht.«
»Wer denn sonst?«
»Na, du!!!«
»Quatsch! Schon als Kind habe ich nicht an den Weihnachtsmann geglaubt, deshalb habe ich auch nie einen Lottoschein ausgefüllt.« Langsam wurde mir die Geheimniskrämerei zu blöd. »Würde mir vielleicht mal jemand sagen, was hier eigentlich los ist?«
»Dann guck doch richtig hin!« Sascha tippte auf einen mittelgroßen Briefumschlag, den ich bisher noch gar nicht gesehen hatte. Er war mit Lorbeerblättern aus dem Gewürzregal bekränzt und trug als Absender jenen Bayreuther Verlag, an den ich schon gar nicht mehr gedacht hatte. Ich hatte mich lediglich geärgert, daß mein Manuskript in Bayern Wurzeln schlug, ohne Blüten zu treiben.
»Die haben dein Buch angenommen. und das nächste wollen sie auch haben«, sprudelte Steffi heraus. »Steht alles im Vertrag drin.«
»Welches nächste?«
»Na das, was du jetzt schreibst«, erklärte Sascha.
»Aber ich schreibe doch gar keins.«
»Dann mußt du eben damit anfangen! Wir helfen auch alle mit, das haben wir schon besprochen.«
»Beim Schreiben?«
»Natürlich nicht, aber im Haushalt und so«, versicherte Sven. »Ich mähe ab jetzt freiwillig den Rasen, Sascha spült Geschirr, und Stefanie wischt auf.«
»Immer soll ich die Dreckarbeit machen! Rasen mähen kann ich genausogut. Und überhaupt sollte Määm eine Putzfrau anheuern, sie kann es sich doch jetzt leisten.«
Während die Kinder temperamentvoll die künftige Arbeitsteilung debattierten und jeden Vorschlag ablehnten, kämpfte Rolf mit der Champagnerflasche. So verzog ich mich samt Brief in die Küche – erfahrungsgemäß der einzige Platz im Haus, wo ich ungestört war.
Der Vertrag umfaßte vier Seiten und hatte achtzehn Paragraphen, von denen mich zunächst nur ein einziger interessierte: Was konnte man bei dieser Sache eigentlich verdienen? Erst kürzlich hatte ich beim Friseur einen Artikel über Konsalik gelesen, der irgendwo in einer Nobelgegend am Rhein eine Art Schloß bewohnte, ein Ferienhaus unbestimmbarer Größe auf den Kanaren besaß, sicher auch über ein ansehnliches Bankkonto verfügte und das alles nur mit seinen Büchern geschafft hatte. Allerdings hatte er schon mehr als ein halbes Hundert geschrieben, mußte also im frühen Schulalter damit angefangen und folglich einen unerreichbaren Vorsprung haben. Ich hatte fast anderthalb Jahre für ein einziges Manuskript gebraucht!
Aber nun wollte es tatsächlich jemand haben! Ich konnte mir noch gar nicht richtig vorstellen, daß aus diesen 198 Schreibmaschinenseiten ein Buch entstehen sollte, das man demnächst im Laden kaufen konnte. Demnächst? Vom Erscheinungsdatum stand nichts im Vertrag, es wurde lediglich angegeben, daß es im Laufe von 24 Monaten herauskommen würde.
Das also war der erste Gummiparagraph. Der zweite betraf die Höhe der Auflage. Darüber stand auch nichts drin. Es wurde nur aufgelistet, wieviel Prozent ich bei soundso viel verkauften Exemplaren bekommen würde. Da ich nicht die geringste Ahnung hatte, wie viele Bücher man überhaupt verkaufen konnte, blieb der finanzielle Aspekt vorläufig im dunkeln.
Wesentlich realistischer war die Ankündigung, daß ich bei Abschluß des Vertrags dreitausend Mark Vorschuß bekommen sollte. So etwas hatte man mir freiwillig noch nie angeboten! Als ich meine Brötchen noch selber verdienen mußte, hatte ich immer kurz vor Ultimo um einen Vorschuß bitten müssen, der mir zwar zusammen mit einem Vortrag über sparsame Lebensweise und übertriebenes Modebewußtsein meistens bewilligt worden war, aber im nächsten Monat hatte es hinten wieder nicht gereicht, worauf ich erneut den Gang nach Canossa hatte antreten müssen. Und plötzlich warf man mir den Vorschuß sogar hinterher! Ich fühlte mich bereits der Elite freischaffender Künstler zugehörig.
»Na, wirst du denn unterschreiben?« Mit zwei gefüllten Gläsern kam Rolf in die Küche. »Nun wollen wir erst einmal auf die neue Bestseller-Autorin anstoßen!«
»Warum mußt du bloß immer so übertreiben?« Auf einen Zug leerte ich das Glas und stellte es auf das Spülbecken. Es rutschte ab. Jetzt hatten wir noch vier.
»Du wirst deinen Vorschuß in Gläsern anlegen müssen.«
»Das könnte dir so passen! Dafür kaufe ich mir endlich eine neue Waschmaschine und einen Trockner.«
»Und ich dachte, wir kriegen jetzt einen Farbfernseher.« Die Enttäuschung stand Sascha förmlich ins Gesicht geschrieben.
»Jetzt, wo ich endlich den Führerschein habe, brauchen wir wirklich einen Zweitwagen«, forderte Sven. »Paps läßt mich doch so gut wie nie ans Steuer. Und dich auch nicht«, fügte er schnell hinzu. »Für zweieinhalbtausend Mark gibt es schon sehr anständige Gebrauchtwagen.«
Die Zwillinge meldeten ebenfalls Wünsche an. »Aus den Kindermöbeln sind wir längst rausgewachsen«, moserte Nikki, während Katja auftrumpfte: »Unsere Lehrerin hat gesagt, wir müssen für die Hausaufgaben einen richtigen Arbeitsplatz haben. Als wir neulich den Dielenschrank gekauft haben, habe ich ganz tolle Schreibtische gesehen. Ich will einen roten.«
»Den will ich schon! Du nimmst doch sonst auch immer blau«, protestierte der andere Zwilling.
Nur Stefanie übte sich in edler Bescheidenheit. »Das ist Mamis selbstverdientes Geld, und damit kann sie auch machen, was sie will.« Später, als sich der Trubel etwas gelegt hatte, flüsterte sie mir leise zu: »Neue Turnschuhe brauche ich doch sowieso, kriege ich denn diesmal die neuen ›Allround‹?«
»Und was bleibt für mich übrig?«
»Ruhm und Anerkennung«, sagte Sven sofort. »Was ist dagegen schon schnöder Mammon?«
»Eins schließt ja das andere nicht aus.« Ich erbat mir seinen Schulfüller, weil man Verträge nicht mit einem profanen Kugelschreiber unterzeichnet, setzte meine Unterschrift unter das gewichtige Dokument und mußte mir von meinem Sohn sagen lassen, daß sie ausgesprochen popelig aussehe. »Viel schwungvoller muß das werden! Du solltest mal üben! Für künftige Autogrammstunden.«
Beim Gutenachtkuß umhalste mich Katja und fragte ehrfürchtig: »Bist du jetzt eine richtige berühmte Schriftstellerin?«
»Ich bin keine Schriftstellerin, und berühmt bin ich schon gar nicht. Ich bleibe weiterhin eure Mutter, die gleich noch die Rouladen fürs Mittagessen anbraten und hinterher deine Latzhose bügeln muß, weil alle anderen schon wieder drekkig sind.« Dabei fragte ich mich im stillen, ob Herr Konsalik wohl auch eigenhändig die Bügelfalten in seine maßgeschneiderten Anzüge plätten mußte.
Kapitel 2
Was ich nun eigentlich erwartet hatte, weiß ich nicht, auf keinen Fall jedoch die ernüchternde Feststellung, daß der Alltagstrott genauso weiterlief wie bisher. Kein Reporter wollte ein Interview, kein Filmproduzent rief an und wünschte ein Drehbuch für eine zehnteilige Familienserie, nur Tante Käte erkundigte sich, wo sie denn das Buch kaufen könne, ihr Buchhändler hätte es nämlich nicht.
Auch mein Anhang, der mich wenigstens ein paar Tage lang mit ungewohnter Hochachtung behandelt hatte, ging wieder zur Tagesordnung über. Ich hatte ihn zu absolutem Stillschweigen verdonnert, aber wenn man mit einer künftig berühmten Mutter nicht mal renommieren darf, verliert die ganze Sache ihren Reiz. Die Bereitwilligkeit, im Garten die Blümchen zu bewässern und in der Küche das benutzte Geschirr zu spülen, ließ ebenfalls sehr schnell nach.
»Du schreibst doch sowieso nicht mehr«, sagte Sascha mürrisch, als ich ihn zum Einkaufen schickte.
»Woher willst du das denn wissen?«
»Ich wollte mir ein paar Bogen Schreibmaschinenpapier holen, aber es war gar keins da. Tippst du denn auf Butterbrotpapier?«
Nein, ich tippte überhaupt nicht mehr, ich ruhte mich vielmehr auf meinen imaginären Lorbeeren aus. Inzwischen war der Vorschuß gekommen, ich hatte ein eigenes Konto eröffnet, dreitausend Mark eingezahlt, für zweitausendachthundert Mark Schecks ausgeschrieben, war Besitzerin einer neuen Waschmaschine mit integriertem Trockner, besaß einen nagelneuen Heißluftherd mit Schaltuhr, und für eine Kaffeemaschine hatte es auch noch gereicht. Der alten hatte ich immer erst einen kräftigen Schlag auf den Deckel geben müssen, bevor sie tröpfchenweise Kaffee produzierte. Derartige Anschaffungen fielen normalerweise in Rolfs Ressort, aber er hatte sie rundweg abgelehnt. Solange die Reparaturkosten für die vorhandene Waschmaschine den Anschaffungspreis einer neuen nicht überstiegen, war er nicht bereit gewesen, das antike Möbel zum Sperrmüll zu stellen. An die ewig verfärbte Unterwäsche mit leichtem Blaustich hatte er sich gewöhnt. Kaffeeautomaten hielt er sowieso für überflüssig, die Prozedur dauerte ihm zu lange. Seine Mutter habe auch keinen besessen und brühe ihren Kaffee sogar heute noch nach Altvätersitte auf.
»Deshalb knirscht er ja auch immer zwischen den Zähnen!«
Wenn ich mein schwer erarbeitetes Geld in so profane Dinge wie Haushaltsgeräte stecken mußte statt in eine Kreuzfahrt durch die Karibik, dann lohnte es sowieso nicht, welches zu verdienen.
Und dann erhielt ich die schwarzumränderte Drucksache mit der Nachricht, daß der Herr Verleger, der mich auf den Thron der schriftstellernden Prominenz hieven sollte, »plötzlich und unerwartet verschieden« sei. Ich rechnete nach und kam zu dem Ergebnis, daß seine Unterschrift unter meinen Scheck eine seiner letzten Amtshandlungen gewesen sein mußte, bevor er gestorben war. Mir blieb nur die Hoffnung, daß beides nicht in ursächlichem Zusammenhang gestanden hatte.
»Muß ich da etwa kondolieren?«
»Natürlich mußt du«, sagte Rolf.
Also sprach ich der mir unbekannten Witwe in wohlgesetzten Worten mein Beileid zum Tod ihres mir ebenfalls unbekannt gebliebenen Gatten aus, worauf eine ebenso wohlformulierte Danksagung erfolgte.
»Und was wird jetzt aus meinem Buch?«
»Makulatur.« Tröstend fuhr mir Rolf durch die Haare. »Immerhin hast du eine neue Waschmaschine, in der die Unterhosen langsam wieder weiß werden, und den Vorschuß darfst du auch behalten.«
»Der ist sowieso schon alle.« Trotzdem rief ich einen befreundeten Rechtsanwalt an.
»Du gehörst quasi zur Erbmasse«, teilte er mir nach längerem Überlegen mit. »Wer immer auch den Verlag weiterführt, muß dich mit in Kauf nehmen.« Manchmal können Männer wirklich unausstehlich sein!
Es war eine Dame, die sich brieflich als neue Geschäftsführerin vorstellte und behauptete, sich schon sehr auf die künftige Zusammenarbeit mit mir zu freuen. Das Buch werde übrigens im Frühjahr des kommenden Jahres erscheinen.
Mein Triumphgefühl dauerte nicht lange. Ausgerechnet eine Frau! Vermutlich so eine karrierebewußte Emanze Mitte Vierzig, die ihre Garderobe aus Paris bezog und hinter dem Namen C&A, meiner bevorzugten Einkaufsquelle, bestenfalls einen ausländischen Investmentfonds vermutete. Wie um alles in der Welt sollte ich mit so was klarkommen? Männer in gehobeneren Positionen waren viel leichter zu nehmen. Es gab da so verschiedene Tricks, die ich schon erfolgreich bei Steuerprüfern, Oberkellnern und Studienräten angewandt hatte, aber sobald ich an eine Vertreterin meines eigenen Geschlechts geraten war, hatten diese kleinen Listen nichts genützt. Und jetzt sollte ich ausgerechnet mit einer Frau über Auflagenhöhen, Honorare und all den anderen geschäftlichen Kram verhandeln, von dem ich ohnehin nicht das geringste verstand? Großartig!
Für hundertneunundachtzig Mark kaufte ich mir einen Hosenanzug, obwohl mir der für zweihundertvierzig viel besser gefallen hatte, aber dazu hätte ich mein neueröffnetes Konto wieder auflösen und noch was vom Haushaltsgeld abzweigen müssen. Da gab’s sowieso nichts mehr zu holen! Die neuen Gläser und Steffis Turnschuhe!
Wenigstens war ich für die zu erwartende Einladung nach Bayreuth gerüstet, hatte ich doch in Hildegard Knefs Memoiren gelesen, daß zwischen Verlegern und ihren Autoren freundschaftliche Bande obligatorisch seien. Aber dazu mußte man wohl zur bundesdeutschen Prominenz gehören, zu der ich mich nun beim besten Willen nicht zählen konnte. Deshalb verknüpften meine Verlegerin und mich lediglich ein paar hundert Kilometer Telefonkabel, die allerdings mitunter heißliefen. Einen Lebenslauf wollte sie von mir haben, über dem ich zwei Tage grübelte, weil er absolut nichts hergab. Dann brauchte sie ein reproduktionsfähiges Foto von mir, und das gab es erst recht nicht. In den vergangenen Jahren hatte ich mich lieber hinter der Kamera aufgehalten als davor, denn die Zeiten, in denen es geheißen hatte: »Die Kleine sieht aber niedlich aus!«, waren längst vorbei. Zum Fotografen wollte ich auch nicht, die letzte Sitzung vor zwei Jahren (Omi hatte sich zum Geburtstag ein Familienporträt gewünscht) hatte beinahe mit einem allseitigen Nervenzusammenbruch geendet. Seitdem ließ ich meine Filme in der Drogerie entwickeln.
»Ist doch gar kein Problem«, sagte Rolf, während er Lampen heranschleppte und Sven anwies, meterlange Alufolie auf ein großes Brett zu kleben. »Das machen wir selber! Ich habe schon ganz andere Objekte werbewirksam fotografiert.«
Nun besteht wohl doch ein gewisser Unterschied zwischen einer festmontierten Hobelbank und einer lebenden Person, die erst einmal Kostümproben veranstalten mußte, um den passenden Kontrast zum Hintergrund zu finden. Nach Ansicht des Fotografen eignete sich dazu ganz besonders die Ligusterhecke, zumal auch gerade die Sonne im richtigen Winkel stand. Nur hatte er nicht bedacht, daß ich mich dazu in die äußerste Ecke quetschen mußte. Die Zweige piekten durch die dünne Bluse, und statt anmutig zu lächeln, brüllte ich »Aua!«
Die Aufnahme wurde wiederholt, aber jetzt hatte Sven vergessen, das Brett hochzuhalten. Beim nächsten Versuch hatte sich eine Fliege auf mein langsam zur Maske erstarrtes Gesicht gesetzt, und dann ging gar nichts mehr, weil die Sonne hinter der großen Birke verschwunden war.
»Standortwechsel!« bestimmte der Fotograf, seine Utensilien zusammenpackend. »Vor dem Haus scheint sie noch.«
»Kommt überhaupt nicht in Frage, ich gebe doch für die Nachbarn keine Vorstellung als Pausenclown!«
Aber Rolf war nicht zu bremsen. Er schleppte einen Gartenstuhl nach vorne, stellte ihn in den Halbschatten, und dann mußte ich mich graziös auf das Maschendrahtgeflecht setzen. Die Kissen hatte er vorher entfernt, sie paßten nicht zum Hintergrund. Jetzt piekte es zur Abwechslung von unten, was die ungezwungene Haltung und den freundlich-verbindlichen Gesichtsausdruck doch ziemlich erschwerte.
»Ein paar Aufnahmen habe ich noch drauf. Lehn dich mal ganz lässig gegen die Blautanne!«
Das sollte er mir erst einmal vormachen! Das Biest hatte Nadeln, gegen die jede Injektionsspritze harmlos war, und wenn ich mich wirklich anlehnen würde, müßte ich eine Woche lang auf dem Bauch schlafen.
»Dann stell dich einfach zwischen die Zweige!«
Nach mehreren vergeblichen Versuchen mußte Rolf einsehen, daß sich diese romantische Pose nicht realisieren ließ. »Würde die Birke nicht denselben Zweck erfüllen? Da könnte ich wenigstens noch an einem Zweig knabbern.«
Er warf mir nur einen bitterbösen Blick zu. »Mir kann es doch Wurscht sein, wie du auf den Fotos aussiehst. Ich will ja nicht Playmate des Monats werden.«
Das wollte ich allerdings auch nicht, doch als ich später die Abzüge meines Hausfotografen sah, wurde mir bewußt, daß meine fotogene Zeit endgültig vorbei war. Auf den Bildern sah ich manchmal aus wie meine eigene Großmutter.
»Die Fotos werden mir wirklich nicht gerecht«, meckerte ich, aber in Wahrheit erwartete ich keine Gerechtigkeit, sondern Barmherzigkeit.
Die Zeit drängte, also schickte ich die am wenigsten scheußliche Aufnahme an den Verlag und hoffte, man würde angesichts dieser zerfurchten Stirn, die auch noch von einer Schmachtlocke halb verdeckt wurde, auf eine Reproduktion verzichten. Falls doch nicht, so würde mich wenigstens kein Mensch auf diesem Bild wiedererkennen. Auch in Zukunft könnte ich unbehelligt von Autogrammjägern und enthusiastischen Fans durch ein Kaufhaus bummeln, obwohl ich eigentlich das Gegenteil erhoffte.
Es muß kurz vor Weihnachten gewesen sein, als mich Steffi eines Nachmittags aus dem Keller holte, wo ich Bestandsaufnahme machte und gerade bei den eingeweckten Pfirsichen angekommen war. Ein Herr wünsche mich zu sprechen.
»Muß das denn sein? Allmählich könntest du diese Häkeldeckchenverkäufer auch mal selber abwimmeln. Sag einfach, deine Mutter sei nicht zu Hause.«
»Das ist kein Vertreter. Er hat gesagt, er kommt von deinem Verlag.«
»Was???« Entsetzt sah ich an mir herunter. Die Hose, deren ursprüngliche Farbe man nicht mal mehr erahnen konnte, war ebenso ausgeleiert wie Rolfs altes Oberhemd, über das ich wegen der lausigen Kälte hier unten das nächstbeste Kleidungsstück gezogen hatte, das mir in die Hände gefallen war. Ich hatte die grüne Wolljacke kurzerhand aus dem Altkleidersack gewühlt. Vorne reichte sie gerade über den Bauchnabel, hinten hing sie in den Kniekehlen. In diesem Aufzug konnte ich mich unmöglich sehen lassen. Warum hatte dieser Mensch denn nicht vorher angerufen? Und wer war das überhaupt? Wenigstens handelte es sich um einen Mann, das machte die Sache einfacher, allerdings nicht in dieser Kellerkluft. Die Haare hatte ich mir heute morgen auch waschen wollen, war bloß nicht dazu gekommen, weil das Bad ewig blockiert war, und dann hatte Sascha auch noch den Fön runtergeschmissen …
»Nun beeil dich ein bißchen, der arme Kerl kriegt ja Frostbeulen da oben!«
»Wo ist er denn?«
»Na, draußen vor der Tür!«
»Bist du wahnsinnig geworden?« Ich jagte die Treppe rauf. Steffi hinterher. »Dauernd bleust du uns ein, wir sollen keine Fremden so einfach ins Haus lassen, und nun ist es auch wieder nicht richtig«, keuchte sie beleidigt.
»In diesem Fall ist das doch ganz was anderes. Jetzt läßt sich endlich mal so ein Verlagsmensch hier blicken, und dann behandelst du ihn wie einen ganz gewöhnlichen Staubsaugervertreter.«
»Und wenn es nun eine Ausrede war? Bei XY warnt der Zimmermann immer wieder vor neuen Gaunertricks.«
»Du hast ein Hirn wie Mickymaus! Ein Wildfremder kann doch gar nicht wissen …«
Zu weiteren Erklärungen blieb keine Zeit. Ungeachtet meines ramponierten Aussehens riß ich die Haustür auf in der Erwartung, entweder überhaupt niemanden mehr oder zumindest einen sehr verschnupften Besucher vorzufinden.
Vor mir stand ein freundlich lächelnder Herr mittleren Alters.
»Entschuldigen Sie …«
»Entschuldigen Sie …«
Wir hielten beide inne, es herrschte sekundenlanges Schweigen, dann lachten wir laut los.
»Jetzt kommen Sie erst einmal herein, bevor Sie endgültig festfrieren. Meine Tochter hat Sie leider mit einem dieser Treppenterrier verwechselt.«
Er schälte sich aus dem Mantel. »Damit liegt sie gar nicht so falsch. Ich bin nämlich der Verlagsvertreter für Baden-Württemberg. Brühl ist mein Name.« Er gab mir die Hand, ich legte zögernd meine Fingerspitzen hinein. Am Rest klebte Pfirsichsaft.
»Zunächst bitte ich um Entschuldigung, daß ich hier so einfach hereinplatze, aber ich habe gerade Frau Eckert besucht, und da dachte ich mir, bei dieser Gelegenheit könnte ich doch unsere neue Autorin kennenlernen.«
So, haste gedacht! Dabei gehe ich jede Wette ein, daß man dich vorgeschickt hat. Mal ein bißchen das Terrain sondieren. Könnte ja sein, daß die Neue schiefe Zähne hat und schielt. Oder stottert.
»Frau Eckert hat übrigens keine Ahnung, daß Sie ein Buch geschrieben haben. Sie war ganz überrascht.«
Frau Eckert ist die Besitzerin der hiesigen Buchhandlung und aus naheliegenden Gründen die letzte, der ich etwas erzählen würde. Während ich Herrn Brühl ins Wohnzimmer führte und dort in den am wenigsten durchgesessenen Sessel komplimentierte (jetzt war aber wirklich mal eine neue Sitzgarnitur fällig!), erklärte ich ihm, weshalb ich zumindest hier im Ort mein Doppelleben verheimlichen wollte. »Als wir herzogen, galten wir mit den fünf Kindern schon beinahe als asozial. Diese Vermutung wurde noch bestärkt durch die Tatsache, daß mein Mann weder bei NSU arbeitet noch bei Kolben-Schmidt, wo jeder zweite Einwohner von Bad Randersau beschäftigt ist, sondern manchmal tagelang zu Hause rumhängt und scheinbar gar nichts tut. Von der Schreibtischarbeit kriegt ja niemand was mit. Die meisten glauben, wir leben vom Kindergeld. Inzwischen haben sich die Gemüter beruhigt, und jetzt möchte ich nicht schon wieder Mittelpunkt des Dorfklatsches werden. – Was darf ich Ihnen anbieten? Kaffee? Tee? Etwas Gehaltvolleres? Oder lieber einen Grog zum Aufwärmen?«
»Am liebsten einen Grog, aber ich muß noch fahren. Da ist Kaffee ungefährlicher.«
Vernünftiger Mensch, Rum war sowieso nicht da. Plötzlich kam mir wieder mein Gammellook zu Bewußtsein. »Bitte entschuldigen Sie mich für ein paar Minuten, aber ich muß mir wenigstens die Spinnweben von den Händen waschen. Ich habe nämlich gerade Pfirsiche gezählt.« Erst beim Hinausgehen wurde mir klar, welch horrenden Blödsinn ich eben von mir gegeben hatte, doch ich konnte schlecht wieder umkehren und meinem Gast verklickern, daß das eine Glas ganz hinten im Regal bereits total verstaubt gewesen war. Kein Wunder, Omi hatte es vor mindestens fünf Jahren angeschleppt. Und in Afrika wird gehungert!
In der Küche braute Steffi Erdbeerblütentee. Der ganze Raum roch süßlich. »Mach gefälligst das Fenster auf, wenn du diesen Sud kochst, hier stinkt es wie in einer Parfümerie.« Ich füllte die Kaffeemaschine. »Deck mal bitte drinnen den Tisch, aber wehe, du fährst wieder diese Steingutkübel auf. Nimm das Porzellangeschirr! Und vergiß die Servietten nicht! Aber die japanischen und nicht die billigen von Aldi. Ein paar Weihnachtskekse kannst du auch aus dem Keller holen!«
»Ich denke, die hast du versteckt.«
»Hab ich auch.«
»Wie soll ich sie dann holen?«
Kluge Frage. »Sie sind in den Blechschachteln in der großen Truhe unter den Kissen von den Terrassenmöbeln.«
»Kein Wunder, daß wir sie neulich nicht gefunden haben.«
Jedes Jahr wiederholt sich das gleiche Spiel. Ich backe Plätzchen, von denen mir die Hälfte noch ofenwarm weggefuttert wird. Mit dem Rest ziehe ich wie ein Eichhörnchen von Versteck zu Versteck, immer damit rechnend, daß doch mal ein Suchtrupp fündig wird und ich am Heiligen Abend nur noch Krümel auf den Tisch stellen kann. Deshalb habe ich immer noch eine ganz geheime Geheimreserve, von der ich manchmal selber nicht weiß, wo ich sie vergraben habe. Einmal fanden wir sie mitten im Hochsommer, als wir die Federballschläger suchten.
Fünf Minuten später erschien ich frisch gewaschen und gestriegelt wieder auf der Bildfläche, bereit, mich den prüfenden Blicken meines Gastes zu stellen. Sogar Schuhe mit hohen Absätzen hatte ich angezogen, obwohl ich die zu Hause sonst nicht mehr trage, seitdem ich auf der Treppe damit hängengeblieben war und mir einen tellergroßen Bluterguß eingehandelt hatte.
Steffi musterte mich kritisch. »Jetzt siehst du wieder menschlich aus, aber ich bezweifle, ob das noch was nützt. Bekanntlich ist der erste Eindruck immer der entscheidende.«
Herr Brühl war anderer Ansicht. Er strahlte mich an. »Nun sehen Sie genauso aus wie auf dem Foto.«
Grundgütiger Himmel! Wenn das ein Kompliment sein sollte, dann hatte er aber haargenau danebengetroffen. »Finden Sie wirklich?« fragte ich gedehnt.
»Ja«, sagte er sofort – und sank in meiner Achtung.
Eine Zeitlang plauderten wir über dies und das, dann kam er zur Sache. »Wie gefällt Ihnen denn das Cover von Ihrem Buch?«
»Gut.« Was um alles in der Welt war ein Cover?
»Wir im Verlag finden es großartig. Es hat ja auch einer der besten Illustratoren gemacht.«
Bevor ich nun endgültig auf dem Glatteis ausrutschte, auf dem ich herumschlidderte, ging ich zur Offensive über. »Könnte ich es wohl noch mal sehen?«
Bereitwillig öffnete er seine Mappe und reichte mir einen Prospekt herüber. Und dann sah ich sie zum erstenmal, die fünf verstrubbelten Karikaturen, die meine Kinder sein sollten. In einer Blümchenwiese standen sie, aufgereiht wie Schießbudenfiguren, und grienten etwas einfältig vor sich hin. Als Zeichnung war das Titelbild exzellent, nur fiel es mir schwer, diese leicht beschränkt aussehenden Gestalten mit meinem geistig nun wirklich nicht zurückgebliebenen Nachwuchs zu assoziieren. »Die Kinder werden begeistert sein.«
»Sie etwa nicht?« fragte Herr Brühl erstaunt.
»Doch, natürlich.«
Meine lauwarme Zustimmung entging ihm nicht. »Sie müssen das objektiv sehen! Nicht Ihre Kinder sind es, die da auf den Margeriten herumtrampeln, sondern fünf Lauser, denen der Schalk im Nacken sitzt. So etwas läßt sich gut verkaufen.«
So lernte ich als erstes, daß der kommerzielle Aspekt immer Vorrang hat.
Zu allem Unglück platzte auch noch Rolf in die Kaffeestunde, dessen fachmännischer Blick sofort die Werbewirksamkeit dieses Buchumschlags erkannte, und danach hatte ich sowieso nichts mehr zu melden.
Als sich Herr Brühl verabschiedete, hörte ich ihn vor der Haustür leise zu Rolf sagen: »Doch, wir können sie ohne weiteres der Öffentlichkeit präsentieren. Ich glaube, das wird sie ganz gut hinkriegen.«
Damit hatte ich die zweite Lektion gelernt: Einen Autor muß man – wo und wem auch immer – vorführen können.
Kapitel 3
Endlich kam der Tag, an dem mein Buch ausgeliefert und in den Buchhandlungen vorgestellt werden sollte. Ich platzte vor Neugierde, denn ein fertiges Exemplar hatte ich selbst noch gar nicht gesehen. Jedem Autor stehen zwar Belegexemplare zu, aber er ist meistens der letzte, der sie bekommt, weil sie dem Verlag nichts bringen, sondern ihn im Gegenteil etwas kosten. Genau wie die Honorare, die ohnehin nur den geringsten Teil der Kalkulationen ausmachen.
Meine Einkaufsrunde verschob ich auf den späten Vormittag, denn Frau Eckert mußte erst einmal Zeit haben, meine Bücher auszupacken und entsprechend zu dekorieren. Als ich betont uninteressiert an den beiden Schaufenstern vorbeidefilierte, sah ich Schmuckkartons mit Briefpapier – »Das ideale Geschenk zur Konfirmation« –, drei Meter DUDEN, der sich bei solchen Gelegenheiten auch immer ganz gut an den Mann bringen läßt, Kinderbücher mit Osterhasen drauf und zwischendrin Watteküken und viele buntbemalte Eier. Keine Blümchenwiese, keine grinsenden Kindlein – gar nichts! Aber vielleicht drinnen im Laden? Mir fiel ein, daß der Sohn unseres Nachbarn ebenfalls konfirmiert werden sollte, da mußte man sowieso etwas hinüberschicken, also warum auf die lange Bank schieben, Briefpapier kann man immer gebrauchen. Obwohl ich sehr lange und sehr gründlich wählte und dabei immer wieder die Bücherregale musterte, konnte ich mein Werk nicht entdecken. Fragen wollte ich natürlich nicht, mich fragte aber auch niemand, und so zog ich schließlich mit dem Briefpapier ab und tröstete mich mit der Gewißheit, daß man mit meinen Büchern natürlich erst die bedeutenderen Buchhandlungen in den großen Städten beliefern würde. Hatte Stefanie nicht erst gestern gesagt, daß sie einen neuen Anorak brauche, weil der alte zu klein geworden war?
Am nächsten Tag fuhren wir nach Heilbronn. Und dann endlich sah ich es! Ganz vorne bei den Neuerscheinungen stand es, unübersehbar und gleich in zehnfacher Ausfertigung. Jetzt gefielen mir plötzlich auch die fünf Kindsköpfe auf dem Titel. Lustig sahen sie aus, direkt zum Verlieben. Erwartungsvoll schlug ich eins auf und las ein paar Zeilen. Es ist schon ein eigenartiges Gefühl, zum erstenmal ein Buch in der Hand zu halten, das man selbst geschrieben hat, in dem man nun blättern und bei jedem einzelnen Absatz nachvollziehen kann, wie oft man ihn in den Papierkorb geschmissen und immer wieder neu formuliert hat.
Stefanie hatte nur einen flüchtigen Blick auf das Buch geworfen, »Hm, sieht niedlich aus« gesagt und war zu dem Ständer mit den Comics gegangen. Ich blätterte immer noch.
»Kann ich Ihnen helfen?« Eine Verkäuferin hatte sich herangeschlängelt. »Suchen Sie etwas Bestimmtes? Soll es ein Geschenk sein? Zur Konfirmation? Da würde ich Ihnen empfehlen …«
»Nein, ich möchte es selbst lesen«, sagte ich, mit dem Buch unter ihrer Nase herumwedelnd, »kennen Sie die Autorin?«
Nur flüchtig streifte sie den Titel, dann bedauerte sie. »Nein, wir haben die Bücher erst vor ein paar Tagen hereinbekommen. Bekannt ist sie aber nicht.«
»Ist das denn ein Werturteil?«
»Natürlich nicht, aber ich kann Ihnen über den Inhalt des Buches nichts sagen, weil ich es nicht gelesen habe. Wahrscheinlich ist es etwas Lustiges, es steht ja ›Heiterer Roman‹ drauf. Wollen Sie es haben?«
Das hatte ich eigentlich nicht gewollt, doch es konnte noch lange dauern, bis ich die mir zustehenden Belegexemplare zu sehen bekäme, und überhaupt sollten es ja auch die anderen sehen, auf den Nachttisch wollte ich es legen, mich noch ein bißchen länger darüber freuen … »Packen Sie es bitte ein!«
An der Kasse tauchte auch Steffi wieder auf. »Willst du etwa dein eigenes Buch kaufen???«