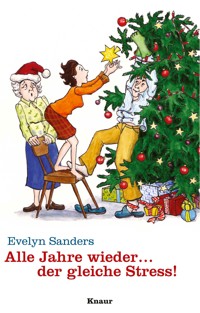6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Kann man ein heiteres Buch über eine ganz und gar nicht heitere Zeit schreiben? Man kann! Evelyn Sanders erzählt von Kriegs- und Nachkriegszeit in Berlin aus der Sicht eines Kindes, für das Geburtstag bei Kartoffelkuchen und Kinderlandverschickung nach Ostpreußen der ganz normale Alltag waren. Und danach? Mathe-Aufgaben bei Kerzenlicht, Christbaumklau im Grunewald, Chewing-Gum und Backfisch-Party bei Musik von Glenn Miller... Selten ist Zeitgeschichte so menschlich geschildert worden wie in diesem Buch, dem tatsächliche Geschehnisse zugrunde liegen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 483
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Evelyn Sanders
Pellkartoffeln und Popcorn
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Kann man ein heiteres Buch über eine ganz und gar nicht heitere Zeit schreiben? Man kann! Evelyn Sanders erzählt von Kriegs- und Nachkriegszeit aus der Sicht eines Kindes, für das Geburtstag bei Kartoffelkuchen und Kinderlandverschickung nach Oßtpreußen der ganz normale Alltag waren. Und danach? Mathe-Aufgaben bei Kerzenlicht, Christbaumklau im Grunewald, Chewing-Gun und »Backfisch-Party« bei Musik von Glenn Miller … Selten ist Zeitgeschichte so menschlich geschildert worden wie in diesem Buch, dem tatsächliche Geschehnisse zugrunde liegen.
Inhaltsübersicht
Widmung
ERSTER TEIL
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
ZWEITER TEIL
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Für H. Q. Sie weiß schon, warum
ERSTER TEIL
»Das Kind kommt zu Tante Lotte!«
Kapitel 1
Ein Lebenslauf – überwiegend bei Bewerbungen erforderlich – beginnt meist folgendermaßen: Ich wurde am soundsovielten als Tochter des … sowie seiner Ehefrau (folgt Name) in … (folgt Ort) geboren. Prominente Mitbürger, die es aus eigener Kraft zu etwas gebracht haben, sind oft das vierte oder fünfte Kind eines ehrbaren Handwerkers, Schauspieler meist das schwarze Schaf der Familie, weil einen unbürgerlichen Beruf ausübend, und Popstars kommen, wenn man ihren Biographien glauben darf, samt und sonders aus den Slums.
Bei mir trifft von alledem nichts zu. Als ich im Mai 1934 geboren wurde, war die Wirtschaftskrise schon längst vorbei und der nächste Krieg noch nicht in Sicht. Es herrschten also sogenannte geordnete Verhältnisse.
Mein Vater stand im letzten Jahr seiner kaufmännischen Ausbildung (er hatte das Abitur erst im zweiten Anlauf geschafft und war deshalb ein bißchen spät dran), meine Mutter besuchte eine Dolmetscherschule; und es ist mir noch heute völlig rätselhaft, weshalb die beiden so früh geheiratet haben. Später habe ich sie einmal danach gefragt.
»Ach, weißt du«, sagte meine Mutter, »ich habe damals für Clark Gable geschwärmt, und dein Vater hatte eine gewisse Ähnlichkeit mit ihm. Bis auf den Bart natürlich, aber dazu habe ich ihn einfach nicht überreden können.«
»Aber deshalb heiratet man doch nicht gleich.«
»Vati konnte aber auch hervorragend tanzen. Außerdem trug er meistens Knickerbockers, und das fand ich todschick.«
Mein Vater wiederum hatte ein Faible für langhaarige Brünette, obwohl man damals blond trug und Bubikopf die neueste Mode war; aber meine Mutter hatte sich von ihrer Lockenpracht nicht trennen wollen. Außerdem spielten beide gerne und sehr gut Tennis.
Es soll bei künftigen Ehepartnern schon weniger Gemeinsamkeiten gegeben haben. Jedenfalls wurde im März 1932 geheiratet. Die etwas überraschten Schwiegereltern stifteten zur Hochzeit die Küchenmöbel sowie ein Schlafzimmer in japanischer Kirsche. Von mütterlicher Seite kam das Wohnzimmer dazu und ein Klavier. Kochtöpfe, Bügeleisen, Kaffeewärmer und weitere unerläßliche Gebrauchsartikel schenkten die Hochzeitsgäste; und das jungvermählte Paar begann den Ehealltag.
Der wurde ein Reinfall. »Ich hab’ doch vom Kochen keine Ahnung gehabt! Und wenn wir auch mittags beide in der Kantine gegessen haben, so mußte ich doch wenigstens ein genießbares Frühstück auf den Tisch bringen.« Meine Mutter schüttelte sich noch nachträglich bei dem Gedanken an ihre vergeblichen Kämpfe mit Kochtopf und Bratpfanne. »Ich weiß noch, wie ich Vati einmal wütend angebrüllt habe, weil er über den verbrannten Toast gemeckert hat: Warum kannst du nicht auch wie andere Männer die Zeitung lesen, anstatt darauf zu achten, was du ißt?«
Bevor die junge Ehe an hartgekochten Frühstückseiern und Oberhemden mit bizarr geformten Brandlöchern zerbrach, starb mein Großvater und hinterließ eine sehr vitale pensionsberechtigte Witwe von 43 Jahren, die sich des führerlosen Haushalts annahm und das Eheschiff wieder flottmachte. Zehn Monate später wurde ich geboren.
Meine Aufzucht wurde Omi anvertraut, die ja ohnehin die Schlüsselgewalt und darüber hinaus entschieden mehr Erfahrung im Umgang mit Kleinkindern hatte als meine Mutter. Meine Eltern sah ich nur abends. Manchmal auch gar nicht, weil ich bei ihrer Heimkehr schon schlief, und darum habe ich wohl damals die Familienverhältnisse ein bißchen durcheinandergebracht.
»Eine Zeitlang hast du zu deiner Großmutter ›Mutti‹ gesagt und zu mir ›Tante Reni‹« erzählte meine Mutter, »während Vater abwechselnd ›Onkel Heinz‹ oder ›der Mann da‹ hieß.«
Die etwas befremdeten Nachbarn fingen an zu tuscheln. Außerdem war ich ein bißchen bleichsüchtig geraten. Der Arzt empfahl Licht, Luft und Sonne. Und so beschloß man einen generellen Wohnungswechsel. Als künftige Heimstatt wurde der Berliner Vorort Zehlendorf gewählt, und dort wiederum der äußerste Zipfel – also quasi ein weiterer Vorort – nämlich ›Onkel-Toms-Hütte‹.
Eine gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft hatte sich in Zusammenarbeit mit einigen wagemutigen Architekten entschlossen, eine neue Art von Mietshäusern zu konzipieren. In diesen Häusern sollte es nicht mehr als höchstens sechs Wohnungen geben, aber viel Grün drumherum, sie sollten freundlich aussehen und auch noch finanziell erschwinglich sein.
So entstand also in Zehlendorf eine völlig neue Siedlung, in der bunt durcheinander Reihenhäuser, Ein- und Zweifamilienhäuser, kleinere und größere Wohnblocks mit flachen und spitzgiebeligen Dächern aus dem Boden schossen, getrennt durch Gärten oder großzügige Grünanlagen. Darüber hinaus wichen die Architekten von den üblichen grauweißen oder ockerfarbenen Fassaden ab und strichen die neuen Häuser bunt an. Halb Berlin pilgerte damals nach Zehlendorf und bestaunte den ›Tuschkasten‹.
»Kiekm ma, Orje, det jelbe Haus mit det rote Dach druff sieht ja nu wirklich aus wie Vanilljepudding mit Himbeersoße.«
»Det jeht ja noch, aba haste da vorne den rosanen Wohnblock jesehn mit die helljrüne Türen? Hat ausjesehn wie ’ne Schtrampelhose für kleene Meechen. Möchste in so ’ne Bonbontüte wohnen?«
»Nee, aber det ville Jrün überall und die Blumen und so, det könnt ma jefallen.«
Trotzdem gab es anfangs nur wenige Mutige, die nach ›Onkel-Toms-Hütte‹ zogen. Meine Eltern gehörten dazu. Sie mieteten die Parterrewohnung im vorletzten Haus – es war resedagrün – eines Wohnblocks in der Riemeisterstraße. Die Wohnung umfaßte dreieinhalb Zimmer, Küche, Bad und Balkon. Vor dem Haus gab es einen Vorgarten, dann kam ein gepflasterter Bürgersteig, danach ein breiter Sandstreifen, der in regelmäßigen Abständen mit Bäumen bepflanzt war, daran grenzte ein Radfahrerweg, und dann kam erst der Fahrdamm. Und gegenüber kam überhaupt nichts mehr. Da begann nämlich schon der Grunewald. Die andere Straßenseite fing erst fünfzig Meter weiter unten an und war mit Einfamilien-Reihenhäusern bebaut. Im ersten wohnte übrigens Klaus, von dem ich später ebensoviel Dresche bezog wie Johannisbeeren aus seinem Garten.
»Hier wird das Kind bestimmt aufblühen«, prophezeite Omi, »der Balkon liegt ja auf der Südseite, hat also immer Sonne, und wenn ich an den herrlichen Fichtenduft denke …«
»Das sind Kiefern«, sagte meine Mutter.
Als wir in unser neues Heim übersiedelten, waren von den sechs Wohnungen erst drei belegt. Ganz oben wohnte Familie Leutze mit einem halbwüchsigen Sohn, der mir immer die Zunge herausstreckte, sonst aber harmlos war. Ihnen gegenüber residierte eine Regierungsratswitwe mit Gesellschafterin. Beide waren meist auf Reisen und aus diesem Grund für uns ziemlich bedeutungslos.
Im ersten Stock rechts, also genau über uns, lebte Herr Jäger nebst Gattin, einer geborenen von, kränklich und ihrem cholerischen Ehemann völlig untertan. Als mich Herr Jäger zum erstenmal zu Gesicht bekam, musterte er mich gründlich, um dann Omi leutselig zuzunicken.
»Nun ja, die Kleine macht ja einen sehr ruhigen Eindruck. Sie müssen nämlich wissen, daß meine Frau ziemlich geräuschempfindlich ist, ganz besonders dann, wenn sie ihren Migräneanfall hat.«
Kurz nach unserem Einzug wurde auch die andere Wohnung im ersten Stock vermietet. Familie Molden zog ein. Sie bestand aus Herrn Molden, der Künstler war und immer Samtschleifen trug, Frau Molden, die im renommierten Pestalozzi-Fröbel-Haus das Fach ›Hauswirtschaftslehre‹ unterrichtete, Tochter Hella-Maria, aus unerforschlichen Gründen ›Mümmchen‹ genannt, und Grete, einem aus dem Spreewald stammenden Dienstmädchen. Grete schlief zwar nicht bei Moldens, sondern bei einer Fleischermeisterswitwe in einem der Nachbarhäuser, aber sie hielt sich den ganzen Tag bei ihnen auf, kaufte ein, kochte, führte Mümmchen spazieren und ließ sich von Frau Molden nachmittags in Haushaltsführung unterweisen. Die verfügte ja schließlich über staatlich geprüfte Kenntnisse. Nur für die Praxis hatte sie nicht allzuviel übrig.
Nun war nur noch die andere Parterrewohnung frei. »Hoffentlich ziehen da auch noch Kinder rein«, wünschte ich mir.
»Aber du kannst doch mit Hella-Maria spielen«, sagte Omi, »sie ist doch beinahe genauso alt wie du.«
»Die ist doof.«
»So etwas sagt man nicht, das ist ein sehr häßliches Wort«, erklärte meine Großmutter.
Herr und Frau Zillig, die unsere Hausgemeinschaft schließlich komplettierten, hatten aber noch keine Kinder. Sie waren erst seit drei Monaten verheiratet.
Die ersten zwei Jahre in Zehlendorf kann ich nur noch bruchstückweise rekonstruieren. Einmal im Jahr erschien ein Fotograf, der mich auf die Sofalehne setzte, dann unter einem schwarzen Tuch verschwand und regelmäßig wieder hervorkam, um den über dem Sofa hängenden, irritierenden Farbdruck von der Wand abzunehmen. Und jedesmal sagte er kopfschüttelnd: »Wie kann man sich sowat bloß uffhängen?«
»Das ist ein Gauguin, also ein sehr bekannter französischer Maler«, belehrte meine Mutter den offensichtlichen Kunstbanausen.
»Mir ejal, wer det is, uff jeden Fall passen die nackichten Negerweiber nich zu det unschuldije Kindajesicht.« Damit stellte er das Bild zur Seite und widmete sich wieder seiner künstlerischen Tätigkeit.
Das so entstandene Porträt kam in einen Ebenholzrahmen, aus dem zuvor das letztjährige Bild entfernt worden war, und wurde dann wieder aufs Klavier gestellt. Das nunmehr ausrangierte Foto verschwand in einem braunen Lederalbum, wo es sorgfältig eingeklebt und mit den erforderlichen Daten versehen wurde.
Wenn ich mir diese Aufnahmen jetzt in chronologischer Reihenfolge betrachte, finde ich eigentlich keine großen Unterschiede heraus. Immer sieht mich ein etwas blasses Mädchen mit einem maskenhaften Lächeln an, die dunklen Augen krampfhaft aufgerissen, die braunen kurzgeschrittenen Haare links gescheitelt, erst ohne Spange, dann mit und vom Schulalter an mit riesen Taftschleifen verziert. Aus dem Rüschenkleid der Zweijährigen wurde ein Bleylekleid, das meistgehaßte Stück meiner Garderobe, weil es nie kaputtging, dann ein kariertes Taftkleid in gedeckten Farben, das war nicht so schmutzempfindlich. Und schließlich wurde ich in einer weißen Bluse mit schwarzem Fahrtentuch und Lederknoten abkonterfeit. Das war 1944 und das letzte Künstlerfoto.
An meinen vierten Geburtstag kann ich mich noch genau erinnern, weil ich zum erstenmal eine Kindergesellschaft geben und alle meine Spielkameraden einladen durfte. Allerdings war dieser Einladung ein erbitterter Kampf vorausgegangen.
»Mümmchen will ich nicht, die spuckt immer!«
»Mümmchen mußt du einladen, denn wir wohnen im selben Haus«, sagte Omi.
Weshalb das ausschlaggebend sein sollte, begriff ich zwar nicht, aber wenn Omi sagte, ich muß, dann mußte ich eben!
»Klaus kann doch auch kommen, nicht wahr?«
Klaus wurde akzeptiert, genau wie Lothchen, der eigentlich Lothar hieß und im Nebenhaus wohnte. Er war ein etwas verschlossener Junge, sehr sensibel und gutmütig bis zur Dummheit. Ich mochte ihn aber leiden und verteidigte ihn sogar heroisch, wenn er von älteren Nachbarskindern gehänselt wurde.
Diese Neckereien verdankte er der Strickleidenschaft seiner Mutter, die ihren Jüngsten von Kopf bis Fuß in Handgestricktes wickelte. Angefangen von hellblauen Gamaschen über dunkelblaue Pullover bis zur ebenfalls hellblauen Mütze in Schiffchenform, trug Lothar nur Stricksachen – vorzugsweise in Perlmuster. Einmal bekam ich von seiner Mutter auch eine Strickjacke geschenkt, die war rosa, hatte Glasknöpfe und kratzte.
»Helga möchte ich auch noch einladen«, ergänzte ich meine Gästeliste.
»Hm«, sagte Omi und dachte scharf nach. »Das wird sich wohl kaum umgehen lassen.«
Helga Ingersen war drei Wochen jünger als ich und wohnte auch im Nebenhaus. Den fehlenden Herrn Ingersen vermißte ich anfangs nie, später wurde mir erklärt, er lebe aus beruflichen Gründen woanders. Noch später kam ich dahinter, daß Frau Ingersen eigentlich Fräulein Ingersen hieß, was die ganze Sache nun auch nicht klarer machte.
Die Geburtstagsfeier wurde ein voller Erfolg; auch wenn Mümmchen ihre Papierserviette an die brennenden Kerzen hielt, die lodernde Fackel auf den Kuchenteller warf und dann schreiend unter den Tisch kroch. Omi löschte die Flammen mit Himbeersaft und Frau Molden bestand darauf, daß ihr die Tischdecke zum Waschen überlassen wurde. Grete aus dem Spreewald schrubbte sie dann auch wieder sauber.
Regelmäßiger Gast in unserem Haus war auch Tante Else. Das war Omis Kusine, die als Hausschneiderin arbeitete und alle paar Monate erschien, um ausgewaschene Kleider zu verlängern und neue anzufertigen. Gegen die neuen hatte ich ja nichts einzuwenden; ich haßte nur die Anproben. Zu diesem Zweck wurde ich auf den Wohnzimmertisch gestellt, während Omi und Tante Else ständig an mir herumzupften, mich mit Stecknadeln piekten und sich über die Rocklänge nicht einigen konnten.
»Zwei Handbreit über’m Knie«, befahl Omi.
»Aber nicht doch«, sagte Tante Else, »dann sieht man ja beim Bücken gleich das Höschen.«
Omi ließ sich nicht erschüttern. »In Zukunft werde ich eben einen halben Meter Stoff zusätzlich kaufen, der reicht dann noch für einen Schlüpfer.«
So kam es, daß ich schon damals sehr farbenfreudige Unterhosen besaß, angefangen von geblümten Musselinhöschen bis zu knisternden Taftungetümen in Karomustern.
Wenn ich heute an die Großstadtkinder denke, die vergebens nach einer Spielmöglichkeit suchen, dann kann ich mich sogar heute noch nur beneiden. Wir konnten und durften überall spielen. Rundherum war Wald, ein paar hundert Meter entfernt gab es eine große Spielwiese; auf dem Fahrdamm rollerten wir – wann kam da schon mal ein Auto? – und den Bürgersteig verzierten wir mit Hopse-Feldern. Überall heißt dieses Spiel ›Himmel und Hölle‹. In Berlin heißt es Hopse.
Im Sommer gingen wir zum Baden an die Krumme Lanke, jenen so oft besungenen See, um den sich ähnliche Gerüchte rankten wie um den legendären schottischen Loch Ness. Omis ständige Ermahnungen lauteten dann auch immer:
»Und daß du mir nicht zu tief hineingehst, Kind! Nur bis zum Bauchnabel. So ein Wels kann sehr gefährlich werden. Und gib acht auf die Strudel!«
Später bin ich oft quer über den See geschwommen, habe aber weder den Wels noch die angeblichen Wasserstrudel entdeckt.
Im Winter zogen wir zur Rodelbahn, wie die schon erwähnte Spielwiese offiziell hieß. Da gab es die große und die kleine, letztere blieb hauptsächlich Kindern vorbehalten. Leider kreuzten sich beide Bahnen im Auslauf, und die manchmal unvermeidlichen Karambolagen galten als harmlos, wenn lediglich die Schlitten splitterten. Im übrigen erwarb ich dort weitere Kenntnisse der bei uns zu Hause verpönten Heimatsprache.
»Dämliche Zimtzicke! Haste Tomaten uff de Oogen? Laß dir ’ne Brille verpassen, damit de siehst, wenn eener kommt. Wenn de mir noch eenmal mang de Beene fährst, denn mach ick Appelmus aus dir!«
An den Wochenenden durften wir Kinder ohnehin nicht auf die Rodelbahn. Dann wurde sie von Erwachsenen bevölkert, vor allem von jenen, die im Stadtzentrum wohnten; und sie glich dem Petersplatz in Rom am Ostersonntag.
Frau Zillig ließ sich von der drangvollen Enge nicht abhalten und marschierte an einem Samstagnachmittag zum Rodeln. Nach einer halben Stunde war sie wieder da, mit aufgeplatzter Augenbraue, geschwollenem Arm und dem Schlittenseil in der klammen Hand. Nun war meine Großmutter im Ersten Weltkrieg in Erster Hilfe ausgebildet worden, fühlte sich seitdem kompetent und nahm sich der Verletzten an.
»Zeigen Sie den Arm mal her!« befahl sie Frau Zillig. Dann drehte sie ihn nach allen Seiten, befühlte ihn gründlich, ignorierte die Schmerzensschreie der Patientin und meinte beruhigend:
»Das ist nur eine leichte Verstauchung. Machen Sie mal ordentlich Umschläge mit essigsaurer Tonerde.«
Als der solchermaßen behandelte Arm am nächsten Morgen auf den doppelten Umfang angeschwollen war, rief Omi sicherheitshalber ein Taxi. »Bringen Sie die Dame zum Oskar-Helene-Heim«, trug sie dem Fahrer auf.
Der musterte seinen Fahrgast mißtrauisch und fragte besorgt: »Sieht ja ziemlich blaß um de Neese aus, wird se mir ooch nicht aus de Latschen kippen?« Dann fuhr er aber doch los.
Omi heizte inzwischen die Kachelöfen in Zilligs Wohnung, machte die Betten, kochte Kaffee und wartete. Nach drei Stunden kam die Patientin zurück, den Arm bis zur Schulter eingegipst und besessen von durchaus berechtigten Zweifeln an Omis medizinischen Kenntnissen.
Zum Einkaufen gingen wir in die Ladenstraße. Sie hieß und heißt auch heute noch so, obwohl sie mit einer Straße herzlich wenig zu tun hat. Rechts und links vom U-Bahnhof ›Onkel-Toms-Hütte‹ zieht sich ein überdachter Weg entlang, von den tieferliegenden Gleisen durch ein massives Gitter getrennt. An diesen beiden Wegen liegt ein Geschäft neben dem anderen; mitten darin sogar ein Kino.
Wir kauften bei Otto, obwohl es noch andere Lebensmittelgeschäfte gab, aber bei Otto kauften alle Leute, die wir kannten. Er war natürlich teurer als der Konsum, aber nicht so teuer wie Sieberts Delikatessengeschäft. Ich wäre ja lieber zur Butter-Berta gegangen; aber um diesen Laden machte Omi immer einen großen Bogen.
»Da gehen nur die gewöhnlichen Leute hin«, begründete sie ihren Boykott.
»Was sind denn gewöhnliche Leute?« wollte ich wissen. Omi äußerte sich nicht näher. Was man selber nicht weiß, kann man Kindern nur sehr schwer erklären.
Am liebsten ging ich in Sakautzkys Kurzwarenladen. Der wurde von den ältlichen Schwestern Ida und Alma geführt, von denen die eine lang und hager, die andere zwei Köpfe kleiner und bucklig war. Das Geschäft war winzig klein und der überwiegende Teil des trotzdem reichhaltigen Sortiments in riesigen Pappschachteln auf Regalen übereinandergetürmt. Nähseide, Gummiband und ähnliche alltägliche Gebrauchsartikel befanden sich in Reichweite; aber schon der Wunsch nach dunkelgrünen Knöpfen löste rege Tätigkeit aus. Die Trittleiter wurde aus der Ecke geholt, Ida bestieg dieselbe, beäugte durch das um den Hals hängende Lorgnon die Aufschriften der Kartons, entfernte die zwei oberen, um den dritten dann ihrer Schwester Alma zu reichen, die ihn auf den Ladentisch stellte und zusammen mit der Kundin anhand mitgebrachter Stoffproben die gewünschten Knöpfe aussuchte.
»Die hier sind doch sehr schön«, sagte Alma, »und sogar aus echtem Horn.«
»Aber ich brauche sie für ein Seidenkleid.«
»Wie wäre es denn mit diesen Kugelknöpfen? Das ganze Dutzend nur fünfundachtzig Pfennig.«
Die Kundin zögerte. »Ob ich nicht doch lieber weiße nehme? Die würden dann auch gleich zu den Schuhen passen.«
Weiße Knöpfe waren in einer anderen Schachtel. »Das würde ich aber nicht tun«, sagte Alma, »was wollen Sie machen, wenn Sie schwarze Schuhe tragen?«
Die Kundin entschied sich also für die Kugelknöpfe, und anschließend wiederholte sich die schon erwähnte Prozedur in umgekehrter Reihenfolge. Die inzwischen weggeräumte Leiter wurde zurückgeholt. Alma reichte Ida den Kasten, und Ida stellte ihn ins Regal. Sie muß – in entsprechende Relation gesetzt – jeden Monat mindestens einmal den Montblanc bestiegen haben.
Nun führten die Schwestern Sakautzky aber nicht nur Kurzwaren, sondern auch Unterwäsche. Überwiegend weiße, lila und lachsfarbene. Und natürlich Büstenhalter. Heute findet man sie in jedem Warenhaus auf dem Wühltisch, damals versteckte man sie in verschnürte Schachteln unter drei Lagen Seidenpapier. Wenn Omi wieder einmal solch ein delikates Wäschestück kaufen wollte, mußte ich draußen vor der Ladentür warten!
Obwohl es in der Ladenstraße auch ein Milchgeschäft gab, betraten wir es nur ganz selten. Milch brachte Bolle. Das ist eine ausschließlich Berliner Institution. Milchautos gibt es überall, Bolle gibt es nur in Berlin. Wenn so gegen halb elf der Bolle-Wagen bimmelte, strömten aus fast allen Haustüren die Frauen mit Kannen, Porzellankrügen oder auch mal mit einem Kochtopf, und heimsten neben der Milch auch noch die letzten Tagesneuigkeiten ein.
»Haben Sie schon den neuen Kavalier von Kubalkes Tochter gesehen? Ist so’n ganz fescher, und jeden Freitag bringt er Blumen mit.«
»Heute nacht soll der Pleisewitz ja wieder einmal seine Frau verprügelt haben!«
»Na, denn hab ich ja doch richtich jehört! Der Olle war wieda voll wie ’ne Strandhaubitze.«
»Ich weiß gar nicht, wie solche Leute überhaupt in diese Gegend ziehen konnten.«
»Wieso denn nich? Als Schuster vadient er doch janz jut.«
Bolle hatte lose Milch und solche in Flaschen. Omi nahm immer lose, die war billiger. Ganz Begüterte verschmähten Bolle und warteten noch zwei Stunden, bis der Wagen von der Domäne Dahlem seine Runden drehte. Der wurde von einem Pferd gezogen, sein Kutscher trug einen Zylinder und stellte Dauerbeziehern die Milchflaschen sogar vor die Wohnungstür. Wenn die verwitwete Frau Regierungsrat mal nicht auf Reisen war, hielt er auch vor unserer Tür.
Meine Erziehung lag ausschließlich in Omis Händen und war entsprechend ihren preußischen Grundsätzen absolut autoritär. Sie drillte mich so lange, bis ich ihren Vorstellungen von einem guterzogenen Kind entsprach.
»Du sollst grade sitzen!«
»Du sollst bei Tisch nur reden, wenn du gefragt wirst!«
»Du sollst nicht mit vollem Mund sprechen!«
»Du sollst das Milchglas nicht immer so voll gießen!«
»Du sollst … du mußt … du darfst nicht …«
Es war mir verboten, mit fremden Leuten zu reden (auch wenn sie mich nur nach dem Weg fragten), ich durfte nicht mit fremden Kindern spielen, ich durfte sonntags nicht Roller fahren, ich durfte mich nicht außer Rufweite des Hauses aufhalten, ich durfte nicht ›blöder Affe‹ sagen, ich durfte nicht die Finger in den Mund stecken und ich durfte keine Bommelstrümpfe tragen, jene von mir so heißersehnten Kniestrümpfe mit kleinen Quasten an der Seite.
Dafür durfte – beziehungsweise mußte – ich: Immer die Wahrheit sagen, bei Dämmerungsbeginn zu Hause sein, Geschirr abtrocknen, täglich einen Löffel Lebertran einnehmen und im Winter zwei Unterhosen tragen, davon eine aus reiner Wolle, die trotzdem kratzte.
Spaziergänge mit Omi, die meistens an der Ladenstraße endeten, wurden für mich zur Qual.
»Da hinten kommt Frau Gerlitz, vergiß nicht zu grüßen!« Waren wir schließlich auf gleicher Höhe, dann blieb ich stehen, machte einen Knicks und durfte weitergehen. Oder wir trafen eine Bekannte, die von Omi etwas wissen wollte. Dann hieß es: »Du kannst schon vorausgehen und an der Litfaßsäule warten, ich komme gleich nach.«
Also spazierte ich bis zur Litfaßsäule, die mich herzlich wenig interessierte, weil ich noch nicht lesen konnte, und wenn ich sie zwanzigmal im Schneckentempo umrundet hatte, war Omi immer noch nicht da.
Da meine Spielkameraden einem ähnlichen Drill unterworfen waren, benahmen wir uns sogar außerhalb mütterlicher Sichtweite einigermaßen gesittet und trugen gelegentliche Streitigkeiten überwiegend mit Worten, hin und wieder aber auch mit Sandschaufeln aus. Kam ich nach Hause, um die kleine Schramme verpflastern zu lassen, examinierte Omi mich sofort:
»Wer war das?«
»Weiß ich nicht genau, ich glaube, der Uli.«
»Weshalb hat er dich geschlagen?«
»Der Klaus hat angefangen, mit Steinen zu schmeißen, und wie ich dann zurückschmeißen wollte, hab’ ich den Uli …«
»Wenn dieser ungezogene Junge dich mit Steinen bewirft, warum bist du nicht zu mir gekommen und hast mir das gesagt, anstatt zurückzuwerfen?«
»Was nützt denn das«, maulte ich. »Du triffst doch nicht mal ein Scheunentor.«
Prompt handelte ich mir eine Ohrfeige ein, und die war schmerzhafter als Ulis Sandschaufel.
Anstatt nun solche belanglosen Vorfälle auf sich beruhen zu lassen, pflegte Omi den vermeintlichen Übeltäter zur Rede zu stellen und zwar vom Küchenfenster aus. Einmal soll sie sogar zornbebend aus der Haustür gelaufen sein und meinen Peiniger mit einer hocherhobenen Toilettenbürste in die Flucht geschlagen haben. Für letzteres kann ich mich nicht verbürgen, aber ich halte es für durchaus denkbar.
Omi liebte mich, aber sie ließ es sich nicht anmerken. Eine deutsche Frau zeigt keine Gefühle! hieß es damals schon, vermutlich als Training für kommende Zeiten. Meine Urgroßmutter hielt sich nicht an dieses Gebot, deshalb freute ich mich auch immer, wenn wir sie besuchten.
Urgroßmutter Meinicke wohnte am Halleschen Tor, also in einer ganz und gar nicht feinen Gegend. Und dann auch noch in einem Hinterhaus! Omi hielt diese blamable Tatsache auch vor allen Nachbarn geheim und siedelte Uroma im noblen Tiergartenviertel an, ohne zu ahnen, daß ich die Wahrheit schon überall herausposaunt hatte.
»Da gibt es einen richtigen Hof mit Mülltonnen drauf und einer Teppichstange, auf der man rumklettern kann«, erzählte ich Mümmchen begeistert, »und die Kinder dürfen alle berlinern, und keiner verbietet ihnen das.«
»Mensch«, sagte Mümmchen (was eigentlich auch schon vorboten war), »da möcht ich mal hin! Könnt ihr mich das nächste Mal nicht mitnehmen?«
Leider fuhren wir viel zu selten zur Uroma. Und wenn Omi dabei war, durfte ich sowieso nicht zum Spielen in den Hof. Manchmal kam es aber auch vor, daß ich über Nacht bei ihr abgestellt wurde – hauptsächlich dann, wenn Omi zu ihrem Kränzchennachmittag trabte und immer erst spätabends zurückkam. Im allgemeinen schleppte sie mich beharrlich überallhin mit: zum Friseur, zum Einkauf eines Korsetts in ein Spezialgeschäft nach Steglitz und zu Tante Friedel, deren Schäferhund mich genausowenig leiden konnte wie ich ihn.
Wurde ich aber doch mal mit Handköfferchen und Teddybär bei Uroma abgeliefert, dann fiel für mich Ostern und Weihnachten auf einen Tag.
»Und laß mir das Kind nicht mit diesen Gören da unten spielen!« ermahnte Omi ihre Mutter regelmäßig, eine Anweisung, die Uroma geflissentlich überhörte.
Bei ihr durfte ich morgens auch die frischen Hörnchen in die Kakaotasse tunken, was den mir eingetrichterten Tischmanieren Hohn sprach. Ich durfte ›nee‹ statt ›nein‹ sagen und brauchte keine Haarschleife zu tragen. Die wurde erst kurz vor Omis vermutlicher Ankunft eingebunden, von ihr jedoch sofort wieder entfernt und gegen eine brettsteif gestärkte ausgewechselt, die sie vorsichtshalber mitbrachte.
Zwei Dinge gab es bei Uroma, die mich immer wieder begeisterten und von denen ich Mümmchen nie genug erzählen konnte. »Da gibt es überhaupt keine Toilette in der Wohnung, man muß immer eine halbe Treppe rauf oder runter, und wehe, wenn du den Schlüssel vergessen hast. Dann kommste nämlich nicht rein. Bei meiner Oma hängt der gleich neben der Korridortür, mit so ’nem alten Markknochen dran. Und daneben hängt Klopapier. Das muß man auch mitnehmen, auf der Toilette liegen nämlich bloß alte Zeitungen.«
Mümmchen staunte. »Wo badet denn deine Oma, wenn sie keine eigene Badewanne hat?«
Darüber hatte ich mir noch nie den Kopf zerbrochen. »Weiß ich nicht. Ich glaube, alte Leute baden überhaupt nicht mehr. Die werden ja auch nicht so schnell dreckig wie Kinder.«
Zweiter Punkt meines nie erlahmenden Interesses war Uromas Morgentoilette. Über das Hemd kam ein Korsett, dann ein Unterrock, dann eine Art Halbrock, dann noch irgend etwas, das ich nicht kannte, und schließlich das Kleid. Aber nicht die vielen Wäschestücke waren es, die mich faszinierten – Omi besaß auch einige, über deren Zweck ich mir nie klar wurde –, sondern Uromas Frisur. Die schütteren grauen Haare waren nämlich zu einem unverhältnismäßig dicken Zopf geflochten und am Hinterkopf in Form einer großen Schnecke aufgesteckt. Zog Oma vor dem Schlafengehen die Nadeln aus dem Zopf und paßte dabei nicht auf, dann fiel ein großer Teil der Haarpracht zu Boden. Heute würde man wohl vornehm ›Haarteil‹ dazu sagen, damals hieß das Ding aber ›falscher Wilhelm‹.
Dieses Erzeugnis der Frisierkunst klemmte Oma morgens in einer Tischschublade fest, bearbeitete es mit Kamm und Bürste und fabrizierte wieder eine Schnecke daraus.
»Ziept das nicht ganz ekelhaft?« wollte ich einmal wissen.
»Ich bin nicht so empfindlich«, antwortete meine Urgroßmutter, zu längeren Erklärungen offenbar nicht aufgelegt. »Komisch, bei mir ziept das immer.«
Omis jahrelange Bemühungen, ihre Mutter aus der beklagenswert unattraktiven Gegend herauszuholen und sie in das viel feinere Zehlendorf zu verpflanzen, scheiterten. Uroma lebte schon seit Jahrzehnten in derselben Straße, erst im Vorderhaus, nach dem Tod ihres Mannes im Hinterhaus, weil da die Wohnungen kleiner und billiger waren; und sie dachte gar nicht daran, die gewohnte Umgebung aufzugeben.
»Wenn Malchen die Gegend nicht paßt, braucht sie ja nicht herzukommen.«
(Malchen war Omi, die eigentlich Amalie hieß und zeit ihres Lebens diesen Namen verwünscht hat.)
In den letzten Kriegstagen wurde Omas Hinterhaus von einer Bombe getroffen. Sie selbst kam zwar mit dem Leben davon, hatte aber außer dem 24-teiligen Fischbesteck nichts retten können. Kurz danach ist sie gestorben, ohne daß man eine genaue Todesursache hatte feststellen können.
Das Fischbesteck erbte Omi, hat es aber meines Wissens nie benutzt, weil wir den gekochten Schellfisch seit jeher mit zwei Gabeln zu essen pflegten.
Wann ich zum erstenmal von meiner Mutter das Wort Krieg hörte, weiß ich nicht mehr, aber ich hätte mir ohnehin nichts darunter vorstellen können. Krieg war etwas, das sich irgendwo in Amerika zwischen Weißen und Indianern abspielte, und den die Indianer immer verloren. Meine Kenntnisse stammten von Lothars Bruder Hartmut und dessen Freund Maugi, der richtig Maximilian hieß und schon in die vierte Klasse ging.
»Also du, Mümmchen, Helga und Klaus spielen die Komantschen, die Old Shurehand gefangen haben. Das ist Lothchen. Und wenn ihr ihn gerade am Marterpfahl rösten wollt – ihr bindet ihn einfach an den Pfahl vom Briefkasten, hier ist Strippe! –, dann werden Hartmut und ich euch umzingeln und unseren Blutsbruder trotz der gewaltigen Übermacht befreien. Und wehe dir, Mümmchen, wenn du wieder spuckst!«
»Ich spiele nicht mit«, erklärte sie vorsichtshalber, »Krieg ist doof.«
Das fand ich auch, und deshalb begriff ich nicht, weshalb Erwachsene das ebenfalls spielen wollten.
Inzwischen wurde dieser Krieg zu Hause immer häufiger erwähnt und besonders ausgiebig diskutiert, wenn wir bei Helmbergs waren. Bei Helmbergs handelte es sich um meine Großeltern väterlicherseits, die eine Sechs-Zimmer-Wohnung in der Nähe des Breitenbachplatzes bewohnten, und bei denen wir alle zwei Wochen sonntags zum Essen zu erscheinen hatten. Mein Großvater war Beamter und bekleidete als solcher einen leitenden Posten in der Stadtverwaltung. Gewissermaßen gehörte er also zur Regierung, und wenn seine politischen Ansichten auch nicht unbedingt konsequent waren, so galten sie innerhalb der Familie zumindest als gut fundiert.
»Natürlich gibt es keinen Krieg«, erklärte er dann auch mit voller Überzeugung, »aber vielleicht wäre es doch angebracht, mein lieber Heinz, wenn du die Stellung bei deinem Exporteur aufgibst, und in den Staatsdienst wechselst. Das ist etwas Sicheres.«
Vati wollte aber auf keinen Fall Beamter werden. »Alle zehn Jahre Beförderung, und mit fünfundsechzig Bauch und Pension – nein danke!«
Mithin war Vati das schwarze Schaf der Familie, denn ich entstammte einer wahren Beamtenhierarchie. Bekanntlich gab es eine Zeitspanne, während der man seine arische Abstammung nachzuweisen hatte, und im Zuge dieser Ahnenforschung entdeckten wir, daß meine Vorfahren alle irgendeinen Beamtenstatus innegehabt hatten.
Da hatte es in Aschersleben einen Nachtwächter gegeben und in Stendal einen Stadtschreiber, ein Zollbeamter war daruntergewesen und ein Stadtverweser, was immer das auch gewesen sein mag. Väterlicherseits ließ sich der Stammbaum noch weiter zurückverfolgen. Der erste nachweisliche ›Beamte‹ dürfte der Hofarzt eines mecklenburgischen Fürsten gewesen sein, der seinem Medicus später eine Leibrente ausgesetzt hatte – in die heutige Sprache transportiert, also: eine Pension.
Als ich später vor der Berufswahl stand und mich für den Journalismus entschied, war mein Großvater sichtlich enttäuscht. »Wenn du schon unbedingt zur schreibenden Zunft willst, dann geh wenigstens nach Bonn. Die Regierung braucht ja auch Schreiberlinge. Vielleicht wird doch noch eine Beamtin aus dir.«
Ich wurde keine. Und was noch viel schlimmer war: Ich habe nicht mal einen Beamten geheiratet! Meinen Großvater nannte ich Opa, denn ich hatte ja nur einen. Dafür besaß ich neben Omi bekanntlich noch eine Urgroßmutter, zu der ich Oma sagte; und so wurde die väterliche Großmutter Omimi gerufen, was etwas albern klang, mir aber die Unterscheidungen der diversen Omas wesentlich erleichterte.
Omimi mochte ich nicht besonders. Sie war etwas verschlossen, fand zu Kindern keinen rechten Kontakt und setzte Omis Erziehungsmaßnahmen in erweitertem Umfang fort.
»Ein gut erzogenes Kind erhebt sich von seinem Platz, wenn ein Erwachsener das Zimmer betritt!« Also hüpfte ich künftig wie ein Stehaufmännchen auf meinem Stuhl herum.
»Es sieht sehr unschön aus, wenn kleine Mädchen mit zerzausten Haaren herumlaufen.« (Omi hatte vor meinem ständigen Wuschelkopf bereits seit langem kapituliert.)
»Man umklammert eine Kuchengabel nicht wie einen Zaunpfahl.«
»Man streckt anderen Kindern nicht die Zunge heraus!«
»Man sagt nicht …«
Nein, also für Omimi hatte ich nicht allzuviel übrig. Außerdem setzte sie uns bei den sonntäglichen Mahlzeiten häufig Grünkohl vor, den ich verabscheute, aber trotzdem hinunterwürgen mußte, weil ich ja gut erzogen war. Meinen Großvater dagegen liebte ich und schaute bewundernd zu ihm auf. Man kann das ruhig wörtlich nehmen, denn er war mit seinen 1.82 Metern die überragendste Person der gesamten Familie. Haare hatte er nicht mehr, dafür aber einen kleinen grauen Schnurrbart und eine Taschenuhr mit zwei Deckeln, auf die ich schon damals Erbansprüche erhob. Opa regierte seinen Haushalt mit der gleichen Konsequenz, für die er auch in seinem Büro bekannt war. Fehler duldete er nicht. Regelmäßig kontrollierte er Omimis Haushaltsbuch, und wenn er auf den Posten ›Sonstiges‹ stieß, forschte er nach. »Sonstiges gibt es nicht!« behauptete er steif und fest.
»Ich weiß aber wirklich nicht mehr, wofür ich die eine Mark fünfundzwanzig ausgegeben habe«, sagte Omimi, »ich kann mir doch nicht alles merken.«
Irgendwann gestand sie dann aber doch, daß ›Sonstiges‹ ein Haarnetz gewesen war, worauf Opa keineswegs das neue Haarnetz bemängelte, sondern lediglich die Fehlbuchung seiner Frau. »Derartige Dinge gehören zur Kategorie Kleidung und sollten extra verbucht werden.«
Alle Vierteljahre verglich er die verbrauchte Menge bestimmter Artikel mit den Einkäufen des vergangenen Quartals. Erschien ihm der Unterschied zu groß, so forschte er nach der Ursache des gestiegenen Verbrauchs. Das geschah übrigens nicht aus Sparsamkeit – denn er war alles andere als geizig –, sondern nur aus Prinzip. Im Rahmen dieser Buchführung entdeckte er einmal, daß sich die Ausgaben für Toilettenpapier fast um das Doppelte erhöht hatten, und er ordnete Zurückhaltung an.
»Jetzt wische ich ihm aber doch mal eins aus!« sagte meine Mutter, und weil Opa wenige Tage später Geburtstag hatte, kaufte sie eine 400-Blatt-Rolle Klopapier, numerierte die einzelnen Blätter, rollte die Papierschlange wieder zusammen, umhüllte das Ganze mit grünem Blumenkrepp, stopfte ein Alpenveilchen hinein und überreichte dieses Arrangement ihrem Schwiegervater. Dazu bekam er noch eine sorgfältig geschriebene und in einzelne Punkte gegliederte Gebrauchsanweisung, wer wann wie viele Blätter Klopapier benutzen darf und daß bei Durchfall ein ärztliches Attest beizubringen sei.
Opa führte über alles Buch. Er konnte noch nach Jahrzehnten belegen, wann mein Vater seinen ersten Zahn bekommen und wann er ihn wieder verloren hatte, wie oft und weshalb er krank gewesen war und wie seine Lehrer hießen. Sogar seine Zeugnisnoten sind der Nachwelt – also mir! – erhalten geblieben und haben sich später als sehr nützlich erwiesen.
Übrigens gehörte zur Familie Helmberg auch noch Onkel Egon, der jüngere Bruder meines Vaters. Er war sehr stolz auf seine Nichte und legte größten Wert darauf, daß ich ihn, den damals Siebzehnjährigen, mit Onkel anredete. Leider ist er gleich zu Beginn des Rußlandfeldzugs gefallen.
Kapitel 2
Und eines Tages war er dann wirklich da, der Krieg.
Die ersten Auswirkungen bekam ich zu spüren, als mein Vater in Uniform vor der Tür stand und sehr heroisch aussah. Er hatte sich freiwillig gemeldet.
»Mein Jahrgang ist doch als erster dran«, hatte er seine übereifrige Pflichterfüllung begründet, »und als Freiwilliger kann ich mir wenigstens die Waffengattung aussuchen. Ich habe mich zur Flak gemeldet. Diese Dinger kann man nicht schultern wie Maschinengewehre, also werden mir Fußmärsche hoffentlich erspart bleiben.«
»Warum hast du denn nicht die Offizierslaufbahn eingeschlagen?« wollte Omi wissen. »Als Abiturient stehen dir doch jetzt alle Wege offen.«
Vati winkte ab. »Ich bin doch nicht verrückt. Offiziere sind immer die letzten, die aus Gefangenenlagern entlassen werden. Im übrigen dürfte dir bekannt sein, Schwiegermama, daß man auch als ganz einfacher Gefreiter Karriere machen kann, wenn man nur genügend Größenwahn mitbringt.«
Das war eine defaitistische Äußerung, und mir wurde eingebleut, daß ich darüber zu schweigen hätte.
Viel wichtiger als der Krieg war für mich ohnehin die bevorstehende Einschulung. Dieses Ereignis fand im April 1940 statt, kurz vor meinem sechsten Geburtstag. Deshalb bekam ich mein Geschenk auch etwas früher.
»Ich habe noch einen richtigen Lederranzen aufgetrieben«, freute sich Mami, als sie mir das unerläßliche Tribut meiner neuen Würde zum erstenmal umschnallte. »Die meisten sind schon aus präparierter Pappe.«
Natürlich war auch die Schultüte besonders schön und besonders groß, und nachdem ich mit diesem Unding längelang auf das Straßenpflaster geknallt war, schleppte Omi es bis zur Schule und auch wieder zurück.
Den Schulweg kannte ich bereits. Die Schule auch. Sie war ausschließlich Mädchen vorbehalten, denn von Koedukation hielt man damals noch nicht sehr viel. Wenn wir zum Friedhof gingen, um meinen toten Großvater zu begießen, dann kamen wir immer an der Zinnowaldschule vorbei, einem modernen Flachbau, direkt am Waldrand gelegen und von hohen Kiefern umstanden. Selbige gewährten Schutz vor Feindeinsicht; zumindest fanden das die Herren vom Roten Kreuz und verwandelten die Schule ziemlich bald in ein Lazarett. Die ausquartierten Kinder wurden auf andere und wesentlich entferntere Schulen verteilt.
Meine erste Lehrerin hieß Fräulein Korody, trug die Haare zu Zöpfen geflochten und als Affenschaukeln aufgesteckt, erschien mit Vorliebe in BDM-Uniform und brachte uns zunächst einmal das Deutschlandlied bei, und davon drei Strophen.
»Das ist unsere Nationalhymne«, verkündete sie mit verklärtem Blick. »Damit sie euch in Fleisch und Blut übergeht, werden wir sie jeden Morgen vor Unterrichtsbeginn singen.«
Also standen wir pflichtgemäß morgens neben unseren Bänken und sangen ›Deutschland, Deutschland über alles …‹ Selbstverständlich mußte auch der ausgestreckte rechte Arm in die Höhe gehalten werden, und weil der regelmäßig nach der zweiten Strophe erlahmte, nahm ich manchmal den linken. Natürlich wurde das entdeckt, Fräulein Korody holte mich zur Strafe nach vorne, hielt der gesamten Klasse und besonders mir einen Vortrag über Selbstbeherrschung und Zähigkeit; und während der folgenden Tage hatte ich das morgendliche Ritual neben der Tafel zu überstehen. Nach ein paar Monaten meldete sich Fräulein Korody zum Kriegseinsatz und wir bekamen Fräulein Luhde.
Die war etliche Jahrzehnte älter als ihre Vorgängerin, trug ihre spärlichen grauen Haare in treppchenartigen Wellen und bevorzugte Kleider, für die sie zwanzig Jahre zu alt war. Außerdem bewertete sie weniger die Leistungen ihrer Schülerinnen, sondern eher deren sozialen Status.
Ihr erklärter Liebling war Ingrid. Sie war nicht nur adelig, ihr Vater gehörte als Luftwaffenoberst sogar zum Generalstab, und deshalb zählte sie in Fräulein Luhdes Augen zu den Privilegierten der Klasse. Sie wurde automatisch Vertrauensschülerin (heute sagt man Klassensprecher), hatte das Klassenbuch zu verwalten, Schwatzliesen zu melden, und die Diktathefte ins Lehrerzimmer zu bringen. Mangelnde Intelligenz glich sie durch Hochnäsigkeit aus; aber sie galt offiziell als Klassenbeste und glaubte es bald selber.
Besonderer Gunst erfreute sich auch Ilse, obwohl sie hinten bloß Schulze hieß. Aber ihr Vater besaß eine Fabrik für irgendwelche kriegswichtige Erzeugnisse; er ließ seine Tochter immer mit dem Auto von der Schule abholen, und manchmal durfte Fräulein Luhde mitfahren.
»Wir haben ja fast den gleichen Weg«, entschuldigte sie diesen offensichtlichen Gunstbeweis.
Ilse war auch die einzige, die unserer Lehrerin jeden Sonnabend ein Päckchen aufs Katheter legte, wobei sie immer sehr beziehungsreich lächelte.
»Was is’n da drin?« wollten wir natürlich wissen.
»Seid doch nicht so neugierig«, wehrte Ilse ab und preßte das geheimnisvolle Päckchen vorsichtshalber gegen die Brust. »Mein Vater hat gesagt, das geht euch überhaupt nichts an!«
Einmal fiel es aber doch herunter, platzte auf, und heraus rollten Kaffeebohnen. Jetzt wußten wir endlich, weshalb Ilse immer Zweien schrieb.
Omi war bestrebt, aus mir eine Musterschülerin zu machen. Hatte ich die Hausaufgaben nicht sorgfältig genug erledigt, was nach ihrer Ansicht meistens der Fall war, dann wischte sie mein Geschreibsel kurzerhand wieder aus, und ich mußte von vorne anfangen. Als ich über das Schiefertafel-Stadium hinaus war und Hefte benutzte, riß sie die beanstandeten Seiten kurzerhand heraus. Meine Hefte litten an chronischer Schwindsucht. Beschwerte ich mich abends bei meiner Mutter, die nach ihrer Rückkehr meist als seelischer Mülleimer herhalten mußte, dann erntete ich immer ein verständnisvolles Zwinkern.
»Nimm’s nicht so tragisch. Die gleichen Methoden hat Omi schon bei mir angewandt. Außerdem muß sie die jetzt sowieso ändern. Schulhefte werden auch rationiert.«
Obwohl Omi sich wirklich redliche Mühe gab, mir die Schule madig zu machen, wurde ich eine ganz passable Schülerin. Das zeigte sich immer bei der halbjährlichen Zeugnisverteilung. Zuerst mußten wir in der Aula eine Ansprache des Rektors über uns ergehen lassen, gefolgt vom Absingen vaterländischer Lieder, dann brüllten wir dreimal »Führer, Sieg Heil« und danach durften wir endlich in unsere Klassenzimmer marschieren.
Am Nachmittag fuhr ich nach Schmargendorf zum Kassieren. Von Omimi bekam ich einen Kuß und einen Bogen Abziehbilder. Opa dagegen zückte Portemonnaie und Brille, bevor er sich ans Rechnen machte.
»Nun zeig mal her. Na, das sieht ja wieder ganz erfreulich aus. Sechs Einser sogar und vier Zweien. Für die Drei in Musik gibt es natürlich nichts, aber es bleibt immer noch genug übrig.«
»Genau acht Mark«, sagte ich eifrig, denn ich hatte das zu erwartende Honorar natürlich längst ausgerechnet. Schwierigkeiten bei der Bewertung gab es zum erstenmal, als in der Zeile für ›besondere Bemerkungen‹ der befremdete Satz stand: ›Evelyn tat sich besonders hervor im Sammeln von Altpapier‹. Opa honorierte diesen Beweis offensichtlicher Vaterlandsliebe vorsichtshalber mit drei deutschen Reichsmark.
Heute nennt man es Recycling, wenn man leere Flaschen in die dafür vorgesehenen Behälter wirft, auf daß sie einer Wiederverarbeitung zugeführt werden. Damals nannte man so etwas ›Rohstoffverwertung‹, und wir Schulkinder wurden angehalten, diese Rohstoffe zu sammeln. Fräulein Luhde hatte uns die Sache gründlich erklärt. »Die Bevölkerung wird durch Rundfunk und Presse von dieser Sammelaktion verständigt und aufgerufen, Stanniolpapier, Zeitungen und hauptsächlich Spinnstoffe bereitzustellen. Ihr Kinder werdet die Sachen abholen und könnt auf diese Weise auch schon unseren tapferen Soldaten helfen.«
Das wollten wir ja recht gern tun, nur begriffen wir nicht, was unsere Soldaten mit alten Zeitungen anfangen sollten.
Am begehrtesten waren ohnehin ›Spinnstoffe‹, aber die bekamen wir bestenfalls in Form von Lumpen. Alte Kleider gab es nicht mehr. Die hatte man entweder in einem verfrühten Anflug von Spendenfreude schon längst beim Roten Kreuz abgeliefert oder selber wiederverwertet, indem man aus zwei alten Kleidern ein neues schneiderte. Tante Else hatte es in dieser Kunst schon zu beachtlichen Fähigkeiten gebracht.
Das anfangs noch ganz interessante, später verhaßte Altpapiersammeln spielte sich nach festen Regeln ab. Jeweils zwei Schulkinder pilgerten von Tür zu Tür und leierten ihr Sprüchlein herunter, in dem so gewichtige Worte wie ›vaterländische Pflicht‹ und ›Volksbewußtsein‹ vorkamen. Je nach Temperament der Angesprochenen bekamen wir entweder drei oder vier alte Zeitungen ausgehändigt, oder uns wurde die Tür vor der Nase zugeschlagen, wobei nicht immer sehr freundliche Bemerkungen fielen. »Verdammte Bettelei« oder »ick brauch det Käseblatt selba, det kommt jeden Abend uff’n Lokus!« waren noch die harmlosesten und keineswegs von Vaterlandsbegeisterung geprägt.
Unsere erbeuteten Schätze trugen wir zu dem alten Kinderwagen, mit dem wir immer herumzogen und der ständig vom dritten Mitglied unserer Gruppe bewacht werden mußte. Schließlich hausierten ja nicht nur wir allein, und Raubzüge von anderen Sammlern kamen gelegentlich vor.
Einmal wöchentlich karrten wir unsere Ausbeute zur Schule, wo sie gewogen, die ermittelten Kilogramm in Punkte umgerechnet und in ein Buch eingetragen wurden. Am Jahresende erhielten die besten Sammler eine öffentliche Belobigung und ein Exemplar von Hitlers ›Mein Kampf‹.
Ich habe übrigens nie eines bekommen, aber wir hatten sowieso schon zwei. »Das eine hat Vati mal bei einem Tennisturnier gewonnen«, sagte meine Mutter und stellte das bedeutende Werk wieder in den Bücherschrank, »im Jahr davor hatte es noch Pokale gegeben. Na ja, und das hier« – damit präsentierte sie mir ein Prachtexemplar in Ledereinband – »habe ich von meinem Patenonkel zum Geburtstag bekommen. Dabei hatte ich ausdrücklich gesagt, welche Handschuhgröße ich habe und daß Braun meine Lieblingsfarbe ist.«
Die lobende Erwähnung im Zeugnis hatte ich der Tatsache zu verdanken, daß ich kurzerhand sämtliche Sportzeitschriften, die Vati im Keller gestapelt hatte, requirierte und heimlich ablieferte. Dasselbe machte ich mit Omis Kundenzeitungen. Die sammelte sie nämlich, weil sie alle darin enthaltenen Romane erst dann las, wenn auch die letzte Fortsetzung vorlag.
Dann begann die Aktion Knüllpapier, und jetzt platzte endlich auch Omi der Kragen. »Es kommt überhaupt nicht in Frage, daß du für andere Leute den Müll zusammenklaubst! Wenn die da oben den Krieg nicht ohne leere Mehltüten gewinnen können, dann sollen sie ihn beenden.«
Unter Knüllpapier verstand man nämlich jede Art von Papierabfällen, angefangen von Briefumschlägen bis zu Einwickelpapier von Fleisch und Butter. Dieses nicht gerade appetitliche Altmaterial sollten wir nun noch sammeln.
»Reni, du schreibst dem Kind eine Entschuldigung!« befahl Omi, und meine Mutter schrieb eine. Sie hat noch sehr viele geschrieben, und die immer variierenden Begründungen, weshalb ich mal wieder nicht meiner Sammelpflicht nachgekommen war, stellten nicht unerhebliche Anforderungen an Mamis Fantasie. Eine weitere, speziell von uns Kindern sehr beklagte Auswirkung des Krieges war die Tatsache, daß es jetzt so viele Leute mit amtlichen Funktionen gab, und alle wollten uns irgend etwas verbieten.
Bisher hatten wir uns lediglich mit dem Hauswart – in Berlin ›Portjeh‹ genannt – auseinanderzusetzen gehabt, aber dessen Spielregeln kannten wir. Das Betreten der Vorgärten war natürlich verboten, im übrigen auch nicht empfehlenswert, denn Hagebuttensträucher pieken. Trotzdem drangen wir manchmal in das Gestrüpp, und prompt erschien Herr Lehmann auf der Bildfläche.
»Ick hab’ euch schon hundertmal jesacht, det ihr nicht in die Anlagen sollt. Die sind bloß für die Oogen und nich für euch Rotzneesen!«
»Mir ist aber der Ball reingefallen«, entschuldigte ich mich.
»Denn mußte’n ebent liejenlassen. Nächste Woche kommt wieder der Järtner, der holt’n denn schon.«
Verboten war auch das Abstellen von Rollern und Puppenwagen im Hausflur. Selbige Gefährte gehörten in den Keller; nur hielt sich niemand an diese Anordnung. Stolperte Herr Lehmann mal wieder über ein Dreirad – er stolperte immer und als einziger –, dann griff er sich das Hindernis und schleppte es eigenhändig in den Keller. Fünf Minuten später stand es wieder im Flur. Mümmchens Gebrüll wegen des vermeintlich geklauten Dreirads hatte den kriminalistischen Spürsinn der Spreewälderin Grete geweckt.
Auch unsere Hopse-Felder waren Herrn Lehmann ein ständiger Dorn im Auge. »Müßt ihr denn immer die janze Straße vollmalen?«
»Ist das denn auch verboten?«
»Nee, det nu nicht jrade, aber schön sieht det nu wirklich nich aus. Könnt ihr nich lieber mit eure Murmeln spielen?«
Auch für die Einhaltung der Mittagsruhe fühlte er sich verantwortlich. Traktierte ich zwischen 13 und 15 Uhr das Klavier, dann klingelte es unweigerlich an der Wohnungstür. »Et is ja nich so, det ick keen Kunstverständnis nich habe, aber et jibt ooch Leute, die wo um diese Zeit schlafen tun, und det ist man ihr jutes Recht.« Mit Frau Lehmann kamen wir besser aus. Sie drückte schon mal ein Auge zu. Außerdem waren wir Kinder angehalten, sie höflich zu behandeln, denn sie half immer bei der großen Wäsche mit. Natürlich gegen angemessene Bezahlung, Mittagessen inklusive.
Jetzt gab es neben Herrn Lehmann, dem Portjeh, auch noch einen Blockwart. Das war Herr Bentin, der im Nebenhaus wohnte, deutlich sichtbar das Parteiabzeichen trug und sich bemühte, seinem Ideal auch äußerlich zu ähneln. Er ließ sich einen kleinen Schnurrbart Marke Rotzbremse wachsen, verlagerte den bisherigen Mittelscheitel etwas nach rechts und versuchte vergeblich, auch noch die erforderliche Haarsträhne in die Stirn zu kämmen. Das scheiterte allerdings an den stark ausgeprägten Geheimratsecken. Dafür grüßte Herr Bentin sehr zackig mit ›Heil Hitler‹, während wir weiterhin ›Guten Tag‹ sagten. Er kassierte die Mitgliedsbeiträge bei den Parteigenossen und achtete darauf, daß an den vorgeschriebenen Tagen auch ordnungsgemäß geflaggt war. Spätestens um acht Uhr hatten die Fahnen draußenzuhängen, sonst klingelte es an der Tür.
»Wissen Sie nicht, welches Datum wir heute schreiben?«
»Doch«, sagte Omi, »den neunten November. Ich weiß das deshalb so genau, weil meine Kusine Geburtstag hat und ich nachher zum Kaffeetrinken fahre. Aber was geht Sie das überhaupt an?«
»Ihre Kusine interessiert mich nicht«, bellte Herr Bentin. »Das deutsche Volk gedenkt heute des historischen Marsches zur Feldherrnhalle und …«
»Ach ja, die Fahne. Gut, daß Sie mich erinnern, ich wollte sie schon gestern vom Boden holen.«
Worauf Herr Bentin einiges nicht sehr Schmeichelhaftes in sein Bärtchen murmelte und wieder abzog. Allerdings behielt er so lange unser Küchenfenster im Auge, bis die Fahne endlich draußenhing.
Herr Bentin verteilte auch die Lebensmittelkarten, wenigstens in den ersten Monaten, später mußte man sich diese lebenswichtigen Papiere bei den amtlichen Kartenstellen selber abholen. Anfangs waren sie noch sehr zahlreich und verhältnismäßig groß, später schrumpften sie immer mehr zusammen und bestanden schließlich nur noch aus einem Blatt in Briefbogengröße. Da gab es eine rote Karte für Brot, eine blaue für Fleisch, gelb stand für Fett und Käse und grün für entrahmte Frischmilch. Nährmittel konnte man unter Abgaben von rosa Marken kaufen, und Tabakwaren bekam man für die braunen Abschnitte. Soweit ich mich erinnere, gab es für Männer und Frauen gesonderte Raucherkarten, denn ›eine deutsche Frau raucht nicht!‹ Meine Mutter war demnach keine, denn sie tauschte unsere übriggebliebenen Brotmarken immer gegen Zigaretten ein.
Dann gab es noch Spinnstoffkarten. Die waren besonders wichtig, weil man ohne sie nicht einmal mehr ein Paar Strümpfe kaufen konnte.
Es dauerte eine ganze Weile, bis wir uns an den Umgang mit diesen Karten gewöhnt hatten. In der ersten Zeit vergaß Omi sie regelmäßig und kam jedesmal wütend zurückgetrabt, um zunächst einmal die halbe Wohnung auf den Kopf zu stellen. »Wo hab ich nun bloß wieder die Kartentasche hingelegt? Ich weiß ganz genau, daß ich sie gestern noch auf dem Dielentisch gesehen habe. Da hat doch sicher Reni …«
Reni hatte nicht, denn die Kunststofftasche mit den ziehharmonikaartig auseinanderzufaltenden Fächern fand sich im Kühlschrank, direkt neben der angeschlagenen Zuckerdose, in der das Kleingeld für die Sammelbüchsen aufbewahrt wurde. Irgend jemand kam immer und sammelte für irgendwas.
Auch an die neuartigen Schaufensterschilder mußten wir uns erst gewöhnen. Da stand zum Beispiel neben einem schlichten Stück Bienenstich der Preis, und daneben war zu lesen: 20 g Z, 10 g Nm. Weil Omi neben der Kartentasche meistens auch ihre Brille mitzunehmen vergaß, mußte ich übersetzen.
»Der Kuchen kostet vierzig Pfennig, zwanzig Gramm Zukker und zehn Gramm Nährmittel.«
»Aha. Und was steht neben der Torte?«
»Dreißig Gramm Zucker, zwanzig Gramm Nährmittel und zwanzig Gramm Fett«, dolmetschte ich.
»Dann essen wir lieber Knäckebrot mit Marmelade«, entschied Omi, »und überhaupt macht das Einkaufen gar keinen Spaß mehr.«
Eine weitere amtlich bestellte Person war der Luftschutzwart. Bei uns bekleidete diesen Posten Frieda Seifert. Sie war etwa Mitte Dreißig, trug immer graue Trainingshosen und Kommißstiefel, hatte ein Pferdegebiß und einen ewig kläffenden Foxterrier namens Struppi. Unter ihrer Anleitung übten wir alle vierzehn Tage ›das Verhalten bei Luftangriffen sowie die Bekämpfung derselben‹. So nämlich lautete die Überschrift des hektographierten Rundschreibens, mit dem sämtliche Bewohner der Häuser 168–176 ›zur ersten Unterweisung in der Handhabung von Feuerlöschgeräten‹ befohlen wurden. Mitzubringen seien gefüllte Wassereimer und Spaten. So nicht vorhanden, habe man sich mit anderen geeigneten Werkzeugen zu behelfen. Omi nahm meine Sandschaufel mit, die hatte einen dreißig Zentimeter langen Stiel.
Schauplatz des Unternehmens war die hinter den Häusern gelegene große Rasenfläche, die unbegreiflicherweise ›Gärtchen‹ genannt und von einem kleinen Weg begrenzt wurde, der zum Müllhaus führte. Dort standen die großen Abfalltonnen, in die wir unsere Mülleimer leerten.
An dem vorgesehenen Abend fanden sich also weisungsgemäß die Hausbewohner auf der Wiese ein, bildeten Grüppchen und diskutierten über die Sinnlosigkeit der angesetzten Übung.
»Was soll das Ganze überhaupt?« Frau Hülsner stellte ihren Wassereimer ab und trocknete sich den linken Fuß mit einem Grasbüschel. »Ich bin gerade beim Einwecken und habe eigentlich gar keine Zeit. Lothchen, nimm sofort die Hände aus dem Wasser!«
Herr Molden rammte einen nagelneuen Spaten in den Rasen. »Gestern extra gekauft. Aber so was kann man ja immer gebrauchen.«
»Heute früh gab’s bei Otto nicht ein Gramm Zucker. Ob der jetzt auch knapp wird?«
Herr Zillig kam angetrabt. »Hat die Vorstellung denn noch nicht angefangen! Wenn wir noch lange warten, sind die Tommies da, bevor wir überhaupt wissen, wie ein Feuerlöscher aussieht.«
»Ach Unsinn«, sagte Herr Molden. »Hermann Göring hat erst kürzlich gesagt, daß er Meier heißen will, wenn auch nur ein feindliches Flugzeug den deutschen Luftraum erreicht.«
»So? Na, dann sollte er sich aber schleunigst um seine neuen Papiere kümmern.«
Endlich kam Frieda. Ihr Auftritt entbehrte nicht der erhofften Wirkung, denn Mümmchen fing sofort an zu schreien. »Muttii! Da kommt der Teufel!«
Zu den Trainingshosen und den Stiefeln trug Frieda jetzt eine dunkelblaue Gummijacke und eine Art Feuerwehrhelm mit Nackenschutz. Ihr Gesicht war verdeckt durch eine schwarze Maske, die an einen Totenkopf erinnerte und in Höhe des Mundes noch von einer silbrigen, durchlöcherten Scheibe verunziert war.
Mümmchen brüllte immer noch und beruhigte sich erst, nachdem Frieda die Gummimaske vom Kopf gezerrt hatte. »Das ist eine Gasmaske«, belehrte sie uns. »Nachher werde ich jedem eine aushändigen. Dieselbe hat künftig jederzeit griffbereit zu sein!«
Dann verteilte sie hellbraune Papiertüten und forderte uns auf, diese mit Sand zu füllen. Wir hatten aber keinen, denn rundherum war Rasen.
»Da jeht mir aber keener ran«, protestierte Herr Lehmann, »hier is doch keen Buddelplatz.«
»Luftschutz ist kriegswichtig!« sagte Frieda. »Alles andere hat zurückzustehen.«
»Aba nich mein Rasen!«
Bevor die beiden Kontrahenten handgreiflich werden konnten, hatten ein paar entschlossene Männer die Tüten mit Grunewalderde gefüllt. Oben piekten Tannennadeln heraus.
»Alle Mann hergucken!« befahl Frieda. Dann zog sie eine Handvoll Kiefernzapfen – hierorts Kienäppel genannt – aus der Hosentasche, häufte sie übereinander und entzündete ein kleines Feuerchen. Anschließend ergriff sie eine Sandtüte und hielt sie nach unten über die Flammen. Nach einiger Zeit war dann auch tatsächlich der Rasen durchgebrannt, der Sand fiel erwartungsgemäß heraus und löschte das Feuerchen.
Das sollten wir nun üben. Bald loderten überall kleine Feuer auf, und wir bemühten uns folgsam, die Tüten vorschriftsmäßig über das Zentrum der Flammen zu halten und sie auf diese Weise wirksam zu bekämpfen. Allerdings glimmte bei manchen die Tüte an der Seite, so daß der Sand neben das Feuer rieselte, Omi verbrannte sich die Finger und ließ vorsichtshalber die ganze Tüte fallen, die dann fröhlich weiterqualmte, Frau Molden goß sich den Sand über die Füße … sehr zufriedenstellend waren unsere Brandbekämpfungsversuche jedenfalls nicht. Das stellte auch Frieda fest.
»Wir werden das jede Woche wiederholen, und zwar so lange, bis es klappt. Sie können ja doch schon privat mal ein bißchen üben.«
Später mußten wir den Umgang mit Feuerpatschen lernen, die genauso aussahen wie Omis Fliegenklatsche. Frieda unterwies uns gründlich in der Handhabung dieses Instruments, und wir sahen interessiert zu, wie sie damit auf die Gänseblümchen einschlug. »Und immer gut aufpassen, daß Sie nicht mit den Füßen im Feuer stehen.«
»Das merken wir dann schon«, versicherte Herr Zillig beruhigend mit todernster Miene.
Den Abschluß dieser denkwürdigen Übung bildete die Verteilung und Anprobe der Gasmasken. Als ich mir das ekelhafte stinkende Ding endlich über den Kopf gestülpt hatte, bekam ich keine Luft mehr, kriegte es aber auch nicht mehr ab. Und nur dem beherzten Eingreifen von Herrn Molden ist es zu verdanken, daß ich nicht als erstes Luftschutzopfer Berlins in die Annalen der Stadt eingegangen bin. Später stellte sich heraus, daß bei meiner Maske der Filter defekt gewesen war. Etwa sechs Wochen nach unserer ersten Luftschutzübung erschien Herr Lehmann mit mehreren Soldaten im Schlepptau und verlangte die Aushändigung der Kellerschlüssel:
»Nu wird die Heimatfront uffjebaut. Wir kriejen Luftschutzkeller.«
Omi stiefelte mit. Schließlich konnte man nicht wissen, ob sich nicht jemand an ihrem Eingemachten vergreifen würde.
Einer der Soldaten – im Zivilberuf Bauingineur und den nie zu ergründenden militärischen Gepflogenheiten entsprechend der Marine zugeteilt, jetzt aber zum Sondereinsatz abgestellt – prüfte die einzelnen Keller, klopfte die Wände ab, hantierte mit Zollstock und Rechenschieber und erklärte schließlich: »Der zweite hier ist als Luftschutzraum am besten geeignet.« Das war der Keller von Herrn Jäger, vollgestopft mit alten Möbeln, Matratzen, zwei Regalen voller Weckgläser und 30 Zentner Briketts.
»Das Zeug muß alles raus. Kohlen und Vorräte können auf andere Räume verteilt werden, und der ganze Krempel da hinten muß sowieso weg, der bedeutet erhöhte Brandgefahr.«
Frau Jäger hatte sich inzwischen auch in den Keller bemüht und zuckte unter den diktatorischen Anweisungen betreten zusammen. »Was wird bloß mein Mann dazu sagen?« flüsterte sie entsetzt.
Herr Jäger sagte nichts; aber er bekam einen Tobsuchtsanfall. Wir hörten ihn abends herumbrüllen, dann knallte die Wohnungstür ins Schloß, er stürmte aus dem Haus, war kurz darauf wieder zurück, zerrte Herrn Lehmann in den Keller, der aber gleich wieder die Flucht ergriff; Herr Bentin wurde geholt – inzwischen standen sämtliche Wohnungstüren offen! – der brüllte mit, und dann schickte man mich leider ins Bett.
Am nächsten Morgen hing an Herrn Jägers Kellertür ein massives Vorhängeschloß. Zwei Tage später wurde es wieder entfernt. Schwergewichtige Männer schleppten Möbel auf die Straße und Kohlen in Ingersens Keller – denn dort war noch am meisten Platz –, und schließlich erschien ein Baubataillon, das die Kellerräume ›bombensicher‹ machte. Zu diesem Zweck wurden Holzbalken auf dem Zementboden verankert und an der Decke verkeilt.
»Hält denn das nun wirklich, wenn hier mal eine Bombe fällt?« erkundigte sich Omi zweifelnd, während sie die uniformierten Pioniere großzügig mit Bohnensuppe und selbsteingelegten Delikateßgurken versorgte.
»Natürlich hält det nich«, versicherte ihr einer dieser Gemütsmenschen, um dann fachmännisch zu erklären: »Sehn Se mal, Muttchen, diese Häuser hier klappen doch zusammen wie Streichholzschachteln. Wir könn’ bloß hoffen, det wenigstens die Kellerdecke hält, bis man Sie rausjebuddelt hat.«
Sehr beruhigend klang das nun gerade nicht, und Omi überlegte ernsthaft, ob sie bei eventuellen Luftangriffen nicht lieber in der Wohnung bleiben sollte. Immerhin gab es dort eine Decke weniger, die ihr auf den Kopf fallen konnte.
Unseren eigenen Keller deklarierte man als Ausweichquartier. Er kriegte Luftschutzbetten, doppelstöckig, damit Kinder und Kranke der Ruhe pflegen könnten. Da in unserem Wohnblock jeweils zwei Häuser durch einen breiten Kellergang miteinander verbunden waren, brauchten nicht einmal Notausgänge geschaffen zu werden. Außerdem gab es sowieso noch einen Ausgang nach hinten, der zum Gärtchen und damit zum Müllhaus führte.
Neben die Haustür wurde lediglich ein weißer Pfeil auf die Wand gemalt, der in schwarzen Buchstaben die geheimnisvolle Inschrift ›LK 3,67‹ trug.
»Det vaschandelt ja den Jesamteindruck von det jepflegte Haus«, sagte Herr Lehmann und machte sich daran, die Farbe wieder abzuschrubben. Das wurde ihm sofort verboten, denn dieser Pfeil sollte späteren Suchtrupps die Ausgrabungsstätte anzeigen. Blieb also nur zu hoffen, daß wenigstens das entscheidende Stück Hausmauer stehenbleiben würde.
Tatsächlich haben diese überall angebrachten Pfeile unzähligen Verschütteten das Leben gerettet; aber wir nahmen sie damals nicht so recht ernst. Wer dachte schon an Luftangriffe? Die deutschen Soldaten siegten sich unaufhaltsam voran; und so ziemlich jeder glaubte zumindest offiziell, daß der ganze Spuk bald vorüber sein würde. Und wer es nicht glaubte, der hielt vorsichtshalber den Mund. Bekanntlich sind wir ja auch vorübergehend ein sehr schweigsames Volk geworden.
Im allgemeinen sagt man den Berlinern nach, daß sie sich von allen Deutschen am schnellsten mit widrigen Verhältnissen abfinden können und immer versuchen, das Beste daraus zu machen. Nun ließ sich an den damaligen Verhältnissen wirklich nichts ändern; und so bemühte man sich wenigstens, das tägliche Leben so normal wie möglich fortzusetzen.
Zum ›normalen Leben‹ gehörten für mich die Ballettstunden. Als ich irgendwann wieder einmal gegen den Teewagen gerast und in voller Länge auf dem Fußboden gelandet war, hatte meine Mutter kopfschüttelnd festgestellt:
»Ich kann mir nicht helfen, aber du bewegst dich wie ein Nilpferd. Überhaupt kein bißchen Grazie!«