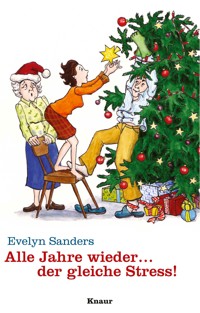6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Dieser dritte Band ist rein chronologisch gesehen der erste der Sandersschen Familiengeschichten. Noch besteht die Familie nur aus vier Personen und wohnt in einer Mietwohnung mitten in Düsseldorf. Doch man träumt von einem Häuschen im Grünen. Schließlich entscheidet man sich für ein Reihenhaus in dem Vorort eines Vorortes. Leider kannten die Sanders ihre neuen Nachbarn vorher nicht...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 418
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Evelyn Sanders
Radau im Reihenhaus
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Endlich erfüllt sich für die Sandersche Familie der Traum vom eigenen Häuschen im Grünen. Aber die Idylle trügt.Die neuen Nachbarn, eigentlich alle recht sympathische Leute, sorgen für Turbulenzen – wie der chaotische Tropenarzt Dr. Bauer, der sich so schwer wieder an europäische Sitten gewöhnen kann.
Inhaltsübersicht
Motto
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Nachwort
Du hast das nicht, was andre haben,Und andern mangeln deine Gaben;Aus dieser UnvollkommenheitEntspringet die Geselligkeit.GELLERT
Kapitel 1
Ich brauch’ Tapetenwechsel, sprach die Birke …«, schmetterte mein Gatte und bemühte sich erfolgreich, das Röhren des defekten Rasierapparats zu übertönen. »Was hältst du davon?«
»Bei der Knef klingt es besser!«
Rolf singt ebenso gerne wie falsch, am liebsten im Bad, und dort meistens beim Rasieren. Wenn die Arien abrupt abbrechen, weiß ich, daß er gerade die Mundpartie schabt.
»Ich meine doch nicht meinen gutturalen Bariton«, korrigierte er mich, »ich spreche vom Text.«
»Na ja, von Birke kann ja wohl nicht mehr die Rede sein, eher von deutscher Eiche!«
Der Mann, den ich vor knapp sieben Jahren geheiratet hatte, sah zwar immer noch gut aus, und graue Schläfen wirken bei Männern bekanntlich sehr dekorativ (bei Frauen spricht man in diesem Fall von Alterserscheinungen), aber die einstmals sportlich-schlanke Figur war dem gewichen, was man so schön als männlich-kraftvoll bezeichnet. In Gegenwart von Damen, hauptsächlich jüngeren, pflegt Rolf denn auch immer den Bauch einzuziehen, was die jeweiligen Unterhaltungen in der Regel auf ein Mindestmaß beschränkt. Gelegentlich muß man ja mal wieder richtig durchatmen können!
Mein Gatte hatte seine Morgentoilette beendet und nahm den Faden wieder auf: »Was hältst du nun wirklich von einem Tapetenwechsel?«
»Nicht schon wieder die Maler!« jammerte ich, weise geworden durch die Erfahrung, daß Rolfs Aktivitäten sich darin erschöpften, Tapeten oder Kacheln auszusuchen, einen Kasten Bier zu holen und sich mit den Vertretern der handwerklichen Zünfte über die politische Lage zu unterhalten. Da die Gesprächspartner selten einer Meinung sind und eben diese gründlich ausdiskutiert werden muß, stimmen hinterher weder Kostenvoranschläge noch Termine. Alles dauert länger, und alles wird teurer als vorgesehen.
»Ich rede nicht von Malern! Ich rede von einem Umzug!« Rolf zupfte vor dem Spiegel ein letztes Mal die Krawatte zurecht, klopfte mir gönnerhaft auf die Schulter und griff nach den Autoschlüsseln, die aus dem Zahnputzbecher hingen. »Wir sprechen heute abend darüber. Jetzt muß ich weg! Tschüß!«
»Aber wieso …?«
Die Wohnungstür schlug zu. »Ich brauch’ Tapetenwechsel …«, klang es aus dem Treppenhaus.
Ich nicht!
Während ich das Bad aufräumte, überlegte ich, was Rolf wohl mit »Umzug« gemeint haben könnte. Er hatte zwar schon des öfteren den Wunsch geäußert, sein Arbeitszimmer in das jetzige Schlafzimmer zu verlegen, weil ihn die Trauerweide vor dem Fenster angeblich immer dann in elegische Stimmung versetzte, wenn er optimistische Werbetexte zu schreiben hatte, aber bisher hatte ich ihm diese innenarchitektonischen Pläne jedesmal ausreden können. Nun war’s offenbar mal wieder soweit, und ich überlegte mir neue Gegenargumente. Das Schlafzimmer lag nach hinten raus, und zumindest nachts hörte man kaum etwas. Tagsüber pflegten allerdings meine Nachbarinnen von Fenster zu Fenster die Tagesneuigkeiten auszutauschen, und da es in einer Großstadt wie Düsseldorf viele gibt, dauerten diese Unterhaltungen manchmal stundenlang. Nur im Winter wurden sie im Telegrammstil geführt. Jetzt hatten wir Juni. Aber notfalls konnte man ja das Fenster schließen.
Irgendwo klirrte etwas.
»Is nich schlimm, Mami!« tönte es aus dem Hintergrund. »Sascha hat bloß mit der Lokomotive die Lampe getroffen. Die is aber nur ein ganz kleines bißchen kaputt!«
Ich raste ins Kinderzimmer. Sascha strahlte mich an. »Hat bum demacht!«
»Das ist jetzt die dritte Lampe, die auf dein Konto geht! Nun reicht es!«
»Für einen Dreijährigen kann der schon ganz prima zielen!« Sven betrachtete seinen Bruder mit sichtbarem Wohlwollen.
»Hättest du ihm die Lok nicht vorher wegnehmen können?«
»Dann hätte er gebrüllt, und dann hätte die olle Schmidt von unten wieder gemeckert. Und du hast selbst gesagt, wir sollen nich so’n Krach machen!«
»Ach, und wenn ihr mit Holzeisenbahnen werft, macht das keinen Krach?«
»Jedenfalls nich so lange. Aber wenn Sascha erst mal schreit …« Quasi als Antwort hörten wir energisches Klopfen gegen den Fußboden.
»Das is aber anders als sonst«, konstatierte Sven. »Vielleicht is ihr Besen nu kaputt!«
Frau Schmidt war Oberstudienratswitwe ohne Kinder, aber mit Migräne, die immer dann auftrat, wenn es regnete und unser temperamentvoller Nachwuchs im Zimmer spielen mußte.
»Frau Schmidt ist krank«, erklärte ich Sven zum fünfzigstenmal.
»Frau Schmidt ist doof!« erwiderte er mit der Konsequenz eines Fünfjährigen, für den es keine Alternative zu doof oder nicht doof gibt.
Ein eigenes Haus sollte man haben, grübelte ich, mit Garten drumherum, den nächsten Nachbarn fünfhundert Meter weit weg, und wenn er außerdem noch schwerhörig wäre, würde das auch kein Fehler sein. Man sollte im Lotto gewinnen oder wenigstens einen reichen Vater haben. Ein Erbonkel täte es auch, aber ich habe ja nicht mal einen ganz gewöhnlichen. Lotto spielen wir auch nicht – wo sollte also das Geld für ein Eigenheim herkommen?
Rolf verdiente zwar als Werbeberater nicht nur die Brötchen, sondern auch noch die Butter dazu, aber andererseits bewies er auch die Richtigkeit jener Statistiken, nach denen die Durchschnittsfamilie mehr ausgeben könnte, als sie einnimmt – und das zumeist auch tut. Wir würden also vorläufig in unserer Vierzimmerwohnung bleiben, Frau Schmidt weiter ertragen und unsere Kinder zum Flüstern erziehen müssen, was zumindest bei Sascha ein aussichtsloses Unterfangen wäre. Er redete sehr viel. Und sehr laut. Und wenn man nicht sofort antwortete, brüllte er. Nach Rolfs Ansicht war er prädestiniert für eine Offizierslaufbahn bei der Bundeswehr.
Rolfs anfängliche Begeisterung für seine Rolle als Vater zweier Söhne war im Laufe der letzten Jahre merklich geschwunden. Seinen Erstgeborenen hatte er noch stolz im Kinderwagen spazierengefahren, hatte ihn gebadet und angezogen (»Ist doch ganz einfach! Sieh zu, daß du einen Knopf zu fassen bekommst, und warte dann, bis das Knopfloch erscheint!«), den ersten Zahn in Postkartengröße fotografiert und mit mir gewettet, daß Svens erstes Wort »Papa« und nicht etwa »Mama« sein würde (es war »Auto«). Er hatte die ersten Gehversuche seines Sohnes überwacht, freiwillig auf die Skatrunde verzichtet, um Svens Dreirad zu reparieren, und sämtliche Spielwarenverkäufer zur Verzweiflung getrieben. »Lehrreich? Was lehrt es denn, außer daß man heute für zehn Mark nicht viel bekommt!«
Als Sascha geboren wurde, entdeckte Rolf plötzlich, daß Brutpflege wohl doch eine überwiegend weibliche Tätigkeit sei und er außerdem genug damit zu tun habe, eben diese Brut zu ernähren. Das hinderte ihn aber nicht, stolz von »meinen Söhnen« zu reden, wenn sie von Gelegenheitsbesuchern bewundert wurden, und sie als »deine Bengels« zu apostrophieren, sobald sich Frau Schmidt wieder einmal lautstark bei ihm beschwert hatte.
Am Abend dieses Tages hießen sie ausnahmsweise einmal »unsere Kinder«.
»In einem Fünf-Familien-Haus können sich unsere Kinder wirklich nicht richtig entwickeln. Sie brauchen Freiraum, und sie brauchen die Möglichkeit, sich individuell zu entfalten«, dozierte Rolf, der sein vorangegangenes Lamento wegen der demolierten Lampe offenbar schon wieder vergessen hatte. Da war von »hemmungslosem Zerstörungstrieb« die Rede gewesen und nicht von Individualismus.
»Was hältst du von einem Umzug nach außerhalb? Ich habe da etwas an der Hand. Reihenhaus in einer Neubausiedlung am Stadtrand.«
»Am Stadtrand von Düsseldorf?« fragte ich verblüfft, denn diese Gegenden waren dem Geldadel vorbehalten und fest in Industriellenhand.
»Natürlich nicht«, dämpfte Rolf meinen Optimismus, »aber gar nicht so weit weg davon. Der Ort heißt Monlingen und liegt an der Strecke nach Opladen.«
»Aha! Und wo liegt Opladen?«
»In Richtung … Du hast aber von Heimatkunde auch nicht die geringste Ahnung!« Rolf erhob sich kopfschüttelnd und suchte im Bücherschrank nach dem Autoatlas. Er schlug eine schon etwas zerknitterte Seite auf und wies mit dem Finger auf ein winziges Pünktchen. »Das ist Monlingen. Und etwa hier« – der Finger wanderte noch einen Zentimeter westwärts – »steht die Reihenhaussiedlung.«
»Also so eine Art Grüne-Witwen-Getto?«
»Blödsinn! Eine ganz normale Neubausiedlung mitten im Grünen.«
»Wie grün?«
»Was soll das heißen, wie grün? Vermutlich mit Büschen und Bäumen, weil die Gärten noch nicht angelegt sind.«
»Auf gut deutsch heißt das also, du hast dieses Dorado noch gar nicht gesehen?«
»Nur auf dem Bauplan, aber es ist genau das, was wir brauchen!« Nun gehen unsere Meinungen über »das, was wir brauchen«, meist ziemlich auseinander. Als wir unsere erste Polstergarnitur kauften, begeisterte Rolf sich für sandfarbenen Velours, während ich für dunkelbraunes Leder plädierte. Sven war damals gerade ein Jahr alt!
Steht die Anschaffung eines Schrankes zur Debatte, entscheidet Rolf sich garantiert für eine Konstruktion aus einzelnen Teakholzbrettern, worin außer Büchern noch drei enggefaltete Tischdecken und notfalls ein halbes Dutzend Weingläser Platz haben – nicht gerechnet die zahllosen Schlingpflanzen, die dieses Möbel im Prospekt so dekorativ machen. Ich suche aber nach Schubladen, verschließbaren Türen sowie nach unsichtbaren Ablagemöglichkeiten für Streichholzschachteln, Matchboxautos und Bügelwäsche.
Von einem idealen Haus erwartete ich denn auch schalldichte Wände, eine gefederte Treppe, die unseren derzeitigen Verbrauch an Heftpflastern etwas reduzieren würde, ein Kinderzimmer mit den Ausmaßen eines Tennisplatzes und einen Garten mit künstlichem Rasen, den man weder zu sprengen noch zu mähen braucht und der keine ungenießbaren Pflanzen hervorbringen könnte, für die Kleinkinder eine unbegreifliche Vorliebe haben.
Rolfs Vorstellungen von den eigenen vier Wänden waren natürlich etwas anders. Er träumte von einem schneeweißen Bungalow mit rustikalem Kamin (den ich natürlich würde säubern müssen), einem elfenbeinfarbenen Flügel im Wohnraum (immerhin hatte er es im Klavierunterricht seinerzeit schon bis zu Beethoven-Sonaten gebracht) und einem Garten, in dem hundertjährige Buchen stehen müßten. Vielleicht sollten es auch Birken sein, das weiß ich nicht mehr, auf jeden Fall müßten sie rauschen.
Nun pflegen speziell in Neubaugebieten keine alten Bäume zu stehen. Etwa vorhandene werden vor Baubeginn entfernt, damit die Bagger Platz haben, und später pflanzt man anderthalb Meter hohe Stämmchen, die aber auch nicht hundert Jahre alt werden, weil sie nach spätestens einem Dutzend Jahren einer Straßenbegradigung oder einem Parkplatz weichen müssen.
»Am besten sehen wir uns die ganze Sache morgen mal an!« beendete Rolf die noch gar nicht richtig begonnene Debatte und wich damit auch allen weiterführenden Fragen aus. Aber was interessierte es ihn schon, ob ich die täglichen Einkäufe zwei oder fünf Kilometer weit würde heranschleppen müssen, ob es in erreichbarer Nähe so segensreiche Institutionen wie Kindergarten und Schule gab, ob man außer in der hoffentlich vorhandenen Wanne auch noch woanders würde baden können, ob Arzt, Friseur und Feuerwehr am Ort … Und wer sollte dieses Haus eigentlich bezahlen???
»Nicht kaufen, nur mieten«, beruhigte mich Rolf und vertiefte sich in die Wochenendausgabe der Tageszeitung, wobei er der Sonderbeilage »Haus und Garten« eine bisher nie gezeigte Aufmerksamkeit widmete. »Hast du gewußt, daß man Radieschen bis zum Spätherbst ernten kann?«
Monlingen war damals, also vor etwa zwanzig Jahren, ein kleines Städtchen, das von den Segnungen der Zivilisation noch weitgehend verschont geblieben war. Es gab keine Hochhäuser, keine Schnellstraße, keine Mülldeponie und nicht mal eine Verkehrsampel. Geschäftsleute wohnten über ihren Läden und waren selten ungehalten, wenn man noch nach Ladenschluß angerannt kam, weil kein Brot mehr im Haus war oder man die Butter vergessen hatte. Es gab eine gemütliche Kneipe, deren Wirt die Polizeistunde insofern beachtete, als er die Fensterläden schloß, das Licht abschaltete und auf die meist noch vollbesetzten Tische Kerzen stellte. An die Tür hängte er ein schon etwas abgegriffenes Schild mit der Aufschrift »Geschlossene Gesellschaft«, womit den gesetzlichen Anordnungen Genüge getan war. Der eine ortsansässige Friseur, Schmitz, hatte sein Handwerk erlernt, als die Herren einen militärisch-kurzen Schnitt, die Damen überwiegend Treppchen in die Haare onduliert bekamen, und da er es ablehnte, »dieses ganze chemische Zeugs, wo man nich weiß, was drin ist«, zu benutzen, lief zumindest die ältere Generation Monlingens mit Frisuren von Anno 1936 herum. Die Jüngeren gingen lieber zu Angelo, der eigentlich Arthur hieß, aber zwei Jahre lang in Turin Damenköpfe frisiert hatte und seitdem nur noch gebrochen Deutsch sprach. Außerdem nannte er sich Coiffeur, was nun wesentlich moderner klang als Herrn Schmitz’ »Damen- und Herren-Salon«.
Es gab eine Mangelstube, die eine füllige Matrone namens Adelmarie Köntgen befehligte und wo man neben schrankfertiger Wäsche auch sämtliche Neuigkeiten geliefert bekam. Es gab nichts, was Adelmarie nicht wußte, und der Fama zufolge soll sie sogar einmal einem ratlosen Abgesandten des Jugendamts geholfen haben, den unbekannten Vater von Fräulein Sigrids Baby ausfindig zu machen. Der allgemeine Konkurrenzkampf und die damit verbundene Preissenkung von Waschmaschinen setzte Adelmaries Mangelstube ein jähes Ende, aber nach vorübergehender Schließung des Etablissements eröffnete sie in denselben beiden Räumen eine Änderungsschneiderei. Adelmarie stellte zwei Hilfskräfte ein, die in den Nachbarorten wohnten und den Zustrom von Informationen wesentlich vergrößerten.
Natürlich gab es auch eine Schule in Monlingen, deren Rektor im Gemeinderat saß, so daß er sich alle Anforderungen gleich selbst bewilligen konnte. Nur einen Kindergarten gab es nicht, dafür aber auch kein Altersheim, was die Schlußfolgerung nahelegte, daß Großmütter und -tanten im Familienverband lebten, den Nachwuchs betreuten und somit dem Kindergarten die Grundlage entzogen.
Aber das alles wußte ich noch nicht, als wir durch die Monlinger Kopfsteinpflasterstraßen fuhren und vergebens nach dem Wiesengrund suchten. Wir hatten schon eine Schachtelhalmstraße überquert und einen Sumpfdotterweg, waren versehentlich in die Ringelblumenzeile eingebogen und vermuteten mit einiger Berechtigung, nun auch irgendwo auf den Wiesengrund zu stoßen. Fehlschluß! Eine Dame mit Hund, hinten Dackel, vorne Boxer, klärte uns auf:
»Dat is hier janz falsch! Dä Wiesengrund liecht da draußen« – sie deutete auf eine entfernte Wiese, wo tatsächlich noch Kühe weideten – »noch hinter dä Köbes seine Scheune. Wenn die Straße zu Ende is un dä Schotter anfängt.«
Also fuhren wir die Straße weiter, und als sie aufhörte, begann ein glitschiger Lehmweg, auf dem ein paar zerbrochene Ziegelsteine und leere Zementsäcke lagen.
»Der Schotter!« vermutete ich. »Sieh mal, da liegt noch welcher!« Rolf knurrte Unverständliches, krampfhaft bemüht, in der Mitte dieses Lehmweges zu bleiben. Bei einem eventuellen Abweichen würden wir hoffnungslos steckenbleiben.
»Immerhin wird ja dran gebaut.« Er wies auf eine leere Teertonne, die umgekippt in einer Pfütze schwamm.
»Wer weiß, wie die hierhergekommen ist. Sie sieht aus, als ob sie schon dreimal überwintert hat.«
Weitere Anzeichen von Straßenbau gab es nicht. Dafür tauchten die ersten Häuser auf. Ein bißchen schmalbrüstig drängten sie sich aneinander, als ob sie in dieser Einöde gegenseitig Schutz suchten.
Jeweils drei Häuser bildeten eine Einheit, dann kam ein asphaltierter Zwischenraum, und daran schlossen sich die anderen drei Häuser an. Die nächste Häuserzeile stand etwa vierzig Meter hinter der ersten, genau parallel, was ein bißchen monoton wirkte, aber vermutlich lange Rechnereien erspart hatte. Wenn man die zweite Häuserreihe etwas nach rechts versetzt hätte und die nächste noch ein bißchen … aber was soll’s, ich bin kein Architekt, und außerdem standen sie ja schon. Zumindest die ersten zwölf Häuser. Von den restlichen sechs sahen wir im Augenblick lediglich die Grundmauern.
»Da wohnen ja schon Leute drin«, wunderte ich mich, als Rolf endlich einen halbwegs festen Ankerplatz gefunden hatte und den Motor abstellte. An den Fenstern von Nr. 1 hingen Gardinen, in Nr. 2 hing etwas, das entfernte Ähnlichkeit mit Bettlaken hatte, Nr. 3 zeigte gerafften Tüll, Nr. 4 und Nr. 5 waren offensichtlich unbewohnt, und in Nr. 6 waren sämtliche Fenster mit etwas Gelbem verhüllt. Ein Schild, zwei Meter davor in den Boden gerammt, besagte, daß es sich um das Musterhaus handele und man es jeweils an den Wochenenden zwischen 12 und 17 Uhr besichtigen könne.
Ich machte meinen Gatten darauf aufmerksam, daß es jetzt zehn Uhr und außerdem Mittwoch sei.
»Betrifft uns nicht«, sagte der, watete auf Zehenspitzen durch eine Schlammkuhle und steuerte das Haus Nr. 1 an. »Nun komm doch endlich!«
Das galt mir. Ich öffnete die Wagentür, stieg aus und stand bis zu den Knöcheln im Wasser. »Hiiilfe!«
Rolf drehte sich um. »Du hättest lieber auf der anderen Seite aussteigen sollen!« bemerkte er ganz richtig, machte aber nicht die geringsten Anstalten, wieder zurückzukommen. Hatte er nicht mal versprochen, mich auf Händen zu tragen?
Also fischte ich meine Schuhe aus der Lehmbrühe und beeilte mich, meinem Herrn und Gebieter zu folgen. Der hatte inzwischen das rettende Ufer in Gestalt einer dreistufigen Treppe erreicht und bemühte sich vergebens, die zentimeterdicke Lehmschicht von seinen Schuhen zu kratzen. »So kann ich doch nicht ins Haus?!«
»Was soll ich denn sagen? Du kannst ja notfalls die Schuhe ausziehen, wenn du nicht gerade wieder die Strümpfe mit dem Loch anhast, aber ich?« Der Lehm begann zu trocknen und zu bröckeln, und meine Füße sahen aus wie Fresken. »In diesem Aufzug kann ich unmöglich …«
Die Tür öffnete sich. Es erschien eine Hand mit einem Wassereimer, darüber hing ein Handtuch, und schließlich tauchte auch der Besitzer von beidem auf. Es handelte sich um einen großen schlanken Mann um die Vierzig, der mich fröhlich angrinste.
»Det kenn’ wa schon, und drum sind wa ooch uff so ’ne Zwischenfälle einjerichtet. Wasser jibt’s vorläufig noch jratis, weil die Uhren noch nich anjeschlossen sind.«
Während ich meine Füße nacheinander in den Eimer tauchte, beeilte sich Rolf, die gesellschaftlichen Formen zu wahren.
»Mein Name ist Sanders. Ich glaube, wir haben gestern miteinander telefoniert.«
»Obermüller. Anjenehm«, sagte Herr Obermüller und reichte mir seinen Arm, weil ich wie ein Storch auf einem Bein herumstelzte. »Nu komm’ Se erstmal rin, und denn jehn wa hintenrum, weil det da noch am trockensten is. Ick hab schon zigmal Krach jemacht bei die Bauleitung, damit die wenigstens mal’n paar Bretter hier hinlejen, aber bis jetzt is noch nischt passiert. Am besten schicken Se den Brüdern Ihre versauten Schuhe und verlangen Ersatz, denn wern die vielleicht uffwachen. Dabei is det ja jetzt noch janischt. Sie müssen det mal sehn, wenn et zwee Tage lang jeregnet hat. Ohne Jummistiebel is da überhaupt nischt zu machen. Am besten welche bis zum Knie. Ick stell meinen Wagen ooch immer vorne neben die Scheune ab. Zweemal hat mich der Bauer schon aus’m Matsch ziehn müssen, vom drittenmal ab kostet’s wat, hat er jesacht.«
Herr Obermüller führte uns ins Wohnzimmer und machte uns mit Frau Obermüller bekannt, einer sympathischen Mittdreißigerin, die bereits eine Kognakflasche schwenkte. »Zum Aufwärmen«, wie sie versicherte. Also wärmten wir uns auf, und während wir das taten, erklärte mir Herr Obermüller, daß er im Augenblick die Rolle eines Beschließers spiele und etwaigen Interessenten die noch vakanten Häuser zeige.
»Die Hälfte is nu schon vakooft, aber die meesten Besitzer woll’n ja weitervermieten, und von denen habe ick die Schlüssel. Wenn ick richtich verstanden habe, reflektieren Sie uff die Nummer vier. Is’n Eckhaus, jenau wie det hier. Is zwar’n bißken windig, aber dafür haben Se bloß uff eener Seite Nachbarn, und det jenücht ooch schon. Wir hab’n welche, die een ziemlich lautstarkes Familienleben führ. Jott sei Dank sind se bloß abends da, weil se in Düsseldorf een Friseurjeschäft hab’n, aber die Stunden von sieben bis Mitternacht sind immer mächtig bewegt.«
»Nun übertreib aber nicht, Hans«, unterbrach ihn Frau Obermüller lachend. »Mindestens zweimal pro Woche sind sie eingeladen.«
»Det stimmt. Denn jeht der Krach erst um Mitternacht los. Ick weeß nich, warum die beeden überhaupt jeheiratet hab’n. Sie wirft ihm immer vor, det se wat viel Besseres hätte kriejen können, und er schreit denn, det er se bloß aus Pflichtbewußtsein jenommen hat. Ick bin bloß noch nich dahinterjekommen, worin nu eijentlich die Pflicht besteht.«
»Was wohnen denn sonst noch für Leute hier?« fragte ich verschüchtert, denn die Bewohner von Nr. 2 schienen nicht gerade das zu sein, was man sich als Nachbarn wünscht.
»Wir kennen sie auch noch zu wenig«, sagte Frau Obermüller, »die meisten sind erst vor kurzem eingezogen. Wittingers aus Nummer drei wohnen seit vorgestern hier. Junges Ehepaar mit einer zweijährigen Tochter. Er arbeitet auf dem Flugplatz in Lohausen, Verwaltung oder so ähnlich. Es heißt, daß er sechs Richtige im Lotto hatte und sich daraufhin das Haus kaufen konnte. Möglich ist es, denn die ganze Einrichtung kam direkt vom Möbelgeschäft. Alles nagelneu.«
»Wie lange wohnen Sie denn schon hier?« wollte Rolf wissen.
»Wir warn die ersten. Det war so kurz nach Ostern. Denn kamen die Missionare aus Nummer sieben, die hab’n sich von ihrem Ersparten det Haus als Alterssitz jekooft, und denn is der Tropendoktor in Nummer neun einjezogen. Oder warn die Vogts von zehn schon früher da?«
»Nein, die sind nach Dr. Brauer gekommen. Vorher sind noch die Damen in Nummer zwölf eingezogen.«
»Ach richtig, die beeden komischen Schachteln.« Herr Obermüller schüttelte den Kopf. »Die treten nur als Duo uff. Ick hab noch nich eenmal erlebt, det die jetrennt det Haus valassen. Die eene schwimmt immer im Kielwasser von die andre. Wovon die eijentlich leben, weeß keen Mensch. Aussehn tun se wie Gouvernanten aus’m vorichten Jahrhundert, so mit Tweedkostüm und Dutt. Ick muß wirklich mal die Missionare fragen, denn det sind die einzigen, mit denen se ab und zu reden.«
Hm. Hier schien jeder alles über jeden zu wissen, und was er noch nicht wußte, kriegte er zweifellos heraus. In Windeseile durchforschte ich unser bisheriges Leben, konnte aber so auf Anhieb keinen dunklen Punkt entdecken. Auch die Verwandtschaft, gottlob weit entfernt und nicht eben reiselustig, würde kein diskriminierendes Angriffsziel bieten.
»Nu werde ick Ihnen mal Ihre künftige Heimstatt zeijen«, meinte Herr Obermüller, nachdem die Flasche leer und er selbst etwas unsicher auf den Beinen war. Er öffnete die Terrassentür, betrat den Schotterhaufen, der erst eine Terrasse werden sollte, und wies mit ausladender Gebärde auf die angrenzende Lehmwüste. »Det sind die Järten. Werden im Herbst anjelegt. Oder soll’n se wenigstens. Jroß sind se nich, aber für Schnittlauch, Petersilie und Federball reicht et. Und nu kommen Se jenau hinter mir her, sonst jehn Se noch mal baden.«
Gehorsam stapften wir im Gänsemarsch hinterdrein. Frau Obermüller hatte sich der Expedition angeschlossen. »Wenn das alles mal fertig ist, werden wir hier bestimmt sehr schön und vor allem sehr ruhig wohnen. Kein Verkehr, viel frische Luft, Platz für die Kinder – haben Sie welche?«
»Ja, zwei Jungs, drei und fünf Jahre alt.«
»Wie schön, dann hat Riekchen ja gleich einen Spielkameraden. Wir haben nämlich eine Tochter im gleichen Alter. Außerdem noch einen Sohn. Aber Michael ist schon zehn und fühlt sich im Augenblick noch ein bißchen vereinsamt. Er vermißt Kino, Fußballplatz, Freibad – also alles das, was nach seiner Ansicht lebensnotwendig ist.«
Wir hatten den Asphaltplatz erreicht, überquerten ihn und standen wieder vor einer Lehmbarriere. Mitten drin drei Treppenstufen, links davon eine zweieinhalb Meter hohe Ziegelmauer.
»Is als Windschutz jedacht. Wäre ja ooch jar keene schlechte Idee, wenn et nich meistens von die andre Seite wehn würde. Und det Rieselfeld hier müssen Se sich natürlich wegdenken, det wird der Vorjarten. Allet einheitlich, so mit Hecke und Kletterrosen, damit die Zuchthausmauer nich so uffällt.«
Obermüller fischte einen Schlüsselbund aus der Hosentasche, suchte kurz, fand das Passende und schloß auf. »Also mit die Türn hab’n die Mist jebaut. Die Dinger sind nämlich jenauso breit wie der Flur. Man muß se immer erst janz uffmachen, bevor man weeß, wer draußen steht. Oder man muß’n Kopp um die Ecke hängen, aber det sieht ziemlich dußlig aus.«
Wir betraten einen nicht allzu großen Flur, von dem links ein kleinerer abging, der zur Küche führte. Daneben befand sich eine Toilette, deren Installationen wir ungehindert besichtigen konnten. Die Tür fehlte.
»Det is nich det einzije, wat noch jemacht wem muß. Det Parkett liecht ja ooch noch nich.«
Das war unschwer festzustellen. Der Flur endete vor dem Wohnzimmer, das außer einer durchgehenden Fensterfront nur zwei graue Heizkörper aufwies. Die staubten in einer Ecke vor sich hin. Immerhin war der Raum groß genug, auch eine Eßecke aufzunehmen, ohne daß man auf dem Weg dahin über Sessel klettern oder die Stehlampe zur Seite räumen mußte. Ich trat ans Fenster. Die Terrasse bestand noch aus Schotter, von der anschließenden Schotterhalde durch eine gemauerte Sichtblende getrennt. Der Rest war Lehm. Aber im Geist sah ich schon dunkelgrünen Rasen, blühende Kirschbäume, einen Sandkasten und hinten am auch noch nicht vorhandenen Zaun bunte Wicken.
»Woll’n wir nu mal nach oben?«
Die Treppe war natürlich nicht gefedert, aber sie sah einigermaßen solide aus und wendelte sich auch nicht in abenteuerlichen Windungen aufwärts, sondern führte schnurgerade ins obere Stockwerk. Ein durchbrochenes Metallgitter grenzte den oberen Flur nach unten ab. Die vier Zimmer hatten normale Ausmaße und konnten auch bei mißgünstigster Beurteilung nicht mit eingebauten Kleiderschränken verwechselt werden. Das Bad war erfreulicherweise quadratisch, ziemlich groß und bonbonrosa gekachelt. Der als Schlafzimmer vorgesehene Raum hatte sogar einen schmalen Balkon, auf dem zwar kaum Stühle, mit Sicherheit aber die zum Lüften auszulegenden Betten Platz hatten. Am Haus Nr. 3 zierte Buntgeblümtes die Brüstung.
»Na, wie gefällt es dir?« fragte Rolf erwartungsvoll.
»Das Haus ist hübsch, aber …«
»Dann nehmen wir’s!« unterbrach er kategorisch, »vorausgesetzt, es wird in diesem Jahr noch fertig.«
»Da brauchen Se sich keene Sorjen zu machen. Wenn die wissen, det wieder eener einziehn will, jeht allet janz schnell. Denn hab’n se nämlich plötzlich ooch Leute, die Klodeckel anschrauben und die Scheuerleisten ankloppen. Sie müssen bloß uffpassen, det bei Ihrem Einzug ooch allet fix und fertig is. Wenn Se nämlich erst mal drin sitzen, kommt keen Mensch mehr, selbst wenn et oben reinregnet. Wann woll’n Se denn übersiedeln?«
Rolf sah mich an. »Wie wäre es mit September? Bekanntlich hat der Herbst auch noch schöne Tage, und wenn man dann auf der Terrasse sitzen und den Sonnenuntergang beobachten …«
»Den könn’ Se nur vom Küchenfenster aus sehn. Hier is nämlich Osten!«
»Hm … Na ja, Sonnenaufgänge können ja auch sehr malerisch sein!« Rolf schüttelte Herrn Obermüller die Hand. »Vielen Dank für Ihre Mühe. Wir werden uns in den nächsten Wochen bestimmt noch öfter sehen, und besonders meine Frau wird Ihre Hilfe brauchen. Da gibt es doch sicher noch einiges auszumessen und zu fragen.«
»Genau. Das fängt bei den Gardinenleisten an und hört beim Elektriker noch lange nicht auf!« Ich sah mich schon wieder inmitten von Kisten und Kartons stehen mit Gardinen, die nicht passen, und mit Lampen, die keiner anschließen kann. Dazu zwei muntere Kinder mit einer ausgesprochenen Vorliebe für Porzellan.
Frau Obermüller zog mich zur Seite: »Sie können von mir die genauen Maße aller Zimmer haben einschließlich Fenster. Außerdem gibt es in Monlingen einen recht ordentlichen Dekorateur und einen Elektriker, der nicht nur zuverlässig, sondern sogar noch preiswert ist. Wenn Sie bei dem noch eine Lampe und ein paar Glühbirnen kaufen, schließt er Ihnen auch alle anderen Geräte an. Im übrigen können Sie jederzeit zu mir kommen, wenn Sie nicht weiterwissen. Hier draußen sind wir ohnehin alle aufeinander angewiesen. Der nächste Laden ist drei Kilometer weit weg, und der Bus fährt nur alle zwei Stunden.«
So etwas Ähnliches hatte ich mir schon gedacht! Und das bei meinem Hang, meterlange Einkaufslisten zusammenzustellen und im ersten Geschäft zu entdecken, daß ich sie zu Hause vergessen hatte!
Als mir Obermüller die Hand reichte, fragte ich neugierig: »Aus welcher Ecke Berlins kommen Sie eigentlich? Ich bin nämlich auch Spreeathenerin.«
»Ick aber nich! Ick bin jewissermaßen Weltbürger. Jeboren bin ick in Prag. War aber bloß Zufall, weil meine Eltern jrade in Marienbad zur Kur warn und zwischendurch een bißchen in Kultur machen wollten. Damit war et denn aber Essig, weil se ja bloß det Krankenhaus jesehn hab’n. Uffjewachsen bin ick allerdings in Berlin, in Schöneberg, um jenau zu sein. Meine Sturm- und Drangjahre habe ick in Rußland verbracht, und als mich der Iwan endlich aus Sibirien rausjelassen hat, war meine linke Hand zum Teufel. Erfroren. Dafür halte ick jetzt aber die rechte auf und kassiere Rente. Hat lange jenug jedauert, bis ick welche jekriegt habe. Vorher hab ick zwee Semester Jura studiert in Hamburg, denn hab ick bei meinem Vater in Köln Speditionskoofmich jemimt, und nu mach ick in Versicherungen. Is ooch nich det Wahre, aber ick jehöre ja zu der verlorenen Jeneration, die von der Schulbank weg in’n Kriech jeschickt worden is. Und hinterher hab’n wir Überleben jelernt, aber nich, wie man Jeld verdient. Det Haus hier jehört meinem Vater, deshalb können wir mietfrei wohnen. Sonst könnten wir uns den Schuppen jar nick leisten. Peinlich is bloß, det alle Welt jloobt, wir schwimmen im Jeld. Ick weeß nich, warum, aber hier in die Jejend heißen die Häuser bloß die ›Millionärssiedlung‹. Na, wenigstens ’nen halben hab’n wir ja – den Lottokönig. Soll ick Sie mal bekannt machen?« Bereitwillig strebte Obermüller auf die Tür zu.
»Vielen Dank, aber nicht heute«, wehrte ich erschrocken ab. »Wir sind sowieso schon viel zu lange geblieben. Ich habe die Kinder bei Bekannten abgestellt, aber länger als zwei Stunden kann ich sie niemandem zumuten. Und die sind fast herum.«
»Is ja ooch nich so wichtig. Wir werden uns noch lange jenug jejenseitig uff n Wecker fall’n. Ick freu mich aber trotzdem, det Se herziehn. Endlich mal Leute, mit denen man reden kann. Die andern müssen det erst noch lernen.«
Obermüllers brachten uns auf Schleichpfaden, aber halbwegs trockenen Fußes zum Wagen, nicht ohne Rolf zu empfehlen, das Auto bis auf weiteres neben »Köbes« Scheune abzustellen.
»Und nich drum kümmern, wenn er meckert. Der wartet ja bloß druff, det eener hier steckenbleibt und ihm wat in die Hand schiebt, damit er ihn wieder aus die Brühe zieht!«
Die Rückfahrt verlief ziemlich schweigsam. Rolf behauptete, sich auf den Verkehr konzentrieren zu müssen, und ich stellte in Gedanken schon wieder Listen zusammen von Dingen, die gekauft, erledigt oder sonstwie beachtet werden mußten. Bedauerlicherweise waren diese Gedächtnisprothesen immer im entscheidenden Augenblick verschwunden und tauchten erst dann wieder auf, wenn ich sie nicht mehr brauchte, weil sowieso schon alles schiefgegangen war.
Unsere Umzüge schienen von Mal zu Mal problematischer zu werden. Den ersten hatten wir noch spielend bewältigt, vor allem deshalb, weil wir kaum Möbel und keine Kinder gehabt hatten. Beim zweiten hatte Sven das Spektakel außerhalb des unmittelbaren Gefahrenbereichs von seinem Kinderwagen aus verfolgt und sich lediglich einen verdorbenen Magen geholt, weil unsere neuen Nachbarn ihn mit Süßigkeiten vollgestopft hatten. Aber diesmal würden wir nicht nur die Möbelmänner beaufsichtigen müssen, sondern gleichzeitig zwei unternehmungslustige Knaben, die flink wie Wiesel waren, neugierig wie junge Dackel und stur wie sizilianische Maulesel.
»Wir werden Felix als Hilfskraft anheuern!«
Rolf mußte Gedanken lesen können. Genau dasselbe hatte ich auch gerade gedacht, obwohl mir sofort Zweifel kamen, ob diese Idee wirklich so gut war.
Felix Böttcher war von Rolf mit in die Ehe gebracht worden – rein symbolisch natürlich. Inzwischen ist er auch mein Freund geworden, was er als besondere Ehre ansieht, denn ich kenne ja sein bewegtes Liebesleben und mag ihn trotzdem. Angeblich ist er nur deshalb noch Junggeselle, weil ich nicht mehr zu haben sei.
Felix ist mittelgroß, schlank und hat ein Dutzendgesicht, das sich auch durch die verschiedenartigsten Barttrachten nicht vom männlichen Durchschnittsbürgerantlitz unterscheidet. Seitdem ihm Sven einmal unverblümt erklärt hatte: »Aber Onkel Felix, Bärte sind doch bloß was für junge Leute!« geht er wieder ohne.
Er ist Buchbindermeister – Kenner behaupten, sogar ein sehr guter – und Kapazität für alle Situationen außerhalb des gewöhnlichen Alltags. Niemand kann so originelle (und so mangelhafte) Parties organisieren wie Felix. Man bekommt zwar nichts zu essen, sitzen muß man auf Lederresten oder Stapeln von Kaliko, rauchen darf man nur vor der Tür, weil sonst die ganze Werkstatt hochgehen könnte – aber man lernt jedesmal neue interessante Leute kennen. Es ist also immer amüsant.
Niemand außer Felix wird mit so unfehlbarer Sicherheit die mieseste Inszenierung heraussuchen, die gerade auf dem Programmplan steht, wenn er jemanden ins Theater einlädt. Und hinterher behauptet er dann noch strahlend: »Ein Glück, daß ich vorher die Kritiken gelesen habe, sonst hätte es mir womöglich noch gefallen!«
Nur Felix kriegt es fertig, sich einen rassereinen Chow-Chow andrehen zu lassen, der sich später zu einem keineswegs rassereinen Spitz auswächst. Und Felix war es auch, der aus eigener Erfahrung den Begriff »Düsenzeitalter« so definierte: »Frühstück in London, Mittagessen in New York, Abendessen in San Francisco, Koffer in Buenos Aires. Ein Glück, daß Weltraumreisen noch nicht gang und gäbe sind. Da müßte man seinem Fluggepäck ja durchs ganze Sonnensystem nachjagen!«
Im übrigen ist Felix ein wahrhafter Freund: Immer dann zur Stelle, wenn er uns braucht.
Jetzt brauchten wir ihn.
»Wann wollt ihr umziehen? Ersten September? Und dann macht ihr jetzt schon die Pferde scheu? Nächste Woche fliege ich nach Bangkok, aber ganz privat, Ende Juli muß ich nach Rom, geschäftlich natürlich, irgendwann dazwischen drei Tage nach Stockholm und Mitte September zu einer Hochzeit nach Münstereifel. Sonst liegt nichts an. Ist doch klar, daß ich euch helfe. Soll ich die Einstandsparty gleich mitorganisieren? Und was ist als Mitbringsel genehm? Wieder’n Gummibaum, oder darf s auch etwas anderes sein? Wolltet ihr nicht schon immer mal ’nen gipsernen Beethoven? Oder war’s Wagner? Ich könnte aber auch …«
Wütend knallte Rolf den Hörer auf die Gabel. »Entweder ist er blau oder endgültig reif für die Klapsmühle. Ich versuche es nächste Woche noch mal, vielleicht ist er dann wieder zurechnungsfähig.«
»Bestimmt nicht, dann ist er doch in Bangkok!«
Kapitel 2
Der Umzugstag beginnt damit, daß der Möbelwagen nicht kommt. Dafür kommt die Krankenschwester vom Parterre und fragt, ob ich ihr eine Zwiebel leihen könnte. Kann ich nicht. Das einzig Eßbare in Reichweite ist Pulverkaffee und ein Rest angebrannter Grießbrei samt Topf. Beides soll in die Mülltonne. Die Mülltonne ist unser Eigentum und gehört zum Umzugsgut. Ich will aber keinen angebrannten Grießbrei mitnehmen!
Rolf hängt am Telefon. In der Speditionsfirma meldet sich niemand. Wieso auch? Normalbürger sitzen frühestens um acht am Schreibtisch. Jetzt ist es sieben. Übrigens regnet es. Die Gehwege in der Millionärssiedlung sind inzwischen asphaltiert, die Zufahrtsstraße ist es noch nicht. Ob man wohl einen vollbeladenen Möbelwagen mit einem ganz gewöhnlichen Trecker aus dem Schlamm ziehen kann? Bauer Köbes meint ja.
Es klingelt Sturm. Die Möbelmänner! Nein, bloß Felix. Seiner Vorliebe für ausgeleierte Manchesterhosen hat er jetzt die Krone aufgesetzt. Er trägt Hosenträger. Grüne, mit Edelweiß drauf.
Halb acht. Frau Schmidt kommt. Aus lauter Freude über unseren Auszug hat sie sich freiwillig bereit erklärt, auf Sven und Sascha aufzupassen. Daß unsere Nachmieter drei Kinder haben, werde ich ihr erst nachher erzählen. Meinen alten Besen lasse ich ihr da, ich habe mir einen neuen gekauft.
Felix schwärmt von Thailand. Es gelingt ihm sogar, die Schönen des Landes zu beschreiben, ohne die Hände zu benutzen.
Acht Uhr. Der Möbelwagen fährt vor. Niemand steigt aus. Rolf geht runter. Die Insassen machen Frühstückspause. Sie kommen gerade aus Dortmund und sind seit halb sechs unterwegs. Ob ich wohl die Suppe ein bißchen wärmen könnte? Ich hole mir von Frau Schmidt einen Kochtopf. Sven steht auf ihrem Balkon und spuckt Weintrauben in die Gegend. Sascha plärrt: »Will nach Hause!« Geht nicht. Zur Zeit haben wir keins.
Rolf sucht seine Brille. Ohne ist er blind wie ein Maulwurf. Wie kann jemand, der nichts sieht, etwas suchen? Ich finde sie neben dem Grießbreitopf.
Felix hat das Kommando übernommen. Mit Bierflasche in der Hand dirigiert er die Möbelmänner. Die scheinen begriffsstutzig oder schwerhörig zu sein. Niemand kümmert sich um ihn. Felix hockt sich beleidigt aufs Fensterbrett und faltet Papierflieger. Einer landet in der Trauerweide, ein zweiter bei Lemkes im Küchenfenster. Frau Lemke schreit. Felix schreit zurück. Er bedauert, daß wir aus dieser schönen Gegend wegziehen.
Im Wiesengrund hatte sich das Empfangskomitee versammelt. Die Familie Obermüller war vollzählig angetreten, Frau Wittinger von Nr. 3 hing aus dem Fenster, schüttelte ein Staubtuch aus und begann die ohnehin blitzblanke Scheibe mit einer bemerkenswerten Intensität zu bearbeiten. Auch in Haus Nr. 10 putzte jemand Fenster.
Herr Obermüller strahlte. »Vor zwee Stunden hat der Maler die letzte Tapetenrolle anjeklebt, und wenn ick nich danebenjestanden hätte, würde er jetzt immer noch kleistern. Aber bis uff’n paar Kleinigkeiten is wirklich allet fertigjeworden, und den Rest kriejen wir ooch noch zusammen.«
Der Sinn dieser Prophezeiung wurde mir erst am Abend klar, als die drei Männer auf Beutejagd gingen.
Frau Obermüller schnappte sich Sascha, bevor er geradewegs in eine große Schlammpfütze marschieren konnte. »Du kommst jetzt mit zu mir, ich habe einen ganz großen Schokoladenpudding gekocht.«
Mißtrauisch plierte Sascha rauf: »Mit Nilljesoße?«
»Natürlich mit Vanillesoße! Und mit Mandeln! Magst du Mandeln?«
»Weiß nich. Sven soll aber mitkommen!«
Sven wollte nicht. »Ich will mir erst das Haus angucken!«
»Das kannst du auch bei uns, da sieht es genauso aus. Nur seitenverkehrt.«
»Ich will nich die verkehrte Seite sehen, ich will ins richtige Haus!« Er rannte Rolf hinterher, der gerade von Herrn Obermüller die Haustürschlüssel in Empfang nahm. »Warum steht da Nummer elf drauf?«
»Det Schloß is noch nich ausjewechselt, und die unbewohnten Häuser kann man alle mit demselben Schlüssel uffmachen. Eijentlich sollte der Schlosser ja schon jestern kommen!«
Erwartungsvoll betrat ich unser neues Heim. Es roch nach Farbe, nach Leim, nach Salmiak und nach öffentlicher Bedürfnisanstalt. Kein Wunder, die Toilettentür fehlte immer noch.
Obermüller bemerkte meinen entgeisterten Blick. »Wir müssen warten, bis et dunkel is!«
»Wieso?«
»Denn jehn wir abmontieren!«
Dank Felix’ Mithilfe landeten die Kinderzimmermöbel im Schlafzimmer und der Schreibtisch im Wohnraum, aber sonst verlief das Ausladen relativ schnell. Der Dekorateur hatte schon die Gardinen angebracht, der Elektriker die bei ihm gekauften Lampen aufgehängt, nur baumelte jetzt die kugelrunde Bastlampe in der Küche, während die Neonröhre Svens Zimmer in ein grellweißes Licht tauchte, aber das waren lediglich kleine Schönheitsfehler. Außerdem wollte Herr Meisenhölder nachher noch mal kommen, um den Herd anzuschließen.
Frau Obermüller erschien, den brüllenden Sascha unterm Arm. »Ist der immer so lebhaft?«
»Warum? Was hat er denn angestellt?«
»Nicht weiter schlimm! Ich weiß nur nicht, wie man Schokoladenpudding von Tapete abkriegt!«
Michael Obermüller, zehn Jahre alt, mit Sommersprossen und einem unschlagbaren Mundwerk, trompetete lautstark: »Eben is Dr. Brauer nach Hause gekommen – zu wie ’ne Handbremse! Die letzten hundert Meter ist er im Zickzack marschiert.«
»Ich habe dir schon hundertmal gesagt, Michael, daß dich das überhaupt nichts angeht. Such lieber deine Schwester, die ist plötzlich verschwunden!«
»Bin ich ja gar nicht!« tönte es von oben. »Ich spiele Kaufladen.« Ulrike, genannt Riekchen, hatte sich seelenruhig in Svens Zimmer verkrümelt und angefangen, die dort abgestellten Kisten auszupacken.
»Komm sofort runter, Rieke!«
»Warum denn?«
»Du wohnst hier nicht, und außerdem störst du!«
»Du bist ja auch hier, wieso störst du denn nicht?«
Frau Obermüller zuckte mit den Schultern. »Kindliche Logik ist selten zu widerlegen.« Dann etwas lauter: »Riekchen, ich gehe jetzt, und die beiden Jungs kommen mit zu uns. Dann bist du hier ganz allein!« Ulrike erschien am Treppenabsatz. »Aber in mein Zimmer dürfen die nich!«
»Brauchen sie ja auch nicht! Wir kochen jetzt Kaffee und Kakao, und wenn Sanders’ ein bißchen aufgeräumt haben, kommen sie zu uns rüber.« Widerwillig kam Riekchen die Treppe herab. »Na gut, aber nur, wenn ich den Kakao auch an die Wand kippen darf!«
Um fünf Uhr hatte ich wenigstens die Küche in einen betriebsfertigen Zustand gebracht und begann meine hausfrauliche Tätigkeit. Ich spülte Gläser. Felix und Herr Obermüller waren sich auf der Grundlage von Cointreau nähergekommen, hatten die neue Freundschaft mit kanadischem Whisky begossen und danach mit Bacardi Brüderschaft getrunken.
Jetzt tauschten sie Kriegserlebnisse aus.
Rolf war vor zwei Stunden »mal eben kurz« nach Monlingen gefahren und noch nicht wieder aufgetaucht. Dreimal war Michael als Abgesandter erschienen, um zu vermelden, daß der Kaffee fertig, lauwarm und endgültig kalt sei. Dann kam er ein viertes Mal und berichtete, daß Sven und Sascha schliefen – einer im Schaukelstuhl, der andere in Riekchens Bett.
Ich brachte einen Stoß Aschenbecher ins Wohnzimmer. Felix stand auf der Zentralheizung und malte einen buddhistischen Tempel auf die beschlagene Fensterscheibe. »So ähnlich hat das ausgesehen, und überall waren Affen«, erklärte er dem erstaunten Obermüller.
»Richtige Affen?«
»Falsche gibts ja wohl nicht«, gluckste Felix, krampfhaft bemüht, das Gleichgewicht zu halten.
»Anscheinend hast du dir einen mitgebracht!« sagte ich, aber Felix glotzte mich nur verständnislos an. »Wollt ihr Kaffee?«
»Wir wollen Rum tralala, Rum tralala, Rum tralala …« sang Obermüller.
»Die Kneipe ist geschlossen! Macht, daß ihr rauskommt!« Wütend knallte ich die Tür hinter mir zu.
»Warum brüllst du denn so? Was sollen die Nachbarn von dir denken?« Rolf stand in der Haustür, beladen wie ein Weihnachtsmann.
»Erstens haben wir noch keine, und zweitens kannst du dich mit den beiden Schnapsdrosseln da drinnen nur schreiend verständigen!«
Er lud seine Pakete auf dem Küchentisch ab. »Für’s Abendessen.«
»Hoffentlich sind Rollmöpse dabei!«
Innerhalb von wenigen Minuten schaffte Rolf Ordnung. Er holte Michael, der seinen Vater mit bemerkenswerter Routine nach Hause führte, zerrte Felix die Treppe hinauf und deponierte ihn auf der Couch im Arbeitszimmer.
»Der trinkt doch sonst nicht soviel«, wunderte er sich, als er leicht lädiert in der Küche erschien.
»Er leitet ja auch nicht jeden Tag einen Umzug!«
Drei Stunden später. Ich hatte Sven und Sascha aus ihrem Exil geholt, ins Bett gesteckt und bezog gerade im Schlafzimmer die Kopfkissen, als es klingelte. Wer wollte denn jetzt noch was von uns?
Also Tür auf, Treppe runter, sieben Schritte bis zum Eingang, Haustür öffnen – prompt rammte ich sie mir zum viertenmal an den Kopf – und nichts sehen!
Straßenlaternen gab es noch nicht, und als ungeübte Einfamilienhausbewohner hatten wir natürlich vergessen, eine Lampe für die Außenbeleuchtung zu kaufen. Für derartige Dinge war bisher immer der jeweilige Hauswirt zuständig gewesen.
»Könn’ wa?« Vor mir stand Herr Obermüller, in einen dunklen Trainingsanzug gehüllt und erstaunlich nüchtern. An seiner linken Armprothese hing ein Schlüsselbund, in der rechten Hand hielt er eine Taschenlampe. »Jetzt is nämlich der jünstigste Zeitpunkt!«
»Wofür denn bloß?« Rolf war aus dem Wohnzimmer gekommen. Erstaunt musterte er unseren Nachbarn. »Wollen Sie einbrechen gehen?«
»Det is nich die richtige Formulierung. Wenn ick mit ’nem regulären Schlüssel die Tür uffschließe, breche ick nich ein. Ick bin ja dazu befugt. Aba wat wir denn vorhaben, liegt vielleicht doch’n bißchen außerhalb von die Legalität.«
»Können Sie nicht deutlicher werden?« Ich war müde und wollte ins Bett. Nächtliche Exkursionen, zu welchen Zwecken auch immer, waren das letzte, wofür ich mich jetzt begeistern konnte.
Obermüller kam ins Haus und schloß die Tür hinter sich. »Ick hab’ heute früh bei meinem letzten Rundgang hier festjestellt, det außer der Klotür noch’n paar andere Sachen fehlen. Der Badewannenstöpsel zum Beispiel und die beeden Schiebetüren von det Spülbecken in der Küche. Vermissen Se sonst noch wat?«
»Ja, einiges. Wir haben bloß drei Zimmerschlüssel, im Bad fehlt der Kopf von der Dusche, im Arbeitszimmer läßt sich der eine Fensterflügel nicht schließen, und im Keller stimmt auch manches nicht. Ich habe alles aufgeschrieben, damit mein Mann morgen früh gleich die Baufirma anrufen kann.«
Obermüller grinste. »Anrufen kann er ja, aber deshalb passiert jarnischt. Ick hab drei Wochen uff Steckdosen jewartet und die Dinger immer wieder reklamiert, bis ick denn zur Selbsthilfe jejriffen habe. Und det machen wir jetzt ooch! Wir jehn die janzen unbewohnten Häuser ab und holen uns allet zusammen, wat Se brauchen. Nach welchen Jesichtspunkten die Baujesellschaft ihre Häuser zusammenjekloppt hat, weeß ick nich, aber keens is komplett. Bloß fehlt überall wat anderet. In eenem Haus sind die Installationen in Ordnung, dafür jibts keene Türklinken. Woanders wieder fehlt noch det Treppenjeländer, und in Nummer acht haben se die Balkontür verjessen. Dreißig verschiedene Handwerker, und det Janze nennt sich denn Teamwork. Jeder macht, wat er will, und keener det, wat er soll!«
Rolf protestierte: »Wir können doch nicht einfach die anderen Häuser ausräumen. Die sind doch teilweise schon verkauft!«
»Aba noch nich bewohnt, und darauf kommt’s an. Den letzten beißen eben die Hunde. Soll der sich doch mit die Bauheinis rumschlagen. Wenn Se allerdings Manschetten hab’n, denn reklamieren Se ruhig. Ick kann Ihnen bloß aus eigener Erfahrung sagen, det Se denn noch zu Weihnachten ohne Klotür dasitzen. Ick weeß sowieso nich, ob wir ’ne passende finden. Die Auswahl is ja nich mehr so jroß wie damals, als wir einjezogen sind. Am besten fangen wir im Nebenhaus an!« Obermüller strebte wieder zur Haustür, drehte sich dann aber noch mal um. »Wo is’n Herr Böttcher? Zu dritt jeht’s nämlich schneller!«
»Herr Böttcher schläft schon. Meinen Sie denn nicht, daß wir es auch allein schaffen?« Rolf hatte sich einen dunklen Pullover übergezogen und wippte unternehmungslustig auf den Schuhspitzen. Ihm schien die Sache langsam Spaß zu machen.
»Ich schlafe überhaupt nicht, weil man bei dem Krach gar nicht schlafen kann!« Felix äugte über das Geländer, entdeckte unseren Besucher und kam die Treppe herab. »Haste Nachschub geholt?«
»Jetzt wird nich jesoffen, jetzt wird jearbeitet!«
»Mitten in der Nacht? Ihr spinnt doch! Arbeit ist eines der größten Dinge auf der Welt, und deshalb sollten wir uns etwas davon für morgen aufheben.«
Als er allerdings erfuhr, um welche Art von Arbeit es sich handelte, war er Feuer und Flamme. »Außer zwei Aschenbechern und ein paar Kleiderbügeln habe ich noch nie was Richtiges geklaut. Habt ihr denn Dietriche?«
Rolf schüttelte den Kopf. »So was benutzen bloß Amateure. Wir haben richtige Schlüssel. Und jetzt komm endlich, du Rififi-Verschnitt!«
Die drei zogen los. Als erster tauchte Felix wieder auf, unterm Arm vier Schiebetüren für die Küchenspüle. Eine paßte. »Wenigstens etwas!« meinte er befriedigt, bevor er sich mit den anderen drei Türen wieder auf den Weg machte. Das fehlende Pendant brachte Obermüller zusammen mit dem Duschkopf. »Beinahe hätten wir ooch die Klotür in Nummer acht ausjehängt, aba mir is noch rechtzeitig einjefallen, det die ja wieda seitenverkehrt is. Nu woll’n wir et mal in Nummer elf probiern.«
Kurz nach Mitternacht luden Rolf und Felix das letzte Stück ihrer Beute ab. Der Fensterflügel von Nr. 5 paßte zwar auch nicht ganz genau in den Rahmen, aber wenigstens ließ er sich schließen. Den ausrangierten brachten sie ins Nebenhaus und hängten ihn provisorisch ein, worauf er zwei Tage später prompt herausfiel. Wir hörten es sogar klirren.
Während ich den neuen Duschkopf ausprobierte und bibbernd unter dem eiskalten Wasserstrahl stand (Rolf hatte sich vorher noch nie als Heizer betätigt und nach kurzer Besichtigung des Kellers erklärt, daß er zunächst einmal fachmännische Unterweisung brauche, um den Kessel in Gang zu bringen), begossen die drei Einbrecher ihren erfolgreichen Beutezug. Ich ging lieber schlafen. Weil die Beteiligten sich später nicht mehr erinnern konnten, wann und vor allem wie sie überhaupt in ihre Betten gekommen waren, blieb der Rest dieses ereignisreichen Tages für immer in gnädiges Dunkel gehüllt.
Mit einem freiberuflichen Ehemann verheiratet zu sein hat Vor- und Nachteile. Die Vorteile bestehen darin, daß er sein eigener Herr ist und in Ausnahmesituationen immer zur Verfügung stehen kann. Der Nachteil ist, daß er es nicht tut, sondern einen wichtigen Termin vorschiebt, dessen Wichtigkeit sich selten nachprüfen läßt.
So war es auch am nächsten Morgen kein Wunder, daß Rolf sich nach einem kurzen Inspektionsgang durch das häusliche Chaos daran erinnerte, um elf Uhr mit dem Leiter einer Kölner Werbeagentur verabredet zu sein.
»Es tut mir leid, Schatz, daß ich dich in diesem Tohuwabohu allein lassen muß, aber es geht um einen großen Auftrag, und einer muß schließlich das Geld verdienen, das du immer so großzügig ausgibst!«
»Wer? Ich? Seit wann trage ich Flanellanzüge für ich weiß nicht wieviel hundert Mark? Seit wann kaufe ich französischen Kognak? Seit wann muß ich für das Auto …«
Der Gatte war ins Bad enteilt. Kurz darauf war er wieder da. »Hier ist ja gar keine Steckdose?!«
»Mir egal. Ich brauche keine!« bemerkte ich schnippisch, trabte auf den Balkon und überlegte, ob ich nun zuerst die Wäsche auspacken, die Bücher einräumen, die Fenster putzen oder mich bei Frau Obermüller ausheulen sollte.
Die Entscheidung wurde mir abgenommen. Eine Tür quietschte, jemand stöhnte ganz entsetzlich, und während ich mich zu erinnern versuchte, in welcher Kiste die Hausapotheke verstaut war, rannte ich ins Bad zurück. Es war leer. Das Schlafzimmer ebenfalls. Ob Rolf in der Küche …? Was macht man überhaupt bei einem Herzinfarkt? Seit Jahren wollte ich schon einen Erste-Hilfe-Kurs … Telefon! Wo ist das nächste Telefon? Ich raste zur Haustür.
Mein Gatte stand vor dem Küchenherd, in der linken Hand die verchromte Aufschnittplatte, und rasierte sich. »Gott sei Dank, dir ist nichts passiert! Aber warum hast du so entsetzlich gestöhnt?«
»Ich stöhne nicht, ich fluche! Wo sind eigentlich unsere ganzen Spiegel?«
»Noch nicht ausgepackt. Du kannst sie ja suchen. Im übrigen kann ich Stöhnen von Fluchen unterscheiden, ich bin ja nicht schwerhörig. Und irgend jemand hat gestöhnt!«
»Vielleicht ist Felix aufgewacht!« Rolf hatte seine Rasur beendet, legte die Chromplatte auf den heißen Herd, den Rasierapparat in den Brotkorb, fuhr sich noch einmal mit dem Kamm durch die Haare und verschwand fröhlich pfeifend nach draußen.
»Ich frühstücke lieber unterwegs, sonst hast du noch mehr Arbeit«, hörte ich, bevor die Haustür klappte.
Es gibt doch wirklich rücksichtsvolle Ehemänner!
Eine Jammergestalt taumelte die Treppe herunter. »Mensch, ist mir mies! Habt ihr mir gestern Brennspiritus eingeflößt?« Felix wankte zum Spülbecken und hielt den Kopf unter die Wasserleitung. »Mein Schädel brummt wie eine Dampframme!«
»Wovon sollte dir denn der Kopf wehtun? Du hast ihn doch gestern abend gar nicht gebraucht.«
»Angesichts eines todkranken Menschen ist dein Sarkasmus gänzlich unangebracht!« Er warf mir einen vernichtenden Blick zu und schlurfte zur Treppe.
»Gehst du wieder schlafen?«
»Quatsch! In zehn Minuten bin ich unten. Hast du irgend etwas Eßbares im Haus?«
»Natürlich. Wie möchtest du denn die Eier! Gekocht, gebraten oder intravenös?«
Seine Augen zeigten Mordgelüste. »Widerliches Weib! Dem Himmel sei Dank, daß ich nie geheiratet habe und trotz aller Anfeindungen immer noch Junggeselle bin.«
»Ich weiß. Deshalb kommst du ja auch jeden dritten Tag aus einer anderen Richtung in deinen Laden!«
Felix zog es vor, schweigend zu verschwinden.
Nach einem frugalen Frühstück aus Ölsardinen, Knäckebrot, Bier und Aspirintabletten fühlte er sich wieder tatendurstig. »Wo fangen wir an?«
»Unten!«
»Hier in der Küche? Das ist aber Frauensache.«
»Unten bedeutet Keller. Sieh zu, daß du die verflixte Heizung in Gang bringst, ich brauche endlich mal warmes Wasser.«
Als die Millionärssiedlung in Monlingen gebaut wurde, benutzte man Erdöl noch vorwiegend zur Herstellung von Benzin, Plastiktüten und Campinggeschirr. Kaum jemand wußte, was ein Barrel ist, es gab noch keine OPEC und keine Sparappelle, und das Wort »Ölkrise« bedeutete allenfalls, daß der nächste Supermarkt statt der sonst üblichen acht Sorten Salatöl nur zwei vorrätig hatte. Daß man Erdöl auch zum Heizen verwenden kann, begann sich erst langsam herumzusprechen. Bis nach Monlingen war diese Kunde noch nicht gedrungen. Dort heizte man mit Kohle. Kachelöfen und sogenannte Allesbrenner dominierten, besonders Fortschrittliche stellten auf Zentralheizung um. Und wie es sich für Millionäre gehörte, besaßen auch die Bewohner des Wiesengrundes zentralgeheizte Häuser.
Für uns war das nichts Neues. Wir hatten bisher immer in Neubauten gewohnt, an kalten Tagen die Heizkörper aufgedreht und zweimal im Jahr eine Abrechnung bekommen, die jedesmal unseren Etat über den Haufen geworfen hatte. Nun würden wir endlich einmal an der Heizung sparen können, denn es lag ja ausschließlich an uns, wie oft und wie maßvoll wir den Kessel füttern würden. Zunächst mußte er aber in Gang gesetzt werden.